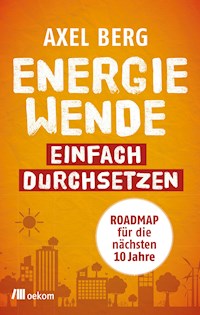Axel Berg
Energiewendeeinfachdurchsetzen
Roadmap für dienächsten 10 Jahre
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Layout und Satz: Reihs Satzstudio, LohmarLektorat: Eva RosenkranzKorrektorat: Petra KienleUmschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-96238-599-6
Gewidmet ist dieses Buch meiner Nichte Julia Berg und meinem Patensohn Kai Hendricks; stellvertretend für die Jugend, die in der hier beschriebenen Zukunft leben wird.
Inhaltsverzeichnis
1In zehn Jahren eine andere Welt – warum dieses Buch
2Das Grundgesetz der Energiewende
3Krisen-Triplex – Energie, Wachstum, Klima
4Zeit der Monster – warum die Energiewende stockt
5Feuer und Geist – Energie ist Macht
6Raubbau als Prinzip – die Loslass-Energien
7Dezentral und enkeltauglich – die Energien der Zukunft
8Versorgungssicherheit – kein Blackout mit den Erneuerbaren
9Verzerrte Märkte und gepäppelte Konzerne – Subventionen, die schaden
10Instrumente und Gesetze – solarer Siegeszug und seine Feinde
11Großprojekte und anachronistischer Zentralismus – die Netze
12Komfortabel, flexibel, innovativ – erneuerbare Wärme
13Mobilität wird neu gedacht – die Verkehrswende
14Vom Bauer zum Energie- und Rohstoffwirt – die Landwirtschaftswende
15Synchron und effizient – unverzichtbare Prozesse
16Die Vierte Industrielle Revolution – Digitalisierung, Internet der Dinge, Blockchain, Speicher
17Zentral vs. dezentral – Akteure in der Energiewirtschaft
18Die Energiewende ist unverzichtbar – Klimawandel, Wetterextreme und Neokolonialismus
19Freiheit und Unabhängigkeit – Trumpf der Energieautonomie
20»Ich will eure Hoffnung nicht« – der Zeitgeist
Epilog
Keine Angst – es gibt viel zu gewinnen
Anmerkungen
Grafiken
Danksagung
Kapitel 1
In zehn Jahren eine andere Welt – warum dieses Buch
Dieses Buch erzählt am Beispiel Deutschlands von einer Zukunft, in der eine Vollversorgung mit erneuerbarer Energie Realität geworden ist. Es beschreibt Wege, die aus der derzeitigen Lähmung herausführen, und will damit einen positiven Sog erzeugen, den Zauber der Idee vom Aufbruch in das nachfossile Zeitalter verbreiten, Gleichgesinnte ermutigen, sie in ihrem richtigen Denken bestärken und an vielen Beispielen aufzeigen, dass es eine Alternative zum Status quo gibt: die dezentrale Energiewende in weniger als zehn Jahren.
Die Energiefrage bestimmt fast alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kriegerischen Entwicklungen der Menschheit. Kein Wunder, ist Energie doch der erste Schritt jeder Wertschöpfung. Bis heute ist die fossil-atomare Verschwendungswirtschaft der Schmierstoff industriellen Lebens in modernen Gesellschaften. Öl, Gas und Kohle halten unsere Wirtschaftskreisläufe in Bewegung. Inzwischen haben wir festgestellt, dass gerade der Einsatz dieser fossilen Energieträger durch Verbrennung größte Schäden in der Umwelt hinterlässt, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Es geht mittlerweile nur noch darum, die Schäden in ihren Auswirkungen in Grenzen zu halten und auszudiskutieren, wer dafür bezahlt. Das bedeutet, dass die Antriebsfeder der gesamten Menschheit nicht mehr wie bisher zur Verfügung steht. Das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis.
Soziologen haben festgestellt, dass einfach verfügbare Energiequellen so lange unbedacht benutzt werden, bis sie aufgebraucht sind. Die herrschende fossil-nuklear angetriebene Wirtschaft erzeugt heute schon Umwelt- und Ernteschäden, ferner hohe Gesundheits- und Arbeitslosenkosten sowie enorme Kosten für militärische Sicherung und Subventionen. Hinzu kommen Zukunftskosten durch Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, Umweltflüchtlinge sowie die sichere Verwahrung von nicht oder kaum biologisch zersetzbaren, radioaktiven Schwermetall- und Kunststoffabfällen und vielleicht von CO2. Weiter erfolgt die Vernichtung von Naturressourcen, die substanzielle Bedeutung außerhalb der Energiewirtschaft haben, etwa für die chemische oder die pharmazeutische Industrie. Wenn man eine Ökobilanz oder Life-Cycle-Analyse macht, dann ist da nichts nachhaltig. Den günstigen Betrieb finanziert der Steuerzahler, die astronomischen Gewinne streichen die Unternehmen ein. Die Betreiber und Institutionen, die von einer großindustriellen Struktur profitieren, machen für deren Erhalt fast alles. Doch ihre Trugbilder stürzen ein.
Klima-, Rohstoff- und Wachstumskrisen lassen ein Weiter-so nicht zu. Das ist jedem klar. Deshalb erkennt man die Gegner der Energiewende nicht mehr an ihrer offenen Gegnerschaft, sondern daran, dass sie Gründe für den Aufschub suchen. Letztlich geht es in Deutschland, Europa und global um die Kontrolle über das Energiesystem der Zukunft. Wird es zentralisiert bleiben, in den Händen weniger Konzerne? Oder wird es ein von Nachhaltigkeit geprägtes System mit einer Vielzahl von Akteuren geben, die alle regenerative Energie bereitstellen? Ein Sowohl-als-auch wird nicht möglich sein. Wo bitte also geht’s zur solaren Weltwirtschaft1? Und wie lange darf’s noch dauern?
Fossile Energien und Uran sind endlich, teuer und schaden Umwelt, Gesundheit und Gerechtigkeit. Erneuerbare Energien sind nachhaltig, sauberer und gerecht; ihre Grenzkosten gehen gegen null. Doch das für die Gesellschaft überlebenswichtige Ziel einer entschlossenen Energiewende steht immer noch nicht oben auf der politischen Agenda.
Zur Jahrtausendwende war eine Vollversorgung mit dezentraler Nutzung erneuerbarer Energien eine Vision und ein Versprechen, dass eine friedliche und lebenswerte Zukunft auf Basis erneuerbarer Energien möglich ist. Heute ist aus der Vision Gewissheit geworden – und angesichts technischer und ökonomischer Fortschritte wird diese Tatsache bald Common Sense sein: Erneuerbare Energien aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie einschließlich Speicher- und Umwandlungstechnologien stehen für eine dezentrale und schnelle Energiewende zur Verfügung und sind längst auch ökonomisch konkurrenzfähig.
Deutschland hat schon früh umgesteuert. Der rot-grüne Atomkonsens von 2000 stand auf zwei Beinen: geregelter Atomausstieg und Anschub für die Erneuerbaren. Für Deutschland löste dieses Konzept eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte aus: rund fünf Gigawatt Zubau jährlich (das entspricht vier Atomkraftwerken), Exportboom und Systemführerschaft bei den erneuerbaren Energien und ein weitgehender Konsens über die Energiezukunft nach endlosen Kontroversen in der Vergangenheit.
Aber noch viel wichtiger war: Ein großes und renommiertes Industrieland ging erfolgreich einen Weg aus der Kernenergienutzung. Wer den globalen Markt der Erneuerbaren nicht überproportional den Deutschen überlassen wollte, musste in diesen Wettbewerb einsteigen – ganz Europa und Länder wie die Vereinigten Staaten und China reagierten. Wenn anderswo der Atomausstieg zumeist auch ausblieb, setzte diese Entwicklung doch starke industriepolitische Signale und über Wettbewerb und die »Economies of Scale« gewannen die Renewables auch weltweit an Gewicht.
Die Energiewende ist eine politische Herausforderung, die schnell konsequente Weichenstellungen verlangt. Doch mit jedem Schritt in Richtung energiepolitischer Veränderung wird der Widerstand des atomar-fossilen Oligopols radikaler. Man blockiert mit allen Mitteln. Willfährige Politiker unterstützen dabei nach Kräften.
Dieses Buch belegt, dass die herkömmlichen Energien Öl, Gas und Kohle ohne milliardenschwere Subventionen längst bankrott wären. Man könnte mit wachsender Fassungslosigkeit über die irrational erscheinende Energiepolitik lamentieren. Klüger ist es, sich klar zu machen, dass wir das – vermutlich letzte – Komplott des atomar-fossilen Lagers erleben. Zentrale und dezentrale Systeme vertragen aufgrund ihrer physikalischen und ökonomischen Charakteristika kein Nebeneinander. Konzerne, die mit weltumspannenden Infrastrukturen und zentralen Versorgungslösungen mächtig geworden sind, wollen ihr Geschäftsmodell nicht auf dezentrale, kleinteilige und beteiligungsintensive Versorgungslösungen umstellen. Sie wollen das alte, nicht nachhaltige Geschäft so lange wie möglich mitnehmen. Daher lassen sie nichts unversucht, dezentrale Lösungen zu erschweren und gleichzeitig mit Pipelines, monströsen Hochspannungstrassen oder Rodungsaktionen neue Fakten und Abhängigkeiten zu schaffen.
Die konzernfreundliche Politik wird dezidiert entlarvt. Denn die Alternativen sind verfügbar. Anfangs belächelt, zeitweise gefeiert und später wieder bekämpft, haben die unzähligen Akteure der Energiewende in den zurückliegenden Jahren eine wechselhafte Resonanz erlebt. Heute entfaltet eine um sich greifende Desinformationspolitik ihre Wirkung. Selbst in Kreisen engagierter Energiewendeaktivisten wachsen die Zweifel daran, dass wir die Wende noch rechtzeitig schaffen. Seit Jahr und Tag ist es fünf vor zwölf; die in Deutschland so gut gestartete Energiewende wirkt zäh und scheint zu lange zu dauern. Viele frühere Optimisten sind enttäuscht und haben den Glauben an den Umbruch verloren. Unschlüssig warten viele Bewegte auf die nächsten Kippelemente in der Klimaentwicklung. Kipppunkte gibt es aber auch gesellschaftlich und technologisch. Wenn sie erreicht sind, geht alles wahnsinnig schnell.
Der Geist ist aus der Flasche. Dafür gesorgt haben Einspeisegesetze wie das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), das inzwischen von rund hundert Ländern übernommen wurde. Einspeisegesetze sind emanzipatorische Gesetze: weg von einer zentralisierten Energieerzeugung in den Händen einiger weniger Großkonzerne hin zu einer Vielzahl von Akteuren, die als Prosumer regenerativen Strom bereitstellen und verbrauchen. Der Massenmarkt senkt beständig die Investitionskosten und macht Strom aus Wind und Sonne konkurrenzlos günstig. Wir haben das Know-how, wir haben die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite und wir haben genug Geld für den Wandel. Alles ist da.
Entscheidend ist der politische Wille. Und zu wissen, was zu tun ist. Hier werden Mittel und Wege beschrieben, was wie wann von wem zur schnellen Energiewende beizutragen ist. Parallel werden Widerstände enthüllt und benannt, wer wie und warum agiert – nicht nur seitens der großen Energieversorger, sondern auch der Kommunen, der Landwirtschaft oder der Automobilindustrie. Aufgezeigt wird nichts weniger als das Energiesystem der nahen Zukunft – und wie damit der Klimawandel eingedämmt werden kann. Dieses Wissen wird verknüpft mit konkreten Forderungen an die Politik.
Am Ende der Reise steht die Erkenntnis, dass ein ehrgeiziges Europa in höchstens zehn Jahren komplett erneuerbar versorgt werden kann. Nicht die Energiewende verursacht Billionenkosten, wie sie der Energie- und Wirtschaftsminister und frühere Umwelt- und Kanzleramtsminister Peter Altmaier bis zum Jahr 2040 fälschlicherweise prognostiziert hat. Im Gegenteil: Ohne Energiewende steigen die Kosten für Energie immens. Die Ausgaben der Deutschen für fossile Energieimporte haben sich im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Seit 1990 sind sie um das Vierfache gestiegen. Die fossilen Energiepreise werden aber nicht stagnieren, sondern aufgrund knapper Ressourcen und geopolitischer Entwicklungen eher ansteigen.
Wer über Energie spricht, meint meist Strom. Die viel höheren Kostensteigerungen für Wärme (Öl, Erdgas) und Mobilität (Diesel, Benzin), die für die Normalbürger rund 80 Prozent der Energierechnung ausmachen, werden selten angesprochen. Nicht ohne Grund: Von den jährlich netto gut 90 Milliarden Euro Importkosten für die deutsche Volkswirtschaft profitieren die globalen Energiekonzerne. Fast 70 Prozent des deutschen Energiebedarfs wird durch Importe gedeckt2.
Im Gegensatz dazu ist die Kostenentwicklung der Erneuerbaren langfristig kalkulierbar, da sie hauptsächlich durch technologische Entwicklungen und den dazu erforderlichen Kapitaleinsatz beeinflusst wird. Brennstoffkosten gibt es ja keine. Eine konsequente und beschleunigte Energiewende ist der einzig sinnvolle Weg, um aus der Kostenfalle beständig steigender fossiler Energiepreise herauszukommen.
Dieses Buch setzt nicht die Angst vor der Klimakatastrophe oder die Rettung der Welt in Szene. Doch es ist auch klar, dass die schnelle und vollständige Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf die dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien die entscheidende Grundvoraussetzung ist für das Überleben unserer Zivilisation. Frieden oder Krieg, Naturbewahrung oder industrielle Naturbeherrschung, soziale Gerechtigkeit oder Ausbeutung, Autonomie oder Diktatur: Unser Leben ist aufs Engste auch mit unserer energetischen DNA verknüpft.
Ein Paradigmenwechsel hin zu einer erneuerbaren Vollversorgung innerhalb von zehn Jahren ist möglich, in Deutschland ebenso wie in anderen überentwickelten Industrieländern. In unterentwickelten Ländern kann sie einfacher sein, weil nicht erst die nicht zukunftsfähigen zentralen Energiesysteme beiseitegeräumt werden müssen. Diese Roadmap will Sie mitnehmen auf eine Reise, an deren Ziel ein anderes Land wartet. Möge sie der – entscheidenden – kritischen Minderheit als Orientierung und Wegweiser dienen.
Kapitel 2
Das Grundgesetz der Energiewende
Artikel 1
Anlagen aller erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Alle Schleusen radikal öffnen, bürokratische und ökonomische Hindernisse beseitigen, insbesondere für Photovoltaik (PV) und Windkraft Onshore. So lange, bis wir bei 100 Prozent des Bedarfs liegen, der in zehn Jahren inklusive Wärme und Verkehr viel höher sein wird.
Strom ist die wertvollste Energieform, weil man damit Licht, Wärme, Mobilität, Industrie und sogar die Landwirtschaft organisieren kann.
Artikel 2
Dezentralität fördern. Die Erneuerbaren sind am besten und billigsten möglichst nah am Verbrauch – weltweit und in jeder Stadt!
Das neue dezentrale System hat andere Anforderungen als das bisher bekannte zentrale System; es gibt leider kein Sowohl-als-auch, nur ein Entweder-oder. Daher: alle Vorhaben darauf checken, welchem System sie dienen – und dann die zentralen verhindern und die dezentralen durchführen.
Artikel 3
Tempo machen. Je schneller wir zu einer dezentralen Nutzung von erneuerbaren Energien zur vollständigen Abdeckung des Energiebedarfs kommen, desto kostengünstiger wird der Umbau der Energieversorgung. Denn schnell bedeutet, dass der kostspielige Parallelbetrieb der beiden nicht kompatiblen Energieversorgungssysteme minimiert wird. Außerdem erzwingt der Klimawandel schnelle Ergebnisse.
Instrumente und Technologien, welche die alte Welt ein wenig verbessern und politisch als gerade noch machbar gelten, sind gut, dauern aber zu lange, zum Beispiel Emissionshandel, CO2-Steuern, Kohlekommissionskompromiss, Effizienzsteigerungen bei überholten Technologien, Auskoppeln von Wärme in Kohle- und Atomkraftwerken. Vor 20 Jahren durchgesetzt, hätte das ausreichen können. Jetzt ist es angesichts des fortgeschrittenen Klimawandels zu spät. Es muss schnell gehandelt werden. Konsens ist deshalb Nonsens.
Ziel ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die allen Luft zum Leben lässt. Dazu müssen wir wachsam sein, denn nicht immer sind Bremsen und Bremser der Energiewende auch sofort zu erkennen. Wie immer hilft auch hier die Frage ›Cui bono?‹. Wer zieht Vorteile aus der neuen Idee, dem neuen Regierungsvorschlag oder Beschluss? Nicht jede neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, trägt dazu bei, dass wir schneller zu einem dezentralen System kommen.
Albert Einstein sagte: Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher. Auf unsere Frage übertragen bedeutet das bis zur Grenze des Verantwortbaren vereinfacht:
Gut ist, was dezentral, recycelbar und schnell anwendbar ist.
Weniger gut ist, was zentral oder schmutzig ist oder lange dauert.
Beispiele
Windkraft Onshore
ja
Windkraft Offshore
nein
Regionale Verteilnetze
ja
HGÜ-Übertragungsleitungen
nein
PV auf Mietshausdächern
ja
PV in der Sahara (außer für die dort lebenden Menschen)
nein
Bestehendes deutsches Gasnetz als Saisonspeicher für Biogas
ja
Neue Gaspipeline nach Russland oder Oman
nein
Sektorenkopplung
ja
Alte Kohlekraftwerke lediglich durch einen Windpark ersetzen
nein
Entsprechend muss man die einzelnen Gesetze und Förderungen nach zentral oder dezentral durchdeklinieren:
EEG, das dezentralen Anlagenbau fördert
ja
EEG, das mit Ausschreibungen den Großen hilft
nein
Erneuerbares Verkehrssystem mit Sharing, mehr Platz für Räder und Fußgänger, dafür weniger Platz für individuelle Verbrenner
ja
Ersetzen des Verbrennungsmotors 1:1 gegen Elektromotor
nein
Beseitigung der bürokratischen Hemmnisse für den EE-Ausbau
ja
Subventionen für Kohle und Diesel
nein
Lokale Ökobauern unterstützen, auch Strom und Bioplastik zu produzieren
ja
Intensivanbau, Massentierhaltung und Regenwaldrodung
nein
Die dezentrale Nutzung von erneuerbaren Energien
macht unabhängig von konfliktreichen Herkunftsländern und entzieht den Konflikten um Öl, Kohle, Erdgas und Uran den Treibstoff;
macht unsere Energieversorgung sicherer gegen Störungen von innen wie von außen, ist damit ein aktiver Beitrag zum Frieden und einer sichereren Welt;
holt die Wertschöpfung in die Regionen und stärkt damit die ländlichen Räume;
schafft hochwertige Arbeitsplätze in Produktion, Aufbau, Betrieb, Pflege, Wartung und später auch Abbau und Recycling von Erneuerbare-Energien-Anlagen;
ist bürgernah und mittelständisch und führt zu einem fairen Energiemarkt ohne unfaire Oligopol-Profite;
verringert massiv die Schadstoffe in der Luft und rettet damit jedes Jahr Tausende Menschenleben;
substituiert den Ausstoß von CO2 und ist damit die Antwort auf die Klimakatastrophe (flankierend sind umweltschädliche Subventionen – in Deutschland circa 60 Milliarden Euro pro Jahr – schnell abzubauen; der Ausstieg aus der Kohle ist sofort umzusetzen, der aus der intensiven Landwirtschaft so schnell wie möglich);
funktioniert überall als volkswirtschaftlich billigste Lösung. Alle gewinnen, außer die Konzerne von gestern und ihre Appendices.
Kapitel 3
Krisen-Triplex – Energie, Wachstum, Klima
Zur Lage: Wir stehen sowohl in Deutschland als auch global vor drei sich verschärfenden und gegenseitig bedingenden Krisen: der Energiekrise, der Wachstumskrise und der Klimakrise. Diese drei existenziellen Probleme unserer Gesellschaft brauchen einen integrierten Lösungsweg – obwohl oder auch gerade weil sie häufig isoliert betrachtet und diskutiert werden. Wir brauchen einen Pfad, der uns zu sozialer Sicherheit, Klimaschutz und Energiesicherheit führt, (gutes) Wachstum inklusive.
Erstens: die Energiekrise
Der weltweite Energiebedarf steigt dramatisch. Von 1970 bis heute hat er sich verdoppelt. Schätzungen der International Energy Agency (IEA) gehen davon aus, dass bei einem Weiter-so der Bedarf jährlich um knapp 2 Prozent wächst – was sich ohne Verbesserungen im Effizienzbereich auch verdoppeln kann. Diese galoppierenden Zuwachsraten haben eine zentrale Ursache: Die Entwicklungs- und Schwellenländer orientieren sich an der Wirtschaftskraft und dem Lebensstandard der Industrienationen – und wer wollte ihnen das verdenken. Das bedeutet aber: Mehr Öl, mehr Gas, mehr Kohle werden aus China, Indien, Brasilien und den anderen aufstrebenden Schwellenländern nachgefragt. Die Verknappung der Reserven spiegelt sich bereits heute in den steigenden Preisen wider. Der Weltmarktpreis für Rohöl ist hoch volatil, in den letzten zehn Jahren schwankte er zwischen 30 und 140 US-Dollar je Barrel. Ökonomische und kriegerische Verwerfungen treten schon lange vor dem letzten Tropfen Öl auf. Der Gaspreis steigt mit dem Ölpreis. Uran gibt es noch ein paar Jahrzehnte. Auch Terroristen suchen fieberhaft danach – zum Bau schmutziger Bomben für mehr Terror. Und sogar die Kohlepreise haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht.
Das alles ist eine zentrale Herausforderung für die hiesige Wirtschaft, aber auch für viele Menschen weltweit. Deutsche Haushalte wenden jährlich über 100 Milliarden Euro an Energiekosten auf – das sind etwa 30 Milliarden Euro mehr als noch vor zehn Jahren. Weitaus dramatischer stellt sich die Situation im globalen Süden dar. Dort werden die Entwicklungshilfegelder ab einem Barrelpreis für Erdöl von etwa 70 Dollar fast komplett vom Ölimport aufgefressen. Für alle Menschen gilt daher gleichermaßen: Der zu erwartende Bedarf kann aus ressourcenökonomischer Sicht keinesfalls mit endlichen fossilen Energieträgern gedeckt werden. Dieses Missverhältnis von wachsender Nachfrage und endlichen Reserven zieht kurz- und mittelfristig weiter steigende Preise nach sich, die sich viele nicht mehr leisten können. Energieknappheit birgt ein hohes sozial- und sicherheitspolitisches Konfliktpotenzial.
Zweitens: die Wachstumskrise
Bereits seit den 1960er-Jahren sinken die langfristigen Wachstumsraten in den großen Industrieländern. Wachstumsraten von über 2 Prozent sind inzwischen so selten geworden, dass sie bejubelt werden. Das Erschreckende: In vielen Branchen in Deutschland, nicht nur in der Energiewirtschaft, schrumpft der Kapitalstock und es wird per saldo desinvestiert (wobei ich hier noch nicht einmal vom qualitativen Wachstum spreche, sondern lediglich vom quantitativen).
Zudem sind die Grenzen des quantitativen Wachstums bereits überschritten. Gegenwärtig lebt die Menschheit so, als stünden ihr 1,7 Erden zur Verfügung; lebten alle wie wir in Deutschland, bräuchten wir 3,3 Planeten. Es kann aber kein grenzenloses Wachstum auf einer begrenzten Welt geben. Diesem Umstand, dieser Verantwortung gerecht zu werden, bedeutet, dass wir anders mit der Umwelt umgehen müssen. Die Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme darf nicht weiter überbeansprucht werden. Der Earth Overshoot Day ist der Kalendertag, ab dem der menschliche Verbrauch der nachwachsenden Rohstoffe das Angebot auf der Erde und ihre Kapazität zur Reproduktion übersteigt. Er lag bis 1990 noch im Dezember – 2019 fiel er bereits auf den 29. Juli. Deutschland lebt im Jahr 2019 seit dem 3. Mai ökologisch auf Pump, auf Kosten der Natur und derer, die sie weniger ausbeuten als wir.
Wir müssen von den Zinsen der Natur leben und nicht von ihrer Substanz. Dabei geht es um das Ende der Verschwendung, nicht um Verzicht. Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir unseren Lebensstandard halten, die Armen mitnehmen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten können.
Bei ungebremstem quantitativen Wachstum kann von Nachhaltigkeit keine Rede sein, weil mit ihm desaströse ökologische Zerstörung einhergeht: Geradezu lehrbuchmäßig ist das am Beispiel China mit seinen bis zu zweistelligen Wachstumsraten zu verfolgen – bei ganz ähnlich hohen Zuwächsen ökologischer Zusammenbrüche. Die Umweltschäden fressen das Wachstum auf. China war bis etwa 2016 der einzige echte Wachstumsmarkt für deutsche Automobilhersteller und ist seit 2017 der größte Ölimporteur der Welt. 1,4 Milliarden Chinesen haben in der Summe einen gigantischen Energiehunger, 1,3 Milliarden Inder ebenso.
Zudem befinden wir uns seit Jahren in einer weltweiten Rezession, verursacht durch Spekulationen und Blasen; erst platzte die IT-Blase und dann die große Immobilien- und Finanzblase. Die Bank of England warnte schon 2005 vor Kohlenstoffblasen, weil sich Investitionen in Kohle, Gas und Öl nicht mehr rechnen könnten. Unsere auf Spekulation angelegte Bubble Economy wird weiter Zusammenbrüche auslösen.
Wir können mit der Energiewende in zehn Jahren ein tolles Paket schnüren, mit dem wir unsere Enkel entlasten, die Umwelt schützen und etwas für unsere Wirtschaft tun, also nachhaltig handeln. Nichthandeln treibt den Klimawandel voran, oder, im Sinne des Stern-Reports formuliert3: Der Nutzen, entschlossen und sofort zu handeln, übersteigt bei Weitem die wirtschaftlichen Kosten, die wir tragen müssen, wenn wir nicht handeln. Sein Verfasser, Sir Nicholas Stern, forderte bereits im Jahr 2006, dass wenigstens 20 Prozent der weltweiten Konjunkturprogramme in Energieeffizienz und erneuerbare Energien gesteckt werden, wovon jede und jeder profitieren würde:
Bürger gewinnen, weil sie weniger Heizkosten zahlen (das ist Sozialpolitik, weil für arme Menschen steigende Heizkosten besonders zu Buche schlagen).
Handwerker und Arbeitsmarkt profitieren von mehr Aufträgen. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort.
Finanzmärkte gewinnen an Stabilität, weil erneuerbare Energien Investitionen in Realwirtschaft sind.
Umwelt und Klima gewinnen, weil viel weniger fossile Energien verbraucht und dadurch weniger Emissionen in die Luft abgesetzt werden.
Der Staat gewinnt, denn mit jedem neuen Arbeitsplatz erzielt der Staat Lohnsteuern, anstatt Sozialausgaben zu tätigen.
Der Friedensprozess gewinnt, denn Öl und Gas liegen in geopolitisch umkämpften Ländern. Wenn man kein Öl oder Gas mehr braucht, gibt es weniger Kriege und die Terrorgefahr nimmt ab.
Demokratie und Verbraucher gewinnen, denn dezentrale Versorgung und hohe Effizienz machen die Bürger unabhängig von den Energieunternehmen und ihren Monopolen.
Die Gerechtigkeit gewinnt, denn erneuerbare Energien sind eine ethische Energiegewinnung. Jeder kann daran teilhaben. Sie sind gut für die Menschen in Nord und Süd, Ost und West und auch für unsere Kinder und Enkel.
Drittens: die Klimakrise
Der Klimawandel ist ein globales Phänomen, die Klimaerwärmung Realität. Verursacher ist der Mensch. In der internationalen Klimaforschung besteht kein Zweifel daran, dass der Klimawandel voranschreitet und sich beschleunigt. Insbesondere Kohlendioxid ist von 280 parts per million (ppm) im Jahr 1750 auf heute über 400 ppm angestiegen. Dadurch wird der Erde ein massiver Treibhauseffekt aufgezwungen. Er bedingt bereits heute eine deutliche Zunahme von extremen Wetterereignissen. Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen) haben sich seit 1990 verdoppelt. Wir sind in ein geschlossenes Ökosystem eingebunden. Jeder Eingriff in dieses komplexe System ist deshalb auch eine Gefahr für uns selbst.
Lassen wir dem Artensterben, dem grenzenlosen Energie- und Wasserverbrauch weiter freien Lauf, sind Barbarei und die Selbstvernichtung der Menschheit nicht ausgeschlossen. Die größten Flüchtlingsströme weltweit setzen sich jetzt schon aus Umweltflüchtlingen zusammen. Die Völkerwanderung von Süd nach Nord hat bereits begonnen.
Perspektive Energieautonomie
Nachhaltiges Wirtschaften ist das Leitbild nicht nur im Energiebereich, sondern genauso in den Bereichen Verkehr, Bauen und Landwirtschaft. A priori setzen politisches und auch unternehmerisches Handeln die Fähigkeit und Bereitschaft zur ständigen Anpassung an neue Gegebenheiten voraus und sind damit das Gegenteil eines strukturkonservativen Bewahrens. Das ist nichts anderes als Joseph Schumpeters Definition vom Menschen als dem schöpferischen Zerstörer. Das Kennzeichen menschlichen Handelns ist gerade die Innovation – auch die Strukturinnovation. Die enorme ökologische Herausforderung, der wir uns gegenübersehen, erzwingt den Bruch mit alten, zerstörerischen Gewohnheiten und die Entwicklung neuer Produkte. Richtig verstanden, ist menschliches Handeln auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet. Alle zur Verfügung stehenden Mittel sollten zur langfristigen Schonung natürlicher und sozialer Ressourcen eingesetzt werden. Darauf müssen wir uns wieder besinnen – und zwar global.
In der Energiepolitik des 21. Jahrhunderts geht es um das Gemeinwohl. Um Wirtschaftspower und Jobs mit einer nachhaltigen, weil umweltverträglichen Energieversorgung. Deutschland kann mit einer zukunftsfähigen Energiepolitik die Binnenwirtschaft stärken, gleichzeitig den Export seiner Technologien ausbauen und sich importunabhängig von Öl, Gas und Kohle machen, die Ressourcen schonen und das Klima schützen.
Meine Leitkultur ist die Energieautonomie. Nach Hermann Scheer, dem Archimedes der Energiewende, ist eine selbst- statt fremdbestimmte Verfügbarkeit über Energie das Ziel – frei und unabhängig von äußeren Zwängen, Erpressungs- und Interventionsmöglichkeiten. Dies ist auf Dauer nur mit den erneuerbaren Energien möglich. Die Autonomie durch eine Vielzahl von Akteuren zu verwirklichen, ist die einzig Erfolg versprechende Methode, den Energiewechsel rechtzeitig und unumkehrbar gegen die Funktionslogik des überkommenen Energiesystems durchzusetzen.
Hermann Scheer schrieb im Jahr 2010, dass ein vollständiger Wechsel zu erneuerbaren Energien weltweit im Zeitraum etwa eines Vierteljahrhunderts und in einigen Ländern auch früher realisiert werden kann4. Realisierbar ist dieser Wandel aufgrund des natürlichen Potenzials der erneuerbaren Energien und der verfügbaren Technik. Er ist keine untragbare Belastung, sondern eine umfassende neue wirtschaftliche Chance für den Norden und ein riesiges Potenzial auch für den Süden. Dieser Umbau erfordert zwar eine beispiellose politisch-kulturelle Anstrengung. Doch auch die Herausforderung, vor der wir stehen, ist als historisch zu sehen. Sie ist umso schwerer zu bewältigen, je länger wir sie vor uns herschieben. Aber das müssen wir nicht, denn seit Scheers Tod (2010) haben sich die erneuerbaren Technologien rasant entwickelt, die Kosten fielen und fallen weiter – das Ziel einer vollständig regenerativen Energieversorgung bis 2030 bleibt damit erreichbar.
Die Integration der Erneuerbaren in das bestehende Energieversorgungssystem ist das Gegenkonzept zur Energieautonomie; eine solche Strategie dient vor allem dazu, diese darin unter Kontrolle zu halten. Antonio Gramsci nannte so ein Vorgehen eine »passive Revolution«: Ein existierendes System bekennt sich zu seinen Versäumnissen in einer allgemein relevanten Frage, nimmt die Kritik an, bedankt sich bei den Anstoßgebern und erklärt sich nunmehr als einzig kompetent für die Umsetzung. Dann interpretiert es die Frage nach seinen eigenen Regeln und setzt nur unwesentliche Teile des Neuen um – das können wir nicht wollen!
Kapitel 4
Zeit der Monster – warum die Energiewende stockt
Das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) aus dem Jahr 2000 ist das erfolgreichste Klimaschutzinstrument der Welt. Es hat wie kein anderes Gesetz dafür gesorgt, dass der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Stromverbrauch von 6 Prozent im Jahr 2000 auf inzwischen 40 Prozent gestiegen ist, und damit den Umbau des Kraftwerkparks gefördert.
Es sorgte außerdem für Investitionen, Wertschöpfung, zukunftsfähige Jobs, Innovationssprünge und die Reduktion von Energieimporten. Weit über 2 Millionen Deutsche arbeiten im Umweltschutz, davon circa 300.000 für erneuerbare Energien. Damit hat das EEG mehr Jobs geschaffen als zu Beginn der Energiewende im Jahr 2000 im Bereich der Kohlewirtschaft noch bestanden. Das Zechensterben begann bereits vor 50 Jahren. Im Vergleich zu rund 340.000 Kumpeln in der Kohlebranche im Jahr 1980 arbeiteten 2018 nur noch 25.000 in der Bergbauindustrie, davon 20.000 in der Braunkohle und 5.000 in der Steinkohle. Die Vergütung für Photovoltaikanlagen sank seit 2004 um über 80 Prozent. Windanlagen erzeugen heute circa neunmal so viel Strom wie in den 1990er-Jahren. Unsere Volkswirtschaft wurde dadurch robuster gegen unkalkulierbar schwankende Weltmarktpreise für fossile Energieträger und unabhängiger von geopolitisch instabiler werdenden Regionen.
Die administrativ festgelegten EEG-Einspeisevergütungen haben einen neuen und wachsenden Markt geschaffen, der zu einem intensiven globalen Wettbewerb zwischen Anlagenherstellern und Projektierern führte. Der Wettbewerb entstand aus der hohen Investitionssicherheit des EEG über 20 Jahre. Dies hat zu derart großen Einsparungen bei den Produktionskosten geführt, dass die Stromproduktion mit Wind-Onshore- und Photovoltaikanlagen aus neuen EE-Anlagen heute kostengünstiger ist als der Weiterbetrieb selbst steuerlich abgeschriebener Kohlekraftwerke. Soweit die positiven Aspekte.
Sand kommt ins Getriebe
Trotz dieser Erfolgsgeschichte und obwohl die Menschen hierzulande mehrheitlich für eine schnelle Energiewende sind, erscheint diese mittlerweile als ein mehr als mühsames Projekt – und sie verdient ihren Namen auch nicht (mehr), denn sie mutierte zu einer eindimensionalen Atomstrom-Austauschaktion, welche die Industrie zu niedrigsten Preisen bedient.
Die Kosten zahlen die Stromverbraucher vor allem über eine höhere EEG-Umlage. Die Umstellungen im EEG 2014, EEG 2017 oder im Energiesammelgesetz 2018 wurden in der Öffentlichkeit so dargestellt, als ginge es um Wettbewerb. In Wahrheit wurde jedoch eine planwirtschaftliche Mengenfestsetzung mit Deckelungen für Erneuerbare zum Schutz der Kohle durchgesetzt. Das schwächt die deutsche Industrie und den Wirtschaftsstandort in diesem Branchensegment.
Noch während der Unterzeichnung des Pariser Weltklimaabkommens am 12. Dezember 2015 ging die Große Koalition den Weg zurück in eine Kombinats- und Oligopolwirtschaft, die einst in Ost- und Westdeutschland für große, stinkende Betriebe und machtpolitische Unbeweglichkeit stand. Offensichtlich sollen die konventionellen Energien noch ein paar Jahre länger am Tropf gehalten werden. Aktuell sind daher Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien wieder gefährdet. In der Photovoltaik ist die Beschäftigtenzahl von 120.000 im Jahr 2010 auf 30.000 im Jahr 2018 eingebrochen. Über 90.000 Arbeitsplätze sind vor allem wegen falscher deutscher Rahmenbedingungen an China und andere Standorte verloren gegangen.
Deutschland forciert Arbeitsplätze im Kohlesektor, der für Verschmutzungs- und Entsorgungsprobleme steht, während im Zukunftsmarkt Photovoltaik achselzuckend Jobs abgebaut werden.
Auch in weiterer Hinsicht ist die Bilanz der ›Klimakanzlerin‹ Merkel nicht gerade berauschend: 90 Milliarden Euro pro Jahr werden für den Import von Öl, Gas und Kohle aufgewendet, noch immer sind 150 Kohlekraftwerke am Netz, eine Verkehrs- und Wärmewende ist nicht in Sicht.
Trotz der enormen Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren beträgt ihr Anteil am deutschen Gesamtenergieverbrauch gerade einmal 15 Prozent. 85 Prozent der in Deutschland verbrauchten Energie kommt also immer noch aus Atomkraft, Kohle, Gas und Öl. Bisher sind wir Deutschen nur im Bereich der Stromversorgung gut. Aber über 90 Prozent unserer Heizungen und Klimaanlagen verfeuern immer noch fossile Brennstoffe. Und fast alle Autos fahren immer noch mit ineffizienten und teuren Verbrennungsmotoren, mit der Folge, dass über 80.000 Menschen jährlich in Deutschland vorzeitig durch Luftschadstoffe und Feinstaub sterben.5
2019 ist klar, dass die Bundesregierung die zugesagten Klimaschutzziele für 2020 um ein Viertel verfehlen wird. Routiniert versprach sie, sich um die weiteren Ziele zu kümmern. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich aber wenig getan – und jetzt zelebriert die Bundesregierung auch noch die Renaissance von Kohle und Gas.
Ungerechtigkeit gebiert Monster
Die ökologische und die soziale Frage sind unmittelbar miteinander verbunden. Gerade die unteren Einkommensschichten zahlen die relativ höchsten Stromkosten, wohnen in schlecht gedämmten Wohnungen, in Gegenden mit der höchsten Luftverschmutzung und können sich keine effizienten Geräte leisten. Gut 6 Millionen Deutsche sitzen über den Winter mit Jacken, Decken und warmen Schuhen im Wohnzimmer. Ungefähr einer Million wird mindestens einmal jährlich der Strom abgestellt. Die Haushaltsstrompreise sind – im Gegensatz zu den Industriestrompreisen – mit die höchsten in der EU.
Derartige Entwicklungen sind nicht nur unschön, sie schaffen Raum für Konflikte und spielen Populisten in die Hände. Nationalisten und Antidemokraten fühlen sich als Teil einer Bewegung der Transformationsverlierer gegen das Establishment. Mit einem Blick über die Grenzen (wenn auch nicht nur dort) könnte man mit Gramsci sagen: »Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der Monster.« Sie gehen wieder um und heißen heute Trump, Putin, Erdogan, Bolsonaro, Orban, Le Pen, aber auch Gauland. Sie sind das Ergebnis der großen Krisen unserer Welt: der Ungerechtigkeit, der Wirtschaft und des Klimas. Sie alle leugnen den Klimawandel.
Dieser gefährlichen Entwicklung müssen wir ein überzeugendes Narrativ entgegensetzen: soziale Gerechtigkeit und eine positive Perspektive für alle. Der Gedanke der Umverteilung durch Fortschritt, wie ihn die SPD postuliert, funktioniert bei geringen Wachstumszahlen, digitalem Kapitalismus und fortschreitender Umweltzerstörung nicht mehr. Der dystopischen, mithin zukunftspessimistischen Erzählung der Rechten sollten die republikanisch gesinnten Kosmopoliten eine demokratische Erzählung entgegensetzen, die mit konkreten Projekten und klarer Zuversicht unterlegt wird.
Was ist zu tun?
Wo ökologische Mengenprobleme vorliegen – etwa beim Verbrauch von Energie, Rohstoffen oder Flächen sowie beim Ausstoß von Emissionen –, sind Instrumente wie eine CO2-Äquivalente- oder eine Schadstoffsteuer geeignet, um der Innovationsdynamik eine neue Richtung zu geben. Ein schneller Kohleausstieg sowie der beschleunigte Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien und von Speichern sind unabdingbar. Gleichzeitig sind der überdimensionierte und überteuerte Ausbau der Übertragungsnetze einzubremsen und eine neue Energiemarktordnung in die Debatte einzubringen, um Konvergenz zwischen dem Strommarkt und den Märkten für Wärme, Gas und Kraftstoffe zu erreichen. Alle Deckel beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind ersatzlos zu streichen.
Kapitel 5
Feuer und Geist – Energie ist Macht
Die Zähmung von Wildfeuern aus Blitzschlägen oder Buschbränden und später die Kunstfertigkeit, Feuer zu entfachen, waren wichtige Schritte der Menschwerdung. Feuer bot Wärme, Licht und Schutz vor Raubtieren und Insekten. Feuer konnte Holz und Steine härten, schuf im Neolithikum Ton und Keramik und schmolz später Erze zu Kupfer und Bronze. So zeichneten sich die Agrargesellschaften im Gegensatz zu den Jäger-und-Sammler-Kulturen dadurch aus, dass sie die Sonnenenergie kontrolliert nutzen konnten. Brennstoff und Baumaterial wie zum Beispiel Holz stammen bis heute daraus. Auch Öl, Kohle und Gas gäbe es ohne Sonne nicht. Die Freisetzung des in ihnen gebundenen CO2 ruiniert mit seiner ineffizienten Verbrennung allerdings gerade das Weltklima.
Der Aufstieg der USA zur weltweit führenden Militär- und Wirtschaftsmacht ist nicht denkbar ohne die zweite Welle der Industrialisierung durch die transkontinentale Eisenbahn – einer Dampfmaschine auf Rädern –, das Öl und das Automobil. Die deutsche Erfolgsgeschichte ist eng mit dem Bergbau und der Schwerindustrie verbunden. Die weltweit höchst ungleiche Verteilung des Energieverbrauchs entspricht der ungleichen Verteilung des Reichtums. Politische Spannungen nehmen dadurch zu, dass die fossilen Ressourcen oft in anderen Regionen zu finden sind als der Reichtum, der aus ihrer Ausbeutung resultiert.
Energie ist der erste Schritt jeder Wertschöpfung und insbesondere der Motor und das Schmieröl moderner Industriegesellschaften. Deshalb sind es letztendlich das Erdöl, das Erdgas und die verschiedenen Kohlearten, die bisher unsere Wirtschaftskreisläufe in Bewegung halten. Inzwischen haben wir festgestellt, dass gerade der Einsatz dieser fossilen Energieträger durch Verbrennung große, langfristige Schäden in unserer Umwelt hinterlässt, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Das bedeutet, dass die zentrale Antriebsfeder des gesamten menschlichen Wirtschaftens nicht mehr wie bisher zur Verfügung steht.
Disruption in der Energiewende
Eine disruptive Technologie (to disrupt – unterbrechen, zerreißen) ist eine Innovation, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung vollständig verdrängt. Dabei geht es auch um Verfahren, Denkweisen, Prozesse, Systeme und ganze Kulturen. Disruption ist ein Prozess, bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch eine schnell wachsende Innovation komplett abgelöst wird. Bestehende, traditionelle Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienstleistungen werden immer wieder durch innovative Veränderungen abgelöst und teilweise vollständig verdrängt. Insbesondere in der Start-up-Szene ist der englisch auszusprechende Begriff ›Disruption‹ eine beliebte Vokabel, da er das revolutionäre Denken eines Gründers zum Ausdruck bringt.
Der Unterschied zwischen einer normalen Innovation, wie sie in allen Branchen vorkommt, und einer disruptiven Innovation liegt in der Art und Weise der Veränderung. Während es sich bei einer normalen Innovation um eine Erneuerung handelt, die den Markt nicht grundlegend verändert, sondern lediglich weiterentwickelt, bezeichnet die disruptive Innovation eine komplette Umstrukturierung beziehungsweise Zerschlagung des bestehenden Markts.
Was jenen blüht, die von der Disruption überrollt werden, wird gern am Beispiel von Kodak erzählt, dem untergegangenen Filmhersteller: im Jahr 1888 gegründet, mit 150.000 Mitarbeitern zu den besten Zeiten Weltmarktführer, im Jahr 2012 insolvent. Dabei haben die Menschen nicht aufgehört, Fotos zu knipsen. Im Gegenteil, es wird mehr denn je fotografiert – nur Kodak ist nicht mehr dabei. Die Firma hat die digitale Revolution verschlafen. In weniger als einer Generation drehten Henry Ford und Fred Taylor, der das Fließband erfand, durch die Industrialisierung der Autoherstellung den Pferdekutschen den Hahn ab und schrieben mit dem massenfähigen Automobil die Erfolgsgeschichte Amerikas. Das Smartphone disruptierte den Handymarkt von oben. Amazon verdrängt langsam den traditionellen Buchhandel.
Nicht jede Transformation ist disruptiv. Noch 1990 prognostizierte AT&T den Bedarf an Handys auf weniger als eine Million in den nächsten 15 Jahren. Es wurden über 100 Millionen. Klare Fehleinschätzung. Trotzdem gibt es AT&T noch – wenn auch geschrumpft. Die Erfindung der CD bedeutete beispielsweise lediglich eine Weiterentwicklung der klassischen Schallplatte. Presswerke, die analoge Platten herstellten, passten ihre Verfahren an die neue Compact Disc an, während Plattenhändler begannen, CDs in ihr Produktsortiment aufzunehmen. Das Aufkommen digitaler Musikvertriebe wie Napster, Deezer, Apple-, Google- bis hin zur Aldi-Music-App bedeutet hingegen die schrittweise Zerschlagung des lokalen Musikgeschäfts. Sie haben einen disruptiven Prozess eingeleitet. Indem Napster einerseits dem Kunden die Möglichkeit gibt, seine Lieblingssongs online zu erwerben, und es andererseits dem Künstler erlaubt, ohne Tonträger erfolgreich zu sein, verlieren Major-Labels, Presswerk und Plattenhändler ihre wirtschaftliche Grundlage.
Viele Webdienste, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen, haben ältere Industrien abgelöst. Früher hatte fast jeder ein Lexikon oder gleich den großen Brockhaus mit 20 Bänden zu Hause; heute gibt es Wikipedia – der Brockhaus wurde disruptiert. Google Maps oder maps.me verdrängten Atlanten und Landkarten.
Selbst wenn sich viele dieser Erkenntnis immer noch verweigern, ist die einzige Lösung dieser größten Herausforderung für die Menschheit eindeutig: Unser Energie- und letztendlich unser gesamtes Wirtschafts- und Ernährungssystem müssen radikal umgebaut werden – und dazu müssen wir anders denken.
Unsere Generation hat von Kindesbeinen an gelernt, dass Energie immer zur Verfügung steht (nur noch Vertreter der Kriegs- oder ersten Nachkriegsgeneration wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist). Darüber hinaus wurde uns beigebracht, dass eine sichere Energieversorgung in modernen Industriegesellschaften nur durch große und aufwendige Maschinen und Anlagen geleistet werden kann. Je größer das Kraftwerk, je zentraler die Anlage und je mächtiger die physikalisch gebändigte Kraft, desto höher die Wirkungsgrade und die Versorgungssicherheit. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum es vielen Menschen schwerfällt, daran zu glauben, dass es auch anders geht. Denn die Situation verändert sich drastisch, wenn wir nur noch Energieträger nutzen, die uns unendlich zur Verfügung stehen, weil dann deren Wirkungsgrad unerheblich beziehungsweise nicht so wichtig ist. Und wenn wir die Energie auch nur noch dort produzieren, wo sie gebraucht wird, dann werden die Schlussfolgerungen anders ausfallen – und die Zeit für eine disruptive Innovation ist gekommen.
Was wir brauchen und was uns bevorsteht, ist also eine Revolution. Die globale Energiewende wird kommen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Daran können auch niedrige Ölpreise und Donald Trump nichts ändern. Die Treiber sind weder ambitionierte Klimaschutzziele noch ein gesteigertes ökologisches Bewusstsein, sondern die exponentielle Kostendegression bei regenerativen Energietechniken, die technischen Innovationen bei den Speichertechnologien und ein hohes industriewirtschaftliches Interesse.
Mittlerweile gibt es die in diesem Buch beschriebenen Schlüsseltechnologien, die – in ihrem Zusammenwirken – das Zeug dazu haben, die Energiewende derartig zu beschleunigen, dass große Player aus der deutschen Old Industry, die Jahrzehnte als unverzichtbares Fundament unserer mächtigen Industrienation galten, einfach von neuen Playern wegdisruptiert werden. Es hat bereits begonnen. Und in weniger als zehn Jahren ist es vielleicht schon vollzogen.
Kapitel 6
Raubbau als Prinzip – die Loslass-Energien
Je mehr Öl aus einer angezapften Quelle gefördert und verkauft wird, desto weniger ist darin. Also muss man zur Aufrechterhaltung des Geschäfts permanent neue Ölquellen suchen, um die erschöpften zu ersetzen. Solche Zusammenhänge finden in der Red-Queen-Hypothese ihren Niederschlag6. Sie bezieht sich auf die Rote Königin aus ›Alice im Spiegelland‹, die Alice erklärt: »Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.« Wobei die benachbarten Ölfelder oft schon schwach sind und es mit der Zeit immer schwieriger wird, neue Felder zu finden und daraus zu fördern. So wurde China vom Ölexportland zum Importeur mit beständig wachsendem Bedarf.
Die Konsequenz: Je größer der Erdölbedarf in Beijing, desto höher steigt der Ölpreis in San Francisco oder Berlin.
Photovoltaik (PV) hingegen hat eine Lernkurve von über 20 Prozent. Mit jeder Verdopplung der Infrastruktur sinken die Produktionskosten um über 20 Prozent. Je größer die Nachfrage auf dem Markt, desto eher werden Grenzkosten von fast null erreicht. Jedes verkaufte Solarmodul trägt dazu bei, dass die nächsten Module günstiger und besser werden. Zwischen 2011 und 2017 sind die Kosten der Stromerzeugung aus Photovoltaik um fast 75 Prozent gefallen. Hätte Erdöl eine vergleichbare Entwicklung hinter sich, dürfte eine Tankfüllung heute nicht mehr als ein paar Cent kosten. Die gesamten Erneuerbare-Energien-Technologien sind hightechbasiert und die Kommerzialisierung aller eher bit- als atombasierten Produkte verfolgt ähnlich exponentielle Kostenkurven. Und so entwickeln sich auch Batterien, Wechselrichter, Smart Grids und viele andere Komponenten, die Photovoltaik noch anwenderfreundlicher und lukrativer machen. Dieser wechselseitige Gewinn ist das Gegenteil von dem, was in rohstofffördernden Branchen wie der Öl- , Gas- oder Kohleindustrie stattfindet.7
Das bedeutet: Je mehr Photovoltaik in Beijing verbaut wird, desto geringer werden die PV-Preise auch in San Francisco oder Berlin.
Im Treibhaus
Treibhausgase sind diejenigen gasförmigen Bestandteile in der Atmosphäre, sowohl natürlichen wie anthropogenen, also menschengemachten Ursprungs, die thermische Infrarotstrahlung zu großen Teilen absorbieren. Über 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, so der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), entstehen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Sie führen zu einem Anstieg der globalen Temperatur. Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O), Methan (CH4) und Ozon (O3) sind die Haupttreibhausgase in der Erdatmosphäre. Die klassischen Luftschadstoffe sind für Versauerung und Eutrophierung, also die Nährstoffanreicherung von Böden und Gewässern, aber auch für eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit verantwortlich. Beim natürlichen Treibhauseffekt ist der Wasserdampf ausschlaggebend: Etwa zwei Drittel des natürlichen Treibhauseffekts werden von Wasserdampf verursacht, nur ein kleiner Teil von CO2. Steigt die Welttemperatur, nimmt auch der atmosphärische Wasserdampfgehalt zu und der Treibhauseffekt wird verstärkt.
Anthropogenes Kohlendioxid wird bei bestimmten Landnutzungen wie der industriellen Landwirtschaft oder Entwaldung frei sowie bei der Verbrennung fossiler Energieträger. Quellen sind hier vor allem die Strom- und Wärmeerzeugung, Haushalte und Kleinverbraucher, der Verkehr und die industrielle Produktion.8 CO2 ist ein geruch- und farbloses Gas, dessen durchschnittliche Verweildauer in der Atmosphäre etliche Jahrzehnte beträgt.
Methan, ebenfalls ein geruch- und farbloses, jedoch hochentzündliches Gas, ist ebenfalls ein wesentliches Treibhausgas. Seine durchschnittliche Verweildauer in der Atmosphäre beträgt 9 bis 15 Jahre und ist somit wesentlich geringer als die von CO2. Trotzdem macht es einen substanziellen Teil des menschgemachten Treibhauseffekts aus, denn das Gas ist mindestens 25-mal so wirksam wie Kohlendioxid. Rechnerisch hat eine Tonne Methan innerhalb von 100 Jahren in der Atmosphäre dieselbe Wirkung wie 28 bis 34 Tonnen CO29. Methan entsteht auch dort, wo organisches Material abgebaut wird, in Deutschland vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere bei der Massentierhaltung. Eine weitere Quelle sind Klärwerke und Mülldeponien.
Kohle – der nie enden wollende Sinkflug
Ohne Kohle keine industrielle Revolution. Doch heute gilt: ohne Kohleausstieg keine Energiewende. Bernd Bornhorst, Leiter der Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen von Misereor bezweifelt nicht den großen Anteil der Kohle am Wohlstand der westlichen Welt10. Aber sie macht Europa und die USA auch zu den Hauptverursachern des Klimawandels. Für China trifft diese Entwicklung inzwischen auch zu. Dabei schadet Kohle nicht nur dem Klima. In vielen Ländern verhindert sie die notwendige Neuausrichtung und sie steht der Armutsbekämpfung im Weg, Ihr Abbau ist eng mit Menschenrechtsverletzungen verknüpft. Der rasche, sozial verträgliche Ausstieg aus der Kohle ist also drängender denn je. Trotzdem stagniert – auch nach dem Klimaabkommen von Paris – in vielen Staaten der Kampf gegen den Klimawandel und der Einsatz für den Kohleausstieg – auch in Deutschland. Im Jahr 2018 sind weltweit 630 Gigawatt (also 630.000 Megawatt) neue Kohlekapazität geplant, davon 61 Gigawatt in Europa, obwohl der derzeitige globale Kohlenstoffhaushalt keinen weiteren Bau von Kohlekraftwerken zulässt.11 Offen ist, ob sie tatsächlich gebaut werden.
Kohlekraftwerke sind zu unflexibel, um als Partner der erneuerbaren Energien zu fungieren. Die schwerfälligen Kraftwerke können nicht spontan hoch- und heruntergeregelt werden und verstopfen dadurch mit ihrem Strom die Netze, anstatt Schwankungen von Sonne und Wind auszugleichen. Auch als Reserve braucht Deutschland keine Kohlekraftwerke.
Hinzu kommen die direkten Gesundheitsschäden. Im Jahr 2013 sind allein in Deutschland fast 4.000 Menschen an kohlefeuerungsbedingten Krankheiten gestorben.12
Das wirklich Beunruhigende ist: Mit dem zunehmenden Wissen über die Zusammenhänge steigen auch die Schätzungen der zu erwartenden Schäden. Insbesondere gilt dies für die Treibhausgase. 80 Euro Kosten pro Tonne CO2 galten über viele Jahre als realistische Einschätzung. Im Jahr 2017 ging das Umweltbundesamt (UBA) von 120 Euro aus.13 2018 taxierte das UBA die CO2-Schäden bereits auf 180 Euro pro Tonne CO2.14 Die amerikanische Environmental Protection Agency bezifferte die Kosten pro Tonne CO2 im Jahr 2018 gar auf bis zu 800 Dollar.
Im Braunkohlebergbau arbeiteten 2018 noch gerade mal 20.000 Menschen, inklusive derer, die mit der Rekultivierung ehemaliger Braunkohlereviere befasst sind. Das entspricht 2 Prozent aller lokalen Arbeitsplätze in der Lausitz, 1,2 Prozent derer am Rhein und unter 0,3 Prozent in den anderen Revieren. In der Steinkohleverbrennung gibt es noch knapp 6.000 Beschäftigte; insgesamt keine 0,1 Prozent aller deutschen Beschäftigten, die Hälfte davon sind über 50 Jahre alt. Die Bezahlung in der Branche ist überdurchschnittlich, ebenso die Qualifikationen, insbesondere im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik); es bestehen somit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die mit Kultur und Tradition begründete Forderung, kein Kumpel dürfe ins Bergfreie fallen – während gleichzeitig frei werdende Stellen kontinuierlich nachbesetzt werden –, ist vorgeschoben, um überholte, nicht wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle, die überdies auf Kosten der Umwelt agieren, so lang wie möglich aufrechtzuerhalten. Von den vielen Milliarden an Subventionen könnte man problemlos alle Betroffenen bei vollem Gehalt heimschicken und stattdessen die Erneuerbaren fördern. Rein rechnerisch könnte man jedem Kumpel sogar eine Million Euro schenken mit der Auflage, sie zu Hause in erneuerbare Technologien oder Speicher zu investieren. Das wäre ein prima Konversionsprogramm, für alle wäre gesorgt und die volkswirtschaftlichen Kosten wären niedriger als die Subventionskosten der Braunkohlewirtschaft in nur einem Jahr.
Sozial ist es auch nicht, wenn alle Strombezieher und Steuerzahler jahrzehntelang wesentlich mehr als notwendig für Strom bezahlen und schlechte Luft atmen müssen, um eine einzige Branche vor Wettbewerb zu bewahren. Überdies holt uns das ein. Oder wollen wir mit der knappen Million Menschen in Deutschland, denen mit dem Niedergang des Verbrennungsmotors ein ähnliches Schicksal droht, auch so verfahren, dass der Ausstieg zu einem künstlich subventionierten jahrzehntelangen Sinkflug wird? So viel Geld hat keiner und der bereits fortgeschrittene Klimawandel verkraftet das auch nicht.
Wasserverschwender Kohle