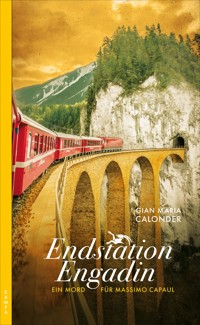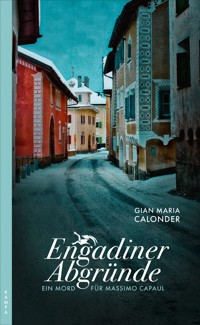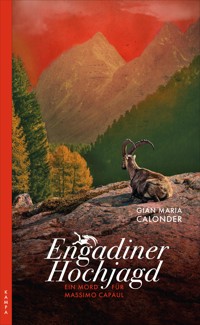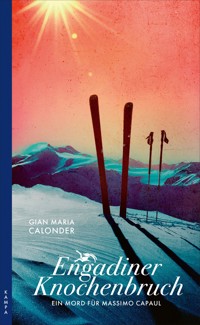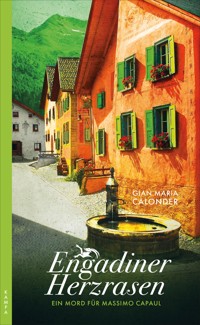
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Mord für Massimo Capaul
- Sprache: Deutsch
Als Massimo Capaul von der Polizeischule ins Engadin kam, um seine erste Stelle anzutreten, bereitete ihm nicht nur die Höhe Kopfschmerzen, sondern auch seine Wirtin. Denn die resolute Bernhild machte Capaul Avancen. Zum Glück fand sie aber schnell ein neues Opfer. Nur leider hat Bernhild wieder kein Glück in der Liebe. Dazu kommen Probleme mit der Polizei. Denn ihr Angebeteter, Theophrast Toutsch, Vertreter für Landwirtschaftsmaschinen und 71 Jahre jung, ist plötzlich tot und die Wirtin die Hauptverdächtige. Capaul will unbedingt herausfinden, ob seine Bernhild wirklich fähig ist zu einem Mord - und das, obwohl er wie schon so oft gar nicht mit dem Fall betraut ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gian Maria Calonder
Engadiner Herzrasen
Ein Mord für Massimo Capaul
Roman
Kampa
I
Wie jeden Morgen stand Massimo Capaul mit dem ersten Zwitschern der Amsel in der Lärche hinterm Haus auf, schlich an Metas Zimmer vorbei und die knarrende Holztreppe hinunter, um die italienische Espressokanne auf den vorsintflutlichen Herd zu stellen. Während er sich am abgestoßenen Spültrog wusch, hörte er durchs schlecht gekittete Fenster das gleichmäßige Rauschen des Zugs von Scuol, der oberhalb des Dorfs den Berghang entlangfuhr, ungebremst am Stationshäuschen von Lavin vorbei und weiter nach Sagliains. Zwanzig nach sechs. Seit Capaul den Dienst bei der Kantonspolizei quittiert hatte, blieb das Handy abgeschaltet, die alte, geliebte Omega-Armbanduhr, die ihn seit seiner Jugend begleitet hatte, war beim Umzug ins Engadin verloren gegangen. Nun waren die Züge seine Uhr. In Lavin galt Halt auf Verlangen. Der erste Zug fuhr durch, der zweite hielt an, gestoppt vom jüngsten Sohn des Bäckers, Baltisar Grass, der zu seiner Lehrstelle in Zernez fuhr. Damit war es sieben Uhr, Zeit für Meta, aufzustehen, und Capaul hatte zu verschwinden.
Wobei das keine Regel war, nur eine unausgesprochene Gewohnheit. Seit dem Tod ihres Mannes waren die Nächte Metas schwierigste Zeit, Albträume quälten sie, und morgens benötigte sie jeweils ein bis zwei Stunden, um sich zu fassen. Hatte sie die nicht, gerieten Capaul und sie leicht aneinander. Diese Auseinandersetzungen endeten meist mit der Feststellung: »Ich wusste ja, dass es nicht funktioniert«, danach folgte entweder der Satz: »Ich ziehe aus« (Capaul) oder: »Es wird das Beste sein, du ziehst wieder aus« (Meta). Was sie beide nicht wollten. Sie wollten, dass es funktionierte. Sie wollten, dass er blieb. Sie wollten eines Tages ein Zimmer teilen, gemeinsam aufwachen, sich am Gesang der Amsel freuen, die Hände am Herdfeuer wärmen und die Kaffeetasse teilen. Doch der Weg dahin war zäh.
Wie immer streckte Capaul den siedend heißen Kaffee mit viel Milch, trank ihn stehend in einem Zug, zog Jacke und Bergschuhe an und verließ das Haus.
Er eilte nicht nur Metas wegen. Er liebte es, am frühen Morgen bergwärts zu steigen, und wollte die Stunde nicht verpassen, in der es unten am Inn noch ganz dämmerig war und das kreuzförmige Gewächshaus der Gärtnerei funkelte wie ein Kristall in seiner Höhle. Die Häuser von Guarda, das auf einer Terrasse oben am Hang lag, leuchteten matt wie Eier in einem Nest, während die Berge über Scuol scharfkantig in den diesigen, blass rosafarbenen Himmel ragten. Dagegen wirkten die Felswände des Pisoc und des Lischana bläulich, mit schlickbraun schimmernden Wäldern. Nur über Österreich leuchtete schon der helle Tag.
Im Herbst war dies die Stunde der Jäger, jetzt im April war kaum jemand unterwegs. Nur die Waldarbeiter schnitten mit heulenden Sägen bereits Fallholz, und irgendwo ratterte ein Bagger. An den schattigen Stellen lagen noch Reste von Schnee, die Wiesenflanken darunter waren getränkt von Schmelzwasser, jeder Schritt schuf quatschend eine Pfütze, und es duftete nach Fruchtbarkeit. Die Wiesen waren voll mit weißen, gelben, rosenrot- und lilafarbenen Blümlein, deren Namen Capaul von Meta gelernt hatte – Küchenschelle, Zwergbuchs, Frühlingskrokus, Schneeheide –, nur vergaß er hartnäckig immer wieder, welche Blume welchen Namen trug.
Nachdem er sich auf einen unter der Schneelast gestürzten Baum gesetzt hatte, beobachtete er Metas Haus, ein großer, vergleichsweise schmuckloser Kasten, nach dem Dorfbrand vor rund hundertfünfzig Jahren als typisches Bauernhaus gebaut: halb Stall, halb Wohnhaus, das Giebeldach mit nur unmerklicher Neigung – so hatte sich vermutlich Raum schinden lassen. Auch typisch war, dass der Stall zur Straße hin ebenfalls als Wohnhaus kaschiert war, mit Sprossenfenstern und Läden anstelle der großen, offenen Holzbögen, wie sie die dem Berg zugewandte Seite einmal gehabt hatte. Inzwischen waren sie ebenso zugemauert wie straßenseitig die Stallfenster, nur Unebenheiten und Verfärbungen im Putz zeigten noch die alte Struktur.
Weshalb, darüber schieden sich in Metas Familie die Geister. Die offizielle Legende lautete, dass Metas Urgroßvater Tabak angebaut und verarbeitet hatte, was Feuchtigkeit und Wärme bedingt. Manche behaupteten aber auch, er hätte den Tabak nicht angebaut, sondern geschmuggelt. Schmuggel war bis in die Siebzigerjahre im Engadin ein lohnendes und weit verbreitetes Geschäft.
Meta selbst hatte dazu keine Meinung, sie sagte nur – mit diesem unergründlichen Lächeln, in das Capaul so vernarrt war: »Las chosas nu sun sco ch’ellas sun, mo sco ch’inchün tillas vezza.« Die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern wie man sie sieht.
Sie mochte sich nicht einmal dazu durchringen, zur öden, leeren Hausfassade mit dem scheckigen Verputz eine dezidierte Haltung zu entwickeln. Man hatte auf der Rückseite sogar die Läden des Wohnteils ausgehängt, die wenigen Fenster waren dunkle Löcher und die schlank gebaute Freitreppe, die außen in den Stall führte, der einzige dürftige Schmuck.
Als Capaul schimpfte: »Wie kann man ein so stattliches Haus derart verludern lassen?«, lachte sie.
»Zugegeben, hübsch ist anders. Aber es ist doch Hässlichkeit mit Charakter. Und was sollen wir deiner Ansicht nach tun? All die vermauerten Fensterbögen wieder aufbrechen? Und wozu? Oder auf die Leiter kraxeln und die Fassade streichen? Vielleicht müsste man sich erst Gedanken machen, wozu der Stall zu gebrauchen wäre.«
Das hatte eine gewisse Logik. Trotzdem beschloss Capaul, kaum hatte er bei seinem Vorgesetzten Offizier Gisler das Gesuch um Entlassung aus dem Polizeidienst eingereicht, Hand ans Haus zu legen.
Nicht brachial, sondern mit der feinen Klinge. Die ausgehängten Fensterläden lagen noch im Stall, die brauchte man nur abzuschleifen, neu zu streichen und wieder einzuhängen. Und auf die nackte Mauer konnten sie etwas malen oder schreiben, das hatte im Engadin Tradition. Dazu wollte er noch ein Spalierobst pflanzen, danach sah das Haus zweifellos schon ganz anders aus. Die Rückseite jedenfalls. Danach konnten sie sich den anderen drei Seiten widmen.
Und Capaul machte Ernst. Auch heute stand er auf, sobald er sah, dass Meta die Bettdecke zum Lüften aus dem Fenster hängte, klopfte sich auf die Schenkel, wie es die Sprinter vor dem Rennen tun, und machte sich im Laufschritt auf den Rückweg.
Als er vergnügt Metas Garten betrat, war heller Tag, die noch schneebedeckten Gipfel blendeten in der Sonne. Er holte aus dem Stall, was er zur Arbeit brauchte: zwei Böcke, Drahtbürste, Schmirgelpapier, Arbeitshandschuhe und zuletzt einen der verwitterten Fensterläden. Das Holz war aschgrau von Regen und Alter, die Farbreste warfen Blasen und lösten sich in dicken Schuppen. Es war ein Vergnügen, kraftvoll mit der Drahtbürste über die Läden zu fahren und Farbschollen splittern zu lassen.
Die Sonne hatte nun auch den Garten erreicht und wärmte ihm Schultern und Scheitel. Es duftete nach Diesel und Jauche, weil die Bauern das schöne Frühlingswetter nutzten, um endlich die randvollen Silos zu leeren und den Dünger auf den Wiesen auszubringen. Er trällerte »Those were the days, my friend« und war so sehr in seiner Welt, dass er eine ganze Weile nicht bemerkte, dass Meta sich auf die Stalltreppe gesetzt hatte und ihr »Rabenhaar«, wie sie es nannte, nach einzelnen grauen Haaren durchsuchte. Hatte sie eines gefunden, riss sie es fast bedächtig aus, wickelte es um zwei Finger, verknotete es und blies es in den Wind.
Als er endlich einmal die Bürste absetzte und sich aufrichtete, um den schmerzenden Rücken durchzubiegen, sagte sie: »Ich habe dir ein Butterbrot gebracht.« Gleich darauf fand sie wieder ein graues Haar.
»Lass sie doch, sie gehören zu dir«, sagte Capaul, wischte die Farbschuppen von den Kleidern und ging zu ihr.
Meta schüttelte lächelnd den Kopf. »Was wäre das für ein Paar! Dir wächst kaum Flaum ums Kinn, und ich habe schon graue Haare?«
»Ich bin auch schon achtunddreißig«, stellte er klar. »Und ich muss mich jeden Tag rasieren, von wegen Flaum. Außerdem würde dir auch mit ein paar grauen Strähnen keiner die fünfzig Jahre abnehmen.«
Sie funkelte ihn an. »Siebenundvierzig.«
Er grinste. »Du bist einfach eitel.«
Da sie keine Anstalten machte zu rücken, quetschte er sich zwischen sie und das Treppengeländer. Gleich legte sie den Arm auf Capauls Schulter und verwuschelte seine dichten, dunklen Locken. »Und du ein Milchkalb, meis char. Guten Morgen.«
Er ließ sich küssen, danach verschlang er hungrig das Butterbrot und erklärte Meta seine Schwierigkeiten mit der wohl ein Jahrhundert alten Ölfarbe, die sich zwar an den meisten Stellen quasi von selbst löste, an einigen aber umso hartnäckiger haftete, viele Schichten dick und hart wie Stein. »Wenn das einigermaßen aussehen soll, brauchen wir eine elektrische Schleifmaschine«, schloss er kauend.
»Ich leihe dir meine«, sagte Jon Luca. Er stand im geöffneten Gartentor, die Uniformjacke lose über die Schultern gelegt, mit offenem Hemdkragen und dem ihm eigenen Lächeln, das zu sagen schien: Keine Sorge, alles lässt sich irgendwie deichseln. »Du brauchst nur einzusteigen.«
Er zeigte hinter sich, offenbar hatte er gleich unterhalb der steilen Mauer auf der Straße angehalten.
»Hilf mir lieber bürsten«, antwortete Capaul. »Im Stall wartet noch ein Dutzend Läden. Die Schleifmaschine brauche ich frühestens zum Wochenende. Warum bist du überhaupt hier?«
»Wir brauchen dich in Samedan. Der Tatort ist bei mir um die Ecke. Danach kannst du die Maschine gleich mitnehmen.«
»Du machst Witze, ich habe gekündigt.«
»Aber Gisler hat deine Entlassung noch nicht bestätigt. So lange hast du bloß Urlaub. Und Urlaub kann man widerrufen.«
»Hat er das getan?«
»Noch nicht. Wir hoffen auf dein freundliches Entgegenkommen.«
Meta schaltete sich ein. »Mein Entgegenkommen. Er hat den Dienst meinetwegen quittiert.«
»Auch«, sagte Capaul.
»Jedenfalls will ich nicht, dass du mitgehst.«
Jon Luca sagte freundlich: »Es geht um Bernhild, die Wirtin im Wassermann. Massimos ehemalige Schlummermutter.«
Capaul erschrak. »Was ist passiert? Ist sie tot?«
»Sie nicht, einer ihrer Gäste.«
»Ist sie verletzt?«
»Nein, aber sie braucht dich. Steig ein, und ich erzähle dir alles.«
»Ich will das nicht, Massimo«, wiederholte Meta entschieden.
»Meta, ich kann Bernhild doch nicht hängen lassen!«
»Mich schon?« Sie stand resolut auf, nahm den leeren Teller und ging um die Ecke. Die Haustür knallte.
Capaul stand auf und klopfte nochmals die Kleider ab. »Ich komme mit, aber als Bernhilds Freund, nicht als Polizist.« Dann folgte er Jon Luca zum Einsatzwagen.
»Spinnt dein Handy wieder?«, fragte Jon Luca, während er auf die Kantonsstraße einbog. »Ich habe bestimmt fünfmal versucht, dich anzurufen.«
»Wozu brauche ich jetzt noch ein Handy? Wir leben so in den Tag hinein.«
»Na hör mal, jeder braucht ein Handy. Hast du keinen Kontakt mehr zu der Kleinen in St. Moritz?«
»Lisa? O doch, aber Meta hat ein schönes altmodisches Wandtelefon. Und jetzt erzähl mir endlich, was passiert ist.«
Jon Luca schaltete noch das Blaulicht ein und beschleunigte auf hundert, dann begann er zu berichten. Ab und zu musste er unterbrechen, weil er zum Überholen die Sirene aufheulen ließ und Capaul dann nichts mehr verstand.
Bernhild hatte am Morgen kurz nach sieben die Notrufnummer gewählt und einen Toten in einem ihrer Gästezimmer gemeldet. Auf die Frage, woher sie wisse, dass die Person tot sei, hatte sie geantwortet: »Er hat jedenfalls ein Loch im Rücken und bewegt sich nicht.« Jon Luca und sein Kollege Linard kamen gleichzeitig mit dem Notarzt an. Im Dachzimmer lag ein alter Mann nackt am Boden, jemand hatte ihn von hinten erschossen, sauber durchs Herz. Während Linard aufpasste, dass der Notarzt nicht die Spuren verwischte, ging Jon Luca runter zu Bernhild, die hinter dem Tresen Kaffeegeschirr parat stellte. Vor dem Wassermann stand inzwischen eine ganze Traube Menschen. Laut Bernhild handelte es sich um Touristen, die sich im Wassermann zu einer Stadtführung trafen, dazu kamen ein paar Stammgäste. »Ich wusste nicht, ob ich sie reinlassen darf.« Jon Luca ging raus und erklärte, dass das Wirtshaus geschlossen bleibe, dann kehrte er zurück und begann damit, sie zu befragen. Ob sie wisse, wer geschossen habe. »Darauf muss ich nicht antworten, oder?« Nein, musste Bernhild nicht. Wann sie den Toten entdeckt habe. Gleich vor dem Anruf. Wer zu der Zeit im Haus gewesen sei. Nur sie und der Indianer.
Capaul wunderte sich. »Indianer?«
»Der Tote. Alle hier nannten ihn so. Gebürtiger Oberengadiner, war allerdings lange in Amerika. Eigentlich hieß er Theophrast Troutsch. Einundsiebzig Jahre alt, Vertreter von Landwirtschaftsmaschinen.«
»Nicht pensioniert?«
»Weiß ich nicht. Bernhild und er waren die ganze Nacht allein im Haus, jedenfalls nahm sie das an. So um elf Uhr abends ging er auf sein Zimmer, sie schloss die Haustür ab und ging auch schlafen. Als er am Morgen nicht zum Frühstück kam, ging sie hoch und fand die Leiche. Ich: ›Und du bleibst dabei, dass sonst keiner im Haus war und auch keiner reinkam?‹ Sie: ›Theo geht ohne Stiefel nicht mal aufs Klo. Das Gepolter hätte ich gehört.‹ ›Aber wer soll es dann gewesen sein?‹ Sie sagt nichts. Ich: ›Wie steht es mit dem Schuss, hast du den gehört?‹ Sie: ›Das hat ganz schön geknallt.‹ Ich frage noch, wann sie den Schuss gehört hat, warum sie nicht nachgesehen hat, solche Dinge. Aber sie antwortet nicht mehr. Als ich frage, ob sie mit mir auf den Posten kommt, nickt sie und steht ohne Widerrede auf. Erst als ich frage, wo sie die Tatwaffe versteckt hat, stutzt sie. ›Hab ich einen Fehler gemacht?‹, fragt sie. Ich: ›Womit?‹ Sie: ›Hätte ich nicht mitkommen sollen?‹ ›Völlig egal, ob du mitkommst oder im Wirtshaus wartest, bis wir den Haftbefehl haben‹, sage ich. Danach schweigt sie, auch auf dem Posten. Erst als ich ihr vorschlage, einen Anwalt kommen zu lassen, sagt sie: ›Ich will, dass Massimo kommt.‹ Ich erkläre ihr, dass ein Anwalt wohl dringender wäre, aber sie bleibt dabei: ›Ich brauche Massimo.‹«
Sie hatten Samedan erreicht, und Jon Luca bog von der Kantonsstraße ab.
»Können wir noch schnell beim Wassermann vorbei?«, bat Capaul.
Jon Luca parkte beim Bahnhof. Das Sträßlein, in dem der Gasthof lag, war von mehreren Polizeiwagen blockiert.
»Roman und Barbla aus Zernez helfen bei der Spurensicherung, Meierhans aus St. Moritz sichert ab«, erklärte Jon Luca.
Die Touristen waren fort, nur ein paar Gaffer standen herum, darunter auch Bernhilds Stammgäste, die Capaul alle kannte: Frank, Peter, Mosse, Martin. Mit betretenen Mienen standen sie auf den Schneehaufen, die die Gasse säumten, traten fröstelnd von einem Bein aufs andere und nippten an ihrem Büchsenbier. Samedan lag spürbar höher als Lavin.
Capaul und Jon Luca wollten an Meierhans vorbei in die Wirtsstube, aber Capaul wurde zurückgehalten.
»Nur Dienstpersonal«, sagte Meierhans.
»Mensch, das ist Capaul«, sagte Jon Luca. »Er gehört zu uns.«
»Tut mir leid, das ist die Anweisung.«
»Er hat ja recht«, sagte Capaul, und während Jon Luca allein reinging, wandte er sich den wartenden Männern zu. »Wo habt ihr das Bier her?«
»Vom Kiosk«, antwortete Peter. »Mensch.« Für mehr fehlten ihm die Worte.
»Mensch«, sagte auch Mosse. »Schöne Tragödie.«
»Was ist denn genau passiert?«, fragte Capaul.
Frank sagte: »Sie hat den Indianer umgelegt.«
»Wer ist sie?«
»Na, Bernhild.«
»Das ist überhaupt noch nicht raus«, erklärte Peter.
»Na hör mal. Sie haben sie doch schon hopsgenommen. Und wer sonst soll die Leiche gewesen sein, die sie vorhin abtransportiert haben? Außerdem passt alles bestens zusammen.«
»Was passt bestens zusammen?«
»Na, es war verschmähte Liebe«, sagte wieder Mosse. »Wie im Film.«
»So ein Quatsch«, rief Peter. »Das war doch schon lange vorbei. Besser gesagt, da war überhaupt nie was. Eine aufgewärmte Jugendschwärmerei, nichts weiter.«
Martin grinste. »Du musst es ja wissen.«
»Seid ihr denn wieder zusammen?«, wandte Capaul sich an Peter.
»Was heißt ›wieder‹? Wir hatten ein, zwei kleine Krisen, meinetwegen. Aber wahre Liebe hält das aus.«
Mosse brach in schallendes Gelächter aus. »Kleine Krisen ist ja gut! Jetzt bist du mit einer Knacki liiert.«
»Peter, hör einfach weg«, riet Frank.
Der war sowieso abgelenkt, weil jetzt Barbla und Linard in weißen Übergewändern und mit einigen Beuteln Beweismaterial aus dem Gasthaus kamen und in einem der Kastenwagen verschwanden.
»Was Schweres war nicht dabei«, stellte er mit verhaltenem Triumph fest. »Solange sie die Tatwaffe nicht haben, ist nichts bewiesen.«
»Da antworte ich nur: ›DNA-Analyse‹«, sagte Martin. »Heutzutage reicht ein bisschen Spucke.«
»Nicht, um Bernhild in ihrem eigenen Gasthaus zu überführen, du Trottel. Dort wimmelt’s sowieso von ihrer DNA. Die brauchen schon was Handfestes. Stimmt’s, Capaul?«
Der zuckte mit den Achseln. »Die Tatwaffe zu haben ist nie schlecht. Noch besser ist ein Geständnis. Am allerbesten beides.«
»Wieso stehst du eigentlich hier rum?«, fragte Frank. »Um uns auszuhorchen? Von uns war’s bestimmt keiner.«
»Bernhild hat mich gebeten, ihr zu helfen. Ich weiß nur noch nicht wie.«
Peter sah ihn überraschend scharf an. »Mit dir hat doch die ganze Misere begonnen.«
»Wieso mit mir? Ich kannte diesen Indianer überhaupt nicht.«
Peters Augen funkelten. Er wollte noch etwas sagen, dann wandte er sich aber nur schweigend ab und trank sein Bier aus.
II
Dann kam auch Jon Luca zurück. »Komm«, sagte er und ging zum Auto.
»Weißt du schon mehr?«, fragte Capaul.
»Nein. Die Kugel haben wir, die Waffe nicht. Es wimmelt von möglichen Spuren, aber Kunststück, da drin wurde auch länger nicht richtig geputzt. Zimmer 20, sagt dir das was?«
»Ja, da habe ich damals auch gewohnt. Das einzige Zimmer unterm Dach.«
»Und was sagen Bernhilds Kumpanen?«
»So konkret nichts. Sie munkeln was von Eifersucht, aber Peter sagt, das sei Quatsch. Peter ist Bernhilds Freund. Oder war es.«
»Dann hoffe ich mal, du kitzelst aus Bernhild ein Geständnis raus, oder wir finden wenigstens die Waffe. Sonst müssen wir Peter auch noch in die Zange nehmen.«
Die paar Hundert Meter ins Dorfzentrum und zum Polizeiposten fuhren sie schweigend. Jon Luca ließ Capaul aussteigen und parkte, Capaul ging aufs Revier, direkt durch zur Zelle und drückte den Türöffner.
Bernhild saß in einem geblümten Putzkleid und mit verrutschtem lachsrotem Haarteil auf dem Bett. Die Filzpantoffeln der Schweizer Armee, in denen er sie zu Weihnachten angetroffen hatte, hatte sie wieder gegen ihre altbewährten grasgrünen Crocs eingetauscht. Bis auf etwas Lippenstift war sie ungeschminkt, und der schien von gestern zu sein.
»Gaff mich nicht so an, bei einer Sechsundsechzigjährigen gehört sich das nicht.«
Capaul log: »Gut siehst du aus«, zog den einzigen Stuhl herbei und setzte sich ihr gegenüber. »Kein Wunder, dass Peter dich bis aufs Blut verteidigt.«
Bernhild richtete sich auf und sah ihn mit einer Mischung aus Erschrecken, Verwunderung und Stolz an. »Heißt das, er hat gestanden?«
»Nein. Glaubst du, er war’s?«
Sie ging darauf nicht ein. »Was hast du dann gemeint?«
»Er hat laut und klar gesagt, dass ihr ein Paar seid und es immer wart. Das freut mich zu hören.«
Bernhild schrumpfte wieder. »Ein Paar«, wiederholte sie matt. »Beim Jassen gibt’s das vielleicht. Wir Menschen sind doch alles hoffnungslose Einzelgänger. Oder geht es dir mit dieser Meta etwa besser?«
»Mal so, mal so. Aber wer war es dann?«
»Was?«
»Wer hat den Indianer erschossen?«
Sie schwieg eine Weile, während sie mit zusammengekniffenen Augen ins Leere sah, als müsste dort etwas geschrieben stehen, das sie in ihrer Kurzsichtigkeit nicht erkannte. Dann schüttelte sie den Kopf und wandte sich wieder Capaul zu. »Ist doch egal, er hat es hinter sich. Ein Schuss, und alles Elend ist vorbei. Du hast doch in so einer Klinik gearbeitet, du verstehst das.«
»Wenn du damit sagen willst, dass es eine Art Sterbehilfe war, so was haben wir nicht gemacht. War der Indianer krank?«
»Kommt drauf an, von welcher Krankheit du redest. Das ganze Leben ist eine Krankheit.«
»Von der du ihn befreit hast.«
Sie sagte nichts.
»Und jetzt hoffst du auf mein Verständnis.«
Noch einige Sekunden schwieg sie, dann sagte sie: »Auf so einen Blödsinn würde ich ja gern was antworten, aber ich kann nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich kann eben nicht.«
»Bleibst du dabei, dass du mit dem Indianer die ganze Nacht allein im Haus warst?«
»Ich habe nur gesagt, ich hätte gehört, wenn er jemandem aufgemacht hätte. Seine Stiefel hat er höchstens zum Duschen ausgezogen.«
»Und im Bett wohl.«
»Zum Schlafen vielleicht. Zum Bumsen musste er sie nicht ausziehen, er hatte Unterhosen mit so Seitenschleifchen.«
»Und wie kam er aus den Hosen raus?«
»Was weiß ich, vielleicht schob er sie nur runter.«
»Warum weißt du das nicht?«
»Wieso sollte ich?«
»Aber du weißt, was für Unterhosen er hatte.«
»Weil ich sie ihm gewaschen habe. Deine Wäsche kenne ich ja auch. Ich dachte, du interessierst dich für die Stiefel. Erst dachte ich, er hat Fußschweiß, aber das war es nicht. Irgendwann hätte ich das gerochen. Jedenfalls hatte er irgendeinen Fimmel, und deshalb ist er auch nachts, wenn er mal aufs Klo musste, mit einem Mordslärm die Treppe runtergepoltert.«
»Hatte er noch andere Fimmel?«
»Seine Tätowierungen. Hast du die nicht gesehen?«
»Ich habe noch gar nichts gesehen. Und warum nannte man ihn den Indianer?«
»Das ist erst seit, ich weiß nicht, etwa zwanzig Jahren so. In unserer Jugend war er der Theo oder der Phrasti. Dann war er lange weg, auch etwa zwanzig Jahre. Und als er wieder auftauchte, trug er diese Lederstiefel und eine Lederjacke mit Fransen und erzählte, dass er in Amerika bei den Apachen gelebt hatte. Keine Ahnung, ob das stimmt.«
»Dann müsste er auch eine Indianersprache gelernt haben.«
»Konnte er auch ein paar Sätze. Er hat aber behauptet, dass die Indianer von heute englisch reden. Und dass er dort gemerkt hat, dass er im Herzen auch ein Indianer ist und deshalb nie lange an einem Ort bleiben kann. Deshalb hat er dann auch Landwirtschaftsmaschinen vertrieben, da kommt man in der ganzen Schweiz rum.«
»Was war er denn davor gewesen?«
»Lass mich nachdenken. Ursprünglich Knecht, glaube ich. Im Winter war er Gemeindearbeiter, Schneeräumung.«
»So lange kennst du ihn schon?«
»Hier oben kennen sich alle. Er war ja aus Celerina. Und er war der Mädchenschwarm schlechthin. Jede, aber wirklich jede war hinter ihm her.«
»Wieso?«
»Oh, da gäbe es viel zu sagen. Er hatte so was Leichtes, Kindliches. Man hatte das Gefühl, bei ihm gibt’s nichts Schlechtes. Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd, so in der Art. Dazu war er schön wie ein Gott. Und klug, bescheiden, irgendwie vornehm.«
»Warst du auch hinter ihm her?«
»Ich? Geschwärmt habe ich bestimmt, aber für mehr war ich viel zu jung. Dachte ich wenigstens. Obwohl ich ja schon auch was hergemacht habe. Habe ich dir erzählt, dass ich mal Seite-drei-Girl im Blick war?«
»Du hast mir sogar das Foto gezeigt.«
»Seitdem ist er jeden Tag in den Wassermann gekommen.«
»Was, damals warst du schon Wirtin?«
»Servierdüse. Der Theo hat ganz schön um mich gebuhlt. Mein Wirt, der Alfons, hat mich gewarnt: ›Der will dich nur flachlegen.‹ Aber so war der Theo gar nicht. Er wollte mit mir reisen, nach Indien, und irgendwann in eine Villa am Comer See ziehen. Das war irgendwie sein Traum. Damals hat er auch sein erstes Tattoo stechen lassen, eine Nixe, weil ich doch im Wassermann serviere. Das habe ich zufällig entdeckt, er war viel zu schüchtern, um es mir zu zeigen. Nimfa hat er mich für sich genannt, das heißt Nixe auf Romanisch. Ja, und dann kamen wir zusammen, und es war alles nicht so toll wie gedacht. Wir haben uns Mühe gegeben, aber irgendwie sollte es nicht sein. Nach zwei Monaten oder so sind wir wieder auseinander. Trotzdem war er meine erste große Liebe, und ich habe es lange nicht überwunden. Vielleicht nie.«
»Du hattest aber danach schon einige andere, oder?«