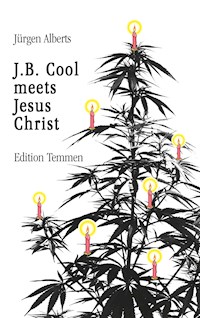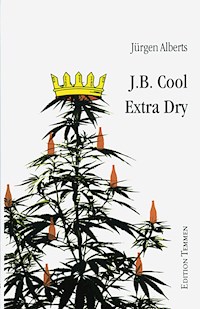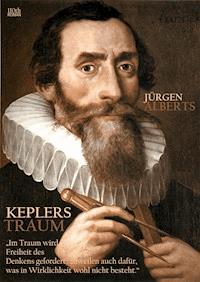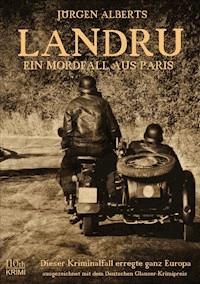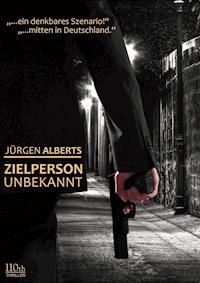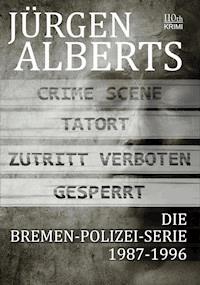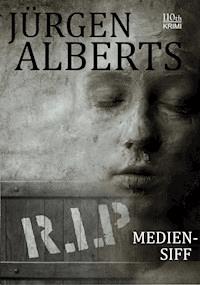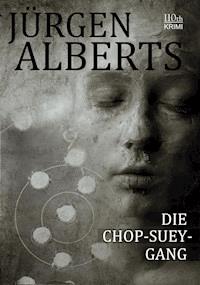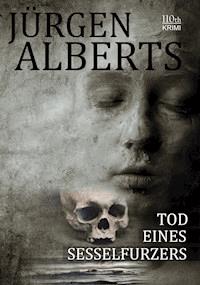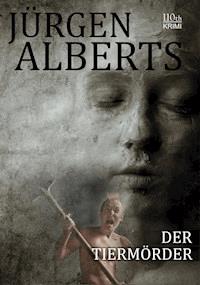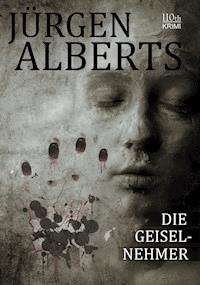3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Während Clas Lutter, Journalist aus Tübingen, im Urlaub mit Freunden den Palio, das berühmte Pferderennen in Siena, verfolgt, verschwindet der Bruder seines Chefs, Mitinhaber eines Medienkonzerns, spurlos aus einer Villa in der Toskana. Die Polizei tippt auf die Roten Brigaden oder sardische Banditen. Doch die mutmaßlichen Entführer schweigen ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Ähnliche
Jürgen Alberts | Marita Alberts
Entführt in der Toskana
Kriminalroman
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Für wenige Minuten verschwand die Sonne hinter dem hohen Campanile der Villa, der Schatten gab den Blick auf die Terrasse frei, weißer Marmorboden, in den ein goldener Löwe mit einem blauen Schwert eingelassen war, das Wappen eines früheren Besitzers, zu beiden Seiten schmiedeeiserne Gitter, an denen Wein rankte, zwei Sitzgruppen mit weißlackiertem Gartengestühl, in der Mitte ein langer Glastisch.
Es war kurz nach vier, als er die breite Terrassentür auseinanderschob. Die schwarze Badehose saß knapp. Mit großen Schritten ging er zum Eisschrank, der in die Außenwand eingelassen war. Er nahm ein gekühltes Glas, ließ ein paar Eisstücke hineingleiten, dann träufelte er ein wenig Zitrone darüber und goß die grellrote Flüssigkeit aus der Campari-Flasche ins Glas. Mit einem langen Löffel rührte er um. Er stemmte den rechten Arm in die Seite und leerte den Campari in einem Zug.
Die Sonne überflutete wieder die Terrasse.
Zeit zum Training.
Er stellte das Glas auf den Tisch und lief zum Pool, der ein paar Treppen tiefer in einer Mulde lag. Fünfundzwanzig Meter blaues Wasser, zwei Bahnen nebeneinander.
Er machte einen Kopfsprung und begann seine Übungen.
Sie hatten ihn Il Ricco genannt, weil sie seinen richtigen Namen nicht kannten. Auch heute hielt er sich an seinen Zeitplan. Mit langen Zügen und hoher Schlagzahl kraulte er bis zwei Meter vor der Wende, dann tauchte er, um unter Wasser die Richtung zu wechseln.
Sein behaarter Körper glitt über die Oberfläche, schon hatte er die ersten zehn Bahnen hinter sich.
Eine halbe Stunde später verließ er das Trainingsbecken, schüttelte sich das Wasser aus den Ohren und rieb sich mit einem weißen Handtuch trocken.
Il Ricco sah zufrieden aus, blickte auf das Wasser, dann zur Villa hoch.
Er schlang das Badetuch um seine Hüften und zog die schwarze Badehose aus, rollte sie zusammen wie einen Knebel und preßte das Wasser heraus.
Il Ricco nahm die vier Treppenabsätze in schnellen Sprüngen, bis er wieder auf der Terrasse stand.
Im vollen Sommerlicht.
Der weiße Marmor reflektierte und ließ die Härchen an seinem Körper weiß erscheinen.
Seit zwei Wochen beobachteten sie ihn, versteckt im Gebüsch, in der Macchia des gegenüberliegenden Hügels, notierten seine Gewohnheiten, nahmen die Zeit, als seien sie Schwimmtrainer. Il Ricco war ihnen vertraut.
Mit einer kräftigen Bürste striegelte er sein volles Haar, dann setzte er die kreisrunde Hornbrille auf, ließ sich in einen Stuhl fallen, nachdem er das Badetuch fester um seine Hüften geknotet hatte.
Der Stapel Zeitungen, der auf einem weißen Hocker lag, rutschte herunter, als er mit dem Fuß dagegen stieß.
Il Ricco fluchte vernehmlich, in einer fremden Sprache.
Er ließ die Zeitungen liegen, ging zum Eisschrank und wiederholte das Campari-Ritual.
Die drei Männer, die ihn mit Feldstecher und Stoppuhr observierten, waren irritiert.
2
Der Kanonenschuß hallte über die Piazza del Campo in Siena, die Tauben flüchteten in hellen Scharen. Carabinieri begannen, die Rennbahn zu räumen, in gemächlichem Gang schoben sie die Zuschauer in den Innenraum, der jetzt schon überfüllt war. Hinter ihnen fegten Helfer in grauen Kitteln mit langen Besen die Lehmbahn. Der erste Probelauf für den Palio stand bevor, das ungewöhnliche Pferderennen auf dem schönsten Platz Italiens. Wie eine geöffnete Muschel lag die Piazza schräg abfallend zum Rathaus hin.
Clas Lutter kletterte auf den Brunnen am oberen Ende des Platzes, von wo aus er schon frühere Rennen verfolgt hatte. Er sah Ilaria, die mit ihren Freunden über die Gewinnchancen von Lupa diskutierte. Lu-pa, Lu-pa, schallten erste Sprechchöre. Seit Jahren hoffte Ilaria auf einen Sieg ihrer Contrada. Die alten Stadtteile von Siena, die man Contrada nannte, traten in diesem Pferderennen gegeneinander an.
Clas Lutter entschied sich in jedem Jahr neu, liebte das Spiel mit den Außenseitern, er setzte diesmal auf die Schnecke, Contrada della Chiòcciola.
In den sechs Jahrhunderten, seit der Palio in Siena ausgetragen wurde, soll es nur drei Tote gegeben haben. Clas Lutter hielt das für eine Zwecklüge, um die anreisenden Touristen nicht allzu sehr zu erschrecken. Schließlich verkaufte man ihnen die Plätze rings um die Piazza del Campo für teures Geld. Drei Tote waren gerade genug Nervenkitzel.
Die Rennbahn, mit gestampftem Lehm ausgelegt, ein steigendes und fallendes Oval, hatte ihre Tücken. Die zehn Reiter mußten sie dreimal umrunden, mußten versuchen, sich nicht an die mit Matratzen verkleideten Holzbarrieren drängen zu lassen. Sie hatten Ochsenziemer und schlugen damit auf die Gegner ein. Natürlich mußten sie gewinnen. Jeder von ihnen. »Geh heim und kehre als Sieger zurück«, so lautete der Schlußsatz des Priesters, der am Morgen Pferd und Reiter in der Pfarrkirche der Contrada segnete. Aber das sagten alle zehn Priester.
In der Mitte der aufgeklappten Muschel wurden die ersten Zuschauer ohnmächtig, Angehörige und Umstehende schrien nach Helfern des Roten Kreuzes.
Clas Lutter fühlte sich wohl. Von seinem Platz am Brunnenrand sah er die drängelnden Zuschauer, die Fahnen schwenkten, die Namen ihrer Contrada skandierten, O-ca, O-ca, die wütende Gesänge anstimmten, Tor-re, Tor-re, die drohend die Fäuste schwangen, Lu-pa, Lu-pa. Seit Jahren ließ Clas Lutter kein Rennen aus, ganz gleich, ob er dafür die Nacht von Tübingen nach Siena durchfahren mußte, ob er einen Tag unbezahlten Urlaub in der Redaktion riskierte, ganz gleich, was seine spöttelnden Kollegen sagten, wenn er wieder mal ein Souvenir-Fähnchen über seinen Schreibtisch hängte.
Palio, das war für ihn eine körperliche Sensation, eine gewaltige Anspannung, eine nicht enden wollende Aufregung.
Manchmal hatte ihn sein Freund Lionello, der an der Universität von Siena Ökonomie unterrichtete, dorthin begleitet, hatte ihn sehen gelehrt: die Gesichter der Sienesen nach Sieg oder Niederlage, die gespenstischen Fratzen bei nächtlichen Feiern, die stolz lächelnden Fantini, die ohne Sattel auf ihren Pferden saßen. Aber oft hatte Lionello ihn auch allein ziehen lassen, dringende Arbeiten vorgeschützt.
Clas Lutter wollte über den Palio schreiben, hatte recherchiert, um ein Buch zu füllen, aber es war ein Plan geblieben. Er kannte Anekdoten, wie die, daß das Siegerpferd einen Ehrenplatz an der Festtafel erhielt und aus silbernem Geschirr gefüttert wurde; er kannte die Zahlen, jede Contrada gab etwa hunderttausend Mark aus, die eine Hälfte bekam der Reiter, die andere kostete die einwöchige Siegesfeier; er kannte die Stimmungen. Aber ihm fehlte die Distanz.
Als müßte er einen Fahneneid leisten, so andächtig hatte er einmal den Palio berührt, das Banner, für das die Reiter ihr Leben riskierten. Durch Ilarias Vermittlung war es ihm gelungen, in das Heiligtum der Contrada Tartaruga, der Schildkröte, einzudringen. Das Bild der Madonna in kitschigem Dekor, Sinnbild der Verehrung, Trophäe des Sieges, ein Banner der Emotion.
In diesem Jahr hatte er wieder seinen Urlaub so gelegt, daß er die zwei Probe-Rennen und das große Finale erleben konnte. Ein Urlaub, der ihm auch aus einem anderen Grund sehr gelegen kam: Der Lokalchef der ›Schwäbischen Nachrichten‹, für die er seit mehr als zehn Jahren arbeitete, war ausgewechselt worden. Versetzt auf einen anderen Posten in eine andere Stadt. Ein Mann, den er sehr schätzte und für den er sich bis zuletzt engagiert hatte. Der Konflikt war eine Nagelprobe für die gesamte Redaktion geworden. Der Lokalchef hätte die weitere Unabhängigkeit der Kommentare garantiert. Immerhin war Tübingen eine Universitätsstadt, und zur Leserschaft zählten Wissenschaftler und Studenten. Aber dieses Argument nutzte kaum in der Auseinandersetzung. Sie hatten den Kampf verloren. Der neue Mann, der aus dem Norden der Republik kam, sorgte bei seinem Einstand für klare Linien. »Wir werden viel Salz miteinander essen, meine Damen und Herren! « hatte er während des kleinen Sektempfangs gesagt.
Clas Lutter freute sich, daß sein jährlicher Ausflug nach Siena nun nicht als Flucht gedeutet werden konnte.
Sein hellblonder Wuschelkopf überragte die meisten Umstehenden; er hatte Mühe, sich nicht vom Brunnenrand drängen zu lassen.
Der zweite Kanonenschuß, die Tauben flatterten hinauf bis zur Torre del Mangia.
Clas Lutter half Ilaria, den Brunnen zu erklimmen. Einen Moment kamen sie sich nahe. Clas Lutter spürte ihre Wärme. Die backsteinernen Palazzi, vor denen Tausende von Zuschauern auf Holzbänken saßen, lagen jetzt im Schatten. Eine merkliche Abkühlung.
Die Gesänge verstärkten sich. Torre, Torre, Lupa, Lupa.
Immer wieder rannten die Sanitäter mit der Trage aus der Erste-Hilfe-Station.
Schreie.
Toben.
O-ca, O-ca, die lautstarke Anhängerschaft der Contrada Gans, die bisher die meisten Siege errungen hatte.
Fast zwei Stunden hatte Clas Lutter gewartet, erst ruhig, dann langsam aufgeregter, angespannt.
Jetzt läuten die Glocken vom Rathausturm.
Die Pferde kommen.
Die Fantini in ihren bunten Kostümen, in den Farben der Contrada, für die sie reiten. Schon lange gibt es keine Reiter aus Siena mehr, denen traut man nicht. Wenn man jemand in Siena nicht traut, dann sagt man, er sei ein Fantino. Die Reiter kommen aus Sardinien.
Die Barbareschi, Stallmeister und Bewacher zugleich, führen die Pferde auf die Rennbahn.
Ohrenbetäubender Lärm.
Zwei Hanfseile werden gespannt.
Jetzt werden die Ochsenziemer verteilt.
Es gibt eine Prügelei.
Schon vor dem Start.
Und im Publikum.
O-ca, O-ca.
Tor-re, Tor-re.
Das Rennen ist gestartet.
Die Schnecke kommt am besten weg.
Macht die erste Runde fast allein.
Aber die Gans kommt heran.
Und auch der Turm. Tor-re, Tor-re.
In der Kurve von San Martino passiert es.
Dick mit Matratzen gepolstert.
Der Fantino der Gans wird gegen die Bande geschleudert.
Abgedrängt.
Weggestoßen.
Madonna.
Ein Peitschenhieb hat genügt.
Nach drei Minuten ist alles vorbei. Die Contrada Leocorno, das Einhorn, hat gewonnen.
Aber jetzt beginnt der Kampf erst.
Wie ein Sturzbach strömen die Zuschauer aus dem Innenraum auf die Rennbahn, es wird gerangelt, gekämpft, gerannt.
Ein Sturm der Aggression.
Wie immer warteten Clas Lutter und die Freunde, bis der erste Schwall von Zuschauern den Platz verlassen hatte. Vor Jahren war ihm einmal im Gedränge ein Arm ausgekugelt worden, und er spürte kein Verlangen nach Wiederholung.
Ilaria war sauer, weil Lupa, die Wölfin, mal wieder unter den letzten war.
Würde das Einhorn auch eine Chance im Finale haben? Es war oft so, daß die Sieger der Proberennen im Hauptrennen besonders scharf angegangen wurden.
Die Diskussionen nahmen kein Ende.
Mit dem Einhorn hatte niemand gerechnet.
Clas Lutter hörte es als erster in der Gruppe.
Der Reiter von Oca hatte sich zu Tode gestürzt.
3
Josef M. Bock schloß den Wagen ab, überprüfte sorgfältig die Seitentüren. Er stand auf dem kleinen Platz von Monteriggioni, einem Ort mit einer Burg aus dem 13. Jahrhundert, die schon Dante in seinem ›Inferno‹ beschrieb, dort soll eine »Höllenschlacht der Giganten« getobt haben. Auch das Restaurant ›Il Pozzo‹ in der Mitte der Festungsanlage verdankte seinen Namen Dantes Gesängen.
Der Wirt war etwas überrascht, als Josef M. Bock in die Vorhalle trat. »Buon giorno«, Bock sprach geläufig Italienisch, »ich suche meinen Bruder.«
»Ah, mio amico, si, si.«
Der Wirt führte ihn an einen Tisch am Ende des niedrigen Lokals.
»Ich hatte dich erst heute abend erwartet«, Franz Bock blickte kurz von seinen Spaghetti alla cinghiale auf.
Der Wirt sah die beiden Brüder an. Josef M. Bock bestellte einen offenen Chianti.
Als der Wirt sich entfernt hatte, sagte Josef: »Ich habe eine Maschine früher genommen – es wird dir ja nichts ausmachen.«
Er war fünf Jahre jünger als sein Bruder, hatte gerade die runde Fünfzig erreicht. Sie hatten sich nicht gesehen, seit er in den USA die internationale Division des Konzerns aufbaute. Und das war fast zwei Jahre her.
»Julia kommt erst heute abend, ich denke, es ist besser, wenn sie …«, Franz Bock legte den Löffel zur Seite, nahm einen Schluck Wasser.
Der Wirt brachte den Rotwein, goß ihn vorsichtig ins Glas. Josef probierte, er war zufrieden. Seitdem er vor Jahren die Zentrale in Rom verlassen hatte, bekam er nur selten einen solchen Wein zu trinken.
Die beiden Brüder schwiegen.
Josef bestellte auch eine Portion Spaghetti mit Wildschwein.
»Wie war der Flug?« Franz begann das Gespräch.
»Ganz gut. Ich habe etwas schlafen können.«
»Also – ausgeschlafen?«
»Ich fühle mich gut.«
Josef leerte sein Glas, ohne seinen Bruder aus den Augen zu lassen.
»Ich denke, Julia wird gegen fünf Uhr ankommen, lassen wir ihr etwas Zeit, und dann können wir meinetwegen beginnen. Was meinst du?«
Josef nickte.
Das Restaurant hatte das Flair eines herrschaftlichen Eßzimmers, weiße Decken, viel Silber und Glas auf dem Tisch, die Wände dezent mit Ölbildern dekoriert – toskanische Landschaften, unverwechselbar mit ihren schwarzen Ausrufezeichen. Zypressen, die einzigen Bäume der Welt, die wußten, wo sie für ein perfektes Bild zu stehen hatten.
»Du hast dich nicht verändert, Josef.«
»Ich hab gerechnet, es sind zweiundzwanzig Monate, seit wir uns nicht mehr gesehen haben.«
»Eine lange Zeit.«
Franz Bock stand auf.
»Du entschuldigst.«
Josef lächelte. So hat er es immer gemacht, dachte er, wenn Franz mich nicht aushält, verschwindet er auf der Toilette.
Der Wirt kam und stellte die Nudeln auf den Tisch.
Sie unterhielten sich. Dieses Jahr waren wieder mehr Touristen gekommen, dem Wirt war es recht, obwohl er die Versuchung spürte, sie billiger abzufüttern. Dieses Jahr war ein besonders guter Wein zu erwarten. Da mußte man zugreifen. »Si, si, mio amico.« Der Bruder aß jeden Mittag hier. Der kleine Wirt lachte.
Franz Bock kam zurück.
»Mio amico.« Der Wirt stellte sich neben ihn, er war einen Kopf kleiner, beide hatten dunkelblondes Haar. Josef konnte sich nicht vorstellen, daß auch Franz sich als Freund des Wirtes bezeichnen würde. Dazu ging er zu sehr auf Distanz.
»Wie sind die Spaghetti?« Franz nahm wieder Platz.
»Meravigliosi.« Josef M. Bock strahlte.
Dann schwiegen sie wieder.
Manchmal trafen sich ihre Blicke. Sie hielten es einige Sekunden aus, dann wandte einer von ihnen den Kopf.
»Ich bin hier Stammgast«, sagte Franz Bock.
»Ja, der Wirt lobt dich, du seist ein guter Esser.«
»Ich werde ihm nachher sagen, er soll für das Nachtessen etwas Besonderes auftischen …«
»Werden wir dazu Zeit haben?« unterbrach ihn Josef.
»Essen müssen wir.«
Er will eine Pause einplanen, dachte Josef, Verhandlungsstrategie.
Josef M. Bock nahm seine dünne Ledermappe, zog den Reißverschluß auf und holte einige Blätter heraus.
»Hier, da kannst du dich hineinvertiefen, bis heute nachmittag.«
»Was ist das?« Franz Bock griff nicht nach den Blättern, die Josef ihm hinhielt.
»Ein Konzept für eine neue Zeitschrift. Das soll ein Verhandlungsergebnis sein, wenn ich wieder abreise.«
»Josef«, Franz Bocks Stimme veränderte sich, »ich denke, wir sollten heute abend, wenn Julia bei uns ist … so hatten wir es am Telefon vereinbart.«
»Aber du mußt es sowieso lesen. Warum nicht jetzt?«
»Weil ich jetzt esse. Ich warte auf den Fisch.«
Franz Bock tupfte sich den Mund ab, bevor er wieder einen Schluck Wasser nahm.
Josef hielt ihm die Blätter hin. Er hatte sich dieses Konzept von einem amerikanischen Journalisten ausarbeiten lassen, obwohl es eine deutsche Zeitschrift werden sollte. Eine Zeitschrift, in der offene Diskussionen über all die Themen geführt werden sollten, die sein Bruder bereits auf die schwarze Liste gesetzt hatte; eine Zeitschrift, in der die intellektuelle Opposition der Republik mit den Konservativen streiten konnte, in der prononcierte Meinung mehr galt als die Wiederholung von Ja-Sager-Argumenten. Er wollte dieses Projekt bei seinem Bruder durchsetzen, sonst würde er überlegen, seinen Anteil aus dem Konzern herauszuziehen.
»Hättest du das Konzept nicht schicken können?«
»Es ist gerade erst fertig geworden.«
Franz Bock nahm ihm die Blätter aus der Hand. Er holte seine Hornbrille aus der vorderen Tasche seines hellgrauen Baumwollhemds und begann zu lesen.
Als der Wirt die Forelle brachte, kannte Franz Bock das Konzept in groben Zügen.
»Was meinst du?« fragte Josef.
»Ich esse erst einmal.«
»Laß es dir schmecken.«
Josef goß sich zum dritten Mal Rotwein nach.
Er stand auf und beriet mit dem Wirt, was er als Secondo nehmen könnte. Er entschied sich für Kalbfleisch in Weinsoße mit frischen Kapern.
Aus einiger Entfernung sah er seinen Bruder essen. Er hatte das Konzept neben seinen Teller gelegt und las zum wiederholten Male.
Die Überraschung war gelungen.
Wenn Julia erst da war, dann würde Franz sich herausreden, würde Vorwände suchen, die Entscheidung zu vertagen, würde Bedenkzeit erbitten, so wie es ihm bisher gelungen war, seine Hauspolitik trotz massiver Kritik durchzusetzen.
»Jetzt hast du genug gegessen und gelesen. Also, was ist mit deiner Meinung?« Josef setzte sich an den Tisch. Die weiße Tischdecke hatte einige Flecken abbekommen.
»Ich brauche Zeit, Josef.«
»Die haben wir nicht mehr.«
Dann begann der Streit.
Josef M. Bock wurde als erster laut. Seitdem Franz sich allein um den deutschen Markt kümmere, habe das internationale Renommee des Medienkonzerns gelitten. Ständig werde er darauf angesprochen, ob man in der Bundesrepublik nichts vom modernen Management verstehe, führende Journalisten hätten sich im Ausland über den Bock-Konzern und dessen rüde Methoden in der Personalpolitik beschwert. Die antiliberale Ausrichtung der Blätter sei in Tokio und Sydney bemerkt worden, der neue Konservatismus als Rückfall ins neunzehnte Jahrhundert, Franz solle nicht glauben, daß die ausländischen Partner das nicht genau registrierten. »Man wirft uns vor, daß wir mal wieder ordnungsstaatliche Vorstellungen praktizieren. Ich muß dich ständig in Schutz nehmen, obwohl ich nicht deiner Meinung bin.«
Franz Bock erinnerte ihn daran, daß sie sich die Aufgaben im Konzern geteilt hätten, weil sie nicht zusammenarbeiten konnten. Alte Rechnungen – persönliche Auseinandersetzungen, er wolle das nicht unerwähnt lassen. Was die Ausrichtung des deutschen Marktes angehe, um den er sich seit der Abmachung zu kümmern habe, da hätten die ausländischen Partner nicht hineinzureden, die Absatzzahlen gäben ihm recht, kein Objekt habe in den zwei Jahren Einbußen erlitten. »Mir ist vorgeworfen worden, ich würde den Konzern ›säubern‹. Gut, wenn das andere so sehen. Aber ich sage dir, die Jahre der Schaukelpolitik sind vorbei, und zwar auf lange Zeit. Die Leser erwarten von uns eine klare Linie. – Was diese superkritischen Kläffer von sich geben, interessiert nicht, so wie du in deinem Konzept für die Zeitschrift …«
Der kleine Wirt stand neben ihrem Tisch, legte den Finger auf den Mund. Aber die Brüder waren nicht zu bremsen.
»Du weißt genau, was das bedeutet, Franz, und du willst den Bruch.«
»Ich will überhaupt keinen Bruch, ich sehe nicht ein, warum du dich nicht an unsere Abmachungen hältst – du hast den internationalen Markt zu organisieren, hast freie Hand auf der ganzen Welt – und ich kümmere mich um den deutschen Markt. Das ist Vertrag.«
»Ich werde meine Anteile aus dem Geschäft lösen.«
»Das wird nicht gehen.«
Franz Bock war aufgesprungen.
Josef versuchte, ruhig zu bleiben.
»Natürlich wird das gehen. Ich lasse mich doch nicht wie einen Idioten behandeln von dir. Die Branche lacht über uns, weil wir so rückständig sind, und du gibst ihr allen Grund dazu.«
»Sie können lachen, ist mir egal. Ich sehe auf die Zahlen, denn die bringen die anderen aus der Fassung.«
Der Wirt versuchte es ein zweites Mal: »Mio amico, per favore …«, aber Franz Bock stieß ihn zur Seite.
Josef schrie: »Du bleibst hier!«
Mit ein paar schnellen Schritten war der Bruder aus dem Restaurant geeilt. Sofort setzte an den Nebentischen Gemurmel ein. Die Gäste sahen neugierig auf Josefs stark gerötetes Gesicht. Der Wirt hob resignierend die Schultern.
Nachdem Josef die Karaffe geleert hatte, bestellte er die Rechnung.
Der Wirt sagte nur: »Mein Freund braucht nicht zu zahlen.«
Sein Gesichtsausdruck war ernst.
Erschöpft stieg er die Eisenleiter hoch.
Dann sah er die weißglänzende Terrasse, in deren Mitte ein Mann stand, das Gesicht mit einer Wollmütze verhüllt.
Im gleichen Moment traf ihn ein Schlag auf den Solarplexus, genau gezielt, er sank zusammen, spürte die Sinne schwinden. Versuchte, sich gegen die Ohnmacht zu wehren.
Jemand drehte seinen Arm um.
Schmerzhaft.
Wenn er doch nur die Brille aufhätte. So sah er alles nur verschwommen.
Die Hände wurden auf dem Rücken mit einem Klebeband verschnürt, das ins Fleisch schnitt.
Ein Knebel in den Mund gepreßt.
Es mußten drei Männer sein, vielleicht vier, mit dem Mann auf der Terrasse.
Die Augen wurden verklebt.
Schwanken zwischen Bewußtsein und Ohnmacht.
Sie hoben ihn auf die Füße, aber er ließ sich fallen.
Er mußte daran denken, was ein Freund ihm geraten hatte: am besten nicht wehren.
Sie schleiften ihn über den Rasen, untergehakt.
Jemand ging hinter ihm.
Drei Männer, also doch.
Er hatte sich nicht gewehrt, hatte keine Chance gehabt.
Eine Autotür wurde aufgeklappt.
Warum hab ich mich nicht gewehrt.
Das Schwimmen hatte ihn ermüdet.
Wenn ich sie gesehen hätte.
Dann verlor er das Bewußtsein.
4
Es war ein Rausch, ein ständiges Bewegtsein, ein Taumel, Clas Lutter hatte zwanzig Stunden hintereinander gearbeitet: Der Tod des Fantino bewegte ihn.
Er hatte Bilder besorgt, nicht nur von den drei ständigen Fotografen, die von jedem Rennen Bilder schossen, die dann auf dem Corso tagelang ausführlich von den Sienesern diskutiert wurden; Lionello hatte ihm einige Amateurfotos beschafft. Auch Ilaria ließ sich einspannen, um Bilder und Informationen zu besorgen. Soviel stand fest: Der Fantino von Torre hatte zwei gezielte Schläge auf dem Oberkörper seines Gegners gelandet und ihn dann mit der Hinterhand des Pferdes an die Bande gedrückt. Der Ochsenziemer als Mordinstrument.
Clas Lutter schrieb. Besessen von der Geschichte. Als hätte es dieses Unfalls bedurft. All die Jahre, die er nur Zuschauer war, konzentriert in diesen zwanzig Stunden. Er bemerkte nicht, daß Ilaria mitten in der Nacht abfuhr, noch daß sich Lionello gegen fünf Uhr morgens zum Schlafen zurückzog. Wieder und wieder änderte er den Text, formulierte Bildunterschriften, riß Seiten aus der Maschine. Er wollte alles zusammen haben.
Eine komplette Geschichte.
Seine Geschichte.
Gegen Mittag begann er zu telefonieren.
Er kannte seit Jahren einen Kollegen bei einer großen Illustrierten, dem er dieses Stück anbieten wollte.
Zwei Stunden später hatte er ihn am Apparat.
Clas Lutter sprudelte die Geschichte hervor: »Der Tod des Fantino Vicario Barbero …«, er las Passagen aus dem Text, hektisch, dann stockend, um eine Reaktion zu erspüren.
Hillermayer sagte: »Schön, das ist schön geschrieben. Wie sind die Bilder? Wir leben ja von den Bildern.«
Lutter freute sich: »Kann ich nach München bringen, ich fahre gleich los.«
Es entstand eine Pause.
Hillermayer räusperte sich: »Nein, warte, es ist besser, du wendest dich direkt an unseren Korrespondenten in Rom, dafür sind die ja da, ich kann den nicht übergehen.«
Gegen vier Uhr nachmittags hatte Clas Lutter den Korrespondenten am Telefon.
Immer wieder hatte die Sekretärin ihn vertröstet: noch nicht im Büro, gerade mal rausgegangen, jetzt zu Tisch, noch nicht wieder zurück, es ist gerade nicht möglich, ja, jetzt ist er da.
»Ha i au scho ghört«, sagte er.
Clas Lutter stellte sich den Korrespondenten vor, ein ruhiger Schwabe, der gut gegessen hatte, gut getrunken, nur noch mal in die Redaktion gekommen war, um zu sagen, daß er heute nichts mehr schaffen wolle.
Er versuchte, ihn zu beeindrucken. Erzählte, wie der Fantino Vicario Barbero zu Tode gekommen sei und was er für irrsinnige Bilder dazu liefern könne.
»I mueß erscht mol Rücksproch halte«, sagte der römische Korrespondent, »rufet Sie mi morgen ahn. Gege elf bin i meischt in dr Redaktion. Friher häts koi Zweck, gell.«
»Aber wenn es noch in die nächste Ausgabe soll …«
»Herr Lutter, i woiß ja net mol, ob des guet is, was Sie gschrieben hent.«
Wütend warf Clas Lutter den Hörer auf die Gabel.
Lionello lehnte an der weißgekalkten Wand. In seinem breiten neapolitanischen Akzent sagte er: »Clas, laß doch diese Ärsche, die fühlen nichts mehr.«
Clas Lutter wollte die letzten Stunden nicht umsonst gearbeitet haben, aber direkt nach München fahren, der Preis schien ihm zu hoch.
Lionello, der den ganzen Nachmittag geschlafen hatte, das stoppelige Gesicht voller Schlaffalten, wollte ihn hinfahren. Aber sie wären erst kurz nach Mitternacht angekommen. Sommerzeit, nur die Hälfte der Redaktion wäre anwesend, vielleicht war der verantwortliche Redakteur gar nicht da.
Gegen sechs Uhr gab er den Plan auf, die Geschichte über Vicario Barbero in der Illustrierten unterzubringen. Clas Lutter packte die sauber abgetippten Seiten und die Fotos in einen großen Umschlag.
Immerhin hatte es ihm Spaß gemacht.
Den Kollegen von den ›Schwäbischen Nachrichten‹ wollte er nichts davon erzählen.
Die schwere Limousine glitt schnell über die Superstrada. »Ach Italien, ich hätte doch schon früher kommen sollen«, Julia sah aus dem Fenster.
Drei Stunden Verspätung hatte der Flieger gehabt, Franz Bock fluchte auf die italienischen Verhältnisse. Der kleine Flughafen Peretola in Florenz besaß nicht mal ein Restaurant, und es gab keine Auskunft darüber, wann denn endlich die Maschine aus Mailand eintreffen würde. Er hatte Zeit genug gehabt, über den Vorschlag seines Bruders nachzudenken. Das Konzept, mit dem er ihn überrascht hatte, war eine Provokation, das stand fest. Eine Zeitschrift als Forum für Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler, populär aufgemacht mit hoher Verbreitung. Die sollen ihre Meinung lieber für sich behalten, dachte er. Aber es ging Josef gar nicht um die neue Zeitschrift, das Ganze war ein Manöver, um auszuprobieren, wieviel Einfluß er im Konzern hatte. Für Franz Bock gab es nur eine Haltung dazu, er wollte diese Provokation benennen und selbstverständlich ablehnen.
»San Gimignano, da fahren wir auch wieder hin«, Julia streichelte seine Hand, »die Stadt mit den Türmen, wo sich die Familien gegenseitig übertreffen wollten. Wer kann den höchsten Turm bauen lassen!«
Der Medienkonzern Bock hatte seinen Anfang in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts genommen, als Emil Bock einen Generalanzeiger in Aachen gründete – eine Zeitung für die Massen, mit Anzeigen und Boulevardgeschichten. Die Auflage wuchs von Woche zu Woche. Sein Sohn Johannes erweiterte in den zwanziger Jahren das Unternehmen zu einem Konzern mit papier- und holzverarbeitenden Betrieben, zu dem bereits vier große Zeitungen gehörten, aber ebenso Buchverlage und Anzeigenblätter. Rechtzeitig hatte Johannes seine Blätter braun gefärbt, noch vor der Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten. Seinen Söhnen Franz und Josef gab er den Rat, sich nur in geschäftlichen Dingen auf Risiken einzulassen, niemals in politischen Fragen. Als er Anfang der fünfziger Jahre starb, wurden die Anteile der Familie je zur Hälfte auf die Brüder verteilt, die noch kaum Erfahrungen besaßen. Sie gingen geschäftliche Risiken ein, und so verlor der Bock-Konzern nach und nach die meisten Unternehmen, die nichts mit der Presse zu tun hatten. Der eigentliche Aufstieg begann, als der Bedarf an Buntbedrucktem und Feierabendlektüre immer größer wurde.
»Wie ist es dir denn ergangen in diesen drei Wochen ohne mich?« Julia lachte ihn an. »Du bist so schweigsam. Oder ist es das Gespräch mit Josef, was dir Magendrücken bereitet?«