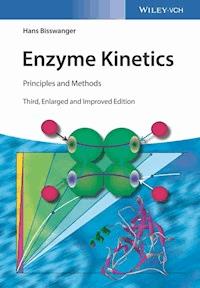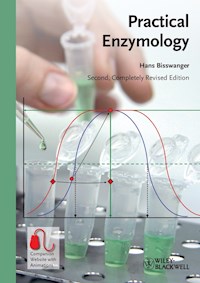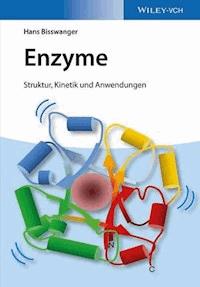
46,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Hans Bisswanger präsentiert eine zugängliche Einführung in ein Gebiet, das zu den traditionellen Angstfächern der Studenten der Naturwissenschaften gehört. Kein anderes Buch bietet eine leichter verständliche Einführung in die Enzymkinetik und die verschiedenen Enzymfamilien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Decken
Titel
Autor
Impressum
Vorwort
Zusatzmaterial: Power-Point Animationen
Abkürzungen
1: Einleitung
1.1 Historische Entwicklung und Bedeutung der Enzyme, ein Überblick
1.2 Wie sind Enzyme entstanden?
1.3 Ribozyme
1.4 Weiterführende Literatur über Enzyme
1.5 Literatur
2: Struktur der Enzyme
2.1 Primärstruktur
2.2 Sekundärstruktur
2.3 Tertiärstruktur
2.4 Quartärstruktur
2.5 Verlauf der Proteinfaltung
2.6 Katalytisches Zentrum und Coenzyme
2.7 Literatur
3: Enzymklassen, Enzymnomenklatur
3.1 Klasse 1: Oxidoreduktasen
3.2 Klasse 2: Transferasen
3.3 Klasse 3: Hydrolasen
3.4 Klasse 4: Lyasen
3.5 Klasse 5: Isomerasen
3.6 Klasse 6: Ligasen
3.7 Literatur
4: Allgemeine Eigenschaften von Enzymen, Enzymtests
4.1 Woran erkennt man ein Enzym?
4.2 Wie werden Enzyme getestet und was ist dabei zu berücksichtigen?
4.3 pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität
4.4 Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität
4.5 Abhängigkeit der Enzymaktivität von der Ionenstärke
4.6 Allgemeine Regeln für Enzymtests
4.7 Aufbewahrung von Enzymen
4.8 Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten mit Enzymen
4.9 Vorgehensweise beim Enzymtest
4.10 Auswertung von Enzymtests, Enzymeinheiten
4.11 Wie bestimmt man die Umsatzgeschwindigkeit von Enzymen?
4.12 Vom Einzelnachweis zum Massentest
4.13 Statistische Behandlung von Daten aus Enzymuntersuchungen
4.14 Literatur
5: Methoden für Enzymuntersuchungen
5.1 Optische Methoden
5.2 Elektrochemische Methoden
5.3 Methoden zur Messung schneller Reaktionen
5.4 Literatur
6: Enzymisolierung
6.1 Wie gewinnt man Enzyme?
6.2 Wie reinigt man Enzyme?
6.3 Fällungsmethoden
6.4 Ultrafiltration und Dialyse
6.5 Zentrifugation
6.6 Säulenchromatografische Methoden
6.7 Elektrophoretische Methoden
6.8 Literatur
7: Ligandenbindung
7.1 Wie findet das Substrat sein Enzym?
7.2 Worauf beruht die Stärke einer Bindung und wie kann man sie quantifizieren?
7.3 Formulierung der Bindungsgleichung
7.4 Wie misst man die Ligandenbindung?
7.5 Literatur
8: Kinetische Behandlung von Enzymreaktionen
8.1 Reaktionsordnung
8.2 Michaelis-Menten-Gleichung
8.3 Rückreaktion
8.4 Literatur
9: Enzymhemmung
9.1 Kategorien der Enzymhemmung
9.2 Reversible Enzymhemmung
9.3 Literatur
10: Mehrsubstratreaktionen
10.1 Darstellungsweise von Mehrsubstratreaktionen
10.2 Die verschiedenen Mechanismen der Mehrsubstratreaktionen
10.3 Analyse von Mehrsubstratreaktionen
10.4 Literatur
11: Allosterische Enzyme
11.1 Grundlagen der Kooperativität
11.2 Symmetrie-Modell und allgemeine Betrachtungen zu allosterischen Enzymen
11.3 Sequenz-Modell und negative Kooperativität
11.4 Kinetische Kooperativität, das Slow-Transition-Modell
11.5 Literatur
12: Passgerechte Enzyme: Immobilisierung, Enzymreaktoren und künstliche Enzyme
12.1 Immobilisierung von Enzymen
12.2 Enzymreaktoren
12.3 Künstliche Enzyme
12.4 Literatur
13: Enzyme im praktischen Gebrauch
13.1 Enzyme in der Industrie
13.2 Enzyme in Medizin und Therapie
13.3 Literatur
14: Ausblick
14.1 Literatur
Sachverzeichnis
End User License Agreement
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
cover
contents
ii
iii
iv
xi
xii
xiii
xv
xvi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Yeh, W., Yang, H., McCarthy, J.R.
Enzyme Technologies
Metagenomics, Evolution, Biocatalysis and Biosynthesis
2010
Print ISBN: 978-0-470-28624-1; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Copeland, R.A.
Enzymes
A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis 2. Auflage
2000
Print ISBN: 978-0-471-35929-6; auch in elektronischen Formaten verfügbar eMobi-lite ISBN: 978-0-470-23916-2
Bugg, T.D.
Introduction to Enzyme and Coenzyme Chemistry 3e
3. Auflage
2012
Print ISBN: 978-1-119-99594-4; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Garcia-Junceda, E. (Hrsg.)
Multi-Step Enzyme Catalysis
Biotransformations and Chemoenzymatic Synthesis
2008
Print ISBN: 978-3-527-31921-3; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Buchholz, K., Kasche, V., Bornscheuer, U.T.
Biocatalysts and Enzyme Technology
2. Auflage
2012
Print ISBN: 978-3-527-32989-2; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Cornish-Bowden, A.
Fundamentals of Enzyme Kinetics
4. Auflage
2012
Print ISBN: 978-3-527-33074-4; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Bisswanger, H.
Enzyme Kinetics. Principles and Methods
2. Auflage
2008
ISBN: 978-3-527-31957-2
Bisswanger, H.
Practical Enzymology
2. Auflage
2011
ISBN: 978-3-527-32076-9
Enzyme
Struktur, Kinetik und Anwendungen
Hans Bisswanger
Autor
Hans BisswangerInterfakultäres Institut für BiochemieHoppe-Seyler-Str. 472076 TübingenGermany
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-33675-3
ePDF ISBN 978-3-527-69585-0
ePub ISBN 978-3-527-69586-7
Mobi ISBN 978-3-527-69587-4
Vorwort
Das Wissen über Enzyme hat seit der Entdeckung der ersten Vertreter sprunghaft zugenommen. Zum einen stieg die Zahl der erforschten Enzyme beachtlich, nicht nur hinsichtlich der Vielfalt der katalysierten Reaktionen, sondern mehr noch durch ihre divergenten Erscheinungsformen in der Organismenvielfalt der Mikro-, Pflanzen- und Tierwelt. Zum anderen verfeinern die immer exakteren Methoden insbesondere der Strukturanalyse unsere Kenntnis von Struktur- und Funktionszusammenhängen bei Enzymen. Ein kurzes Lehrbuch kann daher kaum mehr als einen Überblick über die verschiedenen Aspekte, die für das Verständnis und das Arbeiten mit Enzymen wichtig sind, vermitteln. Für weitergehende und detailliertere Studien sind Literaturhinweise angegeben. Bei der Stofffülle ist auch die Auswahl der Schwerpunkte bis zu einem gewissen Maße willkürlich. Als vorrangig wird das Erfassen der Wirkungsweise von Enzymen gesehen und es wird eine komprimierte Einführung in Struktur und Katalysemechanismen gegeben. Im Weiteren werden die besonderen Aspekte herausgestellt, die beim Arbeiten mit Enzymen von Bedeutung sind: wie lassen sich Enzyme in reiner Form bekommen, wie behandelt man sie, was ist beim Enzymtest zu beachten, und welche hauptsächlichen Methoden eignen sich dafür. Schließlich wird darauf eingegangen, wie mit den Messergebnissen umzugehen ist und wie diese auszuwerten sind. Die Bedeutung von Bindungsvorgängen von Substraten, Cofaktoren und Regulatoren an Enzymen für Katalyse und Regulation der Enzyme wird diskutiert und geeignete Messmethoden besprochen. In einem weiteren Schritt wird die enzymatische Reaktion mit einbezogen und die Grundzüge der klassischen Enzymkinetik vorgestellt. Anhand der Enzymklassen werden die wesentlichen Reaktionstypen behandelt und an repräsentativen Enzymbeispielen charakteristische Eigenschaften von Enzymen diskutiert. Schließlich werden praktische Aspekte beleuchtet: Auf welche Weise können Enzyme technisch nutzbar gemacht werden und in welchen Bereichen der Industrie, der Medizin und der Therapie spielen Enzyme eine wichtige Rolle?
Soweit wie möglich wurde hinsichtlich Text und Abbildungen besonderer Wert auf leichte Verständlichkeit gelegt, was aber bei schwierigeren Themen wie der Enzymkinetik nicht immer konsequent durchzuhalten ist. Komplexere Abhandlungen wie Ableitung von Formeln, soweit sie nicht, wie die Michaelis-Menten-Gleichung, von zentraler Bedeutung sind, sind in Boxen ausgelagert, sodass der Leser, der nicht ins Detail gehen will, darüber hinweggehen kann, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Andererseits soll das dem Buch beigegebene Zusatzmaterial dazu beitragen, vor allem komplexere Sachverhalte anschaulicher darzustellen. In den Abbildungen wie auch im Zusatzmaterial wurde das Schwergewicht auf das unmittelbare Erfassen des jeweiligen Sachverhalts gelegt, gegebenenfalls unter Verzicht auf Detailtreue, wo diese für das Verständnis des eigentlichen Gegenstands entbehrlich ist. Dem trägt auch die Wahl der Sprache Rechnung. Zwar ist Englisch die inzwischen unangefochtene Wissenschaftssprache und viele Begriffe sind nur noch in dieser Sprache gebräuchlich, trotzdem ist es gerade für Einsteiger wichtig, sich einem neuen Gebiet voll widmen zu können, ohne durch sprachliche Barrieren behindert zu sein. Dort wo der englische Ausdruck üblich ist, wird dieser in Klammern ausgewiesen.
Bezüglich der Nomenklatur orientiert sich dieses Buch im Wesentlichen an den von der International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) herausgegebenen Richtlinien, doch finden sich in der einschlägigen Literatur oft andere Schreibweisen, die aber zumeist soweit einsichtig sind, dass es dem Leser beim Vergleich keine wesentlichen Probleme bereiten sollte.
Tübingen, Mai 2015
Hans Bisswanger
Zusatzmaterial: Power-Point Animationen
www.wiley-vch.de/home/EnzymeStrukturKinetik/
Praktische Hinweise zur Benutzung des Zusatzmaterials
Das Buch besteht aus zwei Teilen, dem gedruckten Text und dem Zusatzmaterial. Letzteres soll einzelne Themen des Buches anschaulich machen und vertiefen, es berührt nicht alle Themen des Textes. Der Buchtext mit seinen Abbildungen einerseits und das Zusatzmaterial andererseits können unabhängig voneinander studiert werden. Trotzdem sind im Text entsprechende Verweise auf die jeweiligen Folien des Zusatzmaterials, während dort für weitergehende Studien mit dem Symbol auf das Buch verwiesen wird.
Für die Nutzung des Zusatzmaterials wird eine Grundkenntnis im Umgang mit dem Power-Point-Programm vorausgesetzt. Die Bilder sind im Vorführungsmodus zu betrachten. Ein grüner Pfeil am linken unteren Bildrand zeigt an, dass mit der Maus- bzw. Cursortaste eine Animation auszulösen ist. Solange die Animation läuft, verschwindet der Pfeil und erscheint wieder zur Ausführung des nächsten Schrittes. Erscheint anstelle des Pfeils ein „X“, so ist das betreffende Thema abgeschlossen. Mit der Maus- bzw. Cursortaste wird dann das nächste Thema aufgerufen. Das Thema kann mit einer Folie enden oder aber über mehrere Folien gehen. Die Geschwindigkeit der Animationen ist derart eingestellt, dass diese gut verfolgt werden können. Beim ersten Betrachten mag das Tempo etwas rasch erscheinen, um alles genau aufzunehmen. Es besteht dann die Möglichkeit, in der Pause beim Erscheinen des grünen Pfeils durch Betätigung der Rückwärtstaste den Vorgang nochmals ablaufen zu lassen, sodass genügend Zeit bleibt, sich mit der Materie gründlich zu befassen. Grundsätzlich soll immer das Ende der Animation, also das Erscheinen des grünen Pfeils, abgewartet werden. Zu frühe Betätigung der Cursortaste überschlägt die laufende Animation und lässt unter Umständen das Folgende unverständlich erscheinen.
Abkürzungen
Gängige Abkürzungen wie ATP, NAD, DNA, wie auch Abkürzungen, die nur an der Stelle ihrer Definition gebraucht werden, sind nicht aufgeführt.
A, B, C…
Enzymsubstrate bzw. Enzymliganden
ACP
Acyl-Carrier-Protein
ACTase
Aspartatcarbamoyl-Transferase
ADH
Alkohol-Dehydrogenase
CM
Carboxymethyl
CoA
Coenzym A
DEAE
Diethylaminoethyl
GOD
Glucose-Oxidase
I
Hemmstoff (Inhibitor) eines Enzyms
k
Geschwindigkeitskonstante
k
cat
katalytische Konstante
K
A
Dissoziationskonstante des Substrats oder Liganden
K
d
Dissoziationskonstante
K
g
Gleichgewichtskonstante der Gesamtreaktion
K
i
Hemmkonstante
K
iA
Hemmkonstante des Substrats
K
ic
kompetitive Hemmkonstante
K
iu
unkompetitive Hemmkonstante
K
m
Michaelis-Konstante
K
P
Dissoziations- bzw. Hemmkonstante des Produkts
LDH
Lactat-Dehydrogenase
MDH
Malat-Dehydrogenase
P, Q, R…
Enzymprodukte
PAGE
Polyacrylamidgel-Elektrophorese
PALA
N
-Phosphonacetyl-L-Aspartat
PDH
Pyruvat-Dehydrogenase
PFK
6-Phosphofructokinase
P
i
anorganisches Phosphat
PLP
Pyridoxalphosphat
PMSF
Phenylmethylsulfonylfluorid
PP
i
anorganisches Diphosphat
RN
recommended name
, empfohlener Enzymname
SDS
Natriumdodecylsulfat
SN
systematic name
, systematischer Enzymname
SOD
Superoxid-Dismutase
ThDP
Thiamindiphosphat
THF
Tetrahydrofolat
TIM
Triosephosphat-Isomerase
v
Umsatzgeschwindigkeit
v
i
Anfangsgeschwindigkeit
V
bzw.
V
max
Maximalgeschwindigkeit
1Einleitung
1.1 Historische Entwicklung und Bedeutung der Enzyme, ein Überblick
Enzyme zählen zweifellos zu den wirkungsvollsten Substanzen dieser Erde. Zellen als Grundbausteine lebender Organismen enthalten eine Vielfalt wichtiger Verbindungen: zur Aufrechterhaltung der Strukturen, zur Abschirmung nach außen, zur Regulation, genetisches Material zur Weitergabe der Erbinformation. Alle diese Komponenten sind für das Funktionieren der Zelle und damit des Lebens unentbehrlich. Die Arbeit aber erledigen Enzyme. Sie halten den Stoffwechsel im Gang, bewirken Auf- und Abbau wichtiger Zellbestandteile wie Membranen und Organellen, bewerkstelligen die Weitergabe der Erbinformation sowie deren Umsetzung zu Genprodukten und damit auch ihre eigene Synthese. Somit sind sämtliche Lebensvorgänge direkt von Enzymen abhängig. Sie sind in der Lage, Reaktionen in einem teilweise unvorstellbaren Maße zu beschleunigen, die Umsatzgeschwindigkeit wird um Faktoren zwischen 105−1012 erhöht. Reaktionen, deren Dauer die Lebenszeit von Organismen um ein Vielfaches übersteigt, benötigen in Gegenwart des Enzyms derart kurze Zeit, dass sie in einen normalen Stoffwechsel einzuordnen sind. Die spontane Decarboxylierung von Orotidin-5′ -phosphat hat eine Halbwertszeit von 78 Millionen Jahren, die Orotidin-5′ -phosphat-Decarboxylase, ein besonders effektives Enzym, steigert die Umsatzgeschwindigkeit um den Faktor 1, 4 × 1017. Die Hydratisierung von Kohlendioxid zu Hydrogencarbonat hat mit fünf Sekunden zwar eine wesentlich kürzere Halbwertszeit, doch wäre diese Reaktion immer noch so langsam, dass sich Kohlendioxid im Blut als Gas freisetzt, würde nicht die Carboanhydrase diesen Prozess neunmillionenfach beschleunigen.
Schon im Altertum bediente man sich der Wirkungsweise von Enzymen. Die Sumerer in Mesopotamien stellten bereits 6000 v. Chr. Bier durch Vergären von Getreide her, wie später auch die Germanen Met aus gärendem Bienenhonig gewannen. Die Konsumierung und damit die Kenntnis der Vergärung von Wein ist in der Genesis, dem ersten Buch der Bibel, beschrieben. Die Ägypter verwendeten Hefe zum Brotbacken. Die Herstellung von Essig als frühestes Beispiel mikrobieller Oxidation ist seit 2000 v. Chr. bekannt. Alle diese Fermentationsprozesse bedienten sich der Enzymausstattung lebender Mikroorganismen, doch von der Kenntnis einzelner Enzyme war man noch weit entfernt. Der Beginn der modernen Enzymologie geht zurück ins späte 18. Jahrhundert, als Lazzaro Spallanzani feststellte, dass Magensaft in der Lage ist, Fleisch zu verdauen. Die aktive Substanz bezeichnete Theodor Schwann 1836 als Pepsin. Anselme Payen konnte 1833 zeigen, dass eine in Gerstenextrakt enthaltene hitzelabile Komponente Stärke in Zucker verwandelt. Die wirksame Substanz, nach unserem heutigen Wissen ein Gemisch verschiedener Amylasen, nannte er Diastase. Friedrich Wöhler gelang 1828 die chemische Synthese von Harnstoff und widerlegte damit die bis dahin vorherrschende Auffassung, Substanzen lebender Organismen könnten nur sich mithilfe einer Lebenskraft (vis vitalis) bilden. Ein weiterer entscheidender Schritt in diese Richtung war die Darstellung der alkoholischen Gärung in einem zellfreien Hefeextrakt durch Eduard Buchner 1897. Die wirksame Komponente bezeichnete er als Zymase. Jacob Berzelius (1836) schrieb den Fermentationsprozessen eine katalytische Kraft zu. Eingehende Untersuchungen um 1894 über das Phänomens der Katalyse, bei der der Katalysator selbst an der Reaktion nicht teilnimmt, brachten Wilhelm Ostwald 1909 den Nobelpreis. Oscar Loew beschrieb 1899 die katalytische Funktion der Enzyme.
Die in den Fermentationsprozessen wirkenden Komponenten wurden zunächst als „Fermente“ bezeichnet, bis 1876 Wilhelm Friedrich Kühne den Begriff Enzym (von griech. ενζυμη, im Sauerteig) einführte. Trotzdem war man sich über die Natur der Enzyme lange nicht einig. Selbst noch bis 1920 war ihre Proteinnatur umstritten, auch wenn bereits Buchner feststellte, dass Enzyme ohne Zweifel als Proteine zu betrachten sind. Besonders Richard Willstätter bezweifelte die Proteinnatur von Enzymen und betrachtete sie vielmehr als kolloidale Teilchen mit prosthetischen Gruppen. Diese Ansicht vertrat er selbst noch 1927, ein Jahr nach der Reindarstellung der Urease durch J.B. Sumner. Emil Fischer, der dagegen schon frühzeitig die Proteinnatur der Enzyme erkannte, postulierte 1894 mit der Schlüssel-Schloss-Hypothese die Vorstellung einer spezifischen Wechselwirkung zwischen Enzym und Substrat. Er fand, dass Invertase zwar α-Methylglucosid, nicht aber β-Methylglucosid spalten kann, während Emulsin genau die umgekehrte Spezifität besitzt. Die allgemeine Akzeptanz der Proteinnatur der Enzyme erbrachte die Reindarstellung und Kristallisierung der Urease durch J.B. Sumner im Jahre 1926 und kurz darauf einiger proteolytischer Enzyme durch J.H. Northrop und seine Mitarbeiter.
In den folgenden Jahren wurden die wesentlichen Stoffwechselwege und deren Enzyme aufgeklärt, woran eine Vielzahl von Forscher beteiligt war, hier seien nur die bekanntesten Namen erwähnt. Die Glykolyse wurde durch Gustav Embden, Otto Meyerhof, Carl und Gerti Cori und Carl Neuberg (der auch den Begriff „Biochemie“ prägte) bis 1940 entschlüsselt. Auch Otto Warburg hatte daran einen wesentlichen Verdienst, daneben hatte er entscheidenden Anteil an der Erforschung der Atmungskette und deren Enzyme. Sein Schüler Hans Krebs entdeckte 1932 den Harnstoff-Zyklus und 1937 den auch als Krebs-Zyklus bekannten Citrat-Zyklus. In den fünfziger Jahren klärten schließlich Bernard Horecker, Fritz Lipman und Efraim Racker den Pentosephosphat-Zyklus auf.
Die ersten Enzyme, deren Aminosäuresequenz entschlüsselt wurde, waren Ribonuklease und Lysozym 1963. Lysozym war auch das erste Enzym, dessen dreidimensionale Struktur durch Röntgenstrukturanalyse von D.C. Phillips (1967) aufgeklärt wurde, der seinerseits auf den Pionierarbeiten der Strukturaufklärung des Myoglobins und des Hämoglobins durch John Kendrew und Max Perutz (1962) aufbauen konnte.
Die Geburtsstunde der Enzymkinetik liegt um die Wende zum 20. Jahrhundert, als Victor Henri in Paris und Adrian Brown in Birmingham (1902) eine Formel für das Sättigungsverhalten von Enzym und Substrat unter Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes veröffentlichten. Diese in etwas modifizierter Form als Michaelis-Menten-Gleichung bekannte Beziehung ist nach wie vor die zentrale Gleichung der Enzymkinetik. Sie beschrieb zunächst Bindung des Substrats an das Enzym, mit der Einbeziehung der Steady-State-Theorie unter Berücksichtigung der Umsatzgeschwindigkeit durch G.E. Brigg und J.B.S. Haldane 1925 erhielt sie ihre heute noch gültige Form. Leonor Michaelis und Maud Menten erkannten, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes proportional ist. In ihrer wegweisenden Arbeit von 1913 stellten sie die Abhängigkeit von Enzymreaktionen von äußeren Bedingungen, wie Temperatur und pH-Wert, heraus und zeigten damit Wichtigkeit der Standardisierung bei Messungen von Enzymreaktionen. Ein Meilenstein in der Erforschung regulatorischer Effekte war 1965 die Postulierung des Symmetrie-Modells allosterischer Enzyme durch J. Monod, J. Wyman und F. Changeux. Es erklärt, wie mittels Hemmung und Aktivierung von Enzymen durch Metaboliten, die selbst nicht an der Reaktion beteiligt sind, verschiedene Stoffwechselwege miteinander verknüpft werden und somit Quervernetzungen des gesamten Stoffwechsels entstehen.
Die fortschreitende Erforschung der Enzyme ergab, dass es sich dabei um hochkomplexe Gebilde handelt. In ihrer Grundstruktur sind sie aus einer Vielzahl von Aminosäuren zusammengesetzte Proteine. Trypsin als noch vergleichsweise kleines Protein besteht aus 224 Aminosäuren, zur Katalyse sind aber nur drei davon, die sog. katalytische Triade, notwendig, also kaum mehr als 1 %. Dies mag zunächst als ein unnötiger Aufwand erscheinen, führt man sich aber vor Augen, dass in der Natur durchgehend das Prinzip höchster Sparsamkeit gilt, ahnt man, dass keine einzige Aminosäure überflüssig ist, eine solche wäre längst wegmutiert. Die hohe Effizienz der Enzymkatalyse wird nur durch ein äußerst exaktes Zusammenwirken aller erforderlichen Komponenten erreicht. Jede am katalytischen Prozess mitwirkende Komponente muss eine genaue Position einnehmen. Um dies zu gewährleisten, sind die umgebenden, für die Katalyse nicht unmittelbar essenziellen Aminosäuren verantwortlich. Sie formen ein stabiles Gerüst, in dem die essenziellen Komponenten passgenau eingebettet sind. Weiterhin muss die Umgebung des aktiven Zentrums derart aufbereitet werden, dass die katalytisch wirksamen Gruppen in reaktiver Form vorliegen, so muss der Ionisierungsgrad genauestens eingestellt sein. Die 20 proteinogenen Aminosäuren bieten nicht gerade ein breites Spektrum reaktionsfähiger Gruppen, wenn man noch bedenkt, dass einige davon, vor allem die aliphatischen Aminosäuren, als unreaktiv gelten und überhaupt nicht zur Katalyse beitragen. Die Reaktivität anderer Amino säuren hängt dagegen stark von Einflüssen durch ihre unmittelbare Umgebung ab. So kann der pKa -Wert der funktionellen Gruppen bestimmter Aminosäure, wie Histidin, durch den Einfluss benachbarter Aminosäuren bis zu zwei pH-Einheiten verschoben werden. Derartige Feinanpassungen ermöglichen es Enzymen, mit einer begrenzten Zahl an Aminosäuren vielfältige Katalysemechanismen abzudecken. Wo dies trotzdem nicht ausreicht, bedient sich das Enzym nicht proteinogener Komponenten, wie Metallionen oder Cofaktoren, die beim Menschen häufig Vitamincharakter haben. Cofaktoren binden teilweise in nicht kovalenter Weise an das Enzym und können unter Verlust der enzymatischen Aktivität abdissoziieren. Sie werden als Coenzyme bezeichnet. Andere Faktoren, wie Biotin und Liponsäure, sind kovalent mit dem Enzym verknüpft und gehen nicht durch Dissoziation verloren. Sie werden als prosthetische Gruppen bezeichnet. Allerdings sind auch manche nicht kovalente Coenzyme derart fest mit dem Enzym verbunden, dass sie sich nicht entfernen lassen, ohne das Enzym zu denaturieren.
Neben der katalytischen Reaktion müssen sich Enzyme auch anderen Aufgaben stellen. Das Substrat muss erkannt und eingefangen und für den katalytischen Prozess vorbereitet werden. Darüber hinaus sind wichtige regulatorische Funktionen innerhalb des Zellstoffwechsels zu erfüllen. Diese laufen ebenfalls über hochspezifische Erkennungsmechanismen. Die Signalübertragung vom regulatorischen auf das katalytische Zentrum erfordert genau abgestimmte Beweglichkeiten. Das Enzymmolekül muss eine exakte Raumstruktur aufrecht erhalten, darf aber trotzdem kein starres Gebilde sein. Schließlich muss es auf seine Umgebung reagieren entweder in Form hydrophiler Wechselwirkungen als lösliches Enzym oder über hydrophobe Kräfte in einer Membran integriert.
1.2 Wie sind Enzyme entstanden?
Wie konnten so große Enzymmoleküle entstehen? Wenn eine derartige Größe zur Erfüllung der Aufgaben eines Enzyms erforderlich ist, wären kleinere, einfachere Enzymmoleküle als Vorgänger heutiger Enzyme prinzipiell nicht in der Lage, diese Funktionen zu übernehmen. Trotzdem musste sich der komplexe Stoffwechsel, wie wir ihn heute wahrnehmen, aus einfachen Prozessen entwickeln, die an die katalytische Effizienz der Urenzyme weit geringere Ansprüche stellten. Tatsächlich lässt der strukturelle Aufbau von Enzymen vielfach entwicklungsgeschichtliche Aspekte erkennen. Die Triosephosphat-Isomerase hat eine charakteristische fassähnliche Struktur (TIM barrel), bestehend aus acht ringförmig angeordneten Elementen aus je einer α-Helix und einem β-Strang, das katalytische Zentrum im Inneren einschließend (s. Abschn. 2.3). Vergleichbare Strukturen finden sich in Enzymen, die völlig anderer Reaktionen katalysieren, wie die Aldolase und Pyruvatkinase. Offensichtlich entwickelten sich aus einer stabilen Urstruktur durch Modifikationen der Aminosäuren im aktiven Zentrum unterschiedliche enzymatische Aktivitäten.
Ein anderes Entwicklungsprinzip zeigt sich bei der Klasse der von NAD(P) abhängigen Dehydrogenasen. Diese bestehen meist aus vier identischen Untereinheiten. Jede dieser Untereinheiten wird gebildet aus zwei Domänen ähnlicher Größe, wobei eine für die Bindung des Cofaktors NAD(P), die andere für die Substratbindung verantwortlich ist. Die Cofaktor-Domänen der verschiedenen Dehydrogenasen zeigen auffallende Strukturhomologien, während die Substratdomänen einander wenig ähnlich sind. Auch hier geht man von einem Urenzym aus, dessen Cofaktor-Domäne weitgehend erhalten blieb, wogegen sich die Substratdomänen den verschiedenen Substraten anpasste und sich somit unterschiedliche Dehydrogenasen heraus bildeten.
Ein noch detailliertes Evolutionsprinzip zeigt sich beim Serumalbumin, das Transportprotein des Bluts für zahlreiche Substanzen, wie langkettige Fettsäuren, Billirubin, Tryptophan, Thyroxin, Cystein, Glutathion, Cu2+ und Ni2+. Die Proteinkette des Serumalbumins besteht aus drei Domänen, die beträchtliche strukturelle Übereinstimmungen aufweisen (Abb. 1.1