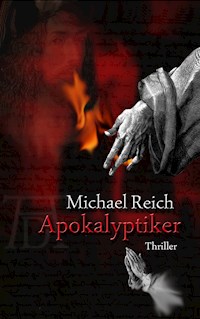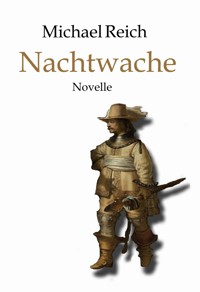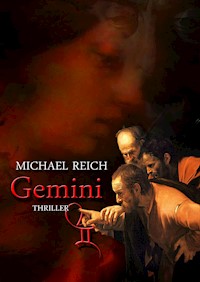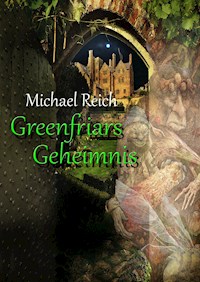Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein neuer atemberaubender Fall für das Ermittlerduo Hauptkommissarin Elise Brandt und den Kunshistoriker Avide St. Cyr. Köln im Dezember 1999, noch wenige Tage bis zum Millennium. Der Jahrtausendwechsel - Beginn einer neuen Zeitrechnung? Eine Ordensschwester mit bewegter Vergangenheit, zwei Tote in einem Benediktinerinnenkloster, ein skrupelloser Söldner mit dunkler Vergangenheit und ein seltsames Gemälde, das mehr verbirgt als es preisgibt ... Die Stimme eines der größten deutschen Künstler, des Wittenberger Hofmalers Lucas Cranach des Älteren, dringt aus den Nebeln der Vergangenheit in die Gegenwart. Musste ein junger Kunststudent sterben, weil er das Rätsel um das Bild gelöst hat? Bald ist ganz Köln in tödlicher Gefahr ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Henriette Jörgens, ‚Schwester Juliana‘ (1931-2022) gewidmet
Die Liebe: Gott; Der Hände Arbeit den Menschen.
Wie man nicht wehren kann, dass einem
die Vögel über den Kopf herfliegen,
aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten,
so kann man auch bösen Gedanken nicht
wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln.
Martin Luther
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Prolog
2. Prolog
3. Prolog
1. Teil
Zwischenspiel
2. Teil
3. Teil
Epilog
Anhang
Vorwort
‚Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.‘
Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1886.
Als Herakles auf dem Weg zu Geryon war, um dessen Rinder zu rauben, wurde er von Bebryx gastfreundlich aufgenommen. Vom Wein berauscht, verführte er dessen Tochter Pyrene, indem er ihr falsche Versprechungen machte. Danach zog er weiter. Pyrene gebar eine Schlange und floh aus Furcht vor ihrem Vater in die Wildnis, wo sie von wilden Tieren getötet wurde. Herakles fand ihre Leiche, als er auf dem Rückweg von Geryon war und bestattete sie. Dabei rief er klagend ihren Namen, der vom Echo des Gebirges wiederholt wurde, das von nun an ihren Namen trug:
Pyrenäen.
I.
Die südlichste Region Frankreichs, das Département des Pyrénées-Orientales, das erst, einst zu Katalonien gehörig, 1659 im Zuge des Pyrenäenfriedens französisch wurde, ist geprägt von den Konturen des östlichsten ihrer rund zweihundert Gipfel, des Pic du Canigou, dessen Hänge oft bis in den Sommer hinein verschneit sind. Seine dunstverschleierte Silhouette nimmt man noch bis zu einhundert Kilometer jenseits der Küstenlinie des Mittelmeeres wahr.
Für die selbstbewussten, geschichtsbewussten Katalanen war er immer ein ‚heiliger‘ Berg, ihr ‚Olymp‘, und in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, dem Johannistag, wird von ihnen traditionell auf seinem Gipfel ein Feuer entzündet, das gegen Morgen mit brennenden Fackeln in die Ortschaften des Tales getragen wird.
Am Ostfuß der Gebirgskette verbreiterten sich die Täler der Têtund des Tech zu einer fruchtbaren Ebene mit üppiger Vegetation. Die Côte Vermeille, der Verbund eines aus Schuttmassen aufgebauten, flachen, vorgelagerten Küstenstreifens, mit der sich nordwärts anschließenden Lagunenküste, war gerade erst im Begriff für den Fremdenverkehr entwickelt zu werden. Die Bevölkerung betrieb, so weit entfernt von der Hektik der modernen Welt, traditionell Wein- und Olivenbau, Holz- und Weidewirtschaft. Im Gegensatz zu anderen lebensfeindlicher anmutenden Territorien an den kargen, rauen Hängen der wie die Alpen vor rund 50 bis 100 Millionen Jahren im Tertiär entstandenen Gebirgskette, waren die Täler der östlichen Pyrenäen mit ihrem Mittelmeerklima freundlich und seine Bewohner den Annehmlichkeiten, die das Leben dort für sie bereithielt, durchaus zugewandt.
Rein verwaltungstechnisch gehörte das Département Pyrénées-Orientales zur Region Languedoc-Roussillon, das vor allem durch das ‚Pays Cathare‘, das Katharerland, im geschichtlichen Gedächtnis Frankreichs präsent war. Eines seiner Hauptmerkmale waren die ‚châteaux cathares‘, die königlichen Burgen, die noch heute, jetzt oft verwittert und zu Ruinen verfallen, auf den Hügeln thronten: steinerne Mahnmale eines einst hart umkämpften Glaubens.
Der alte Geist des okzitanischen Adels, der mächtigen Grafen von Toulouse, das Haus Trencavelden - Vizegrafen von Carcassonne, Béziers und Razès - und den Grafen von Foix, die sich den Häretikern zuwandten, um sich der Machtausbreitung der französischen Könige entgegenzustellen, schien sich in der an das harte Leben und das unwirtliche Klima dieser Region angepassten Landbevölkerung gehalten zu haben, die sich allem Neuen gegenüber kritisch zeigte.
Die vorherrschende Farbe war grau, wie das Gestein des Gebirges, dessen Struktur man in den Gesichtern der Menschen wiederfand, der Himmel über ihnen und die Steine der Häuser in ihren Dörfern.
Dort, im Angesicht der harten, reinen, unverfälschten Natur, scheinbar am Ende der Welt, fühlte man sich zurückgeworfen auf den Kern jedes auf der Erde wandelnden Wesens - das Überleben.
Wer sich hierher zurückzog, suchte die Einsamkeit und fand sie, umschlossen von den sich seit Jahrmillionen auftürmenden Granitmassen des Gebirgszuges, beschütz und abgeschirmt - gefangen?
II.
1094 Meter hoch, am Westhang, auf halber Höhe des 2785 Meter hohen Canigou, lagen auf einem von steilen Felsabstürzen umgebenen Plateau die Gebäude eines Konventes. Sie waren einzig über einen steilen Fußweg von der kleinen Ortschaft am Fuße des Berges zu erreichen. Ein Wildbach hatte sich tief in die Schlucht eingegraben, dessen Tosen die vorherrschende Stille durchbrach. Begleitet von den vielfältigen Düften des aus hohen Eichen, Eschen, Kastanien und Haselnusssträuchern bestehenden, schattigen Waldes erlebte man das ergreifende Panorama einer einzigartigen Bergwelt.
Die Abtei selbst, vor nahezu tausend Jahren von dem Abkömmling eines katalanischen Grafengeschlechts gestiftet, war, nach einer wechselhaften Geschichte und der Säkularisation Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, dem Verfall preisgegeben worden.
In der Mitte der siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts bezogen, kritisch beäugt von den Anwohnern, die Mitglieder einer jener neuen geistlichen Gemeinschaften, die in der katholischen Kirche in den Jahren nach dem II. Vatikanischen Konzil 1962–65 entstanden waren, die Ruine und machten sie, der Abgeschiedenheit und allen sonstigen Widrigkeiten trotzend, wieder bewohnbar. 1979 erhielt die Gemeinschaft schließlich die bischöfliche Anerkennung als Pia unio.
In späteren Jahren begannen auch Bewohner des Dorfes in der Abtei zu arbeiten und man lieferte ihnen die Erzeugnisse ihrer Höfe. Eine gewisse Distanz aber blieb. Diese ‚Bruderschaft‘, wie sie sie nannten, die dabei nicht nur aus Männern, sondern auch aus Frauen bestand, war und blieb ihnen fremd.
Besonders der als Abt des Klosters und Vorstand der Gemeinschaft fungierende Bruder, der sich nie in der Öffentlichkeit zeigte und ein fast eremitenartiges Dasein führte, eingebettet in die stummen Felsen des Canigou, erregte ihr Misstrauen und mehr noch: Es beschäftigte ihre Phantasie.
Niemand wusste etwas über ihn, diesen Abt Grégoire. In einer dunklen, regnerischen Nacht, vor nunmehr fast fünfundzwanzig Jahren, war er, wie ein böser Geist, aus den Nebelfetzen aufgetaucht. Anfangs hatte er alleine in der Abteiruine gehaust. Doch später kamen, erst vereinzelt dann in Gruppen, mehr von ihnen.
Ihr Habit bestand aus einer grobkörnigen, weißen Stofftunika mit einer kleinen Kapuze, darüber ein schwarzes Skapulier, auf das auffällig ein Emblem gestickt war: der Erzengel Michael im Kampf mit dem Drachen. Und so nannten sie sich: Frères et soeur de la Sainte Lance de Michel.
Anders als ihr Abt waren die Brüder und Schwestern wesentlich zugänglicher, und mit der Zeit entwickelte sich eine Art verhaltener nachbarschaftlicher Freundschaft.
Argwöhnisch beobachtet wurden nach wie vor die in den letzten Jahren immer häufiger werdenden Besuche von Fremden. Sie kamen oft in teuren Wagen, die Nummernschilder aus Deutschland, der Schweiz, Italien trugen. Auch französische Kennzeichen waren darunter.
Als sich endlich einer der Einheimischen ein Herz fasste und fragte, erhielt er die Antwort, man gebe Seminare: Kontemplation, innere Einkehr, Selbstfindung durch Mediation. In einer Welt, die sich mit jedem Tag schneller drehte, aufreibender wurde, nervöser, fand diese Art des zeitweisen ‚Ausstiegs‘ großen Anklang. Besonders in den Chefetagen, dort, wo der ausgeübte Druck oftmals sehr ausgeprägt und kaum noch auszuhalten war.
Es war der Versuch, einen aus dem Takt gekommenen Organismus wieder auf die richtige Bahn zu lenken: Ein Leben im Einklang mit der Natur; lernen, wieder auf seine innere Stimme zu hören. Das alles in der Stille der Abgeschiedenheit. Tage, die angefüllt waren nur vom Schweigen und dem Gebet, einer stummen Zwiesprache mit einem höheren Wesen ...
»Und ich sage dir: Ich habe in seinen Augen das Böse gesehen.«
Maurice Abadie stauchte den Bierkrug so hart auf den Tisch, dass die Hälfte der Flüssigkeit auf die karierte Tischecke schwapp te und dort einen dunklen Fleck hinterließ, der sich langsam ausbreitete. Er starrte mit glasigem Blick auf den Krug, dessen Henkel er noch immer so festumschlossen hielt, dass die Knöchel seiner fleischigen Finger weiß hervortraten. Leise fuhr er fort: »Bei Gott, das war das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Ich bin nur ein einfacher Mann, nur ein Bauer, und wahrscheinlich würd‘ ich’s nicht mal verstehen, wenn ich alles wüsste. Aber dass das, was da oben vorgeht«, er deutete mit den ausgestreckten Zeigefinger in die Richtung des Berges, »nichts Rechtes ist, das weiß ich mit aller Bestimmtheit! Das red‘ mir niemand aus!«
Guisepp Amherd lehnte sich zurück. Sein Rücken schmerzte. Die letzten Tage waren anstrengend gewesen. Die kleine Stube des Bauernhauses war nur von dem diffusen Licht einer Öllampe erleuchtet, die zwischen ihnen auf dem Tisch stand, und dem flackernden Feuer eines Kamins, das eine angenehme Wärme spendete.
Es hatte erneut geschneit in den letzten Tagen und auf den schmalen Bänken der kleinen, quadratischen Fenster türmte sich das gefrorene Nass. Er wandte den Kopf und blickte durch das schmale Stück der oberen, freigebliebenen Hälfte des Fensters rechts hinter ihm hinaus, in Richtung des Berges, dessen sonst dunkelgrauen Granitstein der Schnee weiß gefärbt hatte.
Die über 1100 Kilometer von Zürich hatte er mit einem geliehenen Auto zurückgelegt - über Bern und Lausanne, bei Genf über die Grenze nach Frankreich, an Lyon vorbei und Clermont-Ferrand umfahren. Immer wieder Zwischenstopps: misstrauisches begutachten der Lage. War ihm jemand gefolgt? In Ussel hatte er übernachtet und versucht ein wenig Ruhe zu finden. Aber immer wieder war er in der Nacht aufgewacht, zum Fenster der kleinen Pension gegangen und hatte den Parkplatz beobachtet.
Die Fahrt durch alle sechs Departements führte über 34 Pässe: neunhundert Kilometer, von den Pyrénées-Atlantiques via Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude bis in die Pyrénées-Orientales. Für die insgesamt zu überwindenden sechzehntausend Höhenmeter der gesamten Bergfahrt brauchte man eine gute PS-Zahl unter der Haube - oder eine gute Kondition.
Er hatte sich Urlaub dafür genommen. Niemand wusste, wohin er fahren würde. Den Wagen, mit dem er unterwegs war, hatte er unter falschem Namen gemietet. Er versuchte, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Sie waren da, er wusste es. Und sie wachten über ihr Reich. Doch er war ihnen auf der Spur. Jetzt schien er kurz vor dem Ziel zu stehen - nach mehr als anderthalb aufreibenden Jahren voller niederschmetternder Rückschläge, in denen das Gefühl ständig unter Beobachtung zu stehen niemals gewichen war.
Wie immer war es der Zufall, der ihn den entscheidenden Schritt vorangebracht hatte, jenes Puzzlesteinchen zu finden, nachdem er schon so lange suchte:
Den Kopf des Zeck.
III.
Niemand wird dir glauben, hatten ihm die wenigen denen er noch vertraute prophezeit.
Und sie hatten Recht gehabt.
Er brauchte Beweise, stichhaltig, an denen die, die nicht glauben wollten, nicht mehr vorbeisehen konnten.
Er hatte geglaubt, in den knapp dreissig Jahren bei der Kantonspolizei Zürich allen Niederungen der menschlichen Existenz begegnet zu sein. Dem wahren Bösen aber hatte er erst vor anderthalb Jahren ins Gesicht geblickt.
Wer lange genug in den Abgrund sieht ...
Seitdem führte er verbissen einen einsamen Kampf, der ihn bis an die Grenzen seiner physischen und psychischen Gesundheit gebracht hatte.
Er war kurz davor aufzugeben, als ihm das Schicksal, der Zufall, wie immer man es auch nennen mochte, einen weiteren Ball zuwarf: Aus dem Limmat wurde die Leiche einer jungen Frau geborgen.
Der Major, Leiter der Hauptabteilung für Verbrechensaufklärung bei der Kantonspolizei, hatte die Aufklärung des Falles mit seinem Team übernommen. Da die Tote keinerlei Papiere bei sich trug, entschied man sich zur Veröffentlichung eines Fotos in den Tageszeitungen. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Frau meldete, in deren Pension die junge Frau für eine Saison ein Zimmer angemietet hatte. Tatsächlich fanden die Ermittler dort schließlich alle erforderlichen Papiere zur Identifizierung: Bei der Ermordeten handelte es sich um Jaqueline Devoliers, geboren in Frankreich, wohnhaft in einem kleinen Ort im Département Pyrénées-Orientales. Sie war noch nicht lange in der Stadt. Offenbar eine jener zahlreichen Saisonarbeitskräfte, die sich für eine bestimmte Zeit als Servicekraft in einem Hotel oder Restaurant verdingten. Die junge Frau hatte in einem der stark frequentierten Brauhäuser der Stadt eine Anstellung gefunden. Die Vermieterin konnte keine weiteren Angaben machen. Jaqueline war unauffällig, freundlich, lebte sehr zurückgezogen, hatte niemals Besuch bekommen.
Allerdings fand man zahlreiche Briefe aus ihrem Heimatort. Dort gab es einen jungen Mann, mit dem sie verlobt war. Weitere Recherchen ergaben, dass ihre Eltern bereits tot waren und sie bei einer älteren Tante aufgewachsen war, offenbar ihre einzige leibliche Verwandte.
Zur Überraschung der Ermittler fand sich wenige Tage nach dem Auffinden der Leiche ein junger Mann bei der Kantonspolizei ein, der sich als Jules Abadie vorstellte: Er war der Verlobte von Jaqueline Devoliers. Da Major Guisepp Amherd nicht nur der Leiter der Ermittlungen war, sondern von allen auch am besten Französisch sprach, übernahm er die Befragung.
Jules Abadie zeigte sich tief betroffen vom Tod seiner Verlobten. Auf die Frage warum die junge Frau so weit entfernt von ihrer Heimat versucht hatte Arbeit zu finden, antwortete er auffallend ausweichend mit Allgemeinplätzen. Amherds Instinkt war geweckt. Er spürte, dass etwas nicht stimmte mit diesem jungen Mann. So rau er im Umgang mit den kriminellen Subjekten, die ihm täglich begegneten, auch sein konnte, er hatte durchaus auch eine einfühlsame Seite. Und so gelang es schließlich, dass sich Abadie ihm gegenüber öffnete.
Amherd konnte nicht ahnen, dass diese Aussagen alles für ihn verändern sollten ...
»Wir haben gedacht, hier, so weit ab von ihnen, wäre sie in Sicherheit«, sagte Jules.
»Ihnen?«, fragte Amherd.
»Die Bruderschaft. Die ‚Frères et soeur de la Sainte Lance de Michel‘. Sie haben sich bei uns eingenistet, thronen über unseren Köpfen.« Abadie packte den Kragen von Amherds Jacke und zog ihn zu sich. »Sie sind das Böse. Ich weiß es und Jaqueline wusste es auch. Sie hat in ihrer Abtei gearbeitet, als Küchenhilfe. Eines Nachts, kam sie herunter zu uns. Niemals werde ich das vergessen: Es regnete, sie war durchnässt bis auf die Haut und vollkommen aufgelöst. Sie weinte und es war kaum ein vernünftiges Wort aus ihr herauszubringen. Einer der Brüder hatte ihr aufgelauert. Er war immer schon hinter ihr her gewesen. Sie konnte sich ihm entziehen, floh, versteckte sich in einer Kammer, die unter dem Refektorium lag. Die Bodendielen dort sind schlecht verlegt, es gibt einen Kamin und Luftschächte: So hörte sie jedes Wort, das oben gesprochen wurde - furchtbare, schreckliche Szenarien, die sie entwarfen. Sie werden uns umbringen! Uns alle!«
Amherd versuchte, den jungen Mann zu beruhigen. Er veranlasste ihn behutsam sich zurück auf seinen Stuhl zu setzen und gab ihm zu trinken. Abadies Hände zitterten so sehr, dass er das Glas kaum halten und zum Mund führen konnte.
»Haben Sie Jaqueline geglaubt?«, fragte er vorsichtig.
»Natürlich!«, brauste Abadie auf. »Und Sie hätten es auch, wenn Sie sie gekannt hätten. Wir im Tal haben den Brüdern und ihrem ‚schwarzen Abt‘ nie getraut.«
»Schwarzer Abt?«
»Er trägt immer eine schwarze Kutte. Schon damals, als er zu uns kam, mitten in stockfinsterer Nacht. Er hat, Gott weiß wie lange, allein da oben in der Ruine gehaust. Er war uns immer unheimlich. Als wir Kinder waren, haben uns unsere Eltern, wenn wir nicht gehorchten, mit ihm gedroht. Passt nur auf, sonst kommt er euch holen, der ‚schwarze Abt‘. Jaqueline hat immer darüber gelacht. Sie hatte keine Angst - damals nicht.«
»Wie lange ist das her?«, fragte Amherd.
»An die fünfundzwanzig Jahre.«
»Was geschah dann? Ich meine mit Jaqueline?«
»Niemals wäre sie wieder da rauf gegangen. Um keinen Preis. Sie blieb bei uns, bei mir und meinen Eltern.«
»Sie sind nicht zur Polizei gegangen?«, fragte Amherd verwundert.
»Polizei?« Abadie schüttelte heftig den Kopf. »Ja, natürlich sind wir. Am nächsten Morgen sind wir auf unsere Gendarmerie gewandert. Jaqueline hat alles zu Protokoll gegeben, was sie gehört hat. Sie hätten die Gesichter der Gendarmen sehen sollen. Kein Wort haben sie ihr geglaubt. Sie hat sogar Anzeige erstattet, gegen den Bruder, der ihr nachgestellt hat.« Seine Stimme brach. »Nichts ist geschehen! Verstehen Sie! Sie waren oben in der Abtei und sind unverrichteter Dinge wieder zurückgekommen. Es fehlten die Beweise, sagten sie. Man hätte nichts Verdächtiges dort feststellen können. Da wussten wir, woran wir waren. Zwei Tage später kamen sie runter und durchstreiften das Dorf, suchten nach ihr, fragten überall. Aber niemand hat sie verraten. Da war uns klar, dass sie wegmusste. Ein Cousin meines Vaters betreibt hier in Zürich ein Brauhaus. Das, dachten wir, ist weit genug. Ich wollte nachkommen.« Er senkte den Kopf. »Wir wollten zusammen hier neu anfangen.«
IV.
»Eine ziemlich wirre Geschichte«, urteilte Amherds Vorgesetzter, der Leiter der Kantonspolizei. »Von den Pyrenäen bis hier nach Zürich ist es ein verdammt langer Weg.«
Der Major konnte ihm nicht widersprechen, wandte aber ein: »Wir haben sonst keinerlei weitere Anhaltspunkte. Die junge Frau hat hier sehr zurückgezogen gelebt. Wer hätte einen Grund, sie zu töten?«
»Eine Gruppe mordender Mönche, die durch Zürich streift? Ich bitte Sie!«
Tatsächlich blieb der Fall Jaqueline Devoliers unaufgeklärt. An dem Abend, bevor Jules Abadie mit den inzwischen frei gegeben sterblichen Überresten der jungen Frau in die Pyrenäen zurückkehren wollte, suchte ihn Amherd noch einmal in der Pension auf. Er bewohnte, solange er in Zürich war, das Zimmer seiner Verlobten.
»Tut mir leid«, sagte der Major aufrichtig.
»Schon gut«, wehrte Abadie ab. »Eigentlich habe ich nichts anderes erwartet. Das alles ist so verrückt, dass ich es selbst kaum glauben kann.« Er baute sich vor dem Ermittler in seiner vollen Größe auf. »Ich weiß, wer Jaqueline getötet hat. Ich werde zurückkehren, sie begraben, wie es sich für einen Christenmenschen ge hört, und dann den dafür zur Rechenschaft ziehen, der das zu verantworten hat. Ich werde mich an ihre Fersen heften und solange graben, bis ich die Beweise für ihre Machenschaften habe. Und wenn es den Rest meines Lebens dauert. Abt Grégoire und seine Brüder entkommen mir nicht.«
Bei der Erwähnung des Namens des Abtes der ‚Frères et soeur de la Sainte Lance de Michel‘, erstarrte der Major. Es war wie ein Blitz, der ihn, vollkommen unerwartet, ohne jede Vorankündigung eines Gewitters, bei strahlendem Sonnenschein traf.
»Wie?« Seine Hände erfassten die schmalen Schultern des jungen Mannes. »Wie war der Name?«
»Grégoire«, antwortete Abadie erschrocken. »So hat er sich genannt und so nennen ihn die Mitglieder des Konventes. Mehr wissen wir nicht.«
»Wie alt? Wie alt ist er?«, fragte Amherd atemlos.
»Ich weiß es nicht«, stammelte der junge Mann verwirrt. »Alt. Ein alter Mann.«
Amherd ließ die Hände sinken. Das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Heftiger Schwindel erfasste ihn, sein Herz begann heftig zu klopfen. Ein unbestimmter, stechender Schmerz, erfasste die rechte Körperhälfte. Das Atmen fiel ihm schwer. Er suchte und fand einen Stuhl, auf den er sank.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Abadie beunruhigt.
Der Major hob abwehrend die Hand. »Hören Sie, Jules. Sie müssen mir versprechen, Ruhe zu bewahren. Kehren Sie zurück und warten Sie. Auch wenn es schwerfällt. Sobald es mir möglich ist, werde ich nachkommen. Aber vorher erzählen Sie mir mehr.«
V.
Und wieder war er zu spät gekommen ...
Seine rechte Hand ballte sich zur Faust. »Ich hatte Ihrem Sohn gesagt, er solle ruhig bleiben. Er soll auf mich warten.«
Maurice Abadie löste seinen Blick von dem Bierkrug und sah Amherd direkt an. Seine hellgrauen Augen waren gerötet. »Er ist allein auf den Berg gegangen. Und nicht wieder zurückgekommen. So wie mein Urgroßvater. Fünfzig Jahre später haben sie seine Knochen in einer Schlucht gefunden. Ich habe dem Jungen seinen Namen gegeben: Jules.«
»Was hat die Gendamerie gesagt?«
Der alte Bauer zuckte die Schultern. »Sie sind mit nichts raufgegangen und genauso wieder zurückgekommen. Die Teufel da oben haben gesagt, sie hätten Jules nicht gesehen. Er wäre nicht bei ihnen gewesen.« Er atmete tief ein und aus, verschlang den Rest des Bieres aus dem Krug und wischte sich mit dem Ärmel seines Hemdes den Mund ab. »Nicht einmal beerdigen können wir ihn.«
»Aber er muss doch mehr als einmal oben gewesen sein«, hakte Amherd nach. »Sie sagten vorhin, er habe zu Ihnen gesagt: ‚Ich habe das Böse in seinen Augen gesehen.‘«
»Direkt nach Jaquelines Beerdigung ist er rauf. Ich wollte ihn abhalten aber ...«
»Hat er mit dem Abt gesprochen?«
»Ich weiß es nicht. Er war sehr schweigsam, als er zurückkam. Eines aber hat er erwähnt: Jaqueline hat ihm einmal erzählt, sie habe in der Zeit ihrer Arbeit oben eine Art geheimen Gang oder Tunnel entdeck, der von der Abtei in eine der Schluchten führt. Früher war das hier eine unsichere Gegend - alles voller Schmuggler. Durch ihn ist sie damals von oben geflohen. Vielleicht wollte er sich durch diesen Tunnel in die Abtei schleichen.«
»Wo genau dieser Gang oder Tunnel ist, hat er nicht gesagt?«
»Nein.«
Amherd überlegte. »Gibt es hier im Dorf jemanden, der den Berg besser kannt als alle anderen?«, fragte er.
VI.
Eine gefühlt arktische Kälte ließ ihnen kaum Luft zum Atmen.
Der Weg von der Ebene hinauf war tief verschneit. Guisepp Amherd schnaufte und seine schweren Stiefel drangen unter dem fessten, entschlossenen Schritt knirschend in den Schnee.
Der Führer wandte sich um und blickte ihn besorgt an: »Werden Sie es schaffen?«
Der Major winkte gereizt ab und bedeutete ihm weiterzugehen.
Nach gut einer Stunde erreichten sie die Schlucht unterhalb des Abteigebäudes. Der Himmel war durchzogen von dichten, dunkelgrauen Wolken, die unbarmherzig ihre Last zur Erde sandten. Amherd blickte an der steilen Felswand empor und versuchte durch das dichte Schneegestöber einen Blick auf das Klostergebäude zu erhaschen. Aber er erkannte nur die hochaufragende Silhouette einer verwitterten Steinmauer, die sich schwarz vom Nachthimmel abhob, der nur vom Licht des Vollmondes, der hinter den Wolken lauerte, ein wenig erhellt wurde. Dafür erregte etwas anderes seine Aufmerksamkeit: In einiger Entfernung ragte eine Art Gestell aus Metallstreben, gleich einem Miniatur-Eiffelturm, errichtet auf einem der Gipfel, in die Höhe.
Der Major sprach den Führer darauf an und der antwortete:
»Ein Sendemast. Die Frère haben ihn bauen lassen.« Er lachte: »Offenbar reicht ihnen die Zwiesprache mit Gott nicht.«
Amherd verharrte noch einige Zeit in Gedanken versunken, die Augen weiterhin fest auf den Mast gerichtet, während der Führer begann den frisch gefallenen Schnee, einzelne Äste und Gebüsch, beiseitezuschieben, um den Eingang zum Gang freizulegen.
Feuchte, eiskalte Modrigkeit empfing sie. Der Führer schaltete eine Taschenlampe an und beleuchtete eine mittelgroße Höhle, deren Wände von Moos und Flechten bewachsen waren. Am Ende der Höhle führte ein schmaler Gang tiefer in den Fels, direkt unter das Plateau auf dem die Abtei errichtet worden war. Und am Ende des Ganges führten einfache von Hand gehauene Stufen nach oben.
Der Major hielt den Führer, der bereits den Fuß auf die erste Stufe gesetzt hatte, zurück und schob ihn zur Seite. »Sie bleiben hier.« Er nahm ihm die Taschenlampe ab und begann, noch immer schwer atmend, mit dem Aufstieg.
Am Ende der Treppe lag ein weiterer, gemauerter Gang, dessen Ende eine Holztüre verschloss.
Amherd wartete einen Augenblick, bis sich sein Pulsschlag normalisiert hatte. Er spürte einen stechenden Schmerz in seinem rechten Arm, gefolgt von einem Gefühl der Taubheit, bis hinunter zur Hand. Sein Blick war weiterhin auf die Holztüre gerichtet. Was würde ihn dahinter erwarten?
Er legte die belebtere linke Hand auf die eiskalte Klinke. Die schneidende Kälte durchfuhr ihn wie ein scharfes Messer und ließ ihn kurz zurückzucken. Amherd zögerte, dann versuchte er es entschlossen ein zweites Mal. Mit sanftem Druck versuchte er, die Klinke nach unten zu bewegen. Die Türe war von innen verschlossen - natürlich. Er fischte aus einer Tasche seiner Allwetterjacke ein kleines Kästchen und öffnete es. Es enthielt eine gut sortierte Auswahl an Dietrichen. Jetzt kam es darauf an, mit welcher Aufmerksamkeit die Gemeinschaft über ihr ‚Nest‘ wachte oder ob sie sich ihrer Sache so sicher waren, hier, in der Abgeschiedenheit des sie schützenden Felsmassivs, dass sie eine weitere Absicherung nicht für nötig hielten. Nur ein zusätzlicher Riegel auf der Innenseite oder gar eine Art Alarmanlage und sein Plan war gescheitert.
Es dauerte einige Minuten, dann bezeugte ihm ein leises Klicken, das Schloss hatte seinen Bemühungen nachgegeben. Er überlegte nicht mehr und erfasste ein weiteres Mal die Klinke. Sie glitt lautlos nach unten und diesmal ließ sich die Türe mit einem laut vernehmlichen Knarzen öffnen. Er erstarrte in der Bewegung und wartete. Doch nichts weiter geschah, kein akustisches Signal ertönte, das den Eindringling verriet. Er war überrascht, hatte eigentlich damit gerechnet. Er hätte es besser wissen müssen, nach allem was er über den Abt und seine Aktionen und Pläne, seinen bizarren Ideologien und der verzerrten Weltsicht bisher herausgefunden hatte. Dieser Mann glaubte schon lange nicht mehr daran, noch besiegbar zu sein. Sein Körper mochte noch auf dieser Erde wandeln, sein unheilvoller Geist war längst in anderen Sphären, aus denen heraus er alles gnadenlos vergiftete, was mit ihm in Berührung kam.
Der Major griff erneut in seine Jackentasche und förderte eine halbautomatische P2000, seine Dienstwaffe bei der Kantonspolizei, zutage. Er überprüfte ihre Schussbereitschaft und öffnete die Türe ein weiteres Stück. Der Raum dahinter war in Dunkelheit getaucht. Die Luft war verbraucht und von einem durchdringenden Geruch nach abgestandenem Essen erfüllt. Amherd entzündete die Taschenlampe und ließ den Lichtstrahl einmal umher kreisen. Er sah Kisten und Säcke und an den Wänden Regale, die befüllt waren mit Einmachgläsern, Konservendosen und anderen zum Verzehr zu gebrauchenden Nahrungsmitteln. Er schloss daraus, dass es sich um einen Lagerraum handeln musste. Er erinnerte sich und leuchtete zur Decke. Was hatte Abadie gesagt?
‚Jaqueline versteckte sich in einer Kammer, die unter dem Refektorium lag. Die Bodendielen dort sind schlecht verlegt, es gibt einen Kamin und Luftschächte ...‘
Über den Balkenstreben, die quer von einer Seite der Kammer zur anderen führten, waren Dielen aus altem, wurmstichigen Holz erkennbar, die den Boden des darüberliegenden Raumes bilden mussten. Hinter übereinanderliegenden Leinensäcken an der Stirnseite gab es tatsächlich einen Kamin. Auch die erwähnten Luftschächte fand er. Er war sich sicher, dass es jener beschriebene Raum war, in dem sich Jaqueline vor den Nachstellungen eines der Brüder versteckte. Er blickte erneut nach oben. Dann war über ihm das Refektorium - ein Ort der Versammlung ...
Es gab eine weitere Tür, die, so vermutete er, zum Rest des alten Klostergebäudes führen musste. Er durchquerte das Lager, schaltete die Taschenlampe aus und erfasste die Klinke. Die Türe ließ sich ohne Widerstand öffnen. Dunkelheit erwartete ihn auch hier. Er ließ seinen Blick schweifen und erkannte die großräumige Küche der Anlage - mehrere Herde, Arbeitstische, hohe, alte Buffetschränke. Er horchte in die Stille, glaubte sich vollkommen allein und wagte sich aus dem Lagerraum, die Pistole schussbereit im Anschlag.
Durch mehrere vergitterte Fenster rechts von ihm fiel kaltes, blaudunstiges Licht in den Saal, so dass er sich auch ohne die Taschenlampe entzünden zu müssen fortbewegen konnte. Der Boden war mit schwarz-weißen Fliesen im Schachbrettmuster ausgelegt. Er setzte so vorsichtig wie möglich einen Fuß vor den anderen, damit die schweren Winterschuhe kein Geräusch verursachten, das ihn verraten konnte. Wieder eine Tür, auch diese unverschlossen. Die eisernen Angeln gaben ein leise klagendes Geräusch von sich, das wie eine Anklage wirkte - der etwas hilflos wirkende Versuch den ungebetenen Gast mittels der ungelenken Akustik, dem einzigen Mittel, das ihnen zur Verfügung stand, daran zu hindern seinen Weg fortzusetzen.
Amherd gelangte in eine Art Kreuzgang, durch dessen Arkadenbögen man auf einen tief verschneiten quadratischen Innenhof blickte, in dessen Mitte eine Art mittelalterlicher Zisterne aufragte, dessen Öffnung durch eine Eisenplatte verschlossen war.
Er blieb im Schatten der Wand, hinter der sich die Küche befand. Sein Atem ging stockend und bei jedem Ausatmen bildete sich eine weißlich dunstige Rauchwolke. Die Luft war beißend kalt.
Langsam schritt er den Gang entlang, nicht ohne sich immer wieder forschend nach allen Seiten umzublicken, bis er zu einer von einem offenen Rundbogen eingefassten Öffnung kam, die zu einem quadratischen Raum führte. Links vom ihm ging eine breite Treppe in den ersten Stock hinauf. Er erklomm keuchend die steinernen Stufen.
Er war am Ziel seiner nächtlichen ‚Expedition‘. Hinter einer weiteren unverschlossenen Türe am oberen Ende der Treppe lag das Refektorium. Eine Seite des rechteckigen, großen Saales war von nach oben spitz zulaufenden Fenstern durchbrochen, durch die das fahle Mondlicht hinein schien. Der Raum wurde beherrscht von einem ellipsenförmigen Holztisch, an dessen Kopfende ein breiter Stuhl mit einer hohen Rückenlehne thronte. Er war aus sehr dunklem Holz und die Lehne kunstvoll geschnitzt. Die Schnitzereien zeigten einen Engel in langem Gewand, der mit einer Lanze einen Drachen tötet ...
Amherd umrundete den Tisch und blieb an dem Stuhl stehen. Er berührte fast ehrfürchtig die Lehne, fühlte unter seinen Fingern die Unebenheiten des geschnitzten Holzes, bohrte einen Finger in die Vertiefungen.
Mit der anderen Hand langte er in seine Jackentasche und zog ein schwarzes Kästchen hervor. Er klappte es auf und betrachtete seinen Inhalt einige Sekunden: Zwei ganz unscheinbar aussehende runde Knöpfe, die doch Hochtechnologie waren. Es war die neueste Generation von Abhörgeräten. Das Beste was auf dem Markt zu finden war.
Amherd hatte Mühe, die kaum Manschettenknopf großen Wanzen mit seinen kräftigen Fingern aus der Aufbewahrungsbox zu holen. Fast wären sie ihm aus den Händen gerutscht. Er platzierte eine in einer besonders tiefen Einkerbung der Schnitzereien an der Rückenlehne des Stuhles, die zweite unter der Tischplatte.
Er verharrte noch einen Augenblick und machte sich dann auf den Rückweg.
VII.
Maurice Abadie betrachtete misstrauisch die für ihn wie aus einer anderen Welt stammenden Apparate, die Amherd vor sich auf dem Tisch aufgebaut hatte und goss sich noch ein weiteres Glas Schnaps ein, den er mit einem Zug hinunterspülte.
Der Major hockte vor einem geöffneten Koffer und trug Kopfhörer.
»Wenn das da die Zukunft ist, bin ich froh, dass ich alt bin und das nicht mehr erlebe«, sagte der Bauer.
Amherd nahm die Kopfhörer ab. »Damit können wir alles, was im Refektorium gesprochen wird, hören und aufzeichnen.«
»Ist das nicht illegal?«
»Lassen Sie das meine Sorgen sein. Im Krieg zählt nicht, wer am meisten die Regeln beachtet, sondern nur, wer dem Gegner einen Schritt voraus ist. Der allein trägt den Sieg davon.«
»Krieg?«, fragte Abadie skeptisch.
»Krieg«, betonte der Major. »Es ist nichts anderes. Sie gegen uns - schmutzig und gnadenlos. Ich habe die Regeln nicht aufgestellt.« Er deutete auf den Koffer mit der technischen Ausrüstung. »Das hier bietet uns die Chance, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Nur wenn wir wissen, was sie als Nächstes planen, können wir auch wirklich effektiv dagegen vorgehen. In den vergangenen fast zwei Jahren bin ich immer hinter ihnen gewesen, dicht, manchmal nur einen Schritt aber hinter ihnen. Ich habe recherchiert, geforscht, geschnüffelt und dabei die Mehrzahl der Gesetze verletzt, zu deren Schutz ich mich einmal verpflichtet habe. Aber es war wie die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Sie waren immer vor mir im Ziel.« Der Major sah, dass der alte Bauer noch immer zweifelte, doch darauf kam es nicht an. Amherd spürte, dass er endlich auf dem richtigen Weg war.
Er musste sich gedulden. Es dauerte zwei weitere Tage. Bei einem Rundgang durch das Dorf fiel ihm ein Wagen auf, zu groß, zu teuer für diese Gegend, mit einem Schweizer Kennzeichen. Er beobachtete aus einiger Entfernung wie das Fahrzeug am Fuße des Canigou in den Serpentinweg einbog, der zum Kloster hinauf führte. Aufmerksam geworden, setzte er sich, trotz der Kälte, auf eine Bank, die an der Fassade eines alten Bauernhauses unter dem Schutz eines überstehenden Strohdaches stand und wartete. Innerhalb der nächsten Stunde registrierte er vier weitere Fahrzeuge, teils mit französischen, andere mit deutschen Kennzeichen, die den gleichen Weg nahmen. So schnell er konnte, trat er den Rückweg an.
Abadie beobachtete mit gekrauster Stirn wie sich der Ermittler, ohne sich den Mantel auszuziehen, sofort vor das auf dem Tisch aufgebaute Empfangsgerät setzte und die Kopfhörer aufzog. Er betätigte mehrere Knöpfe und den Schalter für die Aufnahme.
»Was ist?«, fragte der Bauer und trat näher.
»Es geht los«, antwortete der Major außer Atem. Amherd reichte dem Bauern ein zweites Paar Kopfhörer. Gespannt warteten die beiden Männer. Die ersten Stimmen wurden hörbar. Das Refektorium füllte sich mit den Ankömmlingen. Schweigend harrten die beiden Zuhörer aus und verfolgten mit angespannten Mienen die sich langsam entwickelnde Diskussion, die auf Französisch geführt wurde.
Mehr als eine Stunde verging. Maurice Abadie sah, wie sich die Hautfarbe des Ermittlers vor Erregung dunkel färbte. Sein Atem ging stoßweise. Immer wieder streiften sich ihre Blicke und jeder las im Gesicht des anderen das Entsetzen über das, was sie hörten.
Am Ende riss sich Abadie die Hörer vom Kopf und warf sie neben sich auf den Boden. Die Züge seines kantigen Gesichtes waren versteinert und glichen mit ihren tiefen Furchen mehr denn je der Oberfläche des Gebirges, in dessen Schatten er lebte.
Er stand wortlos auf, durchquerte den Raum, ergriff eines der gläsernen Behältnisse mit der farblosen Flüssigkeit, die an der Durchreiche zur Küche standen, und trank die noch halbvolle Flasche in einem Zug leer. Mit einem Schrei, in dem sich die ganze in ihm aufgestaute Wut, sein Schmerz, das Gefühl der Hilflosigkeit im Angesicht des wahren Bösen Bahn brachen, warf er die leere Flasche in eine Ecke des Zimmers, wo sie, mit einem lauten Knall in zahlreiche Scherben zerborsten, liegen blieb ...
1. Prolog
‚Schattenküsse, Schattenliebe, Schattenleben, wunderbar!
Glaubst du, Närrin, alles bliebe Unverändert, ewig wahr?‘
Heinrich Heine: Neue Gedichte. Verschiedene. Seraphine, 9.
Frühjahr 1999
Noch 39 Wochen bis zum Millennium
1. Kapitel
I.
‚Ein Kirchenfenster ist die durchsichtige Trennwand zwischen meinem Herzen und dem Herzen der Welt.‘
Marc Chagall
Historisch betrachtet bildete das Fraumünster, eine der vier reformierten Altstadtkirchen und eines der Wahrzeichen der Stadt, eine Keimzelle der Stadt Zürich.
Die Kirche des 853 von Ludwig dem Deutschen, einem Enkel Karls des Großen, gegründete Benediktinerinnenstifts, dessen Gründungsurkunde zu den ältesten Schriftstücken im Staatsarchiv des Kantons Zürich zählte, war eine Institution, die lange Zeit aktiv an der Stadtgeschichte mitwirkte.
Der wunderbar einfach gestaltete hohe romanische Chor aus den Jahren 1250 bis 1270 war ein magischer Ort. Das lag nicht zuletzt an den Glasfenstern, einem fünfteiligen Fensterzyklus und einer Rosette, die der weißrussische Ausnahmekünstler Marc Chagall in den 1970er Jahren, bereits über achtzigjährig, schuf. Das weltberühmte Meisterwerk Chagalls verzauberte seitdem die Betrach ter und entführte sie aus der Realität in eine ganz besondere, den Problemen der Welt entrückte Sphäre.
Wie war es möglich, dass das Lebewesen Mensch, diese unvollkommenste aller Schöpfungen, fähig zu jeder Zeit einen Krieg heraufzubeschwören, mit allem dazugehörigen Leid, aller unbeschreiblicher Grausamkeit, zugleich in der Lage ist, etwas so Schönes zu erschaffen? Ein Werk, dessen bloßer Anblick imstande war, dem Betrachter die Tränen in die Augen zu treiben. Das Höchste und das Niederste vereint in einer Hülle.
Leonardo, der wohl genialste aller Künstler, zauberte Meisterwerke auf die Leinwand, die von so filigraner Zerbrechlichkeit und fast atemberaubender Schönheit waren und entwarf zur gleichen Zeit rollende Geschütze und eine Art von Maschinengewehr.
Die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts, das geprägt war von zwei Weltkriegen und unzähligen weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, brachten den Jugendstil mit seiner verspieltphantastischen Floralornamentik, die Schönheiten des ausgehenden Impressionismus, die Farbenkraft des neu entstehenden Expressionismus hervor. All dies geschah zur gleichen Zeit. Zu all dem war der Mensch gleichzeitig fähig.
Wann immer Sebastian Maler nach Zürich kam und die Zeit fand, ging er in das Fraumünster. Er ließ die Welt hinter sich, setzte sich auf eine der dem Chorraum am nächsten stehenden Bänke und verlor sich in der Welt Chagalls, dessen im Schein des Sonnenlichts erstrahlende Farben ihn lockend forttrugen, fühlte, wie er langsam ruhiger wurde, und verspürte bald den so ersehnten inneren Frieden.
Er hätte die Abfolge der Fenster mit geschlossenen Augen genau beschreiben können, so gut kannte er sie.: Das blutrote ‚Propheten‘-Fenster, an der nördlichen linken Wand, das im unteren Teil Elischa darstellt, der Elijas Himmelfahrt in einem Flammenwagen beobachtet; darüber, in göttliches Blau getaucht, sitzt Jeremias. Das ‚Gesetzes‘-Fenster an der gegenüberliegenden Südwand: Moses, der auf den Ungehorsam und das Leiden der Menschen herabsieht, die einem Reiter in den Krieg folgen. Darunter ist Jesaja in den Armen eines Engels zu sehen, der sich darauf vorbereitet der Welt seine Friedensbotschaft zu verkünden. Die drei Hauptfenster: das Linke, das ‚Jakobs‘-Fenster, der Kampf des Patriarchen mit dem Engel und sein Traum von einer Leiter in den Himmel. Das gelbe ‚Zion‘-Fenster zur Rechten zeigt einen Engel, der mit der Posaune den Beginn der Ewigkeit und das Herabsteigen Neu-Jerusalems vom Himmel anzeigt; darunter sind ein strahlender König David und Bathseba zu sehen. Das zentrale ‚Christus‘-Fenster schließlich zeigt Joseph, der neben einem mächtigen Baum steht - dem Baum des Lebens, der Familie und des Erlösers. In seinen oberen Ästen schwebt eine Vision Marias mit dem Jesuskind, das Gotteslamm zu ihren Füssen.
»Szenen aus dem Leben Jesu und Parabeln kulminieren in einer assoziativen Darstellung der Kreuzigung. Ein Kreuz ist knapp sichtbar und Christus schwebt bereits, von der Welt befreit, zur Quelle eines Lichtes über ihm.«
Sebastian horchte für einen Augenblick der gesenkten Stimme einer Fremdenführerin, die eine Gruppe Touristen durch die Kirche führte.
»Sie sind fasziniert.«
Der Mann, der neben ihm im Gang stand, trug einen hellen Trenchcoat. Er folgte dem Blick des jungen Mannes. »Das kann ich gut verstehen.«
»Sie interessieren sich für Kunst?«, fragte Maler.
»Sie verstehen sicher mehr davon als ich.«
Maler rückte zur Seite und machte den Platz frei. Der Mann im Trenchcoat setzte sich neben ihn. Für einen Augenblick überliessen sie sich der Atmosphäre des Gotteshauses.
»Haben Sie sich entschieden?«
Maler hielt seine Augen fest auf die Glasfenster gerichtet. »Ja. Ich werde es machen. Und Sie wussten genau, dass ich mich so entscheiden würde. Leute wie Sie überlassen nichts dem Zufall.«
»Das wäre fahrlässig und eventuell sogar tödlich. Ich ... wir müssen uns absichern. Es ist ein Geschäft und für beide Seiten ein Gewinnbringendes.«
»Wenn man sich an die Regeln hält«, ergänzte Maler.
»Wir sichern Ihnen absolute Straffreiheit zu. Sie werden aus allem rausgehalten. Dazu stehen wir.«
Maler schloss die Augen. Wie naiv er gewesen war. Diese Situation hier, dieses Treffen, wirkte fast surreal auf ihn. Wie hatte er in eine solche Lage kommen können? Dabei hatte doch alles so positiv, so hoffnungsvoll begonnen. Er erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen ...
Ein sonniger Morgen im Spätsommer, Semesterferien. Er war aus Köln, wo er studierte, nach Stuttgart zu seinen Eltern gefahren. Sein Vater betrieb eine Autowerkstatt. Er hatte sich auf Oldtimer spezialisiert und sich in diesem Bereich einen Namen gemacht., der auch über die Grenzen des Landes hinausging.
An diesem Morgen war ein auf Hochglanz polierter 71er 280 SE Coupé mit Schweizer Kennzeichen auf den Hof gefahren. Sebastian beobachtete aus dem Fenster seines Zimmers im zweiten Stock des elterlichen Hauses, in dessen unteren Etagen sich die Autowerkstatt befand, dass ihm ein elegant gekleideter etwa sechzigjähriger Mann entstieg. Er hatte volles, graumeliertes Haar, das er im Nacken lang trug, was durchaus zu dem ovalen Kopf mit der sonnengebräunten Haut passte. Er nahm langsam die blaugetönte Sonnenbrille ab und sah sich interessiert um.
Sebastians Vater trat aus der Werkstatt und begrüßte den Ankömmling mit Handschlag. Offenbar war er angekündigt. Dem jungen Kunststudenten fiel sofort die reich beringte Grußhand auf, die im Sonnenlicht aufblinkte, als habe jemand den Blitz an einem Fotoapparat ausgelöst.
Der Mann führte seinen Vater zu dem Wagen und erklärte ihm einiges. Sebastian öffnete neugierig geworden das Fenster.
»Und Sie glauben, Sie können das in zwei, drei Tagen erledigen?«, fragte der Mann skeptisch.
»Keine Sorge, Herr de Ungeloube. Ich habe alle passenden Teile da. Es ist nur ein wenig Bastelei.«
Der Angesprochene nickte zufrieden. »Ich bin noch bis Ende der Woche in Stuttgart. Zu einer Messe. Ich wohne im Intercontinental an der Neckarstraße. Könnten Sie mich dort anrufen, wenn Sie fertig sind?« Er griff in die Seitentasche seines dunkelblauen Jacketts und zog einen silbernen Visitenkartenhalter hervor, dem er eine Karte entnahm und seinem Vater gab.
»Hier ist meine vollständige Adresse. Ich betreibe ein Auktionshaus in Zürich.«
Bei dem Wort ‚Auktionshaus‘, stellten sich bei Sebastian die Ohren auf. Der Kunststudent war dringend auf der Suche nach einem Studiennebenverdienst. Nachdem der Besucher das Gelände verlassen hatte, ging er hinunter in die Werkstatt zu seinem Vater und bat um die Visitenkarte.
Zwei Tage später war der Wagen fertig und Sebastian bot sich an, zum Hotel zu fahren, um die Nachricht persönlich zu überbringen. Das mache doch einen guten Eindruck und dieser Ungeloube habe bestimmt eine Menge wohlhabender Freunde, die, so wie er, Oldtimer führen. Und schon war er verschwunden.
Er hatte das beste angezogen, was sein magerer Kleiderschrank zu bieten hatte und einige Dokumente dabei, unter anderem sein sehr gutes Abiturzeugnis und die Immatrikulationsbescheinigung der Uni.
Mit klopfendem Herzen betrat er die luxuriöse Hotelhalle, ging zur Rezeption und fragte nach Herrn de Ungeloube. Er hatte Glück, der Auktionator war da und man ließ ihn nach kurzer telefonischer Ankündigung durch. Ungeloubes Suite lag im zweiten Stock. Der Auktionator öffnete selbst die Tür, lächelte ihn freundlich an und bat ihn ins Zimmer.
»Das wäre doch nicht nötig gewesen«, sagte er. »Ein Anruf hätte genügt.«
Sebastian übergab ihm die Wagenschlüssel und den Umschlag mit der Rechnung, die Ungeloube unbeachtet auf einen kleinen Seitentisch legte. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
Der Kunststudent dankte und nahm einen Orangensaft, den der Auktionator der Minibar entnahm.
Sebastian sah sich im Zimmer um und entdeckte einen Couchtisch, auf dem ein halbes dutzend Kunstbildbände lagen und, an Möbel und Wände gelehnt, ein gutes Dutzend gerahmter Bilder.
Ungeloube kehrte mit einem gefüllten Glas zu ihm zurück. Er bemerkte den interessierten Blick des jungen Mannes.» Ich besitze ein Auktionshaus in Zürich«, sagte er erklärend.
»Ich weiß«, sagte Sebastian zögernd. Er trat näher an eines der Bilder heran. »Ein Calvaert - wunderbar.«
»Auf den ersten Blick erkannt?«, fragte Ungeloube überrascht. Sicher hatte er das von dem Sohn eines Automechanikers nicht erwartet.
Maler fasste sich ein Herz, erklärte, er studiere Kunstgeschichte an der Uni Köln. Die Kunst sei schon immer seine ganze Leidenschaft gewesen. Sein Taschengeld und der schmale Verdienst neben der Schule durch Aushilfsarbeiten, seien von je her für Kunstbildbände draufgegangen. Was immer er sich in Stadtbibliotheken besorgen konnte, hatte er gelesen. Besonders die Kunst der deutschen Renaissance, allen voran Lucas Cranach des Älteren, fasziniere ihn besonders. Aus mehreren Gründen ...
Mit dem Studium habe sich sein Lebenstraum erfüllt. Die Öffnung der Türen der Unibibliothek, seien für ihn wie die Öffnung der Tore des Paradieses gewesen.
Ungeloube verstand sofort. Er erkannte das Feuer, das in dem jungen Mann brannte und es erinnert ihn an sich selbst als er jung gewesen war.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas für Sie tun kann«, sagte er lächelnd. »Mein Geschäft liegt in der Schweiz, wie Sie wissen. Sie studieren in Köln ...«
»Aber in den Semesterferien bin ich frei«, fiel ihm Maler ins Wort. Allein der Gedanke tatsächlich in Kontakt mit den Kunstwerken zu kommen, die er bisher nur aus Büchern und dem Studium aus der Ferne in den Museen kannte, elektrisierte ihn so sehr, dass er alle guten Umgangsformen vergaß.
Am Ende des Gespräches waren anderthalb Stunden vergangen und Ungeloube hatte sich vom Eifer des Studenten anstecken lassen. Er versprach sich bei ihm zu melden, sobald er zurück in der Schweiz sei.
Und tatsächlich hielt er sein Versprechen. Bereits in den folgenden Semesterferien reiste Sebastian zum ersten Mal nach Zürich ...
Maler öffnete die Augen. Das sanfte Licht war wie eine tröstliche, wärmende Umhüllung in der Kälte der Realität.
»Ich verstehe, dass es Ihnen schwerfällt.«
»Tut es nicht«, antwortete Maler trotzig. »Ich habe zu lange gebraucht, um zu begreifen, was gespielt wird. Das ärgert mich. Ich habe mich blenden lassen von Ungeloubes schönem Schein, bin ihm ins Netz gegangen. Ich habe mitgespielt. Ich gebe zu, es hat mich fasziniert. Ungeloube hat genau gewusst, mit wem er es bei mir zu tun hat: jung, unbedarft, geblendet. Und er hat mich gekauft. Die Höhe des Verdienstes war für einen Studenten unvorstellbar.«
»Er hat Sie missbraucht.«
»Er hat die Kunst missbraucht. Sie ist etwas Heiliges. Das werde ich ihm nie verzeihen. Und mir auch nicht ...«, fügte er leise an.
Er spürte eine Hand auf seiner Schulter.
»Sie tun das Richtige. Sie sind im Moment unser wichtigster Zeuge, Sebastian. Ohne Sie kommen wir an Ungeloube, und vor allem an die, die hinter ihm stehen, nicht ran. So nah wie Sie ihm sind, war noch niemand.«
»Ich weiß. Ich glaube sogar, dass er mich mag. Er hat vielleicht geglaubt, er könne mich in seinem Sinn ‚erziehen‘.«
»Ich mache Ihnen nichts vor. Es ist gefährlich. Es handelt sich hier um Schwerstkriminalität. Der illegale Kunsthandel hat längst eine Dimension erreicht, die dem Waffen- und Drogenhandel in nichts nachsteht. Was wir brauchen, sind so viele beweiskräftige Informationen wie nur möglich. Das ist auch zu Ihrem Besten. Sie werden zu gegebener Zeit unser wichtigster, unser Kronzeuge sein. Alles was Ihre Glaubwürdigkeit dabei untermauert, ist auch zu Ihrem Vorteil.«
»Haben Sie daran gedacht, dass ich den Spieß auch umdrehen könnte?«, fragte Maler.
Nach einem kurzen Zögern kam eine klare Antwort: »Wir wissen sehr genau, mit wem wir uns einlassen.«
Maler schüttelte den Kopf. »Sie haben mich vollkommen durchleuchtet.«
»Vergessen Sie nicht, dass Sie selbst sich in diese Situation gebracht haben«, mahnte er den jungen Studenten. »Sie haben es selbst gesagt: Sie wussten schon länger, in welch brisanten Geschäften Ungeloube seine Finger hat. Sie haben das Spiel mitgespielt.«
Maler konnte nicht widersprechen. Er griff zögernd in die Innentasche seiner Jacke und zog einen weißen Briefumschlag hervor. »Das ist mein nächster ‚Auftrag‘«, sagte er und reichte seinem Sitznachbar das Kuvert. »Ein ‚klassisches‘ Ungeloube-Geschäft. Ein fingierter Einbruch. Die Beute, hauptsächlich Bilder und ein, zwei Skulpturen, werden dann an in einer nicht öffentlichen Auktion an eine ausgewählte Käuferschaft verkauft. Ungeloubes Klientel ist handverlesen und er weiß genau, wer auf was scharf ist. Die Provenienz spielt bei diesen Leuten keine Rolle. Zur Not gibt es gefälschte Papiere. Er hat für alles seine Leute.«
»Versicherungsbetrug?«
»Ja, sicher. Aber der Fall ist komplexer.« Sebastian beobachtete wie der Mann neben ihm den Briefumschlag öffnete. Er überflog die aufgezeichneten Informationen und der Student sah, dass er überrascht war.
»Ich habe gleich einen Termin dort. Ungeloube besitzt ein Verzeichnis der gesamten Sammlung und hat vorab die in Frage kommenden Stücke ausgewählt. Ich werde sie mir im Original ansehen und wenn alles in Ordnung ist, die involvierten Personen über den weiteren Verlauf informieren. Anschließend bekomme ich die Details, was den vorhandenen Sicherungsstandard angeht. Die Sache muss aus bestimmten Gründen ziemlich schnell durchgezogen werden.«
»Wir hätten also nicht viel Zeit zum Handeln.«
Maler zuckte die Schultern. »Sie entscheiden.« Er sah, wie der Umschlag in der Innentasche des Mantels seines Sitznachbarns verschwand.
»Ich werde wieder mit Ihnen in Kontakt treten. Sie werden eine Mitteilung bekommen, wann und wo. Und wir entscheiden, wann wir den Deckel draufmachen.«
Maler nickte. Der Mann im Trenchcoat erhob sich und verließ gemessenen Schrittes das Kirchenschiff.
Der Student horchte dem Nachhall der sich langsam entfernenden Schritte. Er sah auf die Uhr an seinem Handgelenk: Noch eine halbe Stunde. Er musste sich beeilen. Sein nächster Termin lag weit außerhalb des Stadtzentrums. Er stand auf und wandte sich schwerem Herzens von den Fenstern ab, deren Licht ihm so viel Trost gab.
Er verließ die Kirche durch den Haupteingang und bog nach rechts auf den Münsterhof ab, den großen Platz vor der Kirche. Tief in Gedanken über das gerade geführte Gespräch und den anstehenden Termin, wäre er fast mit einem großen, untersetzten Mann zusammengestoßen, der ihn stumm mit einem grimmigen Blick von oben herab bedachte.
Sein fleischiges Gesicht war gekennzeichnet von einer knolligen, pockennarbigen Nase und schweren, grauweißen Augenbrauen. Die vollen Lippen mit den nach unten gezogenen Mundwinkeln zeigten einen ungesundes blauviolett. Er atmete schwer. Eine Schirmmütze, tief in die Stirn gezogen, warf einen Schatten auf das von einem glänzenden Schweißfilm bedeckte Gesicht.
Sebastian war sofort weitergegangen, doch irgendetwas veranlasste ihn stehenzubleiben und sich noch einmal umzudrehen. Er sah, dass auch der Fremde halt gemacht hatte und ihn erneut mit einem misstrauischen Blick bedachte, prüfend und voller Argwohn. Dann schien er sich zu besinnen, wandte sich ab und setzte seinen Weg fort, ging durch die Torbögen in den Kreuzgang der Kirche.
Der intensive Blick des Fremden verfolgte Sebastian noch als er bereits in die Fraumünsterstraße einbog, in der sein Wagen stand.
II.
Bevor Regine Spyri zur Kantonspolizei wechselte, war sie 5 Jahre lang als Bezirksanwältin in der Strafverfolgung Wirtschaftskriminalität tätig gewesen.
Seit gut einem Monat war sie als erste Frau auf diesem Posten Chefin der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Zürich. Sie war sich ihrer Qualifikationen bewusst, ebenso sehr wie ihr klar war, dass die Berufung einer Frau auf diesen Posten umstritten war. Die daraus resultierende Erwartungshaltung, intern wie auch in der Öffentlichkeit, war ungleich höher als bei einem Mann in dieser Position. Es gab nicht wenige, die darauf warteten, dass sie Fehlentscheidungen traf, um sich in ihren Vorurteilen bestätigt zu sehen. Auf der anderen Seite ruhten die hoffnungsvollen Augen einer Schweizer Frauenrechtsbewegung auf ihr. Die Schweiz war eines der letzten europäischen Länder, die seiner weiblichen Bevölkerung die vollen Bürgerrechte zugestanden hatte. Es war gerade erst einmal knapp dreissig Jahre her, dass formell das Frauenwahlrecht für das gesamte Land wirksam geworden war.
Spyris Vorgänger hatte mit seiner Skepsis ihr gegenüber nicht hinter dem Berg gehalten. Dennoch hatte er ihr einige gute ‚Navigationstipps‘ mit auf den Weg gegeben, die es ihr ermöglichten, einige gefährliche Klippen ohne Gefahr umfahren zu können.
Die Personalakte eine dieser Klippen lag aufgeschlagen vor ihr auf dem Schreibtisch. Es war eines der letzten noch zu führenden Personalgespräche und sie hatte es, solange es ging hinausgeschoben.
Guisepp Amherd war seit dreissig Jahren bei der Kantonspolizei. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee, in der er als Berufssoldat gedient hatte, war er dorthin gewechselt und hatte es bis zum Major mit Berechtigung zur Leitung einer Hauptabteilung gebracht. Amherd war ein charismatischer Charakter, willensstark, ganz seinem Beruf verpflichtet. Die Leute seines Teams waren ihm treu ergeben. Er war ihr Leitwolf, genoss ihren Respekt. Seine sture Beharrlichkeit hatte ihm eine nicht zu verachtende Erfolgsquote eingebracht. Er verbiss sich bis an die Grenzen der völligen Selbstaufgabe in seine Fälle, ging dabei nicht selten bis an die Grenzen des von seinen Vorgesetzten duldbaren - manchmal darüber hinaus - und wurde dennoch immer gedeckt von den Leuten seiner Abteilung, die ihm den Rücken freihielten.
Sie blätterte in den vor ihr liegenden Papieren. Eine schriftliche Abmahnung folgte der nächsten. Es waren halbherzige Versuche der Züchtigung. Gestärkt durch seine Erfolgsquote bei der Aufklärung der Fälle und der Nibelungentreue seiner Mitarbeiter, zog er immer wieder den Kopf aus der Schlinge. Und schließlich ließen die Strahlen der Sonne von Amherds Erfolgen auch seine Vorgesetzten in goldenem Licht erscheinen.
Regine Spyri folgte diesem Weg nicht. Sie verfolgte eine eigene Strategie, versuchte der Kriminalpolizei ein eigenes, der Zeit gemäßes Gesicht zu geben. Und sie musste prüfen, ob Guisepp Amherd in dieses Konzept passte.
Sie dachte an die letzte Unterredung mit ihrem Vorgänger zurück. Irgendwann musste er unweigerlich auf Amherd zu sprechen kommen. Etwas ganz bestimmtes in diesem Gespräch war ihr präsent im Gedächtnis geblieben: Die wirklichen Probleme begannen für ihn vor gut zwei Jahren. Amherd und sein Team ermittelten in dem Fall des ermordeten Bundesanwalts René Luett. Luett war in Zürich auf offener Straße erschossen worden. Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen. Amherd und sein Team hatten die ersten Ermittlungen durchgeführt. Doch dann wurde von höherer Stelle entschieden, die weitere Ermittlungsarbeit der Bundespolizei zu übertragen. Amherd hatte sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gewehrt - vergebens.
Die Ermittlungen der Bundespolizei kamen am Ende zu keinem befriedigenden Abschluss. Ein Täter konnte nicht präsentiert werden. Die Medien riefen einen Justizskandal aus. Im Anschluss begannen die massiven Probleme mit Amherd. Er distanzierte sich, auch von seinem Team, begann eigene Wege zu gehen und wurde mit fortschreitender Zeit immer unzugänglicher. Es gab Beschwerden von verschiedensten Seiten gegen den Major, der offenbar, ohne dafür die Befugnis zu haben, weiter im Fall Luett ermittelte. Spyris Vorgänger sah sich schließlich gezwungen, die Reißleine zu ziehen und Amherd vor vollendete Tatsachen zu stellen. Da der Major keine konkreten Fakten beibringen konnte, die zur Aufklärung des Falles hätten beitragen können, setzte man ihm die Pistole auf die Brust: Einstellung jeglicher Ermittlungen oder vorzeitiger Ruhestand mit sofortiger Wirkung. Amherd schien klein bei zu geben und fügte sich. Er blieb auf seinem Posten, aber er wurde endgültig zum Einzelgänger. Auch sein Team fand irgendwann keinen Zugang mehr zu ihm.
Nach allem was Regine Spyri bisher über Amherd gehört, was sie über ihn gelesen hatte, beim Studium seiner Akte, zu der auch zahlreiche Belobigungen gehörten, sowie, das war übliche Praxis, ein psychiatrisches Gutachten - trotz aller Schwierigkeiten, dieses Ende passte für sie nicht ins Bild.
Zeit seines Berufslebens hatte Amherd niemals aufgegeben. Je schwieriger es wurde, desto verbissener kniete er sich rein. Die Androhung eines vorzeitigen Ruhestandes an sich, konnte einen solchen Mann kaum abschrecken, wohl aber die damit verbundene Kaltstellung. War er einmal raus aus dem System, so waren ihm die Hände vollkommen gebunden. Was war er, ohne den Dienstausweis, der ihn als Mitglied der Kantonspolizei auswies und deren reiner Anblick schon Respekt abforderte? Er war allein, seine Frau war seit fünfzehn Jahren tot. Er hatte einen Sohn über den aber nichts weiter in den Akten stand. Gerüchteweise hieß es, er habe keinerlei Kontakt mehr zu ihm. Er brauchte also keine Rücksichten zu nehmen.
Nein, Regine Spyri war sich sicher, dass Amherd nicht aufgege ben, sondern weiterermittelt hatte. Er hatte nur zum Schein klein bei gegeben.
Wie sollte sie damit umgehen?
Sie konnte es sich leicht machen: Eines der letzten Papiere in der Personalakte war der Arztbericht der letzten ärztlichen Untersuchung, der sich alle Mitarbeiter der Polizei in regelmäßigen Abständen unterziehen mussten. Guisepp Amherd war nach diesem Bericht gesundheitlich angeschlagen. Besonders sein Herz wies klare Abnormalitäten aus.
Nach diesem Bericht war es kein Problem, den Ermittler tatsächlich mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand zu versetzen.
Die Leiterin lehnte sich zurück, den Blick fest auf die aufgeschlagene Akte geheftet. Ein Klopfen riss sie aus ihren Gedanken.
»Ja, bitte?«
Die Türe öffnete sich und deine zierliche, junge Frau erschien im Türrahmen. »Hauptmann Schaller wäre jetzt da.«
»Ja. Er soll reinkommen.«
Der Hauptmann, lässig in Jeans, weissem Hemd und dreiviertellanger Outdoorjacke gekleidet, war sichtlich nervös.
Die Leiterin lächelte und bot ihm einen Platz vor ihrem Schreibtisch an.
Schaller war mit Mitte dreissig im Alter gutes Mittelmaß. Er war seit zehn Jahren im Team von Guisepp Amherd und nach Aussagen sein engster Mitarbeiter.
Regine Spyri kam, wie sie es gerne tat, schnell auf den Punkt. Hauptmann Schaller hörte sich geduldig an, worum es ging.
»Sie haben lange mit Amherd zusammengearbeitet«, fasste Spyri zusammen. »Können Sie sich den Wandel in seinem Verhalten erklären?« Natürlich hatte sie sich auch Schallers Akte genau angesehen und wusste, dass der Ermittler klug genug war zu begreifen, worum es eigentlich ging.
Er zögerte merklich mit der Antwort und sagte dann zu Spyris Überraschung: »Guisepp Amherd ist einer der besten Kriminalisten, die ich kennen gelernt habe. Er hat mir alles beigebracht, was ich kann.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage.«
»Ich wollte das nur klarstellen«, sagte Schaller. »Alle anderen haben ihn fallen gelassen, ihn verspottet, ihn sogar für verrückt erklärt. Ich nicht. Er war es, der mir gesagt hat, ich müsse Abstand zu ihm halten. Er sei gefährlich.«
»Wie meinte er das?«
»Sie haben doch sicher mit Ihrem Vorgänger über ihn gesprochen?«
Spyri hielt es für sinnlos, das abzustreiten.
»Aber er hat Ihnen bestimmt nicht alles gesagt, was Amherd angeht. Ich wette, das Wichtigste hat er verschwiegen. Er war derjenige, der ihn in die Ecke des Verrückten, des Verschwörungstheoretikers gestellt hat. Er wollte ihn unter allen Umständen kaltstellen.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Hauptmann Schaller«, sagte die Leiterin. »Aber warum sollte er das gewollt haben?«
Der Hauptmann beugte sich vor. »Auch wenn keiner ihm sonst glaubt, ich weiß, dass Guisepp Amherd einer riesigen Schweinerei auf die Spur gekommen ist.«
»Sie meinen den Fall Luett?«
»Luett war nur der Anfang ...«
III.
Guisepp Amherd betrat den Innenhof des Fraumünsters, verschwand sofort in die schützenden Schatten des Kreuzganges und wartete, den Blick in den Hof gerichtet.
Niemand folgte ihm. Er wartete so lange, bis er sich sicher war und lehnte sich an eine der Wände mit den Freskenmalereien die Paul Bodmer, der Schweizer Wand- und Bühnenmaler, zwischen neunzehnhundertvierundzwanzig und -vierunddreissig dort geschaffen hatte.
Vor der Toreinfahrt war er fast mit einem jungen Mann zusammengestoßen. Gerade diese zufälligen Begegnungen versetzen ihn in Unruhe. Seine Hand wanderte zu seinem breiten Hals und seine Finger ergriffen eine feingliedrige Silberkette. Er zog sie aus dem Ausschnitt des karierten Hemdes hervor und umklammerte einen Schlüssel, der daran hing. Sein Herz schlug nervös heftig klopfend gegen die Rippenbögen, als wolle es den schützenden Raum, seinen Brustkasten, verlassen. Wie lange würde er dieses Leben noch aushalten? Die ewige Unsicherheit und das ständige Gefühl, beobachtet zu werden? Er wischte sich mit dem Ärmel seiner Jacke den Schweiß vom Gesicht und zog sich die Schirmmütze vom Kopf.
Wie er es mittlerweile gewohnt war, hatte er seinen Wagen in einiger Entfernung zum Zielort geparkt, war, wie ein Hase Haken schlagend, durch die Altstadt gelaufen. Immer wieder war er in einer Hofeinfahrt oder dunklen Hausfluren abgetaucht, hatte gewartet, bis er sich sicher war, dass ihm niemand folgte.
Er war durch die schmale, überschaubare Storchengasse gekommen. Sie verband den sich an die den Limmat überquerende Rathausbrücke angrenzenden Weinplatz inklusive Winzerbrunnen und den Münsterhof mit dem Fraumünsterkomplex und dem Rokokopalast der alten Gastwirtezunft ‚Zunfthaus zur Meisen‘ aus dem achtzehnten Jahrhundert mit Ehrenhof und elegantem schmiedeeisernen Tor, in dessen Café schon Gottfried Keller und Ferdinand Hodler Gäste gewesen waren. Es war das Zentrum der Altstadt, inmitten des Dreiecks der die Silhouette der Stadt prägenden Kirchen Fraumünster und St. Peter auf der linken Seite des Limmat, Grossmünster auf der Rechten. Wie gut er das alles kannte. Auf diesen Straßen hatte er die letzten dreissig Jahre seines Lebens verbracht, hier kannte er jeden verborgenen Winkel. Es war sein Terrain, auf dem ihm keiner etwas vormachte.
»Sepp!«
Amherd wandte sich erschrocken um. Ein kleiner Herr in seinem Alter, elegant in einen dunklen Tuchmantel mit Seidenschal gehüllt, kam ihm aus dem oberen Kreuzgang entgegen.
Amherd entspannte sich. »Willi.«
Der Mann hatte ihn erreicht und blieb, die Hände in den Manteltaschen vergraben, mitten im Gang stehen. Ein vertrauter Blick aus besorgten Augen traf ihn. »Du siehst schlecht aus.«
»Spar es dir, Wilhelm Bürgi«, sagte Amherd. »Du bist Anwalt nicht Arzt.«
»Was soll das hier? Meine Kanzlei liegt nur eine Straße weiter.«
»Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden, Willi. Du hast doch niemandem erzählt, wohin du gehst?«
»Nein«, antwortete der Anwalt pikiert. »So wie du es wolltest.« Seine Augen forschten in Amherds verwittertem Gesicht, das erneut von Schweißperlen bedeckt war. Er sah die dunklen Ringe unter den Augen. »Wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Ich war in den Pyrenäen«, sagte Amherd zögernd. »Und ich war erfolgreich - endlich. Nach all der Mühe und Arbeit, schießt sich der Kreis.« Er sah die Besorgnis im Gesicht des Freundes. »Wie lange kennen wir uns jetzt, Willi?«
»Nahezu dreissig Jahre«, sagte Bürgi. »Der Fall Lotter. Dein erster Fall bei der Kantonspolizei.«
»Und dein erster Strafrechtsprozess.«
»Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben.«
»Es waren nicht immer friedliche Jahre«, bekannte Amherd.
»Dafür erfolgreich. Wir haben nicht immer auf derselben Seite gestanden, aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft.«
»Du warst ein treuer Freund, Willi. Und du bist es, bis zum heutigen Tag. Sehr geduldig mit mir und meinen ‚Spinnereien‘. Das weiß ich sehr wohl.«
»Ich habe niemals einen Menschen kennengelernt, der klarer gedacht hat als du, Sepp, der aufrichtiger und ehrlicher gewesen wäre. Und es ist mir vollkommen egal, was die anderen sagen.«
»Ich habe alles versucht, die richtigen Stellen auf die Gefährlichkeit von ‚EpiDemos‘ aufmerksam zu machen«, fuhr Amherd fort. »Sie haben mir nicht geglaubt - oder wollten es nicht, weil sie selber bis zum Hals mit drin steckten. Als mir das klar wurde, gab es nur noch einen Weg für mich: Abtauchen, aus dem Blickfeld verschwinden aber am Ball bleiben. Es hat mich die letzten Kräfte gekostet. Ich habe gezögert, vielleicht zu oft, und mich immer wieder gefragt, ob es nicht einen anderen Weg gibt.« Er schüttelte den Kopf. »Du weißt, warum.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«, fragte Bürgi.
»Ich habe ihn zu einem Treffen gebeten.«
»Und wird er kommen?«
»Es ist der letzte Versuch ihn zur Umkehr zu bewegen. Das ist meine Pflicht als Vater. Aber ich bezweifle, dass es fruchtet«, fügte er leise an.
»Es ist nicht nur deine Schuld«, entgegnete der Anwalt. »Ruedi war immer schwierig, ein Einzelgänger, schwer zugänglich.«
»Ich mache mir nichts vor, Willi. Als Vater habe ich versagt. Der Beruf war mir wichtiger. Die Familie ist mir irgendwann entglitten.« Er packte die Kette, die um seinen Hals hing, zerrte so heftig daran, dass sie zerriss. Als er Bürgi mit ausgestrecktem Arm den Schlüssel, der an der Kette baumelte, entgegenhielt, zitterte er.
»Was ist das?«, fragte der Anwalt.
»Ich habe dich einmal etwas gefragt, Willi«, sagte Amherd. »Stehst du zu deinem Wort?«