
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Jonah Fink
- Sprache: Deutsch
Auf den ersten Blick scheint Jonah Fink ein ganz normaler Junge zu sein. Er geht zur Schule, interessiert sich für Fußball, hat Freunde. Doch es gibt einen wunden Punkt in seinem Leben: Sein Vater ist von einem Tag auf den anderen verschwunden. Seitdem ist nichts mehr so wie vorher. Drachenfels am Fuße des Rhenus. In der renommieren Schule eines magischen Ordens, geht die Angst um. Der Kanzler des Landes, Gereon Ggyffel, hat die magischen Orden auf eine schwarze Liste gesetzt, um sie und ihre Kräfte kontrollieren zu können. Der Leiter der Schule Magie-Großmeister Giselherr Großefuß, lässt sich davon nicht einschüchtern und geht seinen eigenen Weg. Doch die Zeiten stehen auf Sturm. Es geschehen merkwürdige Dinge, die ihn zum Handeln zwingen, wenn er seine Welt, die Welt hinter den heiligen, schützenden Nebeln, die einstige Welt der großen Druiden und Hexen, retten will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, die Welt wird von Schatten beherrscht?
Von kalten, gefühllosen, herzlosen Schatten, die alles was sie anpacken in Eis verwandeln, die Herzen der Menschen versteinern und die Kinderseelen zerstören?
Nun, vielleicht habt ihr gar nicht so unrecht …
Hoch oben im Norden, wo der Schnee niemals taut, und die Wipfel der schwarzen Bäume sich neigen unter dem ewigen Eis, das sie bedeckt, liegt, von allen gebannt, von niemandem gesucht, das Land Uruijk.
In den Höhlen seiner Gebirgsmassive, deren schneebedeckte Gipfel den Rand des Himmels berühren, stets umkränzt von Wolken, von keinem Menschenauge je gesehen, ziehen sich, so sagt die Legende, die Drachen, die uralten Herren der Welt, zum Sterben zurück.
Als die Wolken begannen sich schwarz zu färben, von Rangor, dem Nordwind, hinunter in die Täler gepeitscht; als der Tag zur Nacht wurde, durchzuckt von leuchtenden Blitzen und die Himmelsschleusen sich öffneten, und ein schauriges Wehklagen von den Gipfeln erklang, getragen vom Wind bis in die entferntesten Winkel der Erde, da wusste ein jeder, eine neue Zeit bricht an.
Einar, der Große, der Alte, der Letzte seines alten Geschlechtes, stand auf dem steinernen Balkon der Burg Langoland, dem Sitz der Herrscher von Uruijk, jenem Bollwerk des Nordens, aus dem steinernen Granit der jahrtausende alten Felsen gehauen. Er lauschte, die Hände auf die Brüstung gestützt, Umhang und Haar im Winde wehend. So horchte er auf die Stimmen.
Und er verstand.
So ging er zum König, kniete nieder und senkte den Kopf.
„Berungar, der zweite der Fürsten von Legasland und Fahresund, Beherrscher des Landes Uruijk, mein König, ich habe die Stimmen vernommen, sie klagen und zetern, denn hoch oben in den Bergen in seiner Höhle stirbt Oromac, der Letzte der Drachen.“
Der Herrscher erhob sich und ein Raunen ging durch den Saal. „Einar, mein klügster und treuester Berater, mein Freund, was wünschst du?“
„Die Stimmen rufen nach mir. Oromac will mich sehen. Gebt mir eine Handvoll Leute, in den Bergen erfahren, stark und mutig, und ich will den Aufstieg wagen.“
Sorgenfalten zerfurchten die Stirn des alten Königs. Er fürchtete, seinen klugen Berater und Freund zu verlieren. Doch noch mehr, fürchtete er den Zorn der Götter. So gab er Einar was sein Begehr und ließ ihn ziehen.
Fünf Mann, jung, groß und stark, die besten Kletterer des Landes, begleiteten den Alten bei seinem Aufstieg. Gehüllt in warme Tierfelle, von Schneehunden geleitet, kämpften sie verbissen gegen Rangor, den Nordwind, Schnee und Kälte.
Wer will sagen, wie viele Tage und Wochen ihr Aufstieg dauerte, in die raue Unwirtlichkeit des kaum erforschten Gebirgsmassives, dort oben, wo alle Grenzen verschwimmen und die Zeit nicht einmal eine Bezeichnung hat?
So drangen sie vor, bis ins Herz des Berges, in die Höhle Oromacs, am unterirdischen, schwarzen See Falgund, die getragen wird von sechs mächtigen Säulen, in die die Drachen in ihrer Sprache, mit spitzen Krallen, ihre Gesetze in den harten Stein gemeißelt hatten.
Und sie sahen Oromac den Großen, den letzten seiner Art, am Ufer des schwarzen Sees.
Bei jedem Atemstoß erzitterten die Wände der Höhle.
Als die sechs Unerschrockenen in die Höhle traten, öffnete Oromac seine Augen.
„Einar!“, rief er mit rauer, heiserer Stimme, die nur noch ein Flüstern war.
Und der Alte trat vor an das Ufer des Sees und verneigte sich. „Großer Oromac. Ich bin betrübt, dich so schwach zu sehen.“
Der Drache schloss die Augen. „Ein jedes hat seine Zeit. Die Zeit der Drachen auf Erden ist vorbei.“
„Du hast mich gerufen.“
„Unsere Zeit ist vorbei, aber unser Wissen, Einar, darf nicht verloren gehen. Vor langer Zeit haben wir mit den Menschen einen Pakt geschlossen. Jetzt sollt ihr die Bewahrer unserer Weisheit sein. Ihr habt euch als die widerstandsfähigsten Männer eures Volkes erwiesen. Ein Tag wird kommen, wo euer Mut euch Menschen retten wird, so wie euch so oft unsere Stärke und unser Mut geholfen haben.“
Einar der Große, kniete sich vor Oromac und senkte sein Haupt. Und die anderen taten es ihm nach.
„Höre, Einar“, sprach Oromac weiter. „Schlagt aus dieser Höhle ein Felsstück und meißelt ein Gefäß daraus. Dann fügt mir eine Wunde zu und fangt das austretende Blut in diesem Gefäß auf. Versiegelt es und bewahrt es, wie einen kostbaren Schatz. Denn es macht unverwundbar. Einst wird einer kommen, der dieses Blut für den alles entscheidenden Kampf braucht.“
Einar wollte heftig protestieren, doch Oromac hob schwerfällig seinen riesigen Kopf und stieß einen schrecklichen Schrei aus, so dass Felsbrocken von der hohen Decke der Höhle auf sie hinabfielen. Eine blaue Stichflamme schoss aus dem Maul des Drachen.
»Tut es!« Erschöpft sank Oromacs Kopf wieder auf den Boden. „Dir aber Einar, und nur dir, will ich in der wenigen mir verbliebenen Zeit, unsere Geheimnisse anvertrauen.“
So wählten die Vier aus den herabgestürzten Felsbrocken einen in der passenden Größe aus und begannen ihn mit ihren einfachen Werkzeugen zu bearbeiten, bis sie ein Krug ähnliches Gefäß daraus geschnitzt hatten. Einar blieb bei Oromac und horchte.
Als sie geendet hatten, traten die vier Männer zu ihnen und überreichten das Gefäß Einar. Er erhob sich traurig. Er wusste, nun gab es kein Zaudern, kein Zagen mehr. Er suchte nach seiner Waffe. Mit zitternden Händen, ein Schwert in der einen, den Krug in der anderen Hand, trat Einar an den sterbenden Drachen heran.
Oromac nickte und Einar stieß das Schwert tief in den schuppigen, harten Körper, bis das Blut in einer Fontäne hinausspritzte und sich mit den schwarzen Wassern des Sees Falgund vermischte.
Wie befohlen, hielt Einar den Krug so lange in die Fontäne, bis er bis zum Rand gefüllt war.
Oromac stöhnte und mit jedem weiteren Tropfen, das er vergoss, erlosch der Rest seines Lebens. Bis die letzte Kraft aus ihm gewichen war.
Der letzte Drache war tot …
Inhaltsverzeichnis
Am Anfang ein Abschluss
Jonah
Ein Mann namens Garibaldi
Jonah
Treffen
Jonah
Aufgaben
I. Kapitel
II. Kapitel
Jonah
Die Wandernde Bibliothek
I. Kapitel
II. Kapitel
Jonah
Unerwarteter Besuch
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Aldus Albersteins seltsames Tierleben
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Das Große Geheimnis
I. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Ahnungen und Gewissheiten
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
Jonah
Camórnn
I. Kapitel
II. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
Die Welt des Bartholomae Beringsson
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
Entscheidung
I. Kapitel
Jonah
Camórnn
I. Kapitel
II. Kapitel
2. Teil
Der Drache erwacht
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
Die verlorenen Kinder
I. Kapitel
II. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Erwischt!
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
Jonah
Wahrheiten
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Jonah
II. Kapitel
III. Kapitel
Zurück in Camórnn
II. Kapitel
III. Kapitel
Jonah
Dunkle Stunden
I. Kapitel
II. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Überraschungen
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
Enttarnt!
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
3. Teil
Gefährliche Orte
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
III. Kapitel
V. Kapitel
Jonah
II. Kapitel
Im Turm
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Jonah
I. Kapitel
II. Kapitel
Im Untergrund
Jonah
Auf Phoenix Schwingen ...
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
Jonah
Runhildas Geheimnis
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
Jonah
II. Kapitel
Am ende ein Beginn …
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
Jonah
AM ANFANG EIN ABSCHLUSS
Rotglühend sank die Sonne hinter die Hügel, die den sich schlängelnden Lauf des Rhenos säumten, und tauchte alles in goldenes Licht.
Die von den Jahrhunderten, die seit ihrer Erbauung vergangen waren, schwarz gefärbten Mauern Drachensteins, hoben sich kontrastreich vor dem Firmament ab, in dem bereits die ersten Sterne funkelten. Die mächtige Silhouette des uralten Schlosses, spiegelte sich in den sanft dahinrauschenden Wellen des breiten Flusses, der am Fuße des Hügels, auf dem sich Drachenstein erhob, ruhig dahinfloss.
Die Fenster des großen Saales waren hell erleuchtet an diesem Abend; leise Musik und das Lachen zahlreicher Personen drang hinaus in die anbrechende Nacht.
»Sie haben mir noch einen Tanz versprochen, Giselherr. Das dürfen sie mir nicht abschlagen.« Gunhilda Gaumentanz’ große, tiefblaue Augen leuchteten im Schein der unzähligen Kerzen. Die kleine Hexe, die dem Großmeister nur bis zur Schulter reichte, lächelte und breitete die Arme aus.
Der Großmeister erwiderte ihr Lächeln und nickte. Er stellte sein Glas ab und führte Gunhilda auf die Tanzfläche. Sofort waren sie von zahlreichen Anwesenden umringt, die klatschend dem Mut des Großmeisters Beifall zeugten.
»Sie sind doch nicht etwa traurig?«, fragte Gunhilda, während sie über den Steinboden wirbelten. Sie lächelte. »Ich weiß – die Zeit. Ein Semester ist zu Ende. Wieder einmal. Aber ein Neues wird beginnen. Im Herbst. Und mit ihm neue Gesichter, neue Herausforderungen. Ein Anfang …«
Großefuß nickte abwesend. Ein Anfang – unter welchen Bedingungen? Er blickte zur Seite und seine Blicke kreuzten sich mit dem eines etwas abseitsstehenden Mannes, der missvergnügt an seinem Drachenbeerwein nippte. Er war groß und hager, trug das schwarze Haar streng nach hinten gekämmt. Seine Augen mit den dunklen Ringen, die sich von dem blassen Teint besonders stark abhoben, beobachteten misstrauisch das lustige, bunte Treiben um ihn herum. Außer der Lehrerschaft der Hochschule waren alle Schüler und Studenten zum Abschlussball des ausklingenden Semesters anwesend. Die überstandenen Abschlussprüfungen endlich hinter sich, amüsierten sich die Schüler nun. Eine fröhliche Gruppe von Tomten, mit ihren leuchtendroten Mützen, die es als Hausgeister zahlreich auf Drachenstein gab, spielte auf und bot lustige Weisen und Tänze dar. Ihre Pausbacken leuchtenden wie polierte Äpfel und sie lachten über das ganze Gesicht, das von weißen Haaren und Bärten eingerahmt wurde.
Die Musik endete und alle klatschten Beifall, während sich Großefuß, freundlich nickend für den Beifall, zurückzog. Er ging schnurstracks auf den am Rande stehenden Mann zu. »Nun, Nicolas. Sie scheinen sich nicht zu amüsieren. Wie schade.«
Nicolas Nickelblei kniff die dunklen Augen zusammen. »Es reicht ja, wenn es alle anderen tun.«
»Wann kehren sie nach Camórnn zurück?«
Nickelblei verzog den verkniffenen Mund mit den schmalen Lippen zu einem Grinsen.
»Sie wollen mich wohl loswerden?«
Großefuß antwortete nicht.
»Keine Sorge. Ich reise schon bald. Und was ich zu berichten habe, wird dem Kanzler nicht gefallen.«
»Ich leite diese Schule nicht zum Gefallen des Kanzlers.«
»Sie wissen, was mit den Leuten passiert, die die Regeln brechen.«
Die Brauen des Großmeisters zogen sich über der Nasenwurzel zusammen. »Sie werden es mir sicher gleich sagen.«
Nickelblei nahm sein Glas und knallte es auf den Tisch. Der letzte Rest Drachenbeerwein schwappte über den Rand.
»Sie tragen Ihren Kopf sehr hoch, Großmeister. Passen Sie auf, dass Ihnen die Luft in diesen Höhen gut bekommt. Ich weiß sehr genau, was hier vorgeht. Ich habe aufgepasst. Es gibt geheime Treffen. Sie lassen auf Drachenstein Studenten und Schüler aus Ordensbruderschaften zu, die auf der schwarzen Liste stehen.« Er beugte sich näher zu Großefuß. »Auch, wenn Sie sie gut tarnen.«
»Solange ich an dieser Schule Leiter bin, haben diese so genannten ‚schwarzen Listen‘ hier keine Bedeutung.«
Nickelblei ließ den langen dürren Zeigefinger seiner echten Hand vorschnellen. »Sie geben es also zu!«
Der Großmeister antwortete nicht.
»Ihr Schweigen sagt mehr als tausend Worte.«
Er ließ Großefuß stehen und eilte mit wehenden Rockschößen aus dem Saal.
Giselherr Großefuß sah ihm traurig nach.
»Du liebe Güte!« Griseldis Ganskleins ganzer Stolz, ihre rote Haarpracht, die sie mit zahlreichen Verzierungen, Bändern und Schleifen zur Feier des Abends hoch aufgetürmt trug, zitterte wie ein Wackelpudding, als sie geradewegs mit fliegenden Ärmeln ihres smaragdgrünen Kleides auf den Großmeister zukam.
»Der hat aber eine Laune!«
Der Schulleiter sah noch immer versonnen in die Richtung, in der Nickelblei verschwunden war. »Ja ...«
»Sie machen sich doch keine Sorgen?« Die hohe, durchdringende Stimme der Hexe übertönte sogar die Musik. »Ts, ts, ts. Das sollten Sie nicht, an einem so schönen Abend. Der arme Mann ist gänzlich ungeeignet zum Amüsement, wie ich fürchte. Schrecklich. Er setzt Ihnen zu?«
»Ich fürchte, es ist mehr als das, liebe Freundin. Er weiß alles.«
Er sah, wie die Farbe aus dem runden, erhitzten Gesicht der Hexe wich. »Was soll nun werden?«
»Wir werden sehen ...«, sagte der Großmeister ausweichend.
»Er wird nach Camórnn zurückkehren und Bericht erstatten.«
In diesem Augenblick öffnete sich eine der hohen Türen zum Saal und einer der Studenten der Septima trat ein. Das bunte, lustige Treiben um ihn herum, schien ihn nicht zu interessieren. Er suchte den Blick des Großmeisters und eilte durch die tanzende Menge auf ihn zu.
»Meister ...?«
»Was ist denn, Jason?«
»Ihr müsst mit mir kommen. Es ist wichtig.«
Giselherr Großefuß ließ seine Kollegin stehen und ließ sich von seinem Studenten aus dem Saal führen. Sie durchquerten die große zur Feier des Tages festlich geschmückte Halle, in dessen riesigem Kamin, den ein kunstvoll in Stein gehauener, Feuer speiender Drache bewachte, ein loderndes Feuer brannte. »Hier!« Der Student wies auf eine niedrige Eichenholztüre, die in einen Raum führte, der als Abstellkammer für nicht gebrauchte Möbel genutzt wurde.
Als Großefuß eintrat, fand er zu seiner Überraschung einige weitere Studenten der Septima vor, die alle zusammen inmitten der durch einige Kerzen nur schwach erleuchtenden Kammer standen.
Um sie herum türmten sich alte, verstaubte Möbel, Tische und Stühle, und bildeten eine bizarre Landschaft.
»Bei Askarban. Was soll denn das?«, fragte der Großmeister und blickte von einem zum anderen.
Filbert Fleckstein, der größte von ihnen und Sprecher der Septima, trat vor.
»Wir haben ein Problem, Meister.«
Die anderen traten zur Seite und gaben den Blick auf eine am Boden liegende Gestalt frei.
Giselherr Großefuß trat näher und kniete sich neben die Gestalt, die auf dem Bauch lag, die Arme weit von sich gestreckt. Er drehte mühsam den steifen Körper auf den Rücken und hielt die Luft an: Nicolas Nickelblei!
»Grundgütiger!«, murmelte er.
Nickelbleis Augen waren schreckensstarr aufgerissen und starrten an die Decke. Seine ohnehin blasse Gesichtsfarbe zeigte nun ein staubiges Grau.
Er erhob sich umständlich und sah anklagend von einem zum anderen. »Bei den Druiden, was ist passiert?«
Wieder war es Fleckstein, der aus der Gruppe vortrat. »Wir haben ihn mit Euch reden sehen, Meister. Er weiß alles, nicht wahr? Wir vermuten es schon länger.«
»Ja, ja«, sagte Großefuß ungeduldig. »Aber das ist doch kein Grund ...«
»Nein?«, konterte Fleckstein. »Sollen wir untätig warten, bis sich unser Schicksal erfüllt? Was glauben Sie, geschieht, wenn er nach Camórnn zurückkehrt?«
»Aber das ist doch keine Lösung, ihn mit dem Lapideus-Fluch zu belegen!«
»Er darf nicht nach Camórnn zurückkehren.«, beharrte Fleckstein.
»Er kennt keine Namen. Er hat bloß Vermutungen.«
»Das reicht dem Kanzler völlig!«, mischte sich ein weiterer der Studenten ein.
Großefuß bestritt es nicht. »Was habt ihr vor? Wollt ihr ihn hier in der Abstellkammer liegen lassen, bis ihn die Tomten finden oder ihn zu den Statuen der ehemaligen Leiter in die große Galerie stellen?«, fragte er.
»Hauptsache, wir haben Zeit gewonnen«, rief einer von hinten.
»Wie lange glaubt ihr denn, wird es brauchen, bis man ihn in Camórnn vermisst? Er wird sein baldiges Kommen angekündigt haben.« Er blickte zweifelnd auf den am Boden liegenden Nickelblei hinunter. »Vielleicht hat er sein Wissen auch schon einem Taufal übergeben und vorab nach Camórnn geschickt.«
»Dazu war er zu misstrauisch«, sagte Willi Wechsler, ein rundlicher Student mit strohgelben Haaren. »Taufale kann man abfangen.«
»Geht zur Seite.« Der Großmeister kniete sich erneut neben Nickelblei und breitete seine Hände über ihm aus.
Filbert Fleckstein missachtete die Anweisung des Großmeisters und stellte sich neben ihn.
»Was habt Ihr vor, Meister?«
Großefuß ließ die Hände sinken und sah zu seinem Studenten auf. »Ich werde den Lapideus aufweichen und dann einen Vergessenszauber aussprechen. Bis sich die Erstarrung löst, wird geraume Zeit vergehen. Danach wird er sich an nichts mehr erinnern.«
Fleckstein zögerte, trat dann aber doch einen Schritt zurück.
Der Großmeister breitete noch einmal die Hände aus und sprach laut, mit geschlossenen Augen in das Halbdunkel hinein. »Ice, Giselherr Großefuß, Servus is Numes, conclamare Oblivisci!« Ein magisches, tiefblaues Leuchten erfasste den Körper Nickelbleis, der langsam begann zu vibrieren. »Et conclamare opprimere lapide durior fieri.«
Das Leuchten wechselte von Blau zu Violett und erstarb schließlich langsam. Der Körper erstarrte wieder.
Der Großmeister erhob sich und trat zu seinen Studenten.
»So eine Unbedachtheit, will ich nicht noch einmal erleben. Das habt ihr hier auf Drachenstein nicht gelernt.« Er blickte streng von einem zum anderen. Dann lockerten sich seine Gesichtszüge. »Aber ich muss zugeben, es war gekonnt.« Ein kaum sichtbares Lächeln erschien auf seinen Lippen, das sofort wieder verschwand. »Er kann hier nicht bleiben. Bringt ihn in das Zimmer von Ravenstein und Bruchsaal. Die beiden sind schon nach Hause abgereist. Dort kann er liegen, bis sich die Erstarrung löst.«
Die Studenten gehorchten und packten den leblosen Körper an Schultern und Beinen.
»Wartet!« Der Großmeister streckte die Arme hoch und deutete mit den Händen auf die Gruppe Studenten, die Nickelblei trugen.
»Tarnare Chamäleon tibi!«
Die Hände des Großmeisters leuchteten hellgelb auf und sogleich schienen die Körper der Studenten, samt ihrer Fracht an Konsistenz zu verlieren. Ihre Erscheinung wurde blasser, durchscheinender.
Sie hatten sich vollkommen ihrer Umgebung angepasst..
»Beeilt euch. Eure Tarnung hält nur wenige Mikaden.«
Der Großmeister blieb mit den restlichen Studenten in der Abstellkammer zurück. Seine Stirn zeichneten Sorgenfalten. Seine Hand glitt in eine Tasche seines reich verzierten Festmantels, den er zur Feier des Tages trug. Seine Finger ertasteten ein Pergament, über das er sich mehr Sorgen machte, als über den vorerst außer Gefecht gesetzten Inquestor des Kanzlers.
Jonah
Agathe Winkelmann maß Jonah aus kalten, eisblauen Augen. Ihre knorrigen Hände, deren Finger aussahen, wie die verdorrten Äste eines toten Baumes, ruhten auf dem Rücken eines fetten, kupferfarbenen Katers namens Herkules, der auf Agathes Schoss liegend ein tiefes, zufriedenes Brummen ausstieß, dass sich anhörte, wie eine fleißig arbeitende Nähmaschine.
Herkules wandte den Kopf und seine bösen, gierigen, smaragdgrünen Augen ruhten auf Jonah, als wäre er eine dicke Maus, die es gleich zu verschlingen galt.
Der Kater war Jonah von Anfang an unheimlich gewesen. Er war Agathes Liebling und führte darüber hinaus ein seltsames Eigenleben im Haus. Manchmal, wenn Jonah ein Zimmer betrat oder um eine Ecke bog, stand Herkules plötzlich unvermittelt da, ganz starr, die Augen auf ihn gerichtet. Dann hatte Jonah richtig Angst vor ihm. Aber das konnte er natürlich niemandem sagen. Angst vor einer Katze! Jeder hätte ihn ausgelacht.
Für Jonah war Herkules der verlängerte Arm seiner Großtante, ihr Spion, der alles sah.
Tante Agathe wollte immer wissen, was im Hause vor sich ging.
»Nun, Jonah ...«, sagte Tante Agathe mit dunkler, Unheil verkündender Stimme: »Hast du mir etwas zu sagen?«
Jonah wich ihrem Blick aus. Herkules fauchte leise.
»Nein.«
Tante Agathes Augen verzogen sich zu kleinen, schmalen Schlitzen. Ihre Lippen spitzten sich.
Die linke Hand fuhr unablässig über Herkules’ Rücken.
»Ich habe dir gesagt, Jonah, dass es in diesem Haus bestimmte Regeln gibt, die wir alle ...«, und sie wiederholte leise: »alle einhalten. Nur so ist ein einigermaßen vernünftiges Zusammenleben möglich. Dass du den armen Herkules durch den Garten gejagt hast, steht für mich außer Frage.« Sie beugte sich vor. »Ich möchte gern wissen, wieso.«
Jonah blieb stumm.
Wieso? Weil er ein fetter, hässlicher, missmutiger, alter Kater ist, liebe Tante, der gerade dabei war den Ernährer einer kleinen Mäusefamilie umzubringen, liebe Tante.
»Du sagst also nichts?« In Agathes Stimme schwang unmissverständlich Empörung.
Jonah schüttelte den Kopf und biss die Lippen aufeinander.
»Du hast den armen Herkules zu Tode erschreckt«, fuhr Agathe fort. »Und ...«, ihre Augen zogen sich zu kleinen Schlitzen zusammen: »Du hast mein schönstes Rosenbeet zerstört.« Sie senkte ihre Stimmen zu einem gefährlichen Flüstern. »Und bei meinen Rosen verstehe ich keinen Spaß.«
Jonah und Herkules‘ Blicke trafen sich. Der Kater fauchte leise und bleckte seine kleinen, spitzen Zähne. Wahrscheinlich knurrte ihm der Magen, weil ihm sein Abendessen, der arme, kleine Mäuserich, der sich mit so viel Mühe ein Nest für seine kleine Familie gebaut hatte, nur um dann von Tante Agathes Kater gefressen zu werden, durch die Lappen gegangen war.
Tante Agathe ließ sich seufzend in den hohen Sessel sinken.
»Was mache ich bloß mir dir? Du bist der unerzogenste Bengel, der mir je begegnet ist. Also von deiner Mutter, meiner armen Marie, hast du das nicht.«
Jonah ballte die Fäuste hinter dem Rücken. Sie durfte nicht seinen Vater beleidigen! Das durfte sie nicht!
»Dein Vater ...« Sie hielt plötzlich inne. »Ach, lassen wir das. Ich habe die Nase voll, von diesen Ärgerlichkeiten. Du wirst persönlich das Rosenbeet wieder in Ordnung bringen, Jonah Fink. Das heißt, die zerstörten Rosen entsorgen, das Beet umgraben, neue Sträucher kaufen - von deinem Taschengeld, natürlich -, einpflanzen und wässern. Und Gnade dir Gott, wenn sie nicht gedeihen und so schön werden, wie sie vorher waren! Ich werde dir die Adresse des Gartencenters geben, bei dem ich meine Pflanzen beziehe. Du wirst das alles allein und ohne Hilfe machen. Deine Mutter hat, weiß Gott, schon genug Sorgen. Und jetzt geh auf dein Zimmer und bleib dort. Ich kann dich nicht mehr sehen.«
Jonah wandte sich ohne ein Wort ab und verließ das kleine Wohnzimmer. Er stieg die schmale Treppe in den ersten Stock hinauf und ging den schmalen Flur bis zum Ende durch.
Sein Zimmer war das kleinste im Haus, doch wenigstens hatte er es für sich allein, und er hatte versucht, es sich behaglich einzurichten.
An den Wänden hingen die Plakate von Fußballspielern seiner Lieblingsmannschaft. Er wünschte sich so sehr, einmal ein Spiel live miterleben zu können, doch dazu fehlte ihm das Geld. Und die passende Begleitperson ...
Auf dem kleinen Schreibtisch unter dem winzigen Fenster, das hinaus auf den Garten ging, stand ein gerahmtes Bild seines Vaters. Es war kurz nach seiner Geburt aufgenommen worden. Ein strahlender junger Mann hielt das Baby in die Kamera.
Jonah schmiss die Tür zu und warf sich auf das Bett.
Warum nur?
Warum war sein Vater plötzlich verschwunden? Sie waren doch glücklich gewesen.
Warum hatten sie ausgerechnet in dieses dunkle Haus ziehen müssen, in dem es nachts überall knarrte und knackte und in dem es immer kalt war?
Seine Mutter hatte versucht, es ihm zu erklären. Mit dem plötzlichen Verschwinden seines Vaters war der Ernährer der Familie fort gewesen. Marie Fink hatte drei kleine Kinder zu ernähren und wusste nicht wie. Da kam das Angebot von Onkel Augustus und seiner Schwester recht, in das Haus zu ziehen, das für die beiden eigentlich zu groß war.
Es war ein von der Gemeinde gestelltes Haus, denn Onkel Augustus war Pfarrer von St. Ignatius im Felde. Tante Agathe, die Witwe war, führte ihm den Haushalt. Es waren die Geschwister von Jonahs Großmutter. Marie Fink, konnte die kleineren Kinder in der Obhut von Tante Agathe lassen und tagsüber arbeiten gehen.
Es klopfte zaghaft an der Tür.
»Ja?«
Die Tür öffnete sich einen Spalt und Augustus Hebestreit steckte seinen Kopf ins Zimmer.
»Darf ich stören?«
Jonah nickte. Onkel Augustus war die Verkörperung des zerstreuten Professors. Seine Gedanken machten oftmals Spaziergänge. Und sie kamen manchmal dabei, wie er selbst es scherzhaft nannte, vom Wege ab. Seine Nase steckte ständig in irgendwelchen alten Büchern und hätte er Tante Agathe, und jetzt Jonahs Mutter, nicht gehabt, er wäre wohl an den Problemen des Alltags verzweifelt. Tante Agathe kümmerte sich darum, dass er stets gut angezogen war, und sorgte dafür, dass er zu allen Anlässen die richtige Predigt hielt. Bevor sie zu ihm gezogen war, war es schon vorgekommen, dass er es verwechselt hatte, wenn seine Gedanken gerade mal wieder auf einem ihrer ‚Spaziergänge’ waren, und plötzlich avancierten die Täuflinge und ihre Paten zu Brautleuten und die in Hochstimmung versammelte Hochzeitsgesellschaft verwandelte sich in eine Trauergemeinde.
Aber Onkel Augustus war sanftmütig und wenn er seine guten Tage hatte, hörte er ihm zu, wenn es Probleme mit Tante Agathe gab. Was eigentlich ständig der Fall war.
Jetzt kam er ins Zimmer und setzte sich auf den alten, wackeligen Holzstuhl vor dem Schreibtisch. Seine sanften grauen Augen ruhten auf Jonah. Wie immer im Haus, saß auf seinem wattigen, weißen Haar eine Samtkappe mit goldenem Bommel. Er sah Jonah mit einem entrückten Lächeln an und der erkannte, dass dies keiner von Onkel Augustus besten Tagen war.
Tante Agathe hatte ihm also wieder einmal ihr Leid geklagt. Und ihn gebeten, ein ernstes Machtwort zu sprechen. Doch zuvor gab es noch eine Hürde zu nehmen.
»Du musst mit mir sprechen«, half ihm Jonah.
Onkel Augustus führte den Finger an die Lippen. »Stimmt. Du warst nicht pünktlich bei der Sonntagsmesse.«
Jonah schüttelte den Kopf.
Augustus Hebestreit legte den Kopf schief. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er angestrengt nachdachte. Er hob den Finger. »Du warst nicht gehorsam zu deiner Mutter.« Er strahlte Jonah glücklich an, doch der schüttelte erneut den Kopf.
Der alte Pfarrer nickte ernüchtert und ließ die Augen durch das Zimmer wandern, auf der Suche nach seinen umherstreifenden Gedanken. Plötzlich klatschte er triumphierend in die Hände. »Ärger mit Agathe.«
Jonah nickte.
»Aber das ist nichts Neues«, sagte Onkel Augustus etwas enttäuscht. »Ich habe übrigens gehört, wie du die Türe zugeschmissen hast. Wundert mich, dass das Haus noch steht.«
»Tut mir leid.«
Augustus nickte. Jetzt wo er seine fliegenden Gedanken wieder eingefangen hatte, entspannte er sich. »Du weißt, dass sie das nicht so meint. Sie ist den Umgang mit Kindern nicht gewöhnt und ein Mensch, der feste Regeln hat. Das kann manchmal sehr nützlich sein. Sie liebt euch alle. Auch dich.«
»Das verbirgt sie aber gut.«
»Wie war die Schule?«
Jonah schwieg und drehte das Gesicht ab. Früher oder später würde er die verbockte Mathearbeit beichten müssen.
Augustus verstand ihn auch, ohne dass Jonah etwas sagte. »Du wirst Schwierigkeiten mit der Versetzung bekommen, mein Junge«, sagte er. »Das wird deiner Mutter nicht gefallen. Glaubst du nicht, dass sie schon genug Sorgen hat?«
Augustus hielt einen Moment inne, doch Jonah schwieg.
»Ich weiß Jonah, dass du nicht dumm bist. Du hattest doch früher gute Noten.«
Was wusste der Onkel schon? Schule! Wie unwichtig war das geworden, seit sein Vater fort war. Es interessierte ihn nicht mehr.
Der Pfarrer seufzte. »So gern ich dir den Gefallen tun würde, Jonah, ich kann dir deinen Vater nicht herbeizaubern. Keiner von uns kann das.«
»Ich weiß genau, was ihr denkt«, sagte Jonah leise. »Im Stich gelassen hat er uns. Einfach auf und davon ist er gegangen. Bestimmt mit einer anderen.«
»Niemand denkt das. Gott allein weiß, was deinem armen Vater für ein Schicksal widerfahren ist. Aber wir müssen alle lernen mit den Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, zu leben. Du bist nicht der Einzige, der etwas verloren hat, Jonah.« Augustus Hebestreit stand auf. »Ich erwarte von dir, dass du deine Mutter unterstützt und sich deine Noten bessern. Sonst wirst du nicht nur mit Tante Agathe Ärger bekommen.« Sein Mund mit den wulstigen Lippen verzog sich zu einem Lächeln. Er nickte Jonah aufmunternd zu. »Du wirst das schaffen. Ich weiß es. Du bist ein guter Junge.« Sein Blick wurde wieder trüb. »Was wollte ich doch gleich noch, bevor ich zu dir gekommen bin?«
Jonah überlegte einen Augenblick, was für ein Tag heute war. »Du wolltest an der Sonntagspredigt arbeiten.«
»Stimmt!« Er öffnete die Tür. »Die Klugheit hat er von seiner Mutter. Ohne Frage«, sprach der alte Pfarrer zu sich selbst, trat hinaus auf den Flur und schloss die Türe hinter sich.
Nachdem Onkel Augustus das Zimmer verlassen hatte, fühlte sich Jonah wieder so unendlich allein, wie so oft in letzter Zeit.
Er schwang sich vom Bett, durchquerte das Zimmer und verließ leise den Raum. Der Flur machte am anderen Ende einen scharfen Knick nach links, und dort führte eine schmale Treppe, fast nur eine Leiter, hinauf auf den Dachboden.
Jonah schlich sich leise nach oben. Das tat er in letzter Zeit öfter. Aus dem runden Dachfenster hatte man einen Überblick über das Viertel und einen Blick auf St. Ignatius, die kleine Vorstadtkirche, deren hoher Glockenturm seinen mächtigen Schatten auf das Haus warf und es in Dunkelheit tauchte.
Jonah ging zu einem alten Sessel und nahm vorsichtig ein verschlissenes Kissen hoch. Ein ängstliches Fiepen ertönte.
»Keine Angst, ich bin es«, sagte Jonah leise.
Im Sitz des Sessels war ein Loch, das Jonah selbst dort hineingeschnitten hatte. Er hatte die Füllung herausgenommen und so einen sicheren Platz für die kleine Mäusefamilie geschaffen, deren Vater er vor Herkules’ Krallen beschützt hatte. Im Garten war es viel zu gefährlich geworden. Wenn er die Türe zum Dachboden stets gut verschlossen hielt, waren sie hier vor dem Kater sicher. Die kleinen Mäuse zitterten vor Angst und Jonah streichelte sie sanft, um sie zu beruhigen. Plötzlich polterte etwas hinter ihm. Jonah zuckte erschrocken zusammen
Er wagte kaum, sich umzudrehen. Er atmete einmal tief ein und schnellte herum.
Nichts. Der Dachboden war leer. Doch was war da? Auf dem verstaubten Boden lag etwas, das da vorher nicht gelegen hatte. Jonah nahm all seinen Mut zusammen und machte einige Schritte nach vorn. Im Halbdunkel sah er, dass die Tür eines alten Schrankes, der schon immer dort oben gestanden hatte, offenstand. Jonah war sich sicher, dass der Schrank immer fest verschlossen gewesen war. Er hatte Tante Agathe einmal nach dem Schlüssel gefragt, und nur eine kalte Abfuhr bekommen. Sie hatte es sowieso nicht gern, wenn er auf den Dachboden ging. Warum auch immer.
Da! War da nicht ein dunkler Schatten über ihn hinweggehuscht? Er hatte auch einen kalten Lufthauch gespürt. Ganz deutlich. Jonah atmete hektisch. Sein Herz schlug schneller. Er fühlte die Anwesenheit von – irgendetwas. Er war sich sicher, er war nicht allein. Er sah sich vorsichtig um. Doch, er war allein.
Jonahs Augen blieben an etwas Dunklem auf dem Boden haften. Dort lag etwas Rechteckiges. Es sah aus wie ein Buch. Er näherte sich langsam. Es war ein Buch. Ein nicht sehr dickes Buch. Jonah zog einen weiten Kreis darum, um es von vorn betrachten zu können. Das Buch hatte einen Einband aus dunklem Leder und in verschnörkelter Schrift war etwas darauf eingedruckt. Doch die ehemals goldene Farbe war abgeblättert. Um es lesen zu können, musste er es sich näher ansehen.
Jonah schalt sich einen Angsthasen und trat näher heran. Er kniete sich nieder, um das Buch zu berühren, zog aber die Hand schnell wieder zurück. Das Buch sprach! Oder besser gesagt, es flüsterte. Überall um Jonah herum war plötzlich ein Wispern und Tuscheln ganz deutlich zu hören. Jonahs Herz raste wie wild. Plötzlich verstummte das Flüstern. Alles war ruhig. Jonah machte einen Anlauf.
Er streckte vorsichtig die Hand aus und berührte den glatten Einband. Nichts passierte.
Jonah wartete noch einen Moment, dann schlug er den Buchdeckel zurück.
Auf der ersten Seite stand in akkurater Schreibschrift:
Tagebuch
Und etwas weiter unten auf der Seite:
Marie Ritter
Ritter – das war der Name seiner Mutter gewesen, bevor sie geheiratet hatte.
Er überlegte. Er durfte nicht zu lange hier oben bleiben, sonst würde Tante Agathe noch Verdacht schöpfen, nach ihm suchen und am Ende noch seine Mäusefamilie entdecken. Oder Herkules, der doch sowieso immer hinter ihm her spionierte. Noch Schlimmer! Das konnte er nicht riskieren. Warum hatte seine Mutter das Tagebuch hier oben auf dem Dachboden zwischen dem alten Gerümpel versteckt? Oder war es zufällig in den Schrank geraten und dann in Vergessenheit? Jonah konnte nicht sagen warum, aber er hatte das unbestimmte Gefühl, dass es kein Zufall war, dass er das Buch gefunden hatte. Er sah sich noch einmal ängstlich um. Nichts. Er war allein ...
Er nahm das Buch und drückte es fest an sich. Vorsichtig schlich er zur Tür des Dachbodens und sah nach, ob die Luft rein war.
Dann schlich er zurück in sein Zimmer. Er versteckte das Buch unter der Matratze seines Bettes, fest entschlossen es erst in der Nacht, wenn alles schlief, hervorzuholen.
Er hatte Gewissensbisse, durfte er einfach darin lesen? Er musste es tun, die Neugier schien ihm fast unbezähmbar.
EIN MANN NAMENS GARIBALDI
Der Wind heulte Furcht einflößend um die alten Mauern von Drachenstein. In dem alten Schloss herrschte seit dem Abschlussball, an dessen Anschluss die Schüler und Ordensmitglieder, mit wenigen Ausnahmen, in die Semesterferien gefahren waren, bedrückende Stille. Das machte das Heulen des Windes unerträglich.
Doch er hörte noch etwas Anderes. Schritte, auf dem Flur vor seinem Zimmer. Schnelle Schritte, hastige Schritte.
Dann wieder Stille.
Ein deutlich vernehmbares Klopfen hallte in den dunklen, verlassenen Gängen des alten Hauses wieder.
»Ja. Bitte.«
Er wandte den Kopf und starrte auf die Tür, deren Klinke sich wie von Geisterhand nach unten bewegte. Die Tür öffnete sich mit leisem Quietschen in den rostigen Angeln.
Ein kleiner Mann mit rundem Kopf stand im Türrahmen und fixierte Großefuß.
Sein kariertes Cape, dessen Saum fast den Boden berührte, war mit funkelnden Regentropfen übersät.
Magie-Magister Osbert Ohneland, trat ins Zimmer und – nieste kräftig.
»Ein scheußliches Wetter«, kommentierte Großefuß. »Bitte schließen sie die Tür, Osbert. Und ziehen Sie, um Askarbans Willen, den nassen Mantel aus.«
Ohneland schloss kommentarlos die Türe und entledigte sich seines Mantels, indem er ihn achtlos über die Rückenlehne eines hohen Ohrensessels warf, was Großefuß mit einem Stirnrunzeln kommentierte.
»Haben Sie es?«
Ihre Blicke kreuzten sich. Osberts kleine, in ein feines Spinnennetz aus zahlreichen Fältchen eingebettete helle Äuglein funkelten. »Es lag an der von Ihnen beschriebenen Stelle. Woher ...?«
Der Großmeister nickte bestätigend. Und gemahnte den kleinen Osbert mit einer eindeutigen Bewegung seiner Hand zum Stillschweigen.
Osbert duckte den Kopf. Dem großen Meister seine kleinen Geheimnisse entlocken zu wollen, daran waren schon ganz andere gescheitert. In letzter Zeit aber gab er sich noch geheimnisvoller als sonst. Auch wirkte er angespannt, ja, sogar erschöpft. Das war Osbert aufgefallen. Und – seit zwei Tagen trug er an der linken Hand einen schwarzen Handschuh.
Osbert wagte nicht, ihn darauf anzusprechen.
Der Magister zog hinter seinem Rücken ein dickes Buch mit buntem Umschlag hervor und platzierte es behutsam auf dem wuchtigen, reich verzierten Schreibtisch des Großmeisters.
Der Magie-Großmeister ließ den Blick für einen Augenblick ruhen, und niemand hätte an seiner starren Miene ablesen können, was er dachte.
»Sehr produktiv, die Dame«, sagte er leise.
»Der sechste Band«, ergänzte Osbert.
»Sie haben hineingesehen?«
Der kleine Magister nickte. »Voller Unsinn und Albernheiten.
Man schwenkt kleine Stöckchen durch die Luft, fliegt auf Besen und trägt komische Hüte. Die Treppen der Häuser wandern und die Bilder sprechen.«
»Ihre Schlussfolgerung?«
Osbert stützte die Hände auf der Schreibtischplatte ab und beugte sich vor. »Das ist keine Gefahr. Reine Fantasie. Sie weiß nichts von uns.« Osbert sah ein unruhiges Flackern in den dunklen Pupillen des Großmeisters. Er schien nicht überzeugt. Oder war da noch anderes, dass ihn beunruhigte? Er hatte den Verdacht, dass er ihm nicht alles sagte.
»Was glauben Sie denn, Großmeister? Dass sie bei uns ein- und ausspaziert oder gar einen Spion hat, der das für sie tut? Die Weltenwanderer sind eine Spezies, die ausgestorben ist. Die heiligen Nebel sind sicher.«
Er sah, wie sich die schmalen Lippen des Großmeisters so fest aufeinanderpressten, dass sie nur noch ein schmaler Strich waren. Er wandte sich abrupt ab und sah zu einem der hohen Fenster hinaus. Ein greller Blitz durchzuckte den nachtschwarzen Himmel. Aus einiger Entfernung war Donnergrollen zu hören.
»Geben es die Götter, dass Sie Recht haben, Osbert.«
Ein unangenehmes Schweigen breitete sich im Zimmer aus. Magie-Magister Ohneland nahm stillschweigend seinen Mantel und schickte sich an das Zimmer wieder zu verlassen. Die Hand schon auf dem Türgriff, wandte er sich noch einmal um. Stumm maßen sich die beiden Magier mit Blicken. Abrupt wandte sich Ohneland ab, öffnete die schwere Eichenholztüre und trat hinaus auf den dunklen Flur.
Großmeister Giselherr Großefuß atmete erleichtert auf, nachdem die Türe ins Schloss gefallen und er wieder alleine war. Zweifel nagten in ihm. Sollte er sich nicht besser jemandem anvertrauen? Er ging zu seinem Schreibtisch und zog die oberste Schublade auf. Einen Augenblick zögerte er, dann holte er einige fein säuberlich mit violettem Atlasband zusammengebundene Bündel Pergamentseiten hervor. Er entfernte das Band und rollte die Seiten auseinander. Alle Schriftstücke waren mit der gleichen blassbraunen Tinte beschrieben, die Buchstaben und Sätze ordentlich, vielleicht, ein bisschen zu bemüht, niedergeschrieben.
Und noch etwas war auf allen Pergamenten gleich: Es zierte sie eine Unterschrift, schwungvoll mit roter Tinte geschrieben:
Garibaldi
Großefuß las die letzte Nachricht, die er am Morgen dieses Tages auf seinem Schreibtisch liegend vorgefunden hatte. Es war die Vierte.
Seht Ihr die Wolken am Himmel nicht?
Sehr Ihr nicht Schatten, die die Sonne verdunkeln?
Wenn sich die aufgepeitschte Brandung des Meeres
an schwarzglänzenden Felsen bricht
und die Orakel, flüsternd noch, von
großem Unheil munkeln.
Stehen die Zeichen der Zeit auf Sturm.
Sind sie gewappnet, Großmeister? Erkennen Sie die Zeichen?
Ich habe ein Geschenk für Sie, am Fuße der toten Eiche.
Garibaldi
Er sah hoch und ließ seine Augen durch den Raum schweifen.
Alistair von Aschenbruch, die letzten Worte des Heilers aus seinen berühmten Schattengedichten.
Jeder Nachricht von Garibaldi waren Auszüge aus Aschenbruchs Schattengedichten vorangegangen.
Sein Blick fiel auf das dicke Buch mit dem marktschreierisch bunten Umschlag, das, wie angekündigt, am Fuße der toten Eiche gelegen hatte. Ein Geschenk ...
Sogleich fiel dem Großmeister eine andere von Aschenbruchs Gedichtzeilen ein:
Flieht nicht die Schatten; sie holen euch ein.
Kämpft, wie ein Mann, ungeachtet der Pein.
Denn die Nebel, zerfetzt, werden euer aller Untergang sein.
Jonah
Die Nacht hatte sich über die Stadt gesenkt. Jonah lag mit offenen Augen in seinem Bett und starrte zur Decke, an die die Straßenbeleuchtung vor dem Haus ein helles Rechteck gemalt hatte. Immer wenn draußen etwas durch den Lichtkegel der Laterne ging oder flog, warf es einen langen Schatten an die Decke.
Seit diesem Nachmittag, fühlte sich Jonah verunsichert. Irgendetwas war nicht mehr wie vorher, seit er auf dem Dachboden gewesen war.
Ein leises Kratzen auf dem Flurboden vor seiner Zimmertür riss ihn aus seinen Gedanken. Er richtete sich im Bett auf.
Herkules! Er strich durch das Haus.
Jonah starrte auf die Ritze unter der Tür. Das Licht aus den unteren Räumen schien hindurch. Er sah den Schatten des Katers, der ohne sich zu bewegen, auf dem Flur vor seiner Tür wartete. Jonah glaubte sogar, leise den rasselnden Atem des Tieres zu hören.
Was suchte er vor seiner Tür?
»Verschwinde!«, rief Jonah leise.
Doch der Schatten blieb. Ein einsamer Wächter auf seinem Posten. Oder ein Spion?
Jonah richtete sich langsam auf und griff unter seine Matratze. Er fühlte das warme Leder des Buches und zog es langsam hervor.
Herkules, vor seiner Tür, stieß ein leises Fauchen aus. Jonah sah, wie sich der Schatten langsam fortbewegte.
Jonahs Finger zitterten leicht, als er das Buch öffnete. Sofort erkannte er die schöne, geschwungene Handschrift seiner Mutter ...
Immer wieder versuchte Jonah sich das junge Mädchen vorzustellen, das einst über diesem Buch gehockt hatte, hörte selbst das kratzende Geräusch des Füllers auf dem weißen Papier. Ein seltsames Gefühl. Sie hatte diesem Buch ihre geheimsten Gedanken, ihre Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte anvertraut. Durfte er es lesen?
Warum hatte sie es auf den Boden verbannt? Er fühlte sich schuldig, doch seine Neugier war stärker. Er hoffte, vor allem etwas über seinen Vater zu lesen, über die Zeit, als sie sich kennen gelernt hatten.
Er begann zu blättern. Immer wieder blieb er an bestimmten Stellen haften. Einiges fand er sehr mädchenhaft, über manches musste er lächeln, anderes wieder kam ihm vertraut vor. Er begann das Gefühl des Unwohlseins, bei dem Gedanken, etwas zu lesen, das sicher nicht für seine Augen bestimmt war, zu verdrängen. Dieses Buch schien eine geradezu magische Anziehungskraft auf ihn auszuüben.
Aus dem Mädchen wurde ein Teenager und Jonah las von ersten, scheuen Jungenbekanntschaften und heimlichen Küssen an verschwiegenen Orten.
Dann endlich tauchte der Name seines Vaters auf. Alexander Fink. Seine Eltern - zwei verliebte Teenager. Wieder musste Jonah lächeln.
Sie konnten sich am Anfang nur heimlich treffen und – Jonah stutzte. Er blätterte eine Seite zurück und las das Datum der Eintragungen. Das war zehn Jahre vor seiner Geburt. Er hatte nicht gewusst, dass sich seine Eltern schon so lange gekannt hatten.
Er merkte, wie ihm die Augen zufielen, und das Buch rutschte ihm aus der Hand. Es landete auf dem Boden. Erschrocken hob er es auf, wollte es schon zuklappen, aber etwas hinderte ihn daran.
Er zuckte überrascht zusammen. Ein Gesicht sah ihn an.
Das Gesicht eines jungen Mannes. Seine Mutter musste es gezeichnet haben.
Das Gesicht blickte sehr ernst. Ein paar große Augen mit dunklen Pupillen sahen ihn an. Das dichte, schwarze Haar fiel ihm wirr ins Gesicht. Irgendetwas war an diesem Gesicht, das Jonah vertraut vorkam. Es war ihm nicht fremd. Das aber, was seine Aufmerksamkeit am meisten beanspruchte, war etwas Anderes. Es war eine helle, fast weiße Strähne, die dem Gesicht, inmitten der Fülle dunklen Haares, auffällig in die Stirn fiel. Jonah fasste sich unwillkürlich an den Kopf. Er schlug die Bettdecke zurück und durchquerte das Zimmer. Er öffnete den Kleiderschrank, dessen Türen leise quietschend zur Seite glitten.
An der Innenseite der Tür befand sich ein Spiegel. Jonah erblickte sich, sein schmales, blasses Gesicht. Sein strenger Blick fiel auf die helle Strähne in seinem dunkelbraunen Haar, die sich deutlich, auch in der Dunkelheit, abhob. Sie war schon immer da gewesen, so lange er denken konnte ...
TREFFEN
Im Schutz der Schatten der hohen Türme der alten Burg, huschte eine Gestalt lautlos, als würde sie über dem Boden schweben, über den Innenhof.
Besorgt warf Giselherr Großefuß einen Blick zum Himmel. Es hatte aufgehört zu regnen. Doch dunkle, grauschwarze Wolken zogen Unheil verkündend, gnadenlos vom Wind getrieben, über seinem Kopf hinweg und verdunkelten den Mond. Der Großmeister murmelte leise einige uralte, keltische Zauberformeln, die, nach alter Druidenüberlieferung, vor Ungemach und bösen Geistern schützen sollen. Auf den unebenen Stolpersteinen des Innenhofes tanzten dunkle Silhouetten einen wilden Tanz. Eine Windböe riss ihm unvermittelt die Kapuze seines Umhangs vom Kopf, und ein pechschwarzer Rabe drehte mit lautem Gekreisch über dem Hof seine Runden. Keine vergnügliche Nacht
Vor dem hoch aufragenden Westturm der uralten Burganlage, blieb Großefuß stehen. Er sah an der unebenen, von Efeu überwucherten Fassade des runden Turmes hinauf. Ein einziges Fenster, ganz oben, unter dem Dach, war erleuchtet und das helle Licht bahnte sich einen Weg durch die dunkle Nacht. Über der Spitze des Turmdaches durchzuckten, lautlos tanzend, grelle Blitze den Himmel.
Der Großmeister zog einen alten, von dichtem Grünspan überzogenen Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn in das Schloss der alten Tür. Es war eingerostet. Der Schlüssel ließ sich nur schwer drehen und verursachte dabei ein unangenehm kratzendes Geräusch. Lange hatte er ihn nicht mehr benutzt ...
Das Schloss schnappte auf. Ein seltsam gequältes Stöhnen drang aus dem Inneren des Turmes an die Ohren des Großmeisters und er zuckte zusammen. Großefuß atmete tief durch und drückte die alte, angelaufene Klinke herunter. Die Tür quietschte unwillig in den Angeln, ließ sich aber mit leichtem Druck öffnen.
Der Rabe hatte Gesellschaft bekommen und gemeinsam zogen die Tiere, kurze heisere Schreie ausstoßend, gen Horizont.
Großefuß betrat vorsichtig den dunklen, modrig riechenden Raum. Spinnweben hingen wie weiße Vorhänge von der Decke und bewegten sich im Wind, wie gespensterhafte Gestalten.
Der runde Raum war ohne Möbel und wirkte traurig und verlassen. Er nahm eine Fackel aus ihrer verrosteten, eisernen Halterung an der Wand und murmelte:
»Feurio grenzalis adequwit.« Mit einem leisen Ploppen entzündete sich ein Feuer an dem alten, morschen Holz. Die Wärme und das Licht, das es entfaltete, beruhigten die Nerven des Großmeisters.
Er steuerte ohne Umwege eine Wendeltreppe an, die in die oberen Stockwerke führte und erklomm mühsam die ausgetretenen Stufen.
Der große Raum war angefüllt mit Bücherregalen, in denen sich, Rücken an Rücken, schier unzählige, arg verstaubte Bände drängten. Ihre goldbedruckten Einbände leuchteten im kurzen Aufflackern von Großefuß’ Fackel blitzartig auf, wenn er an ihnen vorüberging.
Dazwischen, an den Wänden, hingen zahlreiche Porträts von bedeutenden Ordensmitgliedern und Leitern Drachensteins, einige von ihnen schon sehr alt und von einer dicken Schicht Staub bedeckt, die einst kräftigen Farben nachgedunkelt.
Er sah nach oben. Eine gläserne Kuppel krönte den Turm. Durch sie hindurch, sah er das dramatische Szenario eines von Wolken verhangenen Himmels, vom Wind gepeitscht und vom Mondlicht in gespenstisches Licht getaucht.
Der Großmeister atmete stockend, sein Puls raste. Wie jung war er gewesen, als er damals, selbst noch ein Student, an einem Tisch in diesem Raum gesessen und die Werke der großen magischen Meister studiert hatte. Er war der Liebling des damaligen Großmeisters, des großen Remigius, gewesen, der ihm gestattet hatte, diese Bibliothek zu benutzen. Nur wenigen war dies jemals erlaubt worden, denn das Wissen, das sich hier versammelt hatte, barg auch große Gefahren. Nur wer innerlich stark und gefestigt ist, vermag den Verführungen der schwarzen Magie zu widerstehen. Ein reines Herz, Verstand und den absoluten Willen, die Kraft der Magie nur zum Wohle aller einzusetzen, widerstehen den Schatten der Unterwelt, die beim Aufschlagen der Bücher in den Ecken lauern. Schmal ist der Grat zwischen der schwarzen und weißen Magie, oftmals bemerkt man selbst gar nicht, wie weit man sich bereits in den Bereich des Dunklen begeben hat. Das versammelte Wissen dieser Bücher bedeutete fast grenzenlose Macht. Seit ihm hatte sich niemand mehr hier aufgehalten. Es hatte gute und auch sehr gute Schüler gegeben, doch niemand hatte sich des Wissens der großen Bibliothek als Wert erwiesen. Auch das war eine Sorge, die Großefuß umtrieb. Wer sollte einmal sein Nachfolger werden?
Das Studium der schwarzen Kunst ist unerlässlich, um ein wirklich großer Magier zu werden. Remigius, sein Lehrmeister, wusste das und hatte gespürt, dass sein Schüler die Fähigkeiten zu Großem besaß und ihn schließlich zu seinem Nachfolger erkoren.
Doch er wusste, wie gefährlich die Bibliothek war. Auch er war einmal für wenige Augenblicke schwach geworden, und es hatte gereicht, eine tief in den Bänden dieser Bibliothek verborgene Kraft freizusetzen. Remigius hatte ihn und Drachenstein gerettet und ihm niemals Vorwürfe deswegen gemacht. Allerdings, die Bibliothek hatte er danach nie wieder betreten dürfen.
Jetzt war er wieder hier, und wie stark war doch der Einfluss des Bösen noch immer zu spüren! Der Großmeister murmelte leise einige Zaubersprüche, die das Böse in Schach hielten. Überall, in allen Ecken, wisperte und flüsterte es. Lange Schatten tauchten plötzlich auf und verschwanden, so schnell, wie sie gekommen waren.
Langsam, Schritt für Schritt, durchwanderte er den Raum, den Blick starr geradeaus gerichtet, ohne nach rechts oder links zu blicken.
Dann stand er vor einer weiteren Tür. Einen Moment hielt er inne. Neben dem Türrahmen standen auf zwei Podesten fast lebensgroße Marmorstatuen. Die Linke zeigte ein verhutzeltes, uraltes Männlein in weitem Mantel. Den Kopf krönte die Myrrtha, die mit den alten, keltischen Symbolen bestickte Kappe der Gelehrten, die den gesamten Hinterkopf bedeckte. Er stützte sich auf einen knorrigen Stock und blickte stoisch mürrisch in die Weite des Raumes. Großefuß stellte sich vor die Statue und konzentrierte sich. All seine Gedanken, seine Energie, bündelte sich. Langsam hob er die Arme und legte die Hände auf den Sockel der Statue.
Plötzlich kam, wie von Geisterhand, Leben in den kalten Marmor. Es knirschte und knackte und feiner, weißer Staub rieselte von der großen, vorspringenden Nase auf den Boden. Das Männlein wandte steif den Kopf und schlug die Augen auf.
»Wer stört meinen Schlaf?«, sagte es mit heiserer, piepsiger Stimme.
»Ich bitte um Verzeihung, Aldenott, Edler von Connaugh, aber ich begehre Einlass.«
»Was sonst! Seit Ewigkeiten hat sich niemand mehr hierher verirrt!«, rief das Männchen empört. »Ich bin alt und ich bin tot, aber ich bin nicht blöd!«
»Verzeiht!«
»Und nehmt endlich eure Finger von mir!« Eine der buschigen, weißen Brauen des Männchens hob sich in die Höhe und es reckte den kleinen verschrumpelten Kopf nach vorn. »Du bist es«, sagte es schließlich.
Der Großmeister verneigte sich. »Giselherr Großefuß, der momentane Großmeister von Drachenstein.«
Das Männchen hob missmutig den Stock und stieß ihn mit lautem Knall auf das Podest, auf dem es stand. Eine dichte Staubwolke hüllte Großefuß ein.
»Schon gut, schon gut! Miserabel warst du in alten Sprachen, und die Prüfung in Alchemie hast du auch versiebt. Was man heute alles zu Leitern macht.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Na ja, die Kraft der Gedanken, scheinst du ja inzwischen zu beherrschen.«
Der Großmeister fuhr sich nervös mit der Hand über die Stirn. Bei nächster Gelegenheit, dachte er, wird der umgestellt.
Das Männchen auf dem Podest langte inzwischen in eine Tasche seines Umhangs, fischte einen Moment darin herum und zog einen kostbar verzierten, goldenen Schlüssel hervor.
Er betrachtete den Schlüssel einen Moment versonnen, dann langte seine verhutzelte Hand knirschend nach vorn und hielt ihn Großefuß unwillig hin.
»Muss ja was los sein, wenn du hier auftauchst«, murmelte der Alte misstrauisch.
Der Großmeister ergriff erleichtert den Schlüssel, verneigte sich noch einmal flüchtig und wandte sich zur Tür.
»Sei vorsichtig!«, rief das Männlein, als der Großmeister den Schlüssel ins Schloss steckte. »Ich rieche Unheil. Es dringt aus allen Poren und Ritzen!«
Der Großmeister starrte den alten Mann auf dem Sockel einen Moment lang unschlüssig an. Worüber hatte Osbert sich in Bezug auf die Bücher aus der anderen Welt noch lustig gemacht?
‚Sie sprechen mit Bildern! ’
Er sprach gerade mit einer Statue. Waren seine Ängste doch nicht unbegründet?
Vorsichtig drehte Großefuß, ungeachtet der Warnung, den alten Schlüssel im Schloss. Einige Mechanismen, im Inneren der Tür, sprangen geräuschvoll zur Seite.
Ein weiterer dunkler Raum öffnete sich ihm. Er trat ein. Auch dieser Raum war mit Bücherregalen angefüllt, doch die Bücher hier waren nicht verstaubt. Sie wirkten, als seien sie gerade erst gekauft. Nirgendwo waren hier Spinnweben oder Staub zu erkennen. Der ganze Raum wirkte wie frisch gereinigt – und er war warm. Die schwere, geschnitzte Holzdecke des hohen Zimmers wurde getragen von einer gedrechselten Säule. Genau in der Mitte dieser Säule war ein Stück entfernt und durch einen hohlen Glaskörper ersetzt worden. Inmitten dieses Glaskörpers waberte ein bläulicher Nebel, der den ganzen Raum in gleißendes, blaues Licht tauchte.
»Feurio ad versum bonum«, murmelte Großefuß und die Flamme der Fackel erlosch. Er warf sie zur Seite.
Langsam, bedächtig, den Atem anhaltend, näherte er sich der Säule. Er schloss die Augen und breitete die Arme aus.
Dann rief er:
»Absolum con Muri; Virtago erate virtigo.«
Der blaue Nebel in der Säule geriet heftig in Wallung. Blaue Blitze schossen durch den Raum und Großefuß, die Augen fest geschlossen, wurde in eine Art Trance versetzt. Ein blasser, nebelartiger Doppelgänger seines Selbst löste sich aus seinem Körper, der nun begann im Raum umher zu schweben. Der fahle Großefuß, wie ein Geist seiner selbst, legte die Hände auf das Glas der Säule.
»Remigius.« Seine Stimme war ehrfürchtig leise.
Der Nebel in der Säule formte sich langsam zu einem Bild. Ein alter Mann mit langem, weißem Bart und zerfurchtem Gesicht.
»Ich habe dich erwartet«, sagte eine alte, tiefe Stimme.
»Meister.«
Plötzlich brachen die Ereignisse der Vergangenheit über Großefuß herein. Ganz deutlich, sah er jene schreckliche Nacht vor sich, als, durch ihn verschuldet, Drachenstein, ihre ganze Welt, in die Hände des Bösen zu fallen drohte. Remigius hatte sie gerettet, in dem er seinen Geist von seinem Körper trennte und ihn in den Hohlkörper der Säule einschloss, wo er fortan mit seiner ganzen Macht über die Bibliothek und ihr Wissen wachte und das Böse in Schach hielt.
Er hatte sich für ihn, für sie alle geopfert.
»Ich weiß, es ist mir verboten, hier zu sein, Meister. Doch ich musste es tun.«
Das Gesicht nickte. »Du bist hier und es ist gut.«
»Seltsame Dinge geschehen. Ich sehe die Zeichen und sie verheißen das Kommen des Bösen. Sagt mir, dass ich mich täusche!«
»Ich sehe große Gefahr«, sagte Remigius. »Meine Kraft hat sich erschöpft und das Böse wird stärker. Das Wissen der Alten verliert sich im Dunkel.« Die Stille im Raum, die nun für einige Sekunden alles erfüllte, ließ dem Großmeister einen eisigen Schauer über den Rücken laufen. Dann sagte das Gesicht schmerzverzerrt: »Wir haben Schuld auf uns geladen. Es ist zu spät den Anfängen zu wehren. Das Böse kommt. Ich sehe am Horizont die Heerscharen aufmarschieren und sich formieren. Ihr müsst kämpfen.«
»Aber was können wir tun?«
»Blut.«
»Meister?«
»Das Blut der Drachen und die Kraft eines Kindes - eines besonderen Kindes. Suche das Goldene Buch.«
Der Nebel begann in Wallung zu geraten und das Gesicht zerfloss.
Der geisterhafte Zwilling des Großmeisters schwebte durch den Raum zu seinem Köper zurück, um sich wieder mit ihm zu vereinigen. Kaum war das geschehen, sank Giselherr Großefuß erschöpft auf den Boden nieder. Er blieb fast bewegungslos dort sitzen und starrte in Richtung der Säule.
Es war noch viel schlimmer, als er befürchtet hatte. Das Goldene Buch ... Viele hielten es für eine Legende. Das Blut der Drachen ...
Begleitet vom Knacken seiner Knochen, richtete er sich leise stöhnend auf. Er verließ den Raum, verschloss die Türe sorgfältig und übergab den Schlüssel wieder der marmornen Statue des Männleins.
»Du hast Probleme, was?«, kommentierte der Alte. »Ich habe dir immer gesagt, pass in Abwehr dämonischer Geschöpfe besser auf!«
Ohne weiter auf ihn zu achten, trat Großefuß den Rückweg durch die Bibliothek an. Der Wind hatte die Wolken vertrieben und das helle Mondlicht schien durch die Glaskuppel und tauchte die Bibliothek in ein verzaubertes, silbrig-diffuses Licht.
Plötzlich stockte er. Seltsame kleine, blaue Lichtpunkte tanzten durch den Raum, wie Glühwürmchen.
Atemlos verfolgte Großefuß ihren wilden Flug. An einem der hohen Regale sammelten sie sich und begannen, wie wild zu tanzen. Da hörte er ein leises Rascheln hinter sich.
Er wandte sich ruckartig um und ließ den Blick durch den ins Halbdunkel getauchten Raum schweifen. Nichts. Hatte er es sich nur eingebildet? Spielten ihm seine Nerven einen Streich?
Doch! Da! Ein Schatten! Er huschte zwischen den Bücherregalen umher. Großefuß stockte der Atem. Jetzt hörte er deutlich ein kratzendes Scharren, als schleife jemand etwas über den Boden.
»Wer immer da ist, zeige dich!«, rief der Großmeister in den Raum hinein.
Ganz leise vernahm er ein heiseres Lachen.
Ein kalter Schauer lief Großefuß über den Rücken. Er atmete tief durch und sammelte sich.
Er spürte, dass er all seine magischen Kräfte jetzt würde brauchen können.
Langsam setzte er sich in Bewegung, ging den schmalen Gang entlang und spähte dabei zwischen die Bücherregale, die quer im Raum standen und ihn unterteilten.
Ohne Vorwarnung schoss etwas Großes, Dunkles zwischen den Regalen hervor und stellte sich ihm in den Weg.
Der Großmeister stand da wie erstarrt. »Beim großen Erasmus!«, murmelte er.
Vor ihm stand ein etwa zwei Meter großes Wesen, dessen Augen feurig rot im Halbdunkel leuchteten und ihn gefährlich fixierten. Es war Hund- oder wolfsähnlich mit vier Beinen und einem Schwanz, hatte pechschwarzes Fell, von dem sich nur die glühenden Augen und die spitzen, gelblichen Zähne in seinem Maul abhoben. Es fletschte die Zähne und kam langsam auf ihn zu, wobei es ein leises Knurren von sich gab. Auf seinem Rücken stachen spitze Dornen durch das Fell und seine gefährlichen Krallen scharrten über den Boden.
Wieder hörte der Großmeister ein leises Lachen, irgendwo hinter ihm. Giselherr Großefuß erinnerte sich, in einem der schwarzen Bücher die Abbildung eines solchen Wesens schon einmal gesehen zu haben. Es war eine Art Zerberus, ein Wächter. Doch was bewachte er hier? Und wer hatte ihn zum Leben erweckt?
Das Gehirn des Großmeisters arbeitete fieberhaft. Während das Wesen immer näher auf ihn zukam, durchforstete Großefuß alle Bannsprüche und sonderte die aus, von denen er glaubte, dass sie ihm helfen konnten.
Einen Augenblick standen sie sich bewegungslos, Auge in Auge, gegenüber, dann setzte der Zerberus knurrend zum Sprung auf ihn an.
Mit Geistesgegenwart und für sein Alter erstaunlich behände, duckte sich der Großmeister und kugelte zur Seite. Der schwarze Zerberus flog, geifernd und mit gebleckten Zähnen, über ihn hinweg und landete unsanft auf dem Hinterteil.
Giselherr Großefuß rappelte sich hoch und behielt dabei den riesigen Hund immer im Auge.
Der Zerberus fixierte ihn. Aus den großen Nasenlöchern stieg kräuselnd heller Rauch auf und verteilte sich im Zimmer. Seine Augen, glühend wie Kohlen in einem Ofen, rollten gefährlich.
Der Großmeister hielt sich krampfhaft mit einer Hand an einem der Bücherregale fest. Sein Atem ging stockend, der Puls raste. Lange schon hatte er die Abenteuer den Jüngeren überlassen. Er wurde alt, das wurde ihm jetzt schmerzlich bewusst. Früher hatten ihn derartige Aktionen nicht so aus der Puste gebracht.
In diesem Augenblick stieg aus den Untiefen des schwarzen Innenlebens des Zerberus ein gefährliches Grollen empor. Gleichzeitig setzte er mit ausgefahrenen Krallen zu einem weiteren Sprung auf den Großmeister an.
Giselherr Großefuß nahm all seine Kraft zusammen und breitete die Arme aus.
Laut und deutlich vernehmbar, rief er in den Raum hinein:
»Excelsis kon namibur; bregendum flaxx!«
Seine Hände begannen zu glühen und verbreiteten ein orangerötliches Licht im Raum.
Der Zerberus, der, quer durch den Raum, direkt auf den Magier zuflog, wurde von einem sprühenden Funkenregen eingenebelt.
Dichter Rauch verbreitete sich im Zimmer.
Dann trat Stille ein.
Der Rauch verzog sich langsam und tanzte wie weißgewandete Geistergestalten durch das Zimmer.
Der Zerberus war verschwunden.
Giselherr Großefuß bückte sich und hob das kleine, wimmernde, schwarze Geschöpf, das zu seinen Füßen auf dem Boden hockte, am Nacken hoch.
Er drückte dem kleinen, schwarzen Knäuel einen Kuss auf die Stirn und der Welpe fiepte leise.
Den Welpen im Arm haltend, blickte er sich im Raum um. Sorgenfalten zerfurchten seine Stirn.
»Nun? Noch mehr Überraschungen?«, rief er laut.
Alles blieb still.
Der Großmeister nickte stumm und streichelte dabei abwesend den zitternden Hund. Er verstand. Das war nur eine Warnung gewesen….
Vorsichtig, sich nervös nach allen Seiten umsehend, durchquerte Großefuß mit schnellem, zielsicherem Schritt den Raum.
Irgendwo im Gebäude fiel eine Tür ins Schloss und das Geräusch hallte im Treppenhaus wieder, setzte sich fort, bis es oben bei Großefuß angelangt war.
Er fühlte eine Spannung von sich weichen und wusste: Jetzt war er wirklich allein.
»Komm«, sagte er nachdenklich zu dem kleinen, schwarzen Hund in seinen Armen. »Wir wollen sehen, ob wir noch etwas zu fressen für dich auftreiben.«
Jonah
Vor dem Fenster zogen die Wolken in schneller Folge am Mond vorbei und warfen unheimliche Schattengebilde an die Decke von Jonahs Zimmer.
Er lag in seinem, Bett, die Decke bis ans Kinn hochgezogen und verfolgte das Schattenspiel.
Das Tagebuch lag wieder unter der Matratze, und er bildete sich ein, es durch das dicke Polster hindurch deutlich spüren zu können.
Was hatte das alles zu bedeuten? Könnte er doch seine Mutter nur fragen! Doch dann würde er zugeben müssen, in ihrem Tagebuch gelesen zu haben, und das war ihm peinlich.
Ganz deutlich stand im Halbdunkel des Zimmers das Gesicht aus dem Tagebuch vor seinem geistigen Auge. Die dunklen Augen mit dem fesselnden Blick und die weiße Haarsträhne über der Stirn.
Er schloss ganz fest die Augen, doch das Bild ließ sich nicht vertreiben.
Warum hatte sich alles nur so verändert, seit sein Vater fort war? Er drehte sich zur Seite und kämpfte gegen die Tränen an, die ihm in die Augen stiegen. Ein seltsames Kratzen lenkte ihn ab. Jonah horchte. Die Geräusche kamen von oben. Der Dachboden!
Blitzschnell war er aus dem Bett und an der Tür. Alles schien ruhig. Er huschte hinaus auf den Flur und zur Treppe, die auf den Dachboden führte.
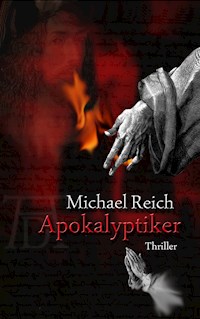
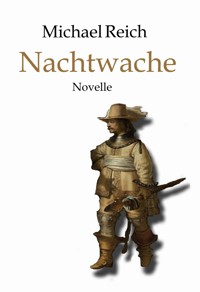


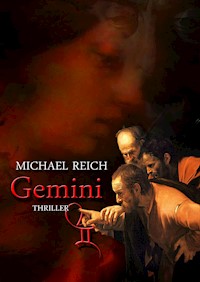
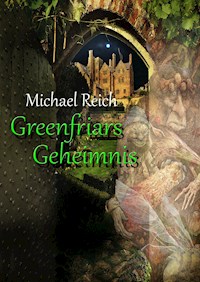













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









