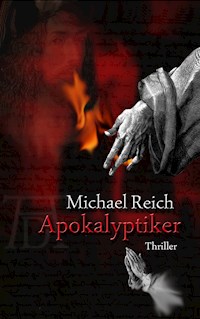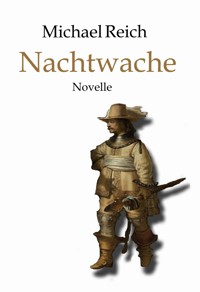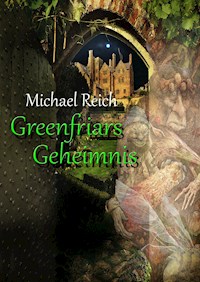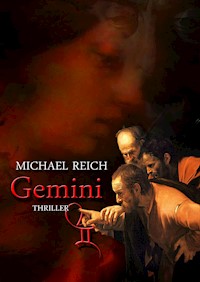
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gemini Ein Elise Brandt Thriller Die Kölner Hauptkommissarin und ihr neuer Fall Ein Serienmörder, der das Selbstbewusstsein der jungen Kommissarin auf eine harte Probe stellt und ein wertvolles Gemälde, das die kriminellen Instinkte verschiedener Gruppierungen weckt. Ein neuer Fall für Brandt und St. Cyr. Intelligent. Abgrundtief. Spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Wolfgang und Angelika.
Zwei Eichen in stürmischer Zeit.
Weh dir, verruchter Mörder! Du Fluch des Sängertums!
Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms!
Dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht.
Sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht!
Ludwig Uhland; Des Sängers Fluch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil
Wien, Juni 1997
Wien, September 1997
Teil
Köln, Frühherbst 1999
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Teil
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Teil
Kapitel
Anmerkungen
Vorwort
Köln, Juni 1969
I.
Nur keine Nervosität zeigen. Sie fischte eines ihrer von Spitzen umsäumten, reinseidenen Taschentücher aus ihrer Handtasche aus hellbraunem Krokodilleder und begann sich den Schweiß von den Händen zu wischen. Sie erlaubte sich niemals Schwäche zu zeigen. Nur Verlierer taten das. Und das war sie nicht. Sie saß im Fond einer der teuersten Limousinen, die derzeit auf dem Markt waren. Ihr schlanker Körper war in einen dunklen Nerzmantel gehüllt und am Ringfinger ihrer rechten Hand funkelte der von Brillanten umkränzte 3,40-karätige Saphir, den sie seit ihrer Verlobung vor fast fünfundzwanzig Jahren trug. Nein, sie war keine Verliererin. Sie tupfte sich die vereinzelten Schweißtropfen von der Stirn. Das Taschentuch verbreitete einen dezenten Duft nach Lavendel. Sie warf einen kurzen Blick auf das gestickte Monogramm, das jedes ihrer Wäschestücke zierte, als wolle sie sich vergewissern, dass es wirklich sie war, die in diesem Wagen saß und sich von ihrem Chauffeur, den sie nur als stumme, dunkle Silhouette wahrnahm, mittels einer Glasscheibe von ihr getrennt, durch die Nacht fahren ließ. Als sie den Verschluss ihrer Handtasche öffnete, strömte ihr der Geruch des exklusiven Parfüms entgegen, das sie sich von einer kleinen Manufaktur schicken ließ. Sie verachtete den Durchschnitt. Entschlossen packte sie das Taschentuch zurück und nahm den kleinen, gläsernen, mundgeblasenen Flakon hervor, den sie stets mit sich trug, um sich zwischendurch zu erfrischen. Die geheimen Ingredienzien der Kreation verbreiteten sich langsam im Fond des Wagens und gaben ihr ein vages Gefühl der Sicherheit.
Der Juni war ungewöhnlich warm in diesem Jahr. Selbst in den Abendstunden war die Luft schwer, fast erdrückend. Sie kurbelte das Seitenfenster auf halbe Höhe herunter. Obwohl sie eher verhalten fuhren, brachte der Fahrtwind Erfrischung und vertrieb die Schwüle, die sich im Wageninneren breitgemacht hatte. Je näher sie ihrem Ziel kamen, desto schneller begann ihr Puls zu schlagen. Ärgerlich. Sie kannte sich nicht in diesem Zustand. Sie hatte sich im Griff. Immer. Selbstkontrolle hatte sie an das Ziel ihrer Wünsche gebracht. Sie war einer der Schlüssel zum Erfolg.
Das Leben einer Großstadt, das an den Seitenfenstern der Limousine vorbeizog, verebbte langsam. Die Abstände zwischen den Häusern wurden größer, die Begrünung üppiger. Bald erschienen die Konturen hoher, eng stehender Bäume, die von einem umfangreichen Parkgelände zeugten. Ihre dichten Kronen, in denen ein lauer Frühsommerwind wie an unsichtbaren Fäden gezogen die Blätter bewegte, hoben sich respekteinflößend vor dem Abendhimmel ab, dessen völlige Verdunkelung noch auf sich warten ließ. Ihre Augen flogen unruhig über die rasch sich veränderte Landschaft. Sie hatten den äußeren Grüngürtel der Stadt erreicht, jene planmäßig angelegten Grünzonen, die sich auf beiden Ufern des Rheins halbkreisförmig um die Stadt Köln legten.
Der Fahrer verlangsamte das Tempo, bis der Wagen mit knirschenden Reifen auf kiesigem Untergrund zum Stehen kam, stieg aus und öffnete wie gewohnt die rechte, hintere Tür. Sie zögerte einen Augenblick. Unsicherheit, auch dies ein unbekanntes, unerfreuliches Gefühl. Doch ihre Entscheidungskraft siegte. Der Kies unter den Sohlen ihrer Lederpumps knirschte unangenehm, als sie den Schutz des Wagenfonds hinter sich ließ.
»Warten Sie hier. Es dauert nicht lange.«
Der Fahrer nickte. Seine Miene blieb unbewegt. Was immer er dachte, es würde in ihm verschlossen bleiben. Er hatte eine Vertrauensstellung und sie noch nie enttäuscht. Seine Frau war Köchin in dem herrschaftlichen Haushalt, den seine Arbeitgeberin führte, selbst seine Tochter arbeitete dort.
Langsam entfernte sie sich vom Wagen. Ihre Schritte waren zögerlich und zeigten nichts von der Energie und Entschlossenheit, mit der sie sonst durch ihr Leben ging. Trotz der Schwüle fror sie und war froh, dass sie sich für den Pelzmantel entschieden hatte. In diesem Augenblick war er mehr als ein Statussymbol, das ihrem Gegenüber ihren Stand und damit ihre Überlegenheit bezeugen sollte. Ihre Hand glitt in die rechte Manteltasche.
Als ihre Finger das kühle Metall berührten, zuckten sie unwillkürlich zurück. Sie beließ die Hand in der Tasche. Ihre Finger umklammerten krampfhaft den Perlmuttgriff der kleinen Handfeuerwaffe. Ein vages Gefühl der Sicherheit stellte sich ein. Ihr Mann hatte ihr die Damenpistole vor Jahren geschenkt und darauf bestanden, dass sie sie immer mit sich führte.
Sie war vollkommen allein auf dem schmalen Fußweg, was zu dieser Zeit nicht verwunderlich war. Sie ließ den Blick aufmerksam schweifen, geriet fast ins Stolpern. Die hohen, schmalen Absätze ihrer eleganten, italienischen Pumps waren für den weichen, sandigen Untergrund völlig ungeeignet. Unpassend. Wie die ganze Situation. Umkehren. Dem Wahnsinn ein Ende bereiten. Leises Rascheln, das wie ein geheimnisvolles Flüstern in der Dunkelheit war, durchbrach die Stille. Sie unterdrückte ihr Unwohlsein und setzte ihren Weg fort. Nur noch um die nächste Biegung. Ein kurzes Stück Weg und sie war am Ziel.
»Was wollen Sie?«
Sie hörte wieder die dunkle, von jahrelangem Zigarettenmissbrauch gebeizte Stimme. Der Mann am anderen Ende der Telefonleitung hustete rau.
»Wir müssen uns sehen.«
»Müssen wir das? Sie scheinen betrunken zu sein.« Sie wollte bereits den Hörer wieder auf die Gabel legen.
Er schien es zu ahnen. »Warten Sie.«
Da war dieser deutlich wahrnehmbare, brutale Unterton, der sie innehalten ließ. Sie war sich sicher, sie kannte diese Stimme. Die Art des Ausdrucks, die raue Tiefe …
»Es geht um Ihren Sohn. Um Ihren teuren, geliebten Sohn.«
Ein leichtes Unwohlsein in der Magengegend stellte sich ein.
»Noch einmal. Wer sind Sie?«
»Das tut nichts zur Sache.«
»Ich lege jetzt auf.«
»Wenn Sie das tun, wird Ihr Sohn im Gefängnis landen. Für eine sehr lange Zeit.«
Er hustete wieder. Angewidert hielt sie den Hörer vom Ohr weg.
»Es liegt in Ihrer Hand.«
»Kommen Sie morgen gegen zehn Uhr in unser Bürohaus. Ich denke, Sie wissen wo. Melden Sie sich beim Pförtner. Man wird Sie zu mir bringen.« Es war ein verzweifelter Versuch. Sie wusste sofort, dass er fruchtlos bleiben würde.
Er lachte, hart und grollend, wie eine Gebirgslawine, die zu Tal stürzt. Es folgte wieder ein Hustenanfall. »Glauben Sie mir, für dieses Gespräch wollen Sie keine Zeugen.«
Ein fester Kloß saß in ihrem Hals. Sie wollte den Hörer auflegen, diesen offensichtlich Verrückten einfach vergessen. Doch irgendetwas hielt sie davon ab. Sie zögerte. Sollte sie einen weiteren Vorstoß machen? Sie durfte ihn nicht reizen. Sie war sich nicht sicher. Und doch … »Kennen wir uns?«
»Wer weiß? Was glauben Sie? Kennen Menschen wie Sie, Leute wie mich?«
»Was soll das?«
»Kommen Sie morgen Abend um halb elf an den Kalscheurer Weiher am Zollstocker Weg. Allein. Ich biete Ihnen nur diese eine Chance.«
Ein dumpfer Knall und dann Stille, zeigten ihr an, dass er den Hörer aufgelegt hatte.
Aus den Hintergrundgeräuschen, die leise an ihr Ohr gedrungen waren, schloss sie, dass er von einem öffentlichen Apparat aus gesprochen hatte: Lachen, Stimmen, das Klirren von Gläsern. Vielleicht von einer der zahlreichen Kneipen in der Altstadt ...
Es war alles wie in einem schlechten Film. Die Realität, dass sie tatsächlich in der Dunkelheit allein am Ufer des Kalscheurer Weihers stand, schien wieder so absurd. Ihre Augen durchforsteten die Bepflanzung rund um den kleinen See. Das alles war der blanke Wahnsinn. Sie wartete förmlich darauf, dass mehrere vermummte Männer aus dem Gebüsch stürmten, um sie zu entführen. Doch nichts dergleichen geschah.
»Sie sind gekommen.« Eine klare, nüchterne Feststellung.
Der Schreck durchfuhr sie wie ein Messer. Sie hatte ihn nicht kommen hören, war so heftig herumgeschnellt, dass sie fast gefallen wäre. Die Hand in der Tasche schloss sich fester um den Pistolengriff.
Sein Blick fiel genau darauf. »Die werden Sie nicht brauchen.«
Er war groß, überragte sie um mehr als einen Kopf, von massiger Gestalt, furchteinflößend. Sie erkannte sofort die tiefe, dunkle Stimme vom Telefon. Er trug einen hellen Trenchcoat und eine karierte Schirmmütze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Seine Augen konnte sie nicht erkennen, nur das kantige Kinn, ein paar aufgeworfener Lippen, eine breite, fleischige Nase. Eine Boxervisage, ging ihr durch den Kopf, wie sie sie aus ihrer Jugend gut kannte, in einem Milieu, das von der Welt in der sie sich jetzt bewegte, so weit entfernt war, wie der Mond von der Erde.
Typen, denen man nichts vormachen konnte, die alles schon gesehen und noch mehr erlebt hatten. Wortlos zog er etwas aus der Innentasche seines Mantels und hielt es ihr entgegen. Sie zögerte, griff schließlich zu. Es war eine Art Akte, Papiere zwischen zwei Deckel aus beigem Karton geheftet.
Auf dem Aktendeckel prangte ein einziges Wort, von Hand mit Filzstift darauf geschrieben. Eine ungelenke Schrift, die Buchstaben grob:
GEMINI.
Sie verstand nicht, hielt die Akte wie einen völlig unbekannten Fremdkörper in ihrer Hand und starrte darauf. Als sie wieder hochblickte, war er verschwunden.
II.
Die Tür zu ihrem Büro war verschlossen. Sie war allein. Die Sicherheit einer gewohnten Umgebung. Ihr Büro lag im obersten Stockwerk, direkt neben dem ehemaligen Chefbüro ihres verstorbenen Mannes. Wie er genoss sie den Rundblick über die Stadt. Durch den Rauch einer Zigarette, den sie weit hinaus in den Raum geblasen hatte, heftete sich ihr Blick auf die hoch aufragenden Türme des Kölner Doms am Horizont. Die einsetzende Dämmerung legte sich über die Häuser, die ersten Lichter wurden entzündet. Das Wasser des Rheins, der sich wie ein Lindwurm zu ihren Füßen schlängelte, spiegelte die Pastellfarben des Abendhimmels. Ein friedvoller Anblick. Sie wandte sich ab und ging zum Schreibtisch zurück, auf der die Aktenmappe lag, die sie, seit jetzt fast vierundzwanzig Stunden in Händen hielt. Sie lag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Sie hatte jedes einzelne der Wörter gelesen, die auf den eingefügten Seiten mittels einer Schreibmaschine fein säuberlich aufgezeichnet worden waren.
Jetzt erst fand sie den Mut, sich auch die beigefügten Schwarz-Weiß-Fotos der Opfer anzusehen. Die Frauen glichen sich, als hätte jemand verschiedene Bilder von ein- und derselben Person gemacht. Alle trugen weiße Kleider. Ein Schal war um ihren Hals gewickelt. Blasse Gesichter, eingerahmt von schwarzem Haar. Die Aufnahmen zeigten die Farben nur in dunklen Grautönen. Die Lippen der Opfer waren besonders dunkel. Sie brauchte nicht lange zu überlegen, um zu erraten, welche Farbe die Lippen der Opfer hatten. Es war ein leuchtendes signalrot. Sie stand langsam auf und ging zu einem der eingebauten Wandschränke, öffnete eine der Türen. An der Innenseite war ein Spiegel angebracht. Sie hob den Kopf, blickte auf ihr Spiegelbild.
… so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz …
Tränen lösten sich aus den Augen, vermengten sich mit der Wimperntusche und liefen die Wangen hinunter. Schwarz auf weiß. Dunkle Spuren auf heller Haut. Sie zog ein Taschentuch hervor und wischte sich damit über das Gesicht und die Lippen. Innerhalb weniger Sekunden war das kunstvolle Make-up zerstört, ihre Züge nur noch eine Farce, eine Clownsmaske. Langsam ging sie zurück zum Schreibtisch.
Als Resultat der Unterlagen, die in dieser Mappe zusammengefasst waren, war dies alles das Werk eines einzigen Menschen: ihres Sohnes.
Dem anfänglichen Ekel war Ungläubigkeit gefolgt. Die Wucht der Aussage dieser Aktenmappe war die eines Faustschlages. Ein Missverständnis, dies alles musste ein Irrtum sein. Ein Alptraum, dem sie gleich entfliehen würde. Doch sie erwachte nicht. Sie erlebte die Realität in ihrem ganzen Wahnsinn. Mit zitternden Händen zog sie eine der Schubladen des Schreibtisches auf, die normalerweise sorgsam verschlossen waren.
Dies war ihre Büchse der Pandora. Sie hatte sie vor Jahren geschlossen und nicht wieder geöffnet. Jetzt war alles anders. Sie musste einen Moment suchen, zwischen alten Papieren, Behördenunterlagen und zahlreichen Fotografien. Bei der bereits verblassenden Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Gruppe lachender Mädchen hielt sie inne. Sie nahm das Bild heraus und legte es auf den Schreibtisch. Aus einer weiteren Schublade nahm sie eine Lupe hervor. Ganz am linken Rand des Bildes lugte der Kopf eines Jungen in die Szene hinein. Sie hielt das Bild hoch und betrachtete das Gesicht, das unschärfer war, als die der Mädchen, genauer. Über dreißig Jahre … Sie konnte sich irren. Doch die breite Nase, die wulstigen Lippen, das Kinn, noch etwas weicher, nicht so markant, und doch…
Sie ließ das Bild und die Lupe wieder sinken. Ihr Blick fiel auf eine weitere Fotografie mit gezacktem Rand, aus derselben Zeit. Sie zeigte zwei lachende, junge Mädchen, dreizehn vielleicht oder vierzehn. Ihre Hand zitterte, während sie das Bild betrachtete.
… so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz …
Gemini. Zwilling. Alle Opfer waren Teil eines Zwillingspaares gewesen. Ihre jetzt farblosen Lippen pressten sich aufeinander.
Sie griff sich das goldene Feuerzeug, das neben dem Aschenbecher auf dem Schreibtisch lag, entzündete es und näherte sich der Fotografie. Sie hielt das Bild so lange fest, bis die züngelnden Flammen ihre Finger fast erreicht hatten.
Dann warf sie die Aufnahme in den Aschenbecher, wo sie langsam ausglühte. Das Fotopapier knisterte. Sie beobachtete, wie die Gesichter der beiden Mädchen von den Flammen ergriffen wurden. Asche.
Sie schob die Schublade zu und verschloss sie sorgfältig. Den Schlüssel in der Hand ging sie zu einem der Fenster, öffnete es und warf ihn in weitem Bogen hinaus.
Sie musste sich den Tatsachen stellen und handeln. So war es immer gewesen. Sie handelte, sie entschied. Und sie gewann. Es ging um alles.
An die letzte Seite war ein Zettel geheftet. Die Handschrift war identisch mit der des Wortes auf dem Aktendeckel: Gemini.
»Sie haben genau 24 Stunden. Dann werde ich sie anrufen und mir ihre Antwort holen.«
Sie sah auf die mit kleinen Brillanten und Rubinen besetzte Platinarmbanduhr an ihrem Handgelenk. Noch zwei Stunden ...
III.
Das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelte um Punkt halb elf. Sie drückte die halb aufgerauchte Zigarette, die sie in der Hand gehalten hatte in dem Kristallaschenbecher aus und hob den Hörer von der Gabel. Es war wieder die dunkle Stimme.
»Nun?«
»Wer sind Sie?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Für mich schon.«
»Jemand der offenbar sehr gut über die Aktivitäten Ihres Sprösslings Bescheid weiß.«
»Haben Sie diese Mappe zusammengestellt?«
»Ja. Und ich bin der Einzige, der jedes Blatt und jedes Foto darin in dieser Zusammenstellung kennt.«
»Sie haben also Zugang zu polizeilichen Ermittlungen.«
»Offensichtlich.«
»Welche Gewissheit habe ich, dass nur Sie diese Akte kennen?«
»Keine. Nur mein Wort. Es sind natürlich Kopien, die Fotografien Abzüge. Ich habe die Originale und die Negative der Fotos hier vor mir liegen.«
»Was wollen Sie?«
Er lachte rau. »Natürlich das, was nur eine sehr reiche Frau einem armen, unterbezahlten Schlucker wie mir bieten kann.«
»Wie viel?«
»Sie werden es leicht verschmerzen. Aber es gibt etwas, das noch wichtiger ist. Eine zweite Klausel in unserem kleinen Vertrag.«
»Wovon sprechen Sie?«
Die Verbindung war schlecht, was die Verständigung erschwerte. »Sie werden dafür sorgen, dass es kein weiteres Opfer geben wird. Machen Sie mit dem Dreckskerl, was sie wollen. Sperren Sie ihn weg, lassen Sie ihn behandeln, was weiß ich. Ich habe gute Kontakte, glauben Sie mir. Ich werde sehr aufmerksam die Presse lesen. Wenn er es wieder tut, werde ich es erfahren und dann geht diese Akte auf direktem Wege zu den richtigen Stellen. Sie werden es gut machen. Davon bin ich überzeugt.«
»Sie wollen mir die Akte nicht aushändigen?«, fragte sie voller Anspannung.
»Nein. Sie ist meine Versicherung. Wenn nichts passiert, wird niemand sie jemals zu Gesicht bekommen. Ich bin ab jetzt Ihr Schatten. Und ich werde es Sie regelmäßig wissen lassen, dass ich Sie nicht vergessen habe. Ich gebe Ihnen noch einmal 24 Stunden. Überlegen Sie gut.«
»Warum tun Sie das?«
»Ich werde jetzt die Summe nennen, die ich von Ihnen erwarte. Wenn Sie auf unseren kleinen Handel eingehen, deponieren sie das Geld in einem Aktenkoffer und hinterlegen ihn in einem Gepäckschließfach am Kölner Hauptbahnhof. Den Schlüssel geben Sie ohne weiteren Kommentar an dem Zeitungskiosk in der Bahnhofshalle einer Frau, klein, graue Haare, Brille. Sie weiß Bescheid. Sollte mich bei der Abholung des Koffers die Polizei erwarten oder mir sonst etwas zustoßen, geht die Akte sofort zu den richtigen Leuten, die wissen, was sie damit anzufangen haben.«
Stille.
Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, blickte auf das Foto auf dem Schreibtisch. »Amiran, bist du das?«
Stille.
»Hör zu, das Ganze ist ein Missverständnis. Wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern, das Geschehene ungeschehen machen. Bitte. Ich habe nur das Beste gewollt … Ich …«
»Leg ein paar Blumen auf ihr Grab. Wenn du dich noch erinnerst, wo es ist.«
Ein lautes Knacken. Er hatte aufgelegt. Wieder waren im Hintergrund leise die Geräusche zu hören gewesen, die sie schon einmal wahrgenommen hatte. Verhaltenes Stimmengewirr, Lachen, das Klirren von Gläsern und Flaschen.
Sie ließ den Hörer sinken und starrte in die Weite des Raumes. Noch einmal hörte sie seine raue Stimme, diesmal aus weiter Ferne:
Sie werden dafür sorgen, dass es keine weiteren Opfer geben wird. Und Sie werden es gut machen …
Ihr Blick fiel auf eine lederne Mappe, die auf ihrem Schreibtisch lag. Ihr Inhalt waren Schriftstücke, die wie kleine Nadeln in ihr Fleisch stachen. Zwanzig Jahre lagen zwischen dem Verfassen und dem Jetzt. Zwanzig Jahre alt, wurde ihr Sohn in wenigen Wochen. Seit zwanzig Jahren währten ihr Glück und ihr Aufstieg. Sollte das jetzt alles vorbei sein?
Sie legte den Hörer wieder zurück auf die Gabel und zündete sich eine weitere Zigarette an.
Sie klappte die Mappe auf. Oben auf den Papieren lag ein handgeschriebener Brief. Es war eine Erpressung. Unverhohlen. Sie verfolgte mit den Augen die Nebelwesen, die der von ihr in die Luft geblasene Zigarettenrauch bildete. Zwei Fliegen mit einer Klappe ...
Er würde einen Koffer vorfinden, mit Geld und einem Brief. Kurze Zeilen nur, handgeschrieben, mit einem Namen. Sie war sich sicher, er würde verstehen. Das war ihre Bedingung.
Sie drückte entschieden die Zigarette im Aschenbecher aus und zog Papier und Füllfederhalter zu sich heran ...
1.Teil
Wien, Juni 1997
I.
Avide St. Cyr verließ das Sacher an der Philharmoniker Straße und entschied sich den relativ kurzen Weg zu Fuß zurückzulegen. Es war früh und obwohl Sommer und Hochsaison noch ruhig in den Straßen. Selbst das Café Mozart um die Ecke des Sacher, sonst von Touristen belagert, zeigte noch freie Tische unter den weißen Sonnenschirmen. Der Gemeindebezirk Wien Innere Stadt war einer der von den Touristen meist bevölkerte Teil der Donau-Metropole. Der Stephansdom, die Kärtnerstraße, Kapuzinergruft, Mozarthaus und die Oper lagen hier. Und es war das klassische Auktionshausviertel der Stadt, angeführt vom ältesten, dem Dorotheum, lagen hier, unweit der Hofburg und den großen Museen, eingebettet in die schmalen von den klassistischen Fassaden der Stadtpalais’ begrenzten Straßen und Gassen, das Kinsky, Sotheby’s und Christie’s und zahlreiche kleinere Auktionshäuser.
Die Sonne strahlte in einem wolkenlosen, azurblauen Himmel und ließ die Fassaden der Häuser leuchten. Er ließ die Albertina linker Hand liegen und bog am Palais Lobkowitz in die Spiegelgasse ein, an der das Dorotheum lag und die auf den Graben auslief, die als luxuriöse Einkaufsund Flanierstraße mit Kärntner Straße und Kohlmarkt das ‚goldene U’ des Wiener Handels bildete. Der Graben war auch zur frühen Stunde gut besucht. Er lief bis zum Kohlmarkt und bog dort in die Bognergasse ein, die auf den großen Platz Am Hof mit der 1667 von Leopold I. aufgestellten Mariensäule und der Jesuitenkirche am Hof zu den neun Chören der Engel auslief, in dessen Chorgruft der Beichtvater Maria Theresias bestattet worden war. Die schöne Barockfassade der Kirche, dessen Gründung schon auf das 14. Jahrhundert zurückging, war eine Stiftung Eleonores von Gonzaga, der Witwe Kaiser Ferdinands III. aus dem Jahr 1662 und beherrschte den Platz. Direkt daneben lag das Ziel seiner Reise, das sich neben der wuchtigen Kirchenfassade eher zierlich ausnehmende Barockpalais Collalto, dessen heutige Form auf die umfangreichen Umbauten der ehemaligen Landschaftsschule Ferdinands I. durch die venezianische Patrizierfamilie Collalto zurückging, die das Anwesen 1671 erworben hatte.
Im Oktober 1762, da war das Palais bereits durch die heutige Barockfassade ergänzt, fand hier das erste öffentliche Konzert des sechsjährigen Wolfgang Amadeus Mozart für den Grafen Thomas Vinciguerra Collalto und seine Gäste statt.
Das Geschäft der Brüder von Szell, Abkömmlinge einer böhmischen Adelsfamilie, war nicht das größte und bedeutendste Auktionshaus der Stadt, genoss aber in Kennerkreisen einen guten Ruf. Immer wieder war es den beiden Brüdern durch Beziehungen zu den gehobenen Kreisen, denen sie selbst entstammten, gelungen qualitativ hochwertige Objekte, meistens aus Hinterlassenschaften, durch ihr Haus zu vermitteln. Die Kataloge ihrer Auktionen konnten durchaus mit denen der großen Häuser mithalten.
Avide betätigte einen Klingelknopf, der an der Hausfassade neben den schweren Massivholztüren des Eingangsportals angebracht war und wartete.
Eine weibliche Stimme ertönte. Er nannte seinen Namen und ein leises Klacken zeigte ihm an, dass sich die Türe nun öffnen ließ.
Er betrat das Vestibül. An der linken Seite öffnete sich eine fast quadratische, von zwei Fenstern erhellte Halle, in drei Bögen zum Treppenhaus. Der Stiegenaufgang war für die Zeit seiner Erbauung ungewöhnlich prunkvoll und farbig. Eine Mitteltreppe führte zu einem Wendepodest, von dem man dann gegenläufig über zwei seitliche Arme die Beletage erreichte. Die roten Marmorbalustraden dieser Arme waren an ihren Enden mit prunkvollen Porphyrvasen besetzt. Zwei reich verzierte Rotmarmorportale ermöglichten den Zugang zur Antecamera. Ihr mit Cherubsköpfen und Fruchtgehängen stuckiertes Spiegelgewölbe stammte noch vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die Wände waren mit Boiserien verkleidet. Von der hohen verzierten Decke hing ein prachtvoller Kristalllüster und verbreitete ein sanftes Licht. Er stieg die mit einem roten Teppich belegten Stufen zur Beletage hinauf, wo ihn bereits eine lächelnde Dame in einem eleganten dunkelblauen Etui-Kleid, dessen dreiviertellange Ärmel in dekorativen, weißen Manschetten ausliefen, erwartete. Marlene Rufiak war seit über zwanzig Jahren die Empfangsdame des Hauses und erste Assistentin der Brüder Szell. In ihren Händen lagen alle administrativen und organisatorischen Aufgaben. Sie war die graue Eminenz im Hintergrund, die alles kontrollierte und koordinierte, vom Erstellen der Kataloge bis hin zum Verschicken der Einladungen. Avide hatte sie jetzt seit längerem nicht mehr gesehen und war erstaunt über das mittlerweile ergraute Haar der Mittfünfzigerin, das sie immer noch schulterlang und in kunstvolle Wellen gelegt trug. Ihr dezentes Make-up unterstrich ihre natürliche Schönheit.
Sie hielt Avide freundschaftlich eine gepflegte Hand entgegen.
»Dr. St. Cyr. Sie sind lange nicht mehr hier gewesen.«
Avide deutete formvollendet einen Handkuss an. »Die Zeit verstreicht viel zu schnell.«
Sie lächelte verschmitzt. »Wenn Sie auf meine grauen Haare anspielen, ich war das ewige Färben leid. Ich finde, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sie nicht mehr zu verstecken brauche.« Sie vollführte eine ausladende Bewegung mit den Armen und wies in die Runde. »Ich habe sie mir redlich verdient!«
Avide nickte verständnisvoll. Er kannte und schätzte die Szells, wusste aber auch, dass sie nicht immer einfach im Umgang waren.
»Kommen Sie. Man erwartet Sie bereits.«
Hinter den hohen, reich verzierten Türen lag der ehemalige große Festsaal des Palais’, der jetzt, sorgfältig restauriert, als prunkvoller Auktionssaal genutzt wurde. Das gebohnerte Parkett glänzte und die von der Decke herabhängenden Prunkleuchter aus böhmischem Kristall spiegelten sich darin. Quer durch den gesamten Saal lief ein roter Läufer, rechts und links davon waren fleißige Arbeiter gerade dabei die Stühle aufzustellen. In Kürze würden dort die zur Auktion geladenen Gäste Platz nehmen. Am Ende des Saales hatte man ein Podest aufgebaut, auf dem das Stehpult stand, von dem aus einer der Brüder Szell die Auktion leiten würde.
Sie durchquerten den Saal und betraten hinter dem Podest durch eine Tür den Bürotrakt des Auktionshauses, in dem bereits emsige Betriebsamkeit herrschte. Es war das Reich von Marlene Rufiak, die von hier aus die Aktivitäten der Firma aufeinander abstimmte. Sie entschied, welche der eingehenden Anfragen dem Ruf und dem Qualitätsanspruch des Auktionshauses entsprach, schickte ausgewählte Experten zu einer Vorabbesichtigung, bevor, bei positiver Beurteilung, die Brüder Szell selbst in Erscheinung traten und den tatsächlichen Geschäftsabschluss tätigten. Erst dann wurde der Bestand aufgenommen, eventuell ein Katalog erstellt und die Auktion der begutachteten Gegenstände organisiert, sowie die Einladungen an ausgesuchte Sammler und Wiederverkäufer versandt. Auch Avide hatte bereits als Gutachter für das Auktionshaus gearbeitet. In den Semesterferien, während seiner Zeit als Student der Kunstwissenschaft an der Sorbonne, sogar zeitweise als Praktikant.
Hinter zwei hohen Flügeltüren im hinteren Teil lag das Allerheiligste, das Büro der Brüder Szell. Marlene Rufiak zögerte, bevor sie klopfte, und nahm Avide beiseite.
»Etwas noch, Dr. St. Cyr. Sie wollen sicher mit Ellen sprechen.«
Avide war überrascht. Von dieser Seite auf eine Exfreundin angesprochen zu werden, damit hatte er nicht gerechnet. »Ich habe sie angerufen, als mir der Auftrag zugewiesen wurde. Aber offen gestanden, sie schien mir sehr reserviert. Ich bin mir nicht sicher …«
»Genau deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie hat sich in der letzten Zeit sehr verändert. Sie war doch stets so fröhlich und offen. Ich habe das Gefühl, sie zieht sich immer mehr zurück. Sie hat sich häufiger krankgemeldet und an einem dieser Tage habe ich sie ziemlich munter in der Stadt gesehen. Das passt nicht zu ihr. Auch heute hat sie sich wieder krankgemeldet. Obwohl sie doch weiß, wie wichtig der Tag für uns ist. Sie war doch immer so zuverlässig. Ich habe mich gefragt … Nun, sie waren ein so nettes Paar damals.«
»Ob ich mal mit ihr sprechen könnte?«, half Avide ihr aus, der merkte, dass Marlene Rufiak das Gespräch nicht angenehm war. »Ich kann es versuchen. Ich hatte nicht vor, mich so kalt abservieren zu lassen. Auch wenn wir mit unserer Beziehung damals gescheitert sind, sind wir doch immer noch befreundet.«
Marlene Rufiak nickte zufrieden und schien erleichtert. »Ich hatte immer gehofft, Ellen würde hier einmal meine Nachfolge antreten. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre.«
»Was glauben Sie, könnte hinter ihrer Wesensänderung stecken?«
Sie zögerte. »Es ist nur eine Vermutung, ein Gefühl. Aber vielleicht ein Mann.« Sie lächelte ihn an. »Seit der Zeit mit Ihnen damals, nun, ist da nicht mehr viel gewesen. Nichts Ernstes. Sie hat sehr viel gearbeitet. Ich habe ihr einmal ernsthaft ins Gewissen geredet deswegen. Aber …« Sie zuckte mit den Schultern.
Avide wusste, wovon sie sprach. Ellen war ein Workaholic. Das war einer der Gründe, warum ihre Beziehung gescheitert war.
»Was ist mit ihrer Schwester?«
»Lebt inzwischen in Amerika. Sie war vor einigen Wochen bei ihr zu Besuch. Seltsam, dass Sie das erwähnen aber kurze Zeit, nachdem sie wieder fort war, begann Ellen sich zu verändern.«
Ellen und Sylvia. Die Bergner-Zwillinge. Selbst Avide hatte sie nicht immer auseinanderhalten können.
Sie waren sich sehr verbunden, wie man es oft bei Zwillingen fand. Dass Sylvia nach Amerika gegangen war, musste Ellen getroffen haben. Er sah sie vor sich, bei einem ihrer gemeinsamen Ausflüge zu den Badeseen des Umlandes am Wochenende.
Das gelockte, schulterlange, schwarze Haar triefnass, die helle Haut in einem engen Badeanzug, der ihre schlanken Figuren betonte, kamen sie lachend aus dem Wasser zu ihm an den Strand. Jede von ihnen drückte ihm einen Kussmund mit ihrem wasserfesten, signalroten Lippenstift auf die Wange. Glückliche Tage…
Marlene Rufiak klopfte an die Bürotür und öffnete ohne eine Reaktion aus dem Inneren des Büros abzuwarten.
»Dr. St. Cyr ist da.« Sie trat einen Schritt zur Seite und ließ Avide eintreten, nickte ihm kurz zu, verließ das Büro und schloss die Türe hinter sich.
Ein intensiver Geruch nach Tabak hing in der Luft. Alfred Szell war Zigarrenraucher, sein Bruder Václav rauchte Pfeife. Das großräumige Büro war dunkel getäfelt. An den Wänden standen Vitrinenschränke, in sie ihre Kostbarkeiten aufbewahrten. Sie sammelten Glaswaren aus ihrer Heimat.
Das berühmte böhmische Kristall - ein Kreideglas, bei dessen Herstellung dem Gemenge aus Sand und Pottasche Kalk in Form von Kreide beigemischt wurde, um die Leistungsfähigkeit der Schmelzöfen zu erhöhen - des ausgehenden 17. bis frühen 20. Jh., nachdem Böhmen die Vorherrschaft Venedigs und der Venezianerhütten nördlich der Alpen, Hall in Tirol und in den Niederlanden, abgelöst hatte, erstrahlte in den von innen beleuchteten Vitrinen in den herrlichsten Farben.
Den Kopf des Raumes nahm ein überdimensionierter steinerner Kamin ein. Über ihm, ebenfalls diskret illuminiert, in einem schmalen goldenen Rahmen, hing Caspar David Friedrichs Böhmische Landschaft.
Rechts und links, sich genau gegenüber, standen zwei ausladende, mit zahlreichen Papieren bedeckte Gründerzeitschreibtische aus nachgedunkeltem Mahagoni, an denen die beiden Brüder seit Jahrzehnten arbeiteten.
Václav und Alfred von Szell waren eineiige Zwillinge und kaum voneinander zu unterscheiden, klein und untersetzt, trugen beide maßgeschneiderte Anzüge, weiße Hemden und farbige Seidenfliegen. Ihre eiförmigen Köpfe mit der hohen Stirn umgab ein Kranz blassroter Haare. Beide trugen Brillen mit schmalem Goldrand, hinter denen zwei paar Augen mit mausgrauen Pupillen ihr Gegenüber taxierend durchleuchteten. Alfred von Szell, der an dem rechten Schreibtisch saß, erhob sich zuerst und begrüßte Avide herzlich; Václav, die kalte Pfeife in der Hand, etwas zurückhaltender als sein Bruder, gesellte sich wenig später zu ihnen.
»Nun, nun«, sagte Alfred mit leichtem Akzent. »Kommen wir zum Geschäftlichen.« Er wies mit der Hand an seinem Bruder vorbei zum anderen Ende des Raumes.
Vor dem Kamin, auf einer Staffelei, stand der Grund, der Avide nach Wien geführt hatte.
Andrea del Sarto, Disputa sulla trinità, gemalt um 1518. Der Streit um die Dreifaltigkeit. Sechs Heilige diskutieren erregt über einen Anspruch auf absolute Gültigkeit. Das Bild, Öl auf Holz, etwa 60 x 80 cm groß, wurde in einem barocken, reich verzierten Rahmen präsentiert. 1517 hatte der Künstler das Thema bereits im Großformat 2,32 zu 1,93 Meter für das Augustinerkloster San Gallo in Florenz gemalt, das 1529 bei der Belagerung von Florenz durch Karl V. zerstört worden war. Die Gemälde des Klosters hatte man vorher nach San Jacopo ai Fossi ausgelagert. Das Werk hing heute in der Halle des Saturn in der Galleria Palatina im Palazzo Pitti in Florenz. Aus einem graublauen, von Wolken verhangenen Himmel trat am oberen Bildrand, in einen leuchtend roten Umhang gehüllt, Gottvater heraus, der wie ein Schild das Kreuz mit Jesus vor sich hertrug. Darunter standen in einem Halbkreis diskutierend der Hl. Augustinus, der Hl. Laurentius, St. Peter der Märtyrer, Franz von Assisi und, vor ihnen kniend, am rechten und linken Bildrand der Hl. Sebastian und Maria Magdalena, die die Züge von Sartos Ehefrau Lucrezia del Fede tragen soll. Der 1486 geborene florentinische Künstler, der eigentlich Andrea d’Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore hieß und den Beinamen Sarto erhielt, weil sein Vater Schneider gewesen war, hatte diese verkleinerte Kopie des Originalgemäldes 1518 für einen nicht bekannten Auftraggeber gefertigt. Del Sarto wurde berühmt durch seine Farbgebung und die Sanftheit der Gesten seiner Figuren. Er war nicht nur Schüler eines bedeutenden Malers – Piero di Cosimo –, sondern auch der Lehrer dreier großer Künstler: Pontormo, Salviati und Giorgio Vasari, der später seine Biographie verfasste. Er war einer der bedeutendsten Maler der Hochrenaissance. Seine ausdrucksstarke Farbgebung war in der florentinischen Malerei unübertroffen. Obwohl er zu seinen Lebzeiten als artista senza erriqui ‚ohne Fehler’ hoch angesehen war, wurde sein Ruhm nach seinem frühen Tod durch den seiner Zeitgenossen Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raphael in den Hintergrund gedrängt.
Mit Michelangelo und Raphael, die in Rom arbeiteten, wurde Andrea del Sarto nach dem Tod von Fra Bartolomeo 1517 der führende Maler in Florenz und durch seine Schüler, II Rosso und Pontormo, gelang ihm ein entscheidender prägender Einfluss auf die Entwicklung des Manierismus.
Das Bild stammte aus einer Privatsammlung, der Sammlung Greven-Montfort, einer Kölner Verlegerdynastie. Severin Greven-Montfort, der derzeitige Chef des Hauses, hatte beschlossen, einige Objekte der Sammlung zu veräußern, angeblich, wie man hinter vorgehaltener Hand munkelte, um anstehende Steuerschulden begleichen zu können.
Avide kannte das Werk. Er hatte es vor zwei Jahren für den Versicherungskonzern, für den er freiberuflich arbeitete, der IAI, der International Art Insurance der Moroni Group, nach einer aufwendigen Restaurierung begutachtet und neu versichert. Bei so hochrangigen Werken schickte die Versicherung gern einen Mitarbeiter, der ein Auge auf den reibungslosen Ablauf des Verkaufs hatte. Avide, durch seine Herkunft und Bildung prädestiniert, verfügte darüber hinaus über entsprechende Umgangsformen, und wurde daher gern für diese Art von Aufträgen herangezogen. Als Sohn eines griechischen Großreeders und der Nachfahrin eines alten Kölner Patrizialgeschlechts, hatte er seine Kindheit auf den teuersten Internaten verbracht und seine Ausbildung schließlich mit einem Abschluss in Kunstwissenschaft und der Erlangung der Doktorwürde an der Sorbonne in Paris gekrönt. Er hatte Verbindungen und Kontakte in der ganzen Welt und bewegte sich in den gehobenen Kreisen so sicher, als wäre er im heimischen Wohnzimmer. Seit einigen Jahren arbeitete der mittlerweile dreißigjährige als freier Dozent an der Uni in Köln und bei der IAI, die den smarten, gutaussehenden Halbgriechen gern für besonders heikle Aufgaben einsetzte. Er besaß neben dem nötigen Fachwissen auch das gewisse Fingerspitzengefühl, das bei der oftmals schwierigen, da jeder Normalität enthobenen Kundschaft, angebracht war.
Avide wandte sich wieder dem Bild zu, um es einer letzten Prüfung zu unterziehen. Die beiden Brüder ließen ihn gewähren und zogen sich diskret an ihre Schreibtische zurück.
Avide prüfte das Bild sorgfältig und ließ sich Zeit dabei. Erneut war er von der Ausgewogenheit der Palette del Sartos begeistert. Die Kostüme der Heiligen erstrahlten in leuchtenden Pastelltönen. Chiaroscuro und Faltenwurf waren perfekt. Ihre Darstellung wurde von den ihnen zugeeigneten Attributen komplettiert: Augustinus mit dem Hirtenstab, Laurentius mit dem Gitterrost, auf dem er gemartert worden war, St. Peter der Märtyrer mit einem Buch, der Heilige Franz mit den Wundmalen an den Händen, Maria Magdalena mit dem Salbbecher der Wundheilung und Sebastian mit einem Pfeil. Augustinus, der einflussreiche Denker, der Philosoph, der Verfasser der Confessiones, hatte das Wort ergriffen, die anderen lauschten ihm. Avide trat einen Schritt zurück und betrachtete das Gemälde noch einmal in seiner Gesamtheit. Die Restaurierung damals, allen voran die Säuberung, war eine gute Entscheidung gewesen. Er kehrte zu den Schreibtischen der Brüder zurück.
»Nun, nun?« Alfred von Szell erhob sich erneut.
»Ein wundervolles Bild.«
»Nicht wahr? Ich finde diese Darstellung noch beeindruckender als die große Version im Palazzo Pitti, so komprimiert, so intensiv. Diese Farben...!«
Avide nickte bestätigend. Václav von Szell betrachtete ihn mit geneigtem Kopf. »Das sind die Gesetzte des Marktes, mein lieber Avide.«, sagte er.
»Ich verstehe nicht …?«
»Ich sehe Ihren Blick. Sie denken daran, wo das Bild nun seinen Platz finden wird. Ob er der Schönheit des Bildes auch gerecht wird? Das Geld bestimmt. Das war übrigens zur Entstehungszeit des Gemäldes nicht anders. Was wäre die Kunstgeschichte ohne die reichen Potentaten, Kirchenmänner oder Kaufleute und Bankiers, die das Geld hatten, solche Werke in Auftrag zu geben.
Dieses Bild wäre nie entstanden ohne einen dieser Männer, der seine eigene Version des Themas besitzen wollte. Vielleicht um sein Renommee aufzupolieren oder vor anderen anzugeben, die sich so etwas nicht leisten konnten.«
Avide nickte stumm. Er wusste, dass Szell Recht hatte. Und doch war er der Meinung, dass jeder die Chance haben sollte etwas so Einzigartiges erleben zu können. Aber er wusste auch, dass die Tendenz Kunst als Handelsware anzusehen, ausschließlich als Wertobjekt, stetig zunahm. Man legte sich ein Gemälde in den Safe, wie man es mit einem Paket Aktien tat. Eine Tatsache, die den schwarzen Kunstmarkt florieren ließ und die Preise bald in schwindelnde, völlig absurde Höhen schießen lassen würde. Eine fatale Entwicklung. Und niemand wusste, auch er nicht, wie man ihr Einhalt gebieten konnte.
»Nun, nun«, mischte sich Alfred Szell ein. »Fort mit den dunklen Gedanken. Lassen Sie uns auf einen guten Abschluss anstoßen.«
Auf einem silbernen Tablett auf seinem Schreibtisch standen Kristallflacon und geschliffene Cognacgläser bereit. Die Flüssigkeit in dem Flacon hatte einen dunklen Karamellton und verhieß einen edlen Tropfen.
»Wird Greven-Montfort anwesend sein?«, fragte Avide, während Alfred Szell mit fast ritualen Bewegungen die Gläser auf dem Tablett füllte.
»Ich bezweifle es«, sagte Václav. »Sie wissen, er ist äußerst scheu und meidet die Öffentlichkeit.«
Avide nickte. Auch er hatte damals nur mit dem von der Familie bestellten Kurator der Sammlung gesprochen.
Václav Szell verteilte die Gläser und sie prosteten sich zu.
Für einen kurzen Augenblick trat eine zufriedene, ausgeglichene Stille ein. Dann drang plötzlich aus weiter Entfernung Stimmengewirr in den Raum und drängte sich wie ein ungebetener Gast in das Schweigen. Avide sah wie Alfred von Szell, der es auch gehört zu haben schien, den Kopf zur Tür wandte. Später erinnerte er sich, dass auch er sich halb zur Tür drehte, zu der er mit dem Rücken gestanden hatte. Danach ging alles so schnell, dass er bei der späteren Befragung durch die Polizei Schwierigkeiten hatte, den genauen Ablauf zu rekonstruieren.
Ein gewaltiger Knall zerfetzte die Stille, der die beiden Flügeltüren zum Büro der Brüder aus den Angeln hob. Glas splitterte, Rauch aus dem Vorzimmer, der in den Augen brannte und sofort einen Reizhusten auslöste, drang in das Büro und hüllte sie ein. Er hörte Schreien, lautes Rufen. Aus dem Rauch tauchten wie zwei Marsmenschen zwei hochgewachsene Männer in grünen Monteuranzügen und mit Gasmasken vor dem Gesicht im Türrahmen auf.
Jeder von ihnen war mit einer schweren Maschinenpistole bewaffnet, aus der sie sofort, ohne Zögern in den Raum feuerten. Avide sah, wie Václav von Szell nach hinten in den Raum geschleudert wurde, das Glas der Vitrinen splitterte im Kugelhagel und die bunten, schillernden Splitter der zerfetzten böhmischen Glasobjekte in ihnen regneten wie Konfetti zur Erde. Alfred von Szell hatte abwehrend die Hände erhoben und wurde von einem der Bewaffneten zu Boden gerissen. Avide hatte sich geistesgegenwärtig mit einem Satz hinter den ausladenden Schreibtisch geflüchtet, als der Kugelhagel losging. Dann war wieder Stille. Einer der beiden Angreifer stampfte mit seinen schweren Militärstiefeln durch das Büro. Die überall auf dem Boden verteilten Glassplitter knirschten unter seinen Tritten. Vor der Staffelei machte er halt und eine behandschuhte Pranke griff nach dem del Sarto. Der zweite Mann am Eingang zum Büro wartete, mit der Waffe im Anschlag.
Avide handelte instinktiv und, wie man ihm später bescheinigte, kopflos. In seinen Augen brannte das Rauchgas. Mit einem Hechtsprung schoss er hinter dem Schreibtisch hervor und umklammerte die Stiefel des Eindringlings, der ins Stolpern geriet und um sich wieder ausbalancieren zu können das Bild fallen ließ. Avide hörte, wie das Holz des Rahmens splitterte. Er hielt noch immer die Beine des Mannes umklammert, der sich aber von ihm befreien konnte, ihn weg von sich stieß, so dass er unsanft auf dem Rücken landete. Anschließend verpasste er ihm mit dem Stiefel einen Tritt an den Kopf, der sofort unter einer Schmerzlawine explodierte. Ein roter Schleier legte sich über seine Augen. Das Letzte was er bewusst wahrnahm, war ein dritter Mann, unbewaffnet und in Zivilkleidung, der den Raum durch die Nebelwand betrat. Er war groß und trug einen dunklen Mantel. Sein Gesicht war markant, eckiges Kinn, breite, fleischige Nase, an beiden Seiten tiefe Falten, die sich bis zum Mund zogen. Das Auffallendste an ihm war ein dicker Schopf leuchtend weißer Haare, der wie ein Fixpunkt aus dem rauchverhangenen Chaos um sie herum hervorstach.
Er sagte kein Wort, nahm das Bild aus dem kaputten Rahmen an sich und bedeutete den Männern mit einer Kopfbewegung, dass es Zeit war, den Ort des Geschehens zu verlassen. Kurz bevor er das Büro verließ, wandte er sich noch einmal um, und blickte Avide an, der mit letzter Kraft den Kopf anhob. Dann wurde ihm übel und er verlor ganz das Bewusstsein.
II.
Avide wachte auf und versuchte sich zu orientieren. Seine Augen brannten wie Feuer, sein ganzer Kopf schmerzte. Vorsichtig wanderte eine Hand hoch zur Stirn und ertastete einen Druckverband. Langsam richtete er sich auf. Um ihn herum strahlendes Weiß. Ein Krankenbett, in einem Krankenhaus, schoss es ihm durch den Kopf. Wenig später waren die Ereignisse des frühen Morgens wieder präsent, der Überfall…
Eine Türe öffnete sich und eine Krankenschwester in weißer Montur kam herein. Das braune Haar war von hellen Strähnen durchzogen, sie trug eine Brille mit Horngestell, das sie älter wirken ließ und lächelte ihn freundlich an.
»Ah, Sie sind wach. Das ist gut.« Sie sprach mit dem typisch wienerischen Akzent. »Sie sind in einem Spital, nicht wahr? Im St. Josef in Hietzing. Ihr armes Köpferl hat ganz schön was abgekriegt. Aber das wird wieder. Ein bisserl Kopfweh werden’s aber schon noch eine Zeitlang haben. Wir mussten nähen. Der Doktor wird dann gleich kommen, nicht wahr.«
Sie stellte eine Metallschale auf einen Nachttisch neben seinem Bett und begann eine Spritze aufzuziehen.
»Ein bisserl was gegen die Schmerzen«, sagte sie und verpasste ihm die Spritze in den Arm.
»Und für die Augen gibt’s gleich eine Spülung.«
Freundlich lächelnd und ihm aufmunternd zunickend verließ sie wieder den Raum. Es dauerte nicht lange, dann öffnet sich die Türe erneut. Ein Mann, klein und schmächtig. Er trug Jeans und eine Cordjacke, die bessere Tage gesehen hatte, darunter ein weißes Hemd mit offenem Kragen und ein buntes Tuch um den Hals gewickelt. Der dichte, dunkle, an den Schläfen ergrauende Haarschopf war verstrubbelt, was ihm ein jungenhaftes Aussehen gab. Seine ganze Erscheinung drückte Widerstand aus, Aufruhr, gegen gängige Moden, vorgefasste Meinungen, das Establishment. Ein junger, rebellischer Geist im Körper eines vierzigjährigen Mannes, für so alt hielt Avide ihn schätzungsweise. Die Partie um den kleinen Mund mit dem ironischen Zug und das runde Kinn war von einem Dreitagebart gekennzeichnet. Unter den eisblauen, sehr wachen Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab, wahrscheinlich von zu wenig Schlaf. Er kaute auf einem Zahnstocher herum, was Avide zu der Vermutung verleitete, er sei dabei sich das Rauchen abzugewöhnen. Vielleicht sollte es aber auch einfach nur lässig wirken. Er hatte einen weichen, etwas schlendernden Gang und näherte sich vorsichtig dem Bett, ließ Avide dabei nicht aus den Augen. Bevor er ihn ansprach, nahm er den Zahnstocher aus dem Mund und steckte ihn in die Tasche seiner Jacke. »Verzeihen Sie, ich gewöhne mir gerade das Rauchen ab. Man hat mir gesagt, dass Sie wach sind. Wie geht es Ihnen?« Seine Stimme war dunkler, als Avide es erwartet hätte. Auch er hatte den breiten Akzent der Wiener.
»Als hätte mir jemand einen schweren Stiefel gegen den Kopf gedonnert. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Major Dittberner, Landespolizeidirektion Wien, zurzeit in einer Sonderkommission für organisiertes Verbrechen. Wir hatten ein paar Probleme in letzter Zeit.« Er deutete mit dem Finger zur Decke. »Man wird nervös, Sie verstehen.«
»Und wenn du nicht mehr weiterweiß, dann gründe einen Arbeitskreis.« »Wie?«
»Schon gut. Organisiertes Verbrechen?«
Dittberner nickte und zog sich einen Stuhl an das Bett heran. Er fixierte Avide mit seinen umschatteten, hellen Augen.
»Sie waren als Vertreter der Versicherung im Auktionshaus von Szell?«
»Ja. Das Bild gehörte zur Greven-Montfort-Sammlung. Meine Versicherung, die IAI, hat sie schon vor einigen Jahren neu taxiert und versichert. Ich selbst den del Sarto, vor zwei Jahren, nach einer aufwendigen Restaurierung. Wie geht es den Szells?«
»Den Umständen entsprechend. Alfred von Szell verarbeitet den Schock, sein Bruder hat einen Schuss in den linken Arm abbekommen. Aber er wird sich wieder erholen.«
»Sie denken, das organisierte Verbrechen ist für den Überfall verantwortlich?«
»Was ist das Bild wert?«
»Es ist für fünf Millionen versichert. Aber der Markt für italienische Renaissancekunst ist zurzeit günstig. Sie ist gefragt und gute Objekte selten. Ein Original von del Sarto in diesem Zustand hätte bei der Auktion mindestens sieben Millionen gebracht, nach oben offen.«
»Kennen Sie den Grund, warum das Bild verkauft werden sollte?«
»Nein. Ich hätte Greven-Montfort auch nicht dazu geraten. Es wertet die gesamte Sammlung ab. Er war eines der Prachtstücke. Zumal nach der Restaurierung.«
Major Dittberner hörte Avide aufmerksam zu.
»Aber das kommt leider immer wieder vor. Es ist selten, dass eine größere Sammlung im Ganzen mehrere Generationen überlebt. Sie glauben wirklich, dass das organisierte Verbrechen hinter der Sache steckt?«
Dittberner zögerte einen Augenblick und unterzog Avide mit einem berechnenden Blick einer genauen Kontrolle. Dann sagte er:
»So wie der Überfall abgelaufen ist, haben wir keinen Zweifel daran. Die gesamte Vorgehensweise ist uns nicht unbekannt.
Diese Art Übergriffe werden mit äußerster Brutalität und Kühnheit begangen. Es ist immer eine Truppe von sechs bis acht Mann, eine Art Söldner, militärisch ausgebildet und völlig gewissenlos. Sie sind sehr gut vorbereitet, überlassen nichts dem Zufall. Sie sind von hinten in das Palais eingedrungen, haben den Sicherheitsdienst, der den hinteren Bereich absicherte, überwältigt. Zwei sind sofort in die Schaltzentrale, wo die Alarmvorrichtungen und die Kameraüberwachung zusammenlaufen, haben die dortige Wache überwältigt und die Anlage völlig zerstört. Es gibt keine Überwachungsvideos. Die anderen sind in den Auktionssaal gestürmt und haben die Arbeiter in Schach gehalten, drei von ihnen sind weiter in die Büros. Sie haben den Zeitpunkt genau abgepasst. Erst kurz bevor Sie ins Palais Collalto gekommen sind, hatten die Brüder von Szell das Bild aus dem Tresor im Untergeschoss nach oben geholt.« Er unterbrach sich, fingerte ein schmuddeliges kariertes Taschentuch aus seiner Hosentasche, nieste hinein und schnäuzte sich. »Pardon. Krankenhäuser haben immer diese Wirkung auf mich. Die Desinfektionsmittel. Sagt Ihnen der Begriff: Diebe im Gesetz etwas?«
Avide sah an Dittberner vorbei in die Weite des Raumes. »Die russische Mafia?«
Dittberner nickte. »Man nennt sie auch Stalins Rache. Männer, die viele Jahre in den russischen Gefängnissen und Gulags verbracht haben. Wenn Sie wieder rauskommen, sind sie kaum noch menschlich zu nennen. Ihre Seelen sind tot. Sie kennen kein Mitgefühl, kein soziales Verhalten. Es sind Todesmaschinen, die alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, gnadenlos. Es gibt ein Lied in Russland, darin heißt es die Hälfte des Volkes sitzt im Gefängnis, die andere Hälfte wartet.
Es gab und gibt eine strenge Hierarchie dort. Die Diebe sind die Könige. Es haben sich schnell Banden gebildet, die die Führung übernahmen. Als Gorbatschow die Perestroika in Gang brachte und sich die Sowjetunion öffnete, ist das Ganze auf den Westen übergeschwappt. Mit Schutzgeld fing es an. Inzwischen sind es regelrechte Wirtschaftsunternehmen. Grigorij Tutchew ist einer der Paten. Mit zehn Jahren hat er wegen Fahrraddiebstahl zum ersten Mal im Gefängnis gesessen. Heute ist er Multimillionär und hat eine Villa in Antibes. Er kontrolliert verschiedene Gangs. Ihre Mitglieder kommen aus der Ukraine, Weißrussland, Aserbaidschan, Armenien oder Georgien.
Die ‚Diebe‘ leben nach eigenen sozialen Regeln, dem ‚Diebesgesetz‘, das ihnen unter anderem verbietet, mit den Behörden in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten, eine Familie zu gründen oder einer regulären Arbeit nachzugehen.
Dabei zahlen die Mitglieder in eine gemeinsame Kasse ein, die sogenannte ‚heilige Abschtschjak‘. Die wird zentral verwaltet und mit den Geldern werden ihre Interessen und der Lebensstil der höherrangigen Mitglieder finanziert.
Jede Gang hat eine Art Clanchef, der einzig dem Paten unterstellt ist. Der Überfall heute Morgen geht auf das Konto der pravednyy narod, der ‚Gerechten des Volkes’, eine überaus brutale und effiziente Gang, die zum Tutchew-Clan gehört. Es sind hauptsächlich Armenier und Georgier, exzellent ausgebildet und zu allem entschlossen. Ihr Anführer ist ein Phantom.
Er ist schon seit vielen Jahren für verschiedene Clanchefs tätig. Er ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich hochgearbeitet. Heute genießt er innerhalb des Tutchew-Clans einen hohen Rang. Er nennt sich Archeuli, was so etwas wie ‚der Erwählte‘ bedeutet. Man weiß so gut wie nichts über ihn, nur, dass er versessen ist auf italienische Kunst der Renaissance. Kann gut sein, dass der Überfall heute nur dazu diente seine eigene Sammlung aufzustocken.«
Avide drehte den Kopf und sah den Major direkt an. »Ich glaube, ich habe ihn heute Morgen gesehen.«
»Wie?« Dittberner war so verblüfft, dass ihm das Taschentuch aus der Hand fiel und auf dem Boden landete.
»Ein großgewachsener, bulliger Mann in einem dunklen Mantel. Kantiges Kinn, auffallende Nase und schlohweiße Haare. Er kam hinter den Bewaffneten ins Zimmer und griff sich das Bild.«
»Das ist allerdings ungewöhnlich. Er tritt nie selbst in Erscheinung. Ich schicke Ihnen einen Phantombildzeichner.« Er stand auf und stellte den Stuhl zurück.
»Was haben Sie nun vor?«
»Nachdem ich mir einen neuen Kopf gesucht habe, verlasse ich die Stadt und kehre nach Köln zurück, um mir eine Standpauke der Geschäftsleitung meiner Versicherung anzuhören.«
Dittberner nickte und zog aus der Tasche seiner Jacke eine schmale, weiße Karte, die er Avide reichte.
»Wenn Ihnen noch etwas einfällt.«
Er wandte sich ab und strebte der Tür zu. Die Hand bereits an der Türklinke, drehte er sich noch einmal zu Avide um. »Er scheint nachlässig zu werden. Oder alt. Normalerweise müssten Sie tot sein.«
III.
Die Wagenkolonne, bestehend aus drei Land Rover Defender Geländewagen, hielt auf dem Vorplatz. Jedem Fahrzeug entstiegen in schneller Folge drei Männer in graugrünen Overalls, zwei von ihnen trugen über der Schulter Schnellfeuergewehre. Einer rief den anderen etwas zu und sie lachten. Archeuli Tutjew stieg als letzter aus, einer der Männer hielt ihm die Wagentür auf und reichte ihm eine Hand.
Ein Mann wie ein Baum, schier unbesiegbar, hart wie Stahl. Manche munkelten, sogar Kugeln würden an ihm abprallen. Das einzige, dass ihn in die Knie zu zwingen vermocht hatte, war das Alter.
Mit Mitte siebzig hatte er seinen Zenit überschritten und er wusste es. Sein Herz rasselte wie ein verrosteter Dieselmotor und ließ ihn jeden Tag spüren, dass es eigentlich keine Lust mehr hatte weiter zu schlagen und diesen an allen Ecken knirschenden und knackenden Organismus in Gang zu halten.
Tutjew stieß barsch die helfende Hand weg und krabbelte ohne Hilfe aus dem Wagen. Sein Rücken schmerzte, seine Beine brannten wie Feuer. Er streckte sich zu seiner vollen Größe und bekam sofort einen Hustenanfall. Er sah die Blicke der umherstehenden Männer und ignorierte sie. Niemals Schwäche zeigen. Das war ein ehernes Gebot.
Sie waren wie die Wölfe und würden nicht zögern, über ihn herzufallen und ihm den Rest zu geben, wenn sie glaubten, er könne eine Gefahr für sie darstellen. Sie waren wie er. So hatte er sie erzogen. So war er zu der Position gekommen, in der er heute war. Noch respektierten sie ihn als ihren Anführer.
Archeuli, ‚der Erwählte‘. Seinen wirklichen Namen hatte er vor Jahrzehnten hinter sich gelassen. Archeuli und Tutchew, der Name seines Paten. Sie alle trugen diesen Namen, um ihre Zugehörigkeit zu ihm zu zeigen. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren stand auf seiner breiten Brust eintätowiert: - einer von uns. Und er trug es mit Stolz.
»Miighet mankanebi dashorebit!«1
»Diakh!«2
Lado, Tutjews rechte Hand, zog ein rechteckiges Paket aus dem Wagen und trug es ihm hinterher. Sie betraten die große Halle einer stillgelegten Blech- und Bleiwarenfabrik am Wiener Neustädter Kanal. Der um 1800 unter der Schirmherrschaft Kaiser Franz II. gebaute Wasserweg, der vom Wiener Hafen über 60 km bis nach Wiener Neustadt führte, war neben der Donau und dem Wienfluss das drittgrößte Fließgewässer Wiens. Seit 1956 gehörten die noch verbliebenen 36 Kilometer dem Land Niederösterreich und waren ein beliebtes Radwandergebiet. Ansonsten waren die an der ehemals bedeutenden Industrie-Wasserstraße, die Kohle, Holz und zahlreiche andere Güter transportiert hatte, leerstehenden, verfallenden Gebäude ein idealer Unterschlupf. Die Tutjew-Gruppe um Archeuli benutzte die alte Fabrik bereits seit geraumer Zeit als geheimen Treffpunkt und Warenumschlagplatz.
Archeuli Tutjew schleppte sich, gefolgt von Lado, eine alte, steinerne Treppe in den ersten Stock hinauf, wo die ehemaligen Büros der Fabrikleiter und Buchhalter lagen.
»Ganatavset ik. Da shemdeg gakreba.«3
Lado stellte das Paket auf einen alten Holzstuhl ab und verließ wortlos den Raum. Tutjew zog umständlich den Mantel aus und warf ihn über einen verstaubten Schreibtisch.
Der del Sarto war in einer wattierten Transporttasche aus reißfestem Nylon verpackt. Tutjew zog vorsichtig den Reißverschluss herunter und klappte die Tasche nach vorn auf. Er packte das Gemälde mit beiden Händen am rechten und linken Rand, stellte es auf einen weiteren Stuhl und betrachtete es aus einigen Schritt Entfernung mit zur Seite geneigtem Kopf.
Ein Lächeln umspielte die wulstigen, rissigen Lippen und es wirkte als habe jemand mit einem Meißel einen Spalt in Granit geschlagen.
Die Farben des Meisterwerks der italienischen Renaissance erstrahlten im Halbdunkel, als wollten sie gegen die triste Umgebung und dem überall fortschreitenden Verfall rundherum ankämpfen. Er nahm das Bild und packte es wieder sorgfältig in die Transporttasche. Es musste fort von hier. Dieser Ort war ein Sakrileg. Es hatte die Jahrhunderte überstanden, Kriege, unzählige menschliche Schicksale, hatte an den seidenbespannten Wänden großer Paläste gehangen und seine Betrachter immer wieder fasziniert. So wie ihn jetzt. Es war wie ein seltsamer Zauber. Beim Anblick der Gemälde spürte er plötzlich, wie seine Kräfte zurückkehrten. Seine Augen saugten sich fest an der Harmonie der Farben, der Konstellation der Figuren, dem Schattenspiel. Diese Bilder erzählten eine Geschichte, nur ihm allein. Wenn er sie betrachtete, fühlte er sich um Jahrzehnte zurückversetzt. In ein Leben voller Träume und Pläne, und der Liebe.
Vera …
Sie besaß und las Bücher, etwas, dass im Haushalt seiner Eltern nicht vorkam. Und die Konzentration mit der sie es tat, faszinierte ihn. Obwohl seine ältere Schwester zu ihrem engsten Freundeskreis gehörte, dauerte es lange, bis sie ihn wahrnahm. Er war gehemmt, sie schüchterte ihn ein. Nicht nur weil sie belesen war und schön. Sie hatte Pläne, wusste, was sie wollte. Sie bemerkte sehr wohl, seine verstohlenen Blicke, ahnte, dass sie sein Interesse geweckt hatte. Es war ein Spiel. Sie wollte ihn testen, ob er mutig genug war, weiter zu gehen. Ein Nachmittag in einem großen Park. Sie saß allein auf einer Bank, las in einem Buch. Er setzte sich kurz entschlossen neben sie, sah stillschweigend zu ihr hinüber.
Das Buch, in dem sie las, hatte viele Abbildungen. Sie zeigte es ihm. Es war eine Abhandlung über die Malerei der italienischen Renaissance. Zum ersten Mal hörte er Namen wie Michelangelo, Botticelli, Raffael oder Leonardo da Vinci. Die Malerei war ihre ganze Leidenschaft. Sie erzählte ihm von jungen Malern an einer Zeitenwende, die in ihren Werken Mensch und Natur in vollendeter Schönheit darzustellen suchten; vom Streben nach dem absoluten Ideal, von der Hinwendung zu den Formen und Lehren der Antike, der Suche nach den Darstellungsmöglichkeiten räumlicher Tiefe und der Benutzung perspektivischer Darstellung, um die formvollendeten Körper ihrer Vorstellung perfekt in Szene zu setzen. Er hörte zum ersten Mal vom Modell des Vitruv’schen Menschen, bei dem der Mensch das Maß aller Dinge darstellt und den Versuchen der Loslösung aus dem Handwerk und der Etablierung als selbstbewusste Künstler mit einer Akademie als Ausbildungsstätte und dem Zeichnen als Grundlage künstlerischen Schaffens, der Intellektualisierung des künstlerischen Schaffensprozesses. Er lernte Begriffe wie Zentralperspektive und imitatio naturae. Sie entführte ihn nach Florenz, in die Palazzi der Medici und an die Höfe anderer großer Renaissancefürsten. Immer wieder entdeckte sie Neues, noch Schöneres. Das sanfte Lächeln einer Madonna Raffaels, der unnachahmliche Faltenwurf Giorgiones und das Chiaroscuro Correggios. Er sah fasziniert, wie bezaubert sie von der zarten Porzellanhaut der Luxuria Bronzinos war und wie beeindruckt von der Würde des von Bellini porträtierten Dogen Leonardo Loredan.
Sie lachte über die gelangweilte Lässigkeit des von Moretto da Brescia dargestellten jungen Adeligen und war fast zu Tränen gerührt von der Zärtlichkeit, die das venezianische Liebespaar ausstrahlte, das Bordone um 1520 gemalt hatte.
Je tiefer sie sich auf diese seit bald fünfhundert Jahren entschwundene Epoche der Menschheit einließen, je näher kamen sie sich. Sie verschmolzen mit den Meisterwerken, den einzig noch übrig gebliebenen Zeugen jener Zeit.
Die Welt um sie herum verschwand. Sie trafen sich im Gartenhaus eines Onkels von Vera, in einer Kleingartenkolonie, liebten sich, redeten und diskutierten, machten Pläne. Sie wollten all das sehen, was sie nur aus Büchern kannten, Florenz, Rom. Einst war es ihr Wunsch gewesen, Malerin zu werden, doch sie wusste, sie würde niemals die Vollendung der von ihr so verehrten Künstler erreichen. Und schlechte Bilder gab es genug auf der Welt. Und so versanken sie im Halbdunkel der Gartenlaube fest aneinandergeschmiegt zwischen den Veroneses, Bassanos, Tizians, Moronis, Lottos und Dossis ihrer Fantasie und träumten.
Träume scheinen mir wie Orchideen, bunt und reich, hat Rilke einmal geschrieben, freuen in der flüchtigen Minute, in der nächsten sind sie tot und bleich.
Ihre Träume erfüllten sich nicht. Es kam anders. Die Erinnerung war alles, was ihm blieb. Niemals würde er sie verblassen lassen. Die Bilder halfen ihm dabei. Mit jedem Blick auf ihre Vollendung, ihre Einmaligkeit, war sie wieder da und wurde lebendig. Ihr schwarzes Haar, ihre weiße Haut leuchteten, der graue Alltag war erfüllt von ihrem Duft – Vera …
Er nahm die Transporttasche und stieg wieder hinunter ins Untergeschoss.
»Moiq’vanet mankana!«4
IV.
Ura o mise
Mal zeigt es die Rückseite,
omote o misete
mal die Vorderseite,
chiru momiji
ein Ahornblatt im Fallen.
Zen-Mönch Ryokan 1757–1831, Todesgedicht.
Zufall ist der gebräuchlichste Deckname des Schicksals, hat Fontane einst behauptet.
Gibt es den Zufall? Oder ist alles vorbestimmt, in einem großen Plan, den kein Mensch zu überblicken die Macht hat? Voltaire glaubte, dass Zufall ein Wort ohne Sinn sei und nichts ohne eine Ursache existieren könne und für Napoleon war er der einzig legitime Herrscher des Universums.
War es Zufall gewesen, dass er auf sie traf? Unter den vielen Menschen um ihn herum, wie wimmelnde Ameisen, deren zur Schau gestellte Hektik ihn abstieß, ausgerechnet ihr begegnete? Oder hatte das Schicksal sie zusammengeführt? Er erinnerte sich des Momentes in allen Einzelheiten, obwohl es schon knapp ein Monat her war…
Es war Mittag. Ein für die Zeit warmer Tag. Die Menschen erfreuten sich an den unverhofften Sonnenstrahlen, die sie hinauszogen, in die Parks, in den Prater, auf die großen Einkaufsstraßen. Die Cafés waren gut besetzt. Sie hatten sich im Schwarzenberg am Kärtner Ring verabredet. Er war zeitig da und hatte sich einen Platz in der Nähe des Eingangs gesucht, ließ sich in einen der halbrunden Ledersessel gleiten und genoss für einen Augenblick die wieder erstandene Pracht des 1861 gegründeten ältesten Ringstraßencafés der Stadt, dessen Interieur zu einem der letzten Beispiele für die von Adolf Loos beeinflussten architektonischen Gestaltung gepaart mit der Ausführung höchsten handwerklichen Standards zählte. Es roch nach Kaffee und Bohnerwachs. Er brauchte nicht lange zu warten. Der Mann auf den er wartete, kam zur Türe herein. Nach kurzem suchen sah er ihn, setzte sich wortlos an seinen Tisch. Sie beäugten sich argwöhnisch. Er hatte einen kleinen schwarzen Aktenkoffer bei sich, den er neben sich auf den Boden stellte. Das gleiche Exemplar war in seinem eigenen Besitz. Es stand ebenfalls neben seinem Stuhl auf dem Boden. Der Mann nahm den Koffer, stand auf und verließ das Café wieder. Das Ganze hatte nicht einmal drei Minuten gedauert. Er zog den Koffer des Mannes unauffällig näher an seinen Stuhl heran. Einer der Kellner kam und brachte ihm einen Einspänner in einem Glas mit Henkel.
Er ließ sich Zeit, hatte keine Eile. Jetzt, da er hatte, was er wollte. Sein Blick glitt durch den Saal. In diesem Augenblick sah er sie. Auf ihrem schwarzen Haar spiegelte sich das Licht der riesigen von der gewölbten Decke herabhängenden Leuchter. Sie lachte, warf dabei ganz leicht den Kopf nach hinten und öffnete die roten Lippen einen Spaltbreit. Ihre Haut war hell und makellos. Ihr gegenüber saß, mit dem Rücken zu ihm, eine weitere Frau, deren ebenfalls schwarzes Haar etwas kürzer war und hinten hochgesteckt.
Alles andere um ihn herum versank in Dunkelheit, aus der einzig allein diese beiden Frauen, wie Fackeln in der Nacht, heraus leuchteten. Seine Hände begannen zu zittern, so sehr, dass er kaum in der Lage war das heiße Glas mit dem Kaffee zu halten. Jetzt stand die andere Frau auf und wandte sich zu ihm um. Das gleiche perfekte Gesicht, wie ein Spiegel. Er ließ das Glas fallen, sein Herz raste. Sie ging an ihm vorbei auf die Toilette, warf ihm einen kurzen Blick zu. Er fingerte mit zitternder Hand einen Schein aus der Tasche und warf ihn auf den Tisch, packte den Koffer und strebte dem Ausgang zu. Die Luft draußen tat ihm gut. Er schwitzte. Nach kurzer Überlegung ging er um die Ecke herum und wartete. Nur nicht auffallen. Ein Stück weiter die Straße hinunter war eine Telefonzelle. Er beeilte sich, ehe ihm noch jemand zuvorkam, stellte sich in die Zelle und tat, als telefoniere er. Dabei behielt er den Eingang des Cafés im Auge.
Es dauerte einige Minuten, scheinbar eine Ewigkeit, bis die beiden jungen Frauen aus dem Café kamen und an ihm vorbei den Kärtner-Ring Richtung Staatsoper hinaufliefen.
Er verließ die überhitzte Telefonzelle und folgte ihnen in einigem Abstand. Sie passierten die Luxushotels der Stadt, das Grand-Hotel und das Hotel Bristol und bogen dann rechts ab zur Kärtner Straße. Die beiden lachten und unterhielten sich angeregt, als ob sie sich lange nicht gesehen hätten und viel nachzuholen. Die identische Art, sich zu bewegen, die oft gleichen Gesten, faszinierten ihn. Selbst von hinten erkannte man, dass es Zwillinge waren. Die Linke, mit den längeren Haaren, die ihm im Café aufgefallen war, warf ab und zu den Kopf zur Seite, um das volle schwarze Haar über die Schulter nach hinten zu werfen. Bei jeder dieser Bewegungen, überkam ihn eine Hitzewelle, ein kaum zu bändigendes Verlangen die in verschiedenen Schattierungen je nach Lichteinfall changierende Haarpracht mit den Händen zu berühren, ihre Seidigkeit zu spüren, ihren Duft zu riechen.