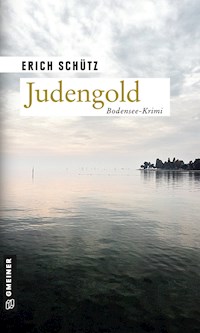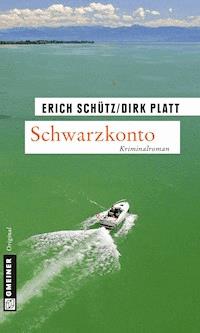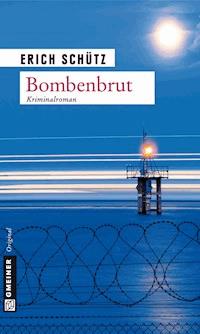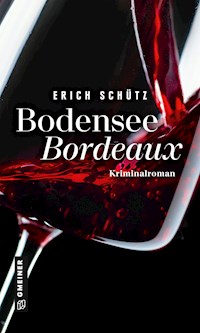Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Lass die Toten ruhen!«, fleht Jakobs Mutter, als sie von den Knochen im Feuerlöschteich ihrer Eltern erfährt. Die Knochen gehören zu einem Mann, der vor 70 Jahren, um das Kriegsende 1945, ermordet wurde. Für Jakob stellt sich die Frage: Ist der Tote Otto Simon, sein Vater und ein Gestapo-Polizist, der seit Kriegsende als vermisst gilt - oder Levi Roth, ein Jude, den seine Mutter damals versteckt hatte? Je tiefer Jakob in die Vergangenheit seiner Familie eintaucht, desto unsicherer wird er, welcher der beiden Männer sein leiblicher Vater ist, und wer damals wen umgebracht hat ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Schütz
Erblast
Kriminalroman
Zum Buch
Last der Vergangenheit Vor 70 Jahren, gegen Kriegsende, wurde in Seeldorf ein junger Mann umgebracht. Jetzt sind die Knochen wieder aufgetaucht – und mit ihnen Fragen zur Vergangenheit. Im Tagebuch seiner Mutter findet Jakob Hinweise, der Tote könnte der Jude Levi Roth sein, den seine Mutter einst liebte und vor der Gestapo versteckt hatte. Doch hatte sie schließlich Otto Simon geheiratet, seinen Vater, einen Gestapo-Polizisten. Während sein Vater nach Kriegsende als vermisst galt, hört Jakob zum ersten Mal von Levi Roth. Er befragt alte Dorfbewohner. Dabei wird er von einer ehemaligen Nazigröße als »Judenbrut« beschimpft und von dessen Enkel in Nazimontur angegriffen. Jakob stellt daraufhin ungeahnte Familienerblinien fest und muss schon bald die eigene Identität infrage stellen. Ist er tatsächlich der Sohn von Gestapo-Polizist Otto Simon oder ist in Wahrheit Levi Roth sein leiblicher Vater? Und welches furchtbare Familiengeheimnis hat Jakobs Mutter zeit ihres Lebens panisch zu verbergen versucht?
Erich Schütz, Jahrgang 1956, ist freier Journalist, Buchautor und Autor verschiedener Fernsehdokumentationen und Reiseberichte, zudem Herausgeber mehrerer Restaurantführer. Aufgewachsen im Schwarzwald, lange in Berlin und Stuttgart zu Hause, erfüllte er sich vor über zwanzig Jahren seinen Traum und zog an den Bodensee. Die verführerische, spannende Grenzregion übt auf den Gourmet und Autor einen besonderen Reiz aus, der sich in seinen Büchern niederschlägt. Erich Schütz’ Krimis und Kulturführer sind ein Muss für alle See- und Krimifreunde.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe 498-1 Nr. 4780 und https://ba.e-pics.ethz.ch/#detail-asset=c4b269f5-578f-4fd2-8967-beb1d9a3dc25«
ISBN 978-3-7349-3350-9
Zitate
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung […].
Grundgesetz Artikel 1. (1)
*
Was Du nicht willst, das man Dir tut,
das füg auch keinem anderen zu.
Immergültige Kinderweisheit der 1. Klasse
Personen
Die Obergfells
Franz-Karl Obergfell (*1890 – †1956) und Ehefrau Theres Obergfell (*1898 – +1954)
Sohn Friedrich Obergfell (*1920 – †2010) und Tochter Verena (*1925 – †2012)
Jakob, Sohn von Verena (*1945), und Ernst – Sohn von Friedrich (*1949)
Luis (*1975) – Sohn von Ernst und Erika, und Luca (*1998) Enkel von Ernst und Erika
*
Die Simons
Paul Simon (*1888 – †1954)
Vier Söhne, Walter, Fritz, Otto und Alfred
Otto Simon (*1922 – vermisst)
Alfred Simon (*1930)
Alexander Simon, Sohn von Walter und Enkel von Alfred (*1990)
*
Bürgermeister- und Arztfamilie
Franz-Josef Haas, Bürgermeister (*1885 – †1956), und
Schwester Wilhelmine Wolf (*1890 – †1955)
Sohn Adi Haas (*1943)
Doktor Nathan Wolf (*1898 – †1957)
Jakob Roth (*1920 – †1945)
Saarah Wolf (*1944)
*
Kronenwirt
Hubert Rieger (*1893 – †1970)
Sohn Artur (*1924)
Enkel Michael (*1964)
*
Die Bendzkos
Eltern kommen als Flüchtlinge 1945 nach Seeldorf
Katharina Bendzko (*1944)
Ihre Brüder Slado (*1940) und Igor (*1942)
*
Knecht Baptist (*1908 – †1952)
Mai 2010
»Jetzt macht keinen Aufstand wegen der paar Knochen.« Katharina Bendzko stand in ihren roten Prada-High Heels im schwarzen, glitschigen Schlamm, den die Arbeiter gerade aus dem ehemaligen Löschteich des Hofguts Obergfell gebaggert hatten, und gab energisch Befehl: »Los, Lorenzo, wirf den Bagger wieder an und weiter geht’s, vàmonos!«
Lorenzo kannte diese hochgewachsene Frau, die er noch nie ohne ihre High Heels gesehen hatte. Groß gewachsen war sie eh, aber in den Stöckelschuhen und mit ihrer Hochfrisur wirkte sie noch größer, was sie sicher beabsichtigte. Ihre auf Kante gebügelten Bluejeans waren ausgewaschen, der helle Business-Blazer spannte sich leicht um ihre Hüften, ihre Lippen unter ihrer hellen Stupsnase leuchteten hellrot.
Lorenzo hatte längst erfahren, dass mit dieser Frau nicht gut Kirschen essen war, das hatte er während mehrerer Auseinandersetzungen mit ihr immer wieder zu spüren bekommen. Sie hatte den kurzen Draht zu seinem Chef. Wenn er mit dabei war, hielt sein Boss immer zu ihr und gab ihr bei jeder von ihrer aufgeblasenen Beanstandung recht.
Er selbst stand in seinen schwarzen, von dunkelbrauner schmieriger Erde verdreckten Gummistiefeln, im Blauen Anton im Schlamm auf dem Grund des ehemals zwei Meter tiefen Tümpels und hob ergeben seine Hände in die Höhe: »Isch verbote!« Als spanischer Gastarbeiter hatte er längst schwäbische Idiome angenommen. »De Bürgermeischter sagt, wir müssen auf Polizei warte.«
»Das heißt: auf die Polizei warten«, betonte Katharina Bendzko den von Lorenzo verschluckten Artikel laut und deutlich und echauffierte sich: »Ihr müsst gar nichts! Außer machen, was ich sage!« Dazu warf sie dem kleinen Spanier noch eine Frage in die Grube: »Wer hat denn den Bürgermeister überhaupt geholt? Wer zahlt euch denn? Der vielleicht?«
Die resolute Bauherrin stand unter Zeitdruck. Sie zählte mit ihren über 60 Jahren zu den erfolgreichen Immobilienmaklerinnen am Bodensee. Sie hatte die geplanten neuen Wohnungen schon verkauft, die sie hier auf dem Gelände des ehemaligen Bauernhofs der Obergfells errichten wollte, bevor das Fundament ausgehoben war.
So ging das Geschäft seit Jahren. Mit dem Erwerb des Grundstücks floss das Geld. In diesem Fall reichlich, denn was zählte, war alleine die Lage: Seeblick war das eine, aber Panoramablick unschlagbar, wie hier auf dem ehemaligen Bauernhof der Obergfells in Seeldorf, auf den Höhen des Linzgaus, über dem Bodensee.
Die zu Geld gekommenen Finanziers der Frankfurter Banken oder die Manager aus den Stuttgarter Industriebetrieben oder auch hochdekorierte Pensionisten der Politik aus Berlin oder Brüssel, sie alle reihten sich ein in den Kreis der vielen Kaufinteressenten auf den ausgewiesenen Neubauplätzen rund um den südlichen Alpensee an der Grenze zur Schweiz.
Früher pickten hier oben, auf dem Obergfellen-Hof, Hühner auf dem Misthaufen. Sie hatten sich um die heute begehrte Aussicht wohl wenig gekümmert. Doch was ahnten sie schon von dem mediterranen Flair auf deutschem Grund, der heute die zu Wohlstand Gekommenen die Portemonnaies zücken ließ.
Der Blick ging über den See und die Alpen schier bis in das sonnige Italien, bei garantierter deutscher Gesundheitsfürsorge mit besten, hochqualifizierten Ärzten und exklusiven Privatkliniken um die Ecke. Sie stärkten das Sicherheitsgefühl der Wohlstandsrentner und boten Luxus-Seniorenresidenzen in der unmittelbaren Nachbarschaft.
»Panoramaweg« hieß über Nacht die Anschrift zu dem ehemaligen Bauernhof der Obergfells in Seeldorf. Den neuen Straßennamen hatte Katharina Bendzko im Rathaus durchgesetzt. »Kramergässle« hieß der Weg zuvor. Ein Sohn der Obergfells hatte nach dem Krieg im Kramer-Werk in Überlingen gearbeitet. Bald fuhr jeder Bauer in der Straße einen Kramer-Traktor.
»Schokoladengasse« nannten die Bewohner im Ort den Weg zuerst, als Katharina Bendzko als kleines Mädchen mit ihrer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling in dem Dorf in eine schnell erstellte hölzerne Baracke eingewiesen wurde.
Damals war der Weg noch ein unebener Feldweg. Nach jedem Regen stand in den Dreckpfützen das Wasser, die Erde wurde durch die groben Profile der Traktorreifen zu schokoladenbraunem Matsch aufgewühlt. Aber wer interessierte sich heute noch für den Dreck von damals?
»Unser Dorf soll schöner werden«, hatte Katharina Bendzko vor dem Gemeinderat plädiert, »wir müssen aber auch unsere Vorzüge zeitgemäß bezeichnen und die Vorteile unserer Gemeinde und die einmalige Lage benennen.«
Die Gemeinderäte hatten schnell verstanden und übersetzten Benennen mit Verkaufen. Das gefiel den Bauern und Handwerkern im Rat. Folgsam hoben sie ihre Hände und stimmten den neuen Straßennamen zu. Aus dem Zinken wurde der Säntisblick, aus dem Schulweg der Alpenblick und aus dem Kramergässle eben der Panoramaweg.
Mit den neuen Namensgebungen waren parallel die Grundstückspreise für die Wiesen und Äcker der Landwirte in wenigen Jahren geradezu explodiert. Die Quadratmeterpreise, die Katharina Bendzko ihnen als Maklerin bot, waren schneller gestiegen als jeder Hahn auf sein Huhn, lachten die Bauern selbstzufrieden und verkauften am liebsten, wie die Obergfells, die Äcker mit Haus und Hof.
»Los jetzt, Lorenzo, komm jetzt da hoch und füll das Loch mit dem Bauschutt auf und terminado!« Die Immobilienmaklerin wurde lauter und zeigte ihre Verärgerung deutlich. Sie kickte mit der Spitze ihres rechten Schuhs die paar Knochen, die die Arbeiter in dem Schlamm des Löschteichs gefunden und an den Grubenrand gelegt hatten, wieder zurück in die Grube vor Lorenzos Füße.
Lorenzo schlug entsetzt das Kreuzzeichen über seiner breiten Brust. Er war ein untersetzter Kanarier, etwas dicklich, hatte ein freundliches Gesicht und eigentlich auch ein ebenso freundliches Gemüt.
»Oh Santa Maria«, brummelte er und wagte entrüstet, Katharina Bendzko darauf hinzuweisen: »Das war ein Mensch!«
»Vielleicht«, antwortete sie schnippisch, »vielleicht auch ein Tier, auf jeden Fall war!« Das »war« hatte sie besonders laut betont und nochmals bestimmt: »Jetzt macht weiter. Morgen planieren wir die Fläche und dann heben wir endlich das Fundament aus!«
Genervt schaute sie zu den beiden anderen Arbeitern, die hilflos neben Lorenzo in der Grube standen. Aber was sollte sie an die beiden hinreden? Die verstanden sowieso kein Deutsch.
Ganz früher waren es Italiener oder Spanier wie Lorenzo. Dann kamen Polen, dann Rumänen und jetzt Albaner. Sie nervte es, dass diese Menschen von ihr Geld bekamen, aber kein Wort Deutsch konnten. Doch ohne diese Ausländer, das wusste sie auch, wurde auf den Baustellen längst kein Stein mehr auf den anderen gesetzt.
Lothar Glatz, der Maurer im Ort, hatte mit dem eingesetzten Bauboom sein eigenes Baugeschäft aufgemacht und mit den Gastarbeitern, so nannten man die ersten Hilfsarbeiter aus Italien und Spanien, alle Bauaufträge des Immobilienunternehmens Bendzko der Reihe nach hochgezogen.
»Mach rapido«, rief sie nochmals Lorenzo zu, »heute Abend ist das Loch cerrado, und morgen kommt die Planierraupe, esta claro!«
Energisch drehte sie ab. Als ob somit klar wäre, dass nun genau das geschehen würde, was sie eben angeordnet hatte. Sie stöckelte entschlossen und gekonnt in ihren High Heels selbstbewusst, ohne auf Hindernisse vor ihren Füßen zu achten, von der verdreckten Baustelle zu ihrem dunkelgrünen Porsche Cayenne, stieg ohne Rücksicht auf ihre Dreckklumpen an den Schuhen in den metallic glänzenden SUV und rauschte davon.
Lorenzo schaute der Immobilienmaklerin ratlos hinterher. Er hatte nun schon über zehn Jahre bei dem kleinen Baugeschäft Glatz in Seeldorf gearbeitet. Er war kein kleiner Hilfsarbeiter mehr, sondern der Polier, der den Auftrag von seinem Chef hatte, mit den beiden Kollegen den ehemaligen Feuerlöschteich auszupumpen und danach mit dem Bauschutt des alten Bauernhauses, der daneben lag, wieder aufzufüllen. Bis zur Mittagspause sollten sie fertig sein, und jetzt das.
Maldito, hätte er doch nur den Schlamm auf dem Grund des Teichs in Ruhe gelassen. Aber kaum hatten sie mit dem Abpumpen aufgehört, hatten sich auch schon diese Knochen gezeigt, und schon stand auch dieser Bürgermeister neben ihnen, warum auch immer.
Den Zeitplan konnte er eh nicht mehr einhalten, und die Bendzko war ihm jetzt egal. Diese verdammten Knochen lähmten ihn, es war beklemmend für ihn. Schließlich hatte er zu Hause auf Gomera unzählige Lämmer, Ziegen oder Hühner geschlachtet. Doch diese Knochen auf dem Grund des Tümpels waren anders, kräftiger und dicker, wenn auch zum Teil ausgefranst und langsam morsch. Sie mussten schon sehr lange in dem Tümpel gelegen haben, doch ihm war klar, es waren Menschenknochen.
Er stieg entschieden aus der Grube und wies seine beiden Arbeiter an, ihm die von der Chefin in den Schlamm des Tümpels gekickten Knochen wieder hochzugeben und in dem Schlick auf dem Grund vorsichtig nach weiteren zu suchen. Er selbst nahm die ausgebuddelten Knochen an sich und betrachtete sie zunächst unschlüssig.
Am Eingang zu dem Stall des ehemaligen Bauernhofs tropfte ein Wasserhahn in die alte Viehtränke. Lorenzo sah auf die verdreckten Knochen und dann zu dem Hahn, nahm schließlich die Knochen wieder in seine Hände und ging zu der ehemaligen Viehtränke. Er drehte den Wasserhahn auf und spülte die Knochen vom Schlamm frei. Seine beiden Kollegen brachten ihm weitere Knochen, die sie im Schlick gefunden hatten, und schauten ihm interessiert zu.
Lorenzo war als junger Mann ein traditioneller »Lucha-Canaria«–Kämpfer. Als kanarischer Ringkämpfer wurde er in Seeldorf sofort Mitglied des dortigen Ringerklubs. Mit seinem Gewicht schmiss ihn so schnell niemand um, doch leider hatte er weiche Knochen und schon bald viele Brüche erlebt. Dadurch hatte er den Knochenaufbau des Menschen kennengelernt und begann nun fachgerecht, auf dem Boden neben dem Brunnen mit den gesammelten Knochenteilen ein menschliches Skelett zu formen.
Als ihm einer seiner Kollegen einen Beckenknochen reichte, huschte ein kurzes Lächeln über seine dicken Wangen. Jetzt sah er das menschliche Skelett deutlich vor sich. Schnell begann er, das Knochen-Puzzle neu zu formen. Der Beckenknochen wurde zum zentralen Punkt, darunter – für ihn klar ersichtlich – legte er einen Oberschenkelknochen. Fast unversehrt war der Schädelknochen, einige Zähne steckten noch in dem Unterkiefer.
Andächtig standen die drei vor dem nun klar ersichtlichen ehemaligen Menschen. Lorenzo nahm den Hut ab und brummelte ein »Santa Maria, Madre de Dios«.
»Ja seid ihr denn total bescheuert!«, riss eine gellende Stimme Lorenzo aus seiner Andacht. »Finger weg, sofort!«
Erschrocken drehten die drei sich um. Sie hatten das Kommen der anderen nicht bemerkt. Hinter ihnen standen zwei Männer und eine Frau.
»Gehen Sie sofort weg! Lassen Sie die Finger von den Knochen! Was machen Sie denn da?«, herrschte die stattliche, etwas kräftige Frau die drei an.
Lorenzo schluckte trocken. Er ahnte, dass die drei von der Polizei sein mussten, und wusste nicht, was er sagen sollte. »Das ist ein Mensch«, stammelte er.
»Gut erkannt, und kein Spielzeug!«, klang ihre Stimme streng und durchdringend.
»Wir wollten nur schauen, ob …«, stockte Lorenzo hilflos.
»Ob was?«, giftete die Frau weiter, besann sich aber plötzlich und wechselte vom lautstarken Forte zu einem verständnisvollen Piano: »Gehen Sie jetzt weg von den Knochen. Ich bin Kommissarin Gerber, zeigen Sie uns, wo Sie die Knochen genau gefunden haben, und dann verschwinden Sie hier, Sie versauen uns alle Spuren!«
»Ich glaube nicht, dass wir da etwas versaut haben«, wollte Lorenzo sich nicht schon am Morgen von einer zweiten Frau unterbügeln lassen, »schließlich haben wir die Knochen erst ausgebuddelt, sonst wären sie jetzt noch da unten im Schlamm.«
»Und damit ist Ihr Job erledigt«, brauste die Kommissarin erneut auf, »oder können Sie mir sagen, wer der Tote war?«
Lorenzo schaute hilflos zu seinen beiden Kollegen. Doch die hatten nur erstarrt zugehört. Sie hatten nicht viel verstanden, aber ihr Polier schien dieser aufgebrachten Frau couragiert gegenüberzutreten. Doch nun schien auch er nicht mehr weiterzuwissen. Weshalb alle drei bedröppelt schwiegen.
»Na also, und jetzt zeigen Sie uns genau, wo und wie Sie die Knochen gefunden haben, und dann verschwinden Sie«, klang die Kommissarin schon wieder versöhnlicher und befahl, zu ihren beiden Kollegen gewandt: »Sperrt die Baustelle ab und ruft die Spurensicherung.«
»Glauben Sie, dass die da noch was finden und wir noch was ermitteln können?«, fragte der jüngste der Kriminalpolizisten. »Schon die Knochen scheinen doch uralt und fast verwest zu sein.«
»Mord verjährt nicht, und ob es das war, das werden wir herausbekommen«, herrschte sie ihren jungen Kollegen an, schnürte mit beiden Händen und flinken Fingern mit einem Gummi ihre grauen Haare am Hinterkopf zu einem Zopf zusammen und stellte klar: »Wir werden die Knochen nach Verletzungen untersuchen, den Schlamm nach eventuellen weiteren Spuren, vielleicht finden wir sogar noch das Mordwerkzeug, ich denke, die Spurensicherung wird hier ihre Freude haben, und wir wissen am Schluss, ob die Person nur in den Tümpel gefallen ist oder ob es Mord war.«
3. Mai 2015, Sonntag
»Es war Mord!«
Jakob Simon sitzt in der Küche seiner Mutter und liest Zeitungsberichte von vor fünf Jahren, die er gerade in ihrer Kommode herausgekramt hatte. Er erinnert sich noch gut daran, als seine Mutter ihm am Telefon aufgeregt von dem Knochenfund in dem Feuerlöschteich ihrer Eltern im Obergfellenhof erzählt hatte. Er hatte sich schon damals sehr gewundert, warum sie wegen der Knochen mehr als nur aufgebracht war. Die Schlagzeile aber, die er erst jetzt liest, gibt ihr recht. Es war Mord!
Doch der Mord war lange her.
Seine Mutter hatte ihm schon damals, vor fünf Jahren, jede neue Erkenntnis über den Knochenfund und die Mordtheorie der Polizei brühwarm mitgeteilt, obwohl ihn die alten Knochen einen feuchten Kehricht scherten. Trotzdem hatte sie ihm dann das Ergebnis der Polizei, dass es Mord war, verschwiegen oder hatte er es einfach vergessen und nicht mehr nachgefragt, weil es ihn nicht interessiert hatte?
Seine Mutter, Verena Simon, war eine geborene Obergfell, auf dem Hof ihrer Eltern ist sie aufgewachsen, und als Jakob 1945 auf die Welt kam, hat auch er die ersten Lebensjahre auf dem Hof verbracht.
Sein Vater, Otto Simon, galt im Krieg als vermisst, doch er war ihm ehrlicherweise nie abgegangen. Denn bis er zehn Jahre alt war, war der Bauernhof seiner Großeltern sein Zuhause, und sein Opa, Franz-Karl Obergfell, war für ihn sein Vater.
Auf dem Feuerlöschteich hinter dem Bauernhaus hatte Jakob mit einem alten aufgepumpten Schlauch eines Traktorreifens Kapitän der Weltmeere gespielt. Dass er damals über einen Toten im Feuerteich gepaddelt ist, kam ihm nicht in den Sinn. Das Wasser war immer trüb, darin zu schwimmen war den Kindern verboten, der Tümpel schien unendlich tief. Doch das alles war lange her, deshalb wollte er das Theater, das seine Mutter um den Knochenfund vor Jahren gemacht hatte, auch nicht verstehen.
Langsam erinnert er sich, dass nach den ersten Ermittlungen der Polizei feststand, dass die Knochen erstens von einem Mann stammten, und zweitens, dass der Mann schon vor über 50 Jahren in dem Teich gelandet sein musste. Ob er aber erst in dem Teich ertrank oder schon tot in dem Teich entsorgt wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden, da sich außer den fragilen Knochen keine Rückstände des menschlichen Körpers mehr finden ließen.
Für seine Mutter war der Fund in dem elterlichen Feuerlöschteich ein Skandal! Dabei war nicht einmal klar, wer der Tote ist noch wie er umkam. Jakob hatte versucht, sie zu beruhigen. Ein Familienmitglied war er auf jeden Fall nicht, denn nie hatte er von einem verschollenen Onkel gehört und man hatte auch nie jemanden gesucht.
»Vielleicht ist ein Fremder betrunken in den Tümpel gefallen«, hatte er seine Mutter zunächst beruhigen wollen. »Vermisst hat ihn jedenfalls niemand«, hatte er nonchalant festgestellt und ihr geraten, die Knochen zu vergessen. Doch seine Mutter ließ sich nicht beruhigen, immer wieder wollte sie mit ihm über den Knochenfund reden und haderte mit dem Toten bis zu ihrem Tod.
Er selbst hatte die Story um den Toten im Teich seiner Großeltern schnell verdrängt und längst vergessen. Erst jetzt, wo er die Wohnung seiner verstorbenen Mutter leer räumt, ist er auf die alten Zeitungsberichte gestoßen. Die Lokalzeitung musste fast täglich über den mysteriösen Fund berichtet haben. Seine Mutter hatte alle Artikel fein säuberlich und akkurat nach den Erscheinungen abgeheftet. Jakob fand sie in einer Schublade in der Kommode im Schlafzimmer. Zunächst steht in den Artikeln die Frage im Mittelpunkt: War es ein Unglück oder doch Mord?
Seine Mutter aber musste von Anfang an ein Verbrechen geahnt haben. »Schrecklich, wenn du wüsstest«, hört er sie heute noch jammern, wenn er an die Zeit des Fundes denkt, »warum konnte man diesen vermaledeiten Teich nicht einfach zuschütten und die alten Geschichten ruhen lassen?«
»Was für alte Geschichten?«, hatte er sie anfangs noch gefragt. Doch wann immer er nachbohrte und auf ihre Bedenken eingehen wollte, winkte sie ebenso schnell und entschieden wieder ab.
Seine Mutter ist vor drei Jahren, mit 90 Jahren, gestorben. Bis zu ihrem Tod telefonierten sie und er fast jeden Sonntagmorgen. Ein Ritual, das sie gemeinsam pflegten, seit er vor fast 50 Jahren, als junger Student, aus dem Kaff Seeldorf in die damals noch geteilte Stadt Berlin gezogen war.
Heute sitzt er wieder in diesem verwünschten Ort Seeldorf und fühlt sich in der Wohnung seiner Mutter allein gelassen. Es ist Sonntag, er sieht das alte grüne Telefon mit der Wählscheibe. In Stuttgart hatte er die sonntäglichen Telefonate mit seiner Mutter nach ihrem Tod kaum vermisst. Aber jetzt, hier in ihrer Wohnung, fehlt sie ihm plötzlich.
Hätte er doch mehr Zeit mit ihr verbringen sollen? Dann hätte er sie auch stärker bedrängen können, warum sie der anonyme Tote im Löschteich ihrer Eltern so beschäftigt hatte.
Er hat die alten Zeitungsartikel auf dem großen Küchentisch ausgebreitet vor sich liegen. Seine Mutter hatte die Vierzimmerwohnung auf das Dach der ehemaligen Milchzentrale und Lagerhalle der bäuerlichen Zentralgenossenschaft bauen lassen. Sie war die sogenannte Genossenschaftsrechnerin und hatte den Aufbau der Wohnung klug berechnet. Ihr Schulkamerad, Anton Glatz, der Vater des heutigen Bauunternehmers Lothar Glatz, hatte die Wohnung auf die große Lagerhalle aufgesetzt.
Das war Anfang der 1950er-Jahre, in der Zeit der großen Wohnküchen. Das Küchenfenster mit Veranda auf dem Dach der Halle bot einen Blick in den Obstgarten des Nachbarn und über den Bodensee bis zu den Alpen.
In seinen jungen Jahren war diese Aussicht für Jakob nichts Besonderes. Den weiten Blick hatte jeder Seeldorfer, doch dafür kann er sich nichts kaufen, dachte er damals.
Nun saß er an dem gezimmerten Küchentisch mit der langen Eckbank. Er bot ausreichend Platz für mindestens sechs Personen. Auch das große Küchenbuffet hatte der damalige Schreiner gebaut. Er hatte auch die hellbraunen Tannendielen verlegt, die mit der Zeit immer breitere Fugen aufgewiesen hatten. Seine Mutter hatte den Schmutz immer mit einem Messer aus den Fugen gekratzt, danach den Holzboden geschrubbt. Als Kind saß er dann auf dem Blocker, wenn sie das Bohnerwachs über die Dielen auf Hochglanz polierte.
Wo einst das alte Ausgussbecken stand, erstreckt sich jetzt eine moderne Küchenzeile mit Elektroherd und Kühlschrank. Auf der Anrichte steht noch die alte blaue Porzellanschüssel, in die seine Mutter immer das Obst gelegt hatte. Jetzt ist sie leer. Es hat alles seinen Platz, wie eh und je.
Nur seine Mutter fehlt.
Es ist der erste Tag allein in ihrem Haus. Es ist still wie noch nie. In Stuttgart hatte er gesagt, er fahre »nach Hause«. Aber nun fühlt er sich hier eher wie in der Fremde oder in einer Geschichtserzählung.
Jakob wohnte mit seiner Mutter immer allein in den vier Zimmern mitten im Ort mit Blick über das Dorf. Auf der Terrasse vor dem Küchenfenster sammeln sich plötzlich Regentropfen. Gerade schien noch die Sonne. Typisches Aprilwetter im Mai, denkt Jakob, dann winkt er ab. Alles Schnee von gestern. »Ich will wieder nach Hause«, sagt er sich und denkt an Stuttgart.
Eine Woche gibt er sich Zeit, dann will er die Wohnung leer geräumt und verkauft haben und sich schnellstmöglich wieder vom Acker machen.
In Seeldorf hat er nichts mehr verloren.
Der Hof seiner Großeltern ist abgerissen. Heute stehen Luxusapartments auf dem ehemaligen Grundstück. Das Grab seiner Mutter kann er vom hiesigen Friedhofsgärtner pflegen lassen, und nach dem Toten im ehemaligen Feuerlöschteich kräht kein Hahn mehr. Somit kann er das Kapitel Seeldorf abschließen.
Er muss die Wohnung aufräumen, will damit fertig werden, damit er wieder nach Hause fahren kann, zurück nach Stuttgart. Er packt die Zeitungsartikel vor sich zusammen, überfliegt noch manche Überschriften und sieht eine Schlagzeile, die ihm wohl bisher verborgen geblieben war: »Wurde der Tote an einem Stein versenkt?«
Verdammt, was heißt das jetzt? Neugierig liest er den Artikel, der ihm gerade ins Auge gestochen ist. Die Staatsanwaltschaft hatte die Obduktionsergebnisse der Gerichtsmediziner bekanntgegeben und damit gleichzeitig den Mord bestätigt. Zwar blieb nach wie vor unklar, ob der Mann ertrank oder schon tot in den Tümpel geworfen wurde. Doch Spuren einer Eisenkette, die um einen Stein gebunden in dem Schlamm gefunden worden waren, fanden sich auch an einigen Knochen.
Seltsam, dass ihm davon seine Mutter nichts gesagt hatte. Sie hatte ihm die Ohren über den Knochenfund vollgejammert. Von einer Fremdeinwirkung hat sie doch wirklich nie etwas erzählt und auch nicht von dem Stein und der Kette. Das kann er doch nicht alles verdrängt haben? Sicher nicht. Im Gegenteil, noch hört er sie klagen: »Tote soll man ruhen lassen.« Und schon kurze Zeit später stimmte sie ihm zu: »Wen interessiert das noch, nach so langer Zeit?«
Das hätte ihn sicher interessiert, das musste seine Mutter auch gewusst haben. Die Frage ist jetzt nur, warum hatte sie plötzlich kein Interesse mehr an den neuen Erkenntnissen der Polizei?
Seltsam, denkt Jakob, dabei war doch erst dadurch erwiesen, dass tatsächlich auf dem Hof ihrer Eltern ein Verbrechen stattgefunden hatte. Jemand hatte einen jungen Mann umgebracht und im Teich seiner Großeltern, ob tot oder lebendig, entsorgt.
Ein Mord! Wenn auch vor vielen Jahren. Auf dem Hof ihrer Eltern beziehungsweise seiner Großeltern.
Warum nur hat sie, nach ihrer anfänglichen Aufregung über den Knochenfund, plötzlich kein Interesse mehr daran gezeigt und beschwichtigt: »Kann man nicht endlich die alten Geschichten ruhen lassen?« Doch verdammt, welche Geschichten?
Jetzt, wo geklärt war, dass es ein Mord war.
Steckt doch ein unaufgeklärtes Verbrechen hinter dem Toten, von dem seine Mutter wusste? Ein Verbrechen von vor über 50 Jahren?
Seine Mutter ist tot. Seine Großeltern liegen ebenfalls längst auf dem Friedhof, und auch der Bruder seiner Mutter wurde vor Kurzem beerdigt. Mit wem also könnte er über die Zeit von damals noch reden?
Es wird ihm klar, er zählt heute zu den Alten. Aber er weiß leider gleich gar nichts, was vielleicht auch schon vor seiner Kindheit in Seeldorf hätte passiert sein können. Dabei hatte er doch immer alles, was die Großen hinter vorgehaltener Hand im Ort redeten, mitbekommen. Aber nichts in seinen Erinnerungen hatte mit einem Toten im Löschteich seiner Großeltern zu tun.
Er schiebt den Stapel der Zeitungsberichte vor sich auf die Seite, das Gleiche will er auch mit seinen Gedanken über den Toten im Feuerlöschteich tun. Was jucken ihn denn die alten Storys von vorgestern. Er wird die ganze Sammlung seiner Mutter wegwerfen, er will die Geschichte vergessen. Was geht ihn das heute noch an? Seit nunmehr über 40 Jahren fühlt er sich in diesem Kaff Seeldorf eh nicht mehr zu Hause. Er ist hier, um die Zelte endgültig abzubrechen.
Er muss den Haushalt seiner Mutter auflösen, die Wohnung beziehungsweise das Haus verkaufen und dem Kaff für immer den Rücken kehren.
Im Nachhinein tut es ihm leid, dass er in den letzten Wochen vor ihrem Tod seiner Mutter nicht beigestanden ist. Aber er hatte endlich mal wieder einen größeren Auftrag. Er war für eine ARD-Dokumentation unterwegs gewesen, als sie vor drei Jahren nach einem plötzlichen Schlaganfall auch schon wenige Tage später starb.
Ihm war keine Zeit geblieben, schnell nach Seeldorf zu düsen. Er hatte in Sachsen gedreht. Dort war er schon Jahre zuvor, kurz nach der Wende, auf Neonazis gestoßen. In seiner neuen Dokumentation wollte er zeigen, wie die altbekannten Nazis sich in der vermeintlich bürgerlichen Partei, der AfD,sammelten.
Zur Gründung der AfDhatten ursprünglich ein paar Wirtschaftsliberale um den Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke gegen den Euro Stellung bezogen. Eine lautere, politische Forderung, die selbst namhafte Industriebosse unterstützten. Doch gegen den Euro hieß in der Partei bald gegen die EU und schon bald auch gegen Migranten und Flüchtlinge.
Jakob wollte am Beispiel verschiedener Neonazis, die er kannte, zeigen, wie sich die rechtsradikalen Jugendlichen in der AfDbeziehungsweise in der Jungen Alternative sammelten.
In Thüringen trommelte Björn Höcke hemmungslos für ein neues »Tausendjähriges Reich«, und in Brandenburg gründete der Neonazi Andreas Kalbitz den rechtsextremen Verein Zukunft Heimat, der gegen Flüchtlinge mobilisierte und als Musterbeispiel der Vernetzung zwischen der AfDund rechtsextremen Organisationen galt.
Genau dies wollte Jakob vor drei Jahren dokumentieren. Er hatte alle Interviewtermine festgezurrt. Er konnte den Dreh nicht einfach abbrechen. Seine Mutter lag über Nacht ohne Bewusstsein im Krankenhaus. Was sollte er tun? Helfen hätte er eh nicht können, sie war gut betreut, also drehte er weiter.
Jakob war das erste Mal, schon gleich nach dem Mauerfall, als die DDR noch offiziell existierte, zu seiner eigenen Überraschung auf rechtsradikale Jugendliche im damals noch existierenden »Sozialistischen Arbeiter-und-Bauern-Staat« gestoßen. Er hatte gedacht, in den neuen Ostländern überzeugte Kommunisten anzutreffen, auf jeden Fall keine Neonazis. Doch er hatte sich getäuscht.
Er hatte in Cottbus nur ein paar O-Töne von Jugendlichen sammeln wollen, da streckten ihm unverhohlen vier junge Burschen stolz ihre Paradegürtel mit Koppelschloss der Waffen SS, die um ihre Kampfhosen geschnallt waren, in die Kamera: »Unsere Ehre heißt Treue«.
Die jungen Männer, gerade mal 20 Jahre alt, waren stolz, sich schon im DDR-Staat öffentlich zur Tradition der NSDAPbekannt zu haben. Der SED-Staat hatte sie verfolgt, aber lediglich wegen Rowdytums verurteilt. Nazis gab es in der DDR offiziell nicht!
Völkerfreundschaft war staatlich verordnet. Doch Ausländerhass hatte auch vor dem antifaschistischen Schutzwall nicht Halt gemacht.
Während der Recherchen wurde Jakob klar, dass das faschistische Erbe auf beiden Seiten der Mauer überlebt hatte. Im Westen grölten Hooligans in den Fußballstadien »Juden raus« und warfen den ersten schwarzen Fußballspielern in den Stadien mit nachgeahmten Affengeräuschen Bananen zu. In der DDR vermöbelten die Jung-Nazis ihre sozialistischen Gäste wie Vietnamesen, die in Sachsens Textilkombinaten arbeiteten, und nannten sie abfällig nur »Fidschis«.
Nach der friedlichen Revolution in der DDR, aber vor der amtlichen Vereinigung mit Westdeutschland, waren die Volkspolizisten in dem noch existierenden Staat DDR erst mal verunsichert. Die jungen Nazis nutzten die neue Freiheit und propagierten hemmungslos ihren wirren Traum eines »Großdeutschen Reichs«. Sie forderten allen Ernstes nach der Vereinigung Westdeutschlands mit Mitteldeutschland – so nannten sie die DDR – nun auch die Übernahme der ehemaligen »Ostgebiete«. »Schlesien, Pommern, bis zum Memelland ist Deutschland!«, skandierten sie.
Westdeutsche Neonazis erkannten das Potenzial im Osten. Der in Westdeutschland bekannte und verurteilte Neonazi Michael Kühnen wurde schnell ihr »Großdeutscher Führer«. Seine sexuellen Beziehungen zu Männern rechtfertigte er mit der liebevollen Hingabe an die Gemeinschaft des nationalen Volkes.
Jakob hatte sich von dem Vorhaben einer Grenzüberschreitung mitreißen lassen und war mit seinem Kamerateam und einer kleinen, verschworenen Gruppe um Michael Kühnen bei Nacht und Nebel über die »Neiße-Demarkationslinie« nördlich von Görlitz auf polnisches Gebiet eingedrungen. Im Gepäck hatten sie eine Reichskriegsflagge von 1939 und eine Hakenkreuzfahne. Kühnen hatte als ehemaliger Leutnant der Bundeswehr das Kommando. Er war wie immer in eine tadellose schwarze Kombination gekleidet, seine Jungs dagegen steckten in Kampfmonturen, mit Accessoires der Reichswehr oder gar mit SS-Auszeichnungen geschmückt.
Flugs hissten sie auf polnischem Grund ihre mitgebrachten Fahnen, entzündeten ein Feuer und sangen die verbotene Strophe der deutschen Nationalhymne »Von der Maas bis an die Memel«. Dann legte Kühnen los: »Wir werden zusammenführen, was zusammengehört!« Königsberg, Böhmen und Mähren waren seine Ziele, und dank der deutschnationalen Partei Österreichs wollte er selbst auch noch die »Ostmark« wieder »heim ins Reich« holen.
Jakob hatte zu Kühnen ein professionelles, äquivalentes Verhältnis aufgebaut. Seine Abenteuerlust hatte ihn gezwungen, sich Kühnen unterzuordnen, doch als er die Forderungen nach der Einverleibung Pommerns und Schlesiens und selbst Österreichs hörte, hatte er sich schon gefragt, wie er am schnellsten die unheimliche Szene verlassen konnte.
Zurück im Schneideraum, verwahrte er die Aufnahmen in einem Giftschrank. Er traute sich nicht, das Erlebte öffentlich zu zeigen. Deutsche Jugendliche hissen in Polen die Reichskriegsflagge, zeigen den Hitlergruß und grölen Naziparolen. Würden diese Bilder deutsche Politiker aufschrecken?
Oder würde er bei manchem Fernsehzuschauer damit das genaue Gegenteil erreichen?
Zu oft hatte er schon nach der Ausstrahlung rechtsradikaler O-Töne von Zuschauern Anrufe erhalten, die unbedingt die Kontaktdaten zu den Neonazi-Organisationen von ihm erfahren wollten, um sich ihnen anzuschließen. Kühnen hatte ihn und sein Team nicht ohne Hintergedanken mitgenommen.
Mit unter fünf Prozent Rechtsradikalen in der NPDhatte die Republik lange gut leben können. In seinem Heimatort Seeldorf hatte er die Altnazis in seiner Jugend noch grölen gehört. Nach fast jedem Fußballspiel sangen sie am Stammtisch SA-Lieder. Wer sie maßregeln wollte, hörte: Ein kleiner Hitler würde nicht schaden, schließlich sorgte er erst mal für Arbeit für alle. Und wenn alle arbeiten würden, bräuchte man auch keine Itaker im Ort, so wurden die ersten Gastarbeiter in Seeldorf begrüßt.
Sein Opa, Franz-Karl Obergfell, hatte ihn gewarnt und ihm alle im Ort genannt, die zur NS-Zeit »Hundertprozentige« waren. »Nur weil Hitler sich umgebracht hat, sind die Überlebenden nicht zu besseren Menschen geworden.«
Heute, 70 Jahre später, muss Jakob erfahren, wie das faschistische »Herrenmenschen«-Gedankengut in Deutschland wieder erwacht. Als er das erste Mal das Thema der vereinigten West- und Ost-Neonazis in seiner Redaktion vorschlug, schob man die rechten Sprüche und Nazi-Ausschreitungen in den Stadien nur ein paar verirrten Spinnern zu, die man aber nicht ernst nehmen wollte.
»Deutschland erwache!«, nannte er deshalb seine erste Dokumentation in der ARD. Seither hatten sich immer mehr rechtsradikale Organisationen zusammengefunden. Michael Kühnen war an seiner Aids-Erkrankung gestorben, aber seine Saat ging auf, und immer mehr rechtsradikale Kampfgruppen bildeten sich in allen Bundesländern. Die Anzahl der Anschläge auf Flüchtlingsheime hatte erschreckend zugenommen. Die Asyldebatte hatte sich verschärft, und die Flüchtlingshetze sorgte dafür, dass Asylsuchende schon auf der Fahrt zu den ihnen zugewiesenen Flüchtlingsheimen angegriffen wurden.
Deshalb hatte er vor drei Jahren in seiner Redaktion eine Fortsetzungs-Dokumentation zu der Zusammenrottung der rechtsradikalen Kräfte durchgesetzt. Er hatte endlich den Auftrag in der Tasche und war mit seinem Kamerateam wieder in Dresden, Cottbus und Görlitz. Seine Mutter war stolz auf ihn und seine Filme, die im Ersten Programm liefen. Sie hätte ihn sicher verstanden, dass er die Drehtermine einhalten musste. Danach wollte er sie sofort besuchen.
Aber da war sie schon tot.
Den Anruf wird er wohl nie vergessen. Er hatte gerade erst die Telefonnummer der Freundin seiner Mutter in seinem Handy gespeichert, nachdem sie ihn wegen des Schlaganfalls informiert hatte. Nun sah er die Nummer erneut auf seinem Display aufleuchten. Er stand gerade am Fenster seines Zimmers im Hotel Obermühle in Görlitz und blickte über die Neiße hinüber nach Zgorzelec in Polen. Glücklicherweise waren sie ohne Polizei oder Grenzkontrollen wieder über die Grenze zurück nach Deutschland gekommen. Noch wusste er nicht, wie er diese Grenzverletzung mit den Neonazis bei Nacht und Nebel einordnen sollte, da schreckte ihn der Anruf aus seinen Gedanken.
Er hatte schon das Schlimmste geahnt, nahm einfach wie in Trance das Gespräch an und legte nach kurzer Zeit wieder auf.
Er hatte seinen Drehplan fast geschafft, noch zwei Tage standen aus, und nächste Woche konnte er den Film schneiden. Aber verdammt! Jetzt musste er seine Mutter beerdigen.
»Hättest du nicht noch warten können, bis ich wieder zu Hause bin?«, fragte er seine Mutter gehetzt und war gleichzeitig froh, dass seine Gedanken niemand hören konnte.
Aber was hätte es gebracht, wenn er am Bodensee im Krankenhaus neben ihrem Bett gesessen hätte, hätte sie überhaupt mitbekommen, dass er da war?
Und wenn schon, zu ihrem 90. Geburtstag hatte sie sich selbst den Tod gewünscht. Und sie beide hatten sich längst ausgesprochen. Er jedenfalls hatte ihr alle seine Sünden gebeichtet und ihr für ihre liebevolle Fürsorge in seiner Kindheit gedankt. Sie schienen sich einig und trugen sich nichts nach. Er hoffte, sie möge in Frieden eingeschlafen sein.
Eine Träne kullerte über sein Gesicht. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Er musste die Beerdigung bis zum Ende seiner Dreharbeiten verschieben. Anfang nächster Woche war er wieder zurück. Dann musste er mit dem Schnitt beginnen und konnte zwischendurch schnell einen halben Tag von Stuttgart nach Seeldorf rauschen.
Wie eine lästige Nebensächlichkeit schob er die Beerdigung seiner Mutter zwischen seine beruflichen Termine, ohne sich Zeit für seine Trauer zu nehmen. Aber so hatte sie ihn erzogen, sagte er sich. »Die Arbeit geht vor«, war immer ihre Devise.
Zur Beerdigung war er in seinem Saab 900 über die A81 von Stuttgart nach Seeldorf gebrettert. Mit dem Dorfpfarrer hatte er zuvor eine heftige Auseinandersetzung geführt. Natürlich hatte der Pope recht und seine Mutter hätte sich sicherlich eine ordentliche Beerdigung gewünscht, was für sie geheißen hätte mit einer Totenmesse, das hieß mit einer Eucharistiefeier. Doch auf den katholischen Kirchenzauber mit Wandlung und Kommunion wollte er verzichten.
Einen halben Tag hatte er für die Beerdigung eingeplant, dann musste er in den Schneideraum zurück und seine Doku fertigstellen.
Die Dokumentation war in den Programmzeitschriften schon groß angekündigt. Am Morgen hatte er noch mit seiner Cutterin die ersten Schnitte besprochen, dann musste er los.
Wohl bald zum letzten Mal, dachte er, dass er über diese Autobahn von Stuttgart an den Bodensee düste. Was wollte er in dem Kaff noch, wenn seine Mutter nicht mehr lebte?
Bei Überlingen verließ er die Bundesstraße und fuhr die Serpentinen hinauf in seinen alten Heimatort. Er hatte noch knapp zehn Minuten Zeit, als er den Kirchturm Seeldorfs zwischen den Höhen des Linzgaus sah.
Das alte Kirchlein galt als das Wahrzeichen des kleinen Bauernortes, um es herum wurden seit Jahrhunderten die Toten beerdigt. Hätten sie aus ihrem Grab sehen können, hätten sie die heute so begehrte Aussicht über den Bodensee bis zum Tag der Auferstehung genießen können.
In seiner Jugend war der Gottesacker ausschließlich Katholen vorbehalten, andere Konfessionsangehörige gab es eh nicht im Ort. Vielleicht hätte der Kirchengemeinderat später bei manch einem zugezogenen Evangelen noch ein Auge zugedrückt. Aber seit immer mehr Neubürger in den Ort drängten, selbst konfessionslose, wurde beschlossen, auf dem Friedhof nur noch echte, das hieß im Ort geborene Seeldorfer neben ihrem Kirchlein zu beerdigen. Diplomatisch schoben die Gemeinderäte ihre Entscheidung auf die zunehmende Einwohnerzahl und auf die begrenzte Fläche des Dorffriedhofs.
Verena Simon aber war eine von ihnen. Von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod hatte sie im Ort gelebt. Zu allem hin war sie jahrzehntelang die Ratsschreiberin, eine wahre Respektsperson! Für viele war sie nach 40 Jahren im Rathaus mächtiger und gewiefter als mancher Bürgermeister, der – wie die Einheimischen urteilten – unter ihr gedient hatte. Und sie hatte über 60 Jahre im Kirchenchor gesungen. Allein dafür war ihr ein Grab in der ersten Reihe des Friedhofs gesichert.
Um 14.30 Uhr war die Trauerfeier angesetzt. Punkt 14.30 Uhr parkte er seine Karre frech vor dem Eingang zu dem Dorffriedhof. Perfekt, dachte er, alle Trauergäste schienen schon in der Kirche zu sein, so hatte er sich die lästigen Begrüßungen seiner alten Freunde und Bekannten vor der Zeremonie erspart.
Er war zwar gespannt, wen er von der buckligen Verwandtschaft noch erkennen würde. Aber eigentlich interessierten ihn seine Verwandten einen feuchten Kehricht, er kannte sie eh nicht mehr. Der Bruder seiner Mutter war schon tot, und seine Cousins und Cousinen hatte er das letzte Mal beim 80. Geburtstag seiner Mutter, und das war vor genau zehn Jahren, gesehen.
Seine Mutter hatte danach auf größere Feiern verzichtet. Sie wollte das »dumme Geschwätz« des neuen Bürgermeisters nicht mehr ertragen, »und seinen schwäbischen Fusel kann er auch behalten«, hatte sie energisch geschimpft, als sie auf dem Etikett der von ihm mitgebrachten Weinflasche »Württemberger Trollinger« gelesen hatte.
Die Trauergemeinde war schon in der Friedhofskapelle versammelt. Jakob wusste, da half auch keine falsche Bescheidenheit, er musste jetzt durch den Kirchgang ganz nach vorn in die erste Reihe gehen. Links in den Bänken saßen die Frauen, rechts die Männer. Der Sarg stand vor dem Altar.
Jakob marschierte schnurstracks an den Reihen entlang Richtung Altar auf den aufgebahrten Sarg zu. Er wusste, alle Augen schauten ihm nach. Der Junge von Verena, tuschelten sie.
Im Dorftratsch hatte sich schnell herumgesprochen, dass er seine Mutter nicht einmal im Krankenhaus besucht hatte, um ihr in ihren letzten Stunden beizustehen. Sollte er jetzt, wie er es gelernt hatte, vor dem Altar und dem Sarg seiner Mutter kurz innehalten oder gar eine Kniebeuge hinlegen? Ein deutlicher Diener musste reichen. Dann drückte er sich in die erste Reihe in die rechte Bank.
Hier hatte er einige Gesichter der Männer seiner Sippe wiedererkannt. Die Köpfe der schwarz gekleideten Herren drehten sich wie auf Befehl zu ihm um. Er lächelte ihnen zu.
Der erste reichte ihm die Hand, begrüßte ihn und kondolierte hilflos. Da musste er nun durch, also schüttelte er jedem der Männer der Reihe nach die Hand und brummelte irgendwelche inhaltsleeren Sätze dazu.
Die ersten Klänge des Requiems von der Orgel auf der Empore der kleinen Kirche beendete das für Jakob unwürdige Schauspiel. Parallel erschien der Pfarrer mit zwei Ministranten am Altar.
Jakob erinnerte sich, dass er früher als Ministrant Beerdigungen liebte. Meist steckten ihnen die Hinterbliebenen nach der Feier ein Scheinchen zu. Daran wollte er nachher unbedingt noch denken.
Der Pfarrer wartete, bis der Organist das Requiem beendet hatte, und begrüßte dann die Trauergemeinde. In der Zeit konnte Jakob kurz in die Gesichter seiner vermeintlichen Verwandtschaft schauen. Er meinte, einen der Cousins zu erkennen. Doch sie waren ihm eigentlich alle so fremd, wie sicher auch er ihnen fremd geworden war.
Sie sahen in seinen Augen alle verdammt alt aus. Dabei wurde ihm klar, die Kinder seiner Onkels waren heute so alt wie er. Doch ihnen sah man ihr Alter an, dagegen fühlte er sich noch immer jung. Schließlich waren sie alle Opas und Omas und er noch immer Junggeselle.
Die Gesichter der Männer neben ihm schienen ihm von einem anstrengenden und arbeitsreichen Leben gezeichnet. Der Alte neben ihm hatte ohne Zweifel einen zu hohen Blutdruck, was aber seiner roten Knollennase nach eher auf einen zu hohen Alkoholkonsum schließen ließ. Der Bauch seines Banknachbarn ragte über die Kirchenbank hinaus.
Sie alle waren gestandene Männer und trugen graue oder schwarze Mäntel. Jakob roch Mottenkugeln. Vermutlich holten sie ihre schwarzen Anzüge nur zu Festtagen oder eben zu Beerdigungen aus dem Kleiderschrank.
Jakob hatte zu Hause noch kurz überlegt, ob er sich auch einen dunklen Anzug kaufen sollte. Doch für den einen Tag sparte er sich die Investition. Seine schwarze Lederjacke interpretierte er als Statement, dazu die obligatorische Jeans, heute in Schwarz. Das musste reichen, mehr Kompromiss hätte seine Mutter kaum erwartet.
Verstohlen blickte er zu seinen weiblichen Verwandten hinüber. Auch die Frauen hatten alle ihre schwarzen Mäntel und Kleider an. Sie alle lauschten andächtig den Worten des Pfarrers direkt vor ihnen.
Jakob glaubte, eine seiner Cousinen zu erkennen. Er erinnerte sich an eine junge, flotte und schlanke Frau mit unternehmungslustigen Augen, mit der er während einer der letzten Familienfeiern unbeschwert, vielleicht etwas zu heftig, geflirtet hatte. Freilich war auch sie älter geworden, aber jetzt sah er die einst blitzenden Augen tief liegend hinter dickeren Wangen versteckt. Ihr Mantel spannte um einen beachtlichen Bauch. Angestrengt schaute sie nach vorn.
An Hunger jedenfalls schienen alle seine Verwandten nicht zu leiden, diagnostizierte Jakob. Früher drehte er Filme über arme Rentner, die zum Sozialamt mussten, um ihr Leben bestreiten zu können. In Seeldorf könnte er wohl eher mit den Alten einen Film zu Diabetes Typ 2 drehen.
Endlich gab der Pfarrer den Bestattern ein Zeichen, den Sarg aus der Kirche zu tragen. Die Trauergesellschaft formierte sich. Jakob wurde in die erste Reihe geschoben und trottete langsam hinter dem Sarg und den Sargträgern her. Die alten Weiber begannen, einen Rosenkranz zu beten.
Jakob las entlang des Weges auf den Grabkreuzen die Namen einiger alten Bekannten aus seiner Jugend. Sie schienen ihm nun wie Zeugen aus einer anderen Zeit zu sein. Bizarr, hatte er gedacht. Angesichts aller Toten des Ortes lebten auf dem Friedhof die alten Traditionen über Jahrhunderte weiter.
Während der Pfarrer den Sarg vor der Bestattung mit seinem Weihwasser bespritzte, hatte Jakob überlegt, wie er seine Dokumentation aufbauen wollte. Sollte er eine Collage erstellen, in der er die Neonazis mit Hitlergruß zeigte und die glatt gebügelten Fernsehgesichter der AfDdazwischenschnitt?
Als der Kirchenchor anfing, das Lied »Mögen Engel dich begleiten« anzustimmen, überlegte er, mit welcher Musik er seinen Film unterlegen sollte. Er musste diesen Nazi-Grölern akustische, distanzierende Kontrastpunkte setzen, am besten mit modernen, jazzigen Klängen.
An seine Mutter dachte er kaum. Ein paar Tränen standen hin und wieder in seinen Augen, wenn er auf den Sarg schaute, in dem er seine Mutter liegen wusste. Er hörte ihre Worte in seinem Ohr, die sie ihm bei seinem letzten Abschied mitgab, als hätte sie ihr Ende geahnt: »Du darfst nicht traurig sein«, hatte sie ihm aufgetragen, als sie über ihren baldigen, unausweichlichen Tod sprachen.
Er war es nun aber trotzdem.
Sie würde ihm fehlen. Das wöchentliche Gespräch, der Anker Seeldorf. Alles das war nun vorbei. Er sah seine Mutter mit den Augen seiner Kindheit als junge Frau vor sich. Sie war eine stattliche Dorfschönheit. Auch zu ihrem letzten Geburtstag hatte sie noch eine besondere Würde ausgestrahlt.
»Wir haben ihren Verlust schon vor 30 Jahren erfahren«, hörte er den Bürgermeister über die Pensionierung seiner Amtsleiterin reden. Es war noch immer der gleiche Dorfschultes, der ihr zu ihrem Geburtstag den schwäbischen Trollinger überreicht hatte. Ruhe in Frieden, dachte Jakob, ab heute musst du dich über keinen Amtsschwätzer mehr aufregen.
Die anschließend noch längere Trauerrede des Kirchenchor-Vorstands nutzte Jakob, um die Trauergäste genauer unter die Lupe zu nehmen. Er rätselte, welche der Seeldorfer er noch aus seiner Schul- und Jugendzeit erkannte. Dabei wurde ihm klar, warum er alle Klassentreffen mied. Was sollte er im Kreis dieser Grauen Panther. Die Schlankgebliebenen sahen krank oder ausgezehrt aus, die Dicken überfressen. Zu beiden Parteien zählte er sich nicht. Und so fühlte er sich auch nicht!
Plötzlich blieben seine Augen an einer Person in der hinteren Reihe hängen. Es gab ihm einen kleinen Stich ins Herz, den er aber nicht wahrhaben wollte. Katharina!
Zuerst war ihm zwischen all den Grauköpfen ihre blonde Hochsteckfrisur aufgefallen. Dann sah er ihr Gesicht, unverkennbar, ihre ebenmäßigen Gesichtszüge mit ihrer kecken Stupsnase. Ihre hellen Augen strahlten wie früher. Ihr blasses Gesicht zeigte kaum Falten. Zugegeben, ihre einst blonden Haare schienen nun eher weißblond.
Jakob streckte den Kopf, um mehr von ihr zu sehen. Schlank wie in ihren Jugendjahren war sie nicht mehr, aber ihr schwarzes, eng anliegendes Kleid unterstrich den Reiz ihrer runden Fettpölsterchen. Groß und stattlich stand sie in der hintersten Reihe. Immer noch sexy, dachte er, und begehrenswert.
Verdammt, gerade auf sie hätte er heute verzichten können. Trotzdem musste er immer wieder zu ihr hinsehen. Sie war einst seine große Jugendliebe.
Er bemerkte, dass auch sie ihn interessiert musterte.
Schnell zog er seinen Bauch ein und schaute rasch unsicher auf den Sarg. Dieser wurde in dem Moment von vier Totengräbern, die auf allen Seiten ihre Leinen hielten, langsam in das leere Loch abgelassen. Mama, ade, dachte er und spürte, wie erneut Tränen seine Augen füllten. Verdammt, haste mich doch noch zum Flennen gebracht.
Dafür war die Zeremonie aber endlich beendet. Er wusste, er musste noch stehen bleiben. Jeder der Trauergäste zog an der Trauerfamilie vorbei und jeder oder jede schüttelte ihm die Hand und sprach ihm sein Beileid aus.
Natürlich kam irgendwann auch Katharina. Sie griff seine Hand, schaute ihm ins Gesicht und sagte trocken: »Schade, dass für unser Wiedersehen erst deine Mutter sterben musste.«
Jakob hatte weiche Knie bekommen. Schnell entzog er ihr seine Hand. Nickte unbestimmt mit dem Kopf, bekam kein Wort aus seinem Mund heraus und wandte sich schnell dem nächsten Kondolierenden in der Reihe zu.
Endlich hatte der letzte der Besucher ihm die Hand geschüttelt. Jakob schaute sich nochmals kurz um, sah niemanden, dem er verpflichtet wäre, ihn noch zu grüßen. Die Trauergemeinde hatte kleine Grüppchen gebildet, in denen zum Teil lebhaft diskutiert wurde. Schnell nutzte er die Chance, um sich zu verdünnisieren. Zuerst aber ging er, für alle sichtbar, in die Sakristei der Kirche.
Der Pfaffe entwand sich gerade seinem schwarzen Messegewand, die beiden Ministranten halfen ihm dabei. »Das war auch mal mein Job«, stellte Jakob sich vor und drückte den beiden je einen 20-Euro-Schein in die Hände. »Sie haben ja meine Anschrift«, wandte er sich an den Pfarrer.
»Unser Dienst ist kostenfrei«, antwortete der Geistliche kühl, »schade, dass Sie auf eine Eucharistiefeier verzichtet haben.«
»Ich habe leider gerade kaum Zeit«, wandte sich Jakob zum Gehen, »ich muss zur Arbeit.«
»Wenn der Mammon ruft, wird die Liebe schnell vergessen«, hörte er den Pfaffen ihm noch nachrufen, doch er verdrückte sich schon Richtung Friedhofsausgang.
Eigentlich hätte es sich gehört, dass er die Trauergemeinde zu einem Leichenschmaus eingeladen hätte. Er hatte im Vorfeld auch daran gedacht, doch das Dorfgasthaus, die Krone, hatte vor Jahren schon das Restaurant geschlossen, und in ein anderes Dorf wollte er nicht ausweichen. Das hätte alles zu lange gedauert, und überhaupt, er wollte schließlich mit der Mischpoke nach dem Tod seiner Mutter nichts mehr zu tun haben.
Rund 15.000 Tote allein in Deutschland hat jährlich die Feinstaubbelastung durch den Autoverkehr zu verantworten. Jakob hatte schon genügend Filme über die jährlichen Krebstoten der mobilen Autowelt gedreht und sprach sich, für ihn logisch und konsequent, für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen aus. Trotzdem blieb auf der Heimfahrt nach Stuttgart sein rechter Fuß meist durchgedrückt auf dem Gaspedal. Die A81 bot nicht nur den Schweizer Rennfahrern freie Fahrt.
Ab dem Herrenberger Tunnel waren die 120 Stundenkilometer Gesetz. Jakob nahm den Fuß vom Gaspedal und drehte David Clayton-Thomas, dem Leadsänger von Blood, Sweat & Tears, den Ton ab. Die Beerdigung hatte er überstanden, nun fragte er sich nur noch, vor wem er so auffallend schnell geflüchtet war? Vor seiner Verwandtschaft oder vor Katharina? Er sah auf der Fahrt immer wieder Bilder von ihr vor sich, aus ihrer gemeinsamen Jugend und sie heute auf der Beerdigung.
Er musste sich eingestehen, dass er beim Anblick von Katharina eine seltsame Hilflosigkeit empfunden hatte. Aber was hätte er ihr auch sagen sollen? Dass er sie nie vergessen hatte? Dass er noch jahrelang nach ihrer Trennung von ihr geträumt hatte?
Er war als Jugendlicher unsterblich in sie verliebt gewesen, sie aber hatte ihn nach einigen Techteleien kühl abblitzen lassen und über Nacht einen anderen ihm vorgezogen.
Kalter Kaffee von vorgestern, schob er die Erinnerungen beiseite und drehte wieder Blood, Sweat & Tears auf.
Heute, drei Jahre später, sitzt er wieder in diesem vermaledeiten Flecken Seeldorf. Nach der Beerdigung seiner Mutter hatte er gedacht, dass er nie wieder in dieses Kaff zurückkehren würde. Eine ehemalige Freundin seiner Mutter hatte für die Wohnung einen Schlüssel und seit ihrem Tod sich um das leer stehende Haus gekümmert. Kehrwoche war Pflicht im Ort, da schützte selbst der Tod nicht davor. Persönliche Briefe, wobei es eigentlich nur amtliche Briefe waren, hatte sie ihm nachgeschickt.
Die Wohnung selbst wirkt ohne seine Mutter steril. Und doch sieht Jakob sie in jeder Ecke hantieren und mit ihm reden. Auch ihr Geruch wabert noch durch alle Räume.
Als Kind hätte er jedes der Häuser im Ort allein nach dessen Geruch identifizieren können. Der Stallgeruch war in jedem der Bauernhäuser identisch. Aber spätestens in der Küche und erst recht in der Stube bewies jedes Haus seine eigene Ausdünstung.
Mit dem Duft seiner Mutter in der Nase schieben sich in schneller Folge wieder viele Bilder seiner Kindheit und Jugend vor seine Augen. Seine Mutter strahlt ihn in seinen Erinnerungen immer fröhlich an, sie lacht und wird nie älter.
Werd jetzt bloß nicht schwach, Jakob, versucht er, den aufkommenden Sentimentalitäten auszuweichen. Aber es tut ihm heute unendlich leid, dass er sich für seine Mutter zu ihren Lebzeiten nicht mehr Zeit genommen hatte.
Meist hatte er seine Mutter gerade zweimal im Jahr besucht, zu ihrem Geburtstag und zu Weihnachten. Sie hatte ihm ihre Freude bei jedem Besuch gezeigt. Ihn aber nie gedrängt, sie öfter zu besuchen. Und er musste ja arbeiten, beruhigt er sich.
Nun ist er zurückgekommen in seinen Heimatort Seeldorf. Nur wenige Alte kennen ihn noch. Jakob Simon, der Junge vom Obergfellenhof. Sohn der ehemaligen Ratsschreiberin Verena Simon. Und des Vaters Otto Simon. Aber wer kannte den noch? Nicht einmal er, der Sohn! Was weiß er über ihn? Aber wer interessiert sich denn überhaupt noch dafür?
Wieder betrachtet er den Stapel Zeitungsausschnitte vor sich auf dem Tisch: Es war Mord! Jetzt sieht er wieder seine Mutter vor sich, alt und gebrechlich, wie sie vor fünf Jahren immer wieder von diesem ominösen Knochenfund zu erzählen anfing.
Jakob weiß nicht, wofür er sich mehr schämen soll: dafür, dass er ihre Unruhe und Befürchtungen nach dem Knochenfund nicht ernst nahm oder dass er sie überhaupt so wenig besucht hatte, oder dafür, dass er jetzt das von ihr hart angesparte Erbe einfach einsacken wird.
Er tigert unschlüssig durch die Wohnung. Zu viele alte Geschichten gehen ihm, seit er in Seeldorf angekommen ist, durch den Kopf. Doch warum will er sich jetzt, wo seine Mutter längst tot ist, damit noch belasten?
Im Bad schaut er in den Spiegel und streicht sich mit der rechten Hand über sein kurz geschorenes Haar. Die ausufernde Glatze über der Stirn hatte vor längerer Zeit zu einer Vokuhila-Frisur geführt. Eine kurze Liebe aber hatte ihm vor Jahren dann auch noch die langen Nackenhaare abgeschnitten, woraufhin er sich kurze Zeit später gleich auf einen Kurzhaarschnitt eingelassen hatte.
Zunächst hatten ihn die ausrasierten Hinterköpfe der Jungen an die HJ-Rasuren der Nazizeit erinnert. Doch mit dem Haarausfall auf seinem gesamten Schädel kam ihm der Kurzhaarschnitt gerade recht. Er hatte geglaubt, der Undercut ließe ihn jünger erscheinen. Doch jetzt sieht er in dem Neonlicht des alten Alibert-Badschranks seiner Mutter deutlich, wie sein Gesicht immer länger wird und seine Vorderplatte sich bald bis zur Kopfkrone ausweitet.
Er verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. 70 gelebte Jahre hinterlassen auch bei einem Junggesellen ihre Spuren. »Vergiss es«, spricht er zu sich selbst, wendet sich ab, knipst schnell das Licht aus und geht aus dem Bad.
In der Schublade der Kommode seiner Mutter hat er außer den Zeitungsartikeln auch noch einen Brief an ihn gefunden. Der Brief lag auf einem quadratischen, fest eingebundenen und etwas abgegriffenen Buch, das Jakob an die Poesiealben der Mädchen in seiner Volksschulzeit erinnert. In Sütterlinschrift steht »Erlebnisbuch« auf dem Einschlag.
Doch bevor er sich an ihr Tagebuch wagt, liest er ihren Brief:
Ich habe Dich schon unter meinem Herzen getragen, als ich Otto Simon heiratete. Es ging damals, Ende 1944, alles sehr schnell. Otto Simon war bei der Gestapo in Singen, er hatte mir schon immer schöne Augen gemacht. Wir heirateten an einem nebligen Novembersonntag 1944, schon einen Tag später war er verschwunden. Man sagte, er hätte sich zur Ostfront gemeldet, dabei war an einen Endsieg doch schon längst nicht mehr zu denken – und jetzt findet man die Knochen eines jungen Mannes, in Ottos Alter, im Teich hinter unserem Haus.