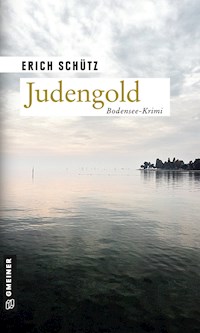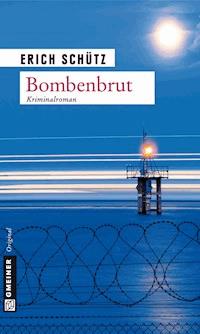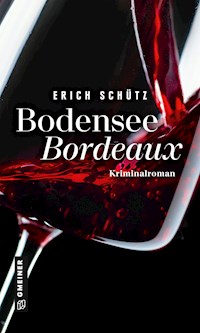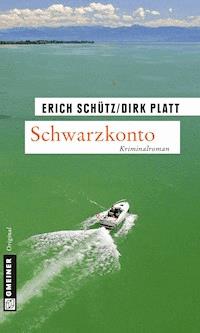
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Gmeiner-VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
In Kressbronn am Bodensee wird eine nackte Leiche angeschwemmt. Von Nacktwanderern hat der Fernsehjournalist Lebrecht Fritz schon gehört. Aber Nacktsurfer? Dabei war der Mann ein solider Banker in Liechtenstein. Fast zeitgleich findet die Polizei eine Leiche im Kleinen Wannsee in Berlin - ebenfalls nackt. Der Tote hätte nach der Bundestagswahl Finanzminister werden sollen. Kathi Kuschel, Fernseh-Journalistin aus Potsdam erkennt bald einen Zusammenhang mit dem toten Banker am Bodensee.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Erich Schütz / Dirk Platt
Schwarzkonto
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © terranova_1 – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4512-5
Danksagung
Freundschaft ist, wenn zwei zusammen ein Buch schreiben und sich darüber keinmal in die Haare bekommen.
Wir danken unseren Frauen für ihre Geduld, ihre Liebe und ihre konstruktive Kritik. Ihr habt das Buch wirklich besser gemacht.
Ein Dank auch an Kitty und Karl-Ernst Platt für ihre professionelle Unterstützung.
Und nicht zu vergessen:
Dank an Obis Geißbock Bruno – in memoriam
Erich Schütz und Dirk Platt
Prolog
Im Todeskampf verschwimmt die Realität. Nackte Panik bietet kaum Raum für klare Gedanken. Fragen, die sich stellen, bleiben unbeantwortet. Für immer. Zumindest für Reto Welti. Er ist Bankangestellter. Sein Arbeitgeber eine renommierte Liechtensteiner Anlagebank. Sein Leben erlischt. Warum? Wieso? Antworten werden andere für ihn finden müssen.
Wer ist sein Mörder? Wer sind die Hintermänner? Was ist überhaupt der Grund des Mordkomplotts? Reto Welti stirbt leise. Unwissend. Ohne Antwort. Obwohl er das Motiv ahnt.
Ahnte.
Er wehrt sich. Er krümmt seinen Körper mit letzter Kraft zusammen und drückt ihn schnell nach oben. Die Beine strampeln, suchen Halt, die Finger krallen sich in den Neoprenanzug seines unbekannten Angreifers.
Der Fremde umklammert ihn fest wie eine Eisenzange. Er zieht ihn immer weiter in die eiskalte Tiefe des Bodensees.
Reto Welti kämpft seinen letzten Kampf, der aber längst verloren ist. Bei klaren Gedanken würde er die Ausweglosigkeit seiner Situation erkennen.
Sein Körper wehrt sich reflexartig und doch vehement.
Sein Gehirn zieht einen erbarmungslosen Schlussstrich. Es ruft sein kurzes Leben mit wenigen Bildern ab: Er mit dem begehrten Master der renommierten Universität St. Gallen; er mit leuchtenden Augen vor seiner neuen, großen Liebe Sandra; er mit ihr auf Hawaii.
Filmriss. Ein Gedankenblitz: Alles nur Träumerei.
Aus.
Reto Welti hat sich offensichtlich mit den Falschen angelegt. Seine Gegner sind nicht nur eine Nummer zu groß, nein, sie sind ihm haushoch überlegen. Er hat ihre Brutalität unterschätzt. Der Killer, der ihn mit vorgehaltener Waffe ins Boot gezwungen hatte, ist Profi.
Er dagegen war in dem Spiel von Anfang an ein Dilettant.
Der Mann in seinem schwarzen Neoprenanzug bewegt sich unaufhaltsam wie ein ferngesteuerter Roboter. Jeder seiner Handgriffe scheint einstudiert. Jede Bewegung führt zum gesetzten Ziel.
Er hat alles getan, was der Mann verlangte. Er musste sich splitternackt ausziehen, stand vor Kälte schlotternd vor ihm. Die Todesangst lähmte ihn. Laut schrie er ein verzweifeltes: »NEIN!«
Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einer grinsenden Fratze. »Dich hört niemand«, lachte die dunkle Gestalt hämisch. Unausweichlich bewegte der Mann sich auf ihn zu. Er streckte seinen Arm nach ihm aus. Stand nur noch wenige Zentimeter vor ihm. Da traf ihn unvermittelt ein Schlag auf den Oberarm.
Welti konnte sein Gleichgewicht nicht halten und stürzte über die Bordkante des kleinen Bootes platschend in den eiskalten See.
Der Angreifer war ihm sofort hinterher gesprungen. Landete knapp neben ihm. Hielt ihn fest.
Das kalte Novemberwasser des Bodensees schmerzte Reto schon nach wenigen Sekunden. Ihm schien, als stünde sein Herz abrupt still.
Jetzt spürt er noch immer den harten Griff des fremden Mannes. Unbarmherzig zieht er ihn mit nach unten in die eiskalte Dunkelheit. Seit etwa vier Minuten sind sie unter Wasser. Was wollen sie von mir? Was habe ich getan? Warum töten sie mich?
Noch auf dem Boot hatte der Unbekannte wenigstens auf eine seiner vielen Fragen zynisch geantwortet. »Es wird ein schöner Tod. Keine hässlichen Spuren.« Der Mörder hatte dabei unverhohlen gegrinst, »Menschen ertrinken hin und wieder.« Ebenso emotionslos und kühl, wie diese Novembernacht, hatte er hinterher geschoben: »Keine Sorge, es geht relativ schnell. Ich bin Kampfschwimmer. Acht Minuten unter Wasser ohne Luft, für mich kein Problem, für dich das Aus!«
Es wird leicht. Reto spürt, wie die Kälte schwindet. Er lächelt. Sieht kleine Luftbläschen den Weg aus seinem Mund nach oben tanzen. Perlen wie im Sektglas.
Gruß an Sandra.
Endlich ist es warm.
Der Tod tut nicht weh.
Montag, 21. November
Langenargen, frühmorgens
»Verdammt noch mal, es ist November, da gibt es noch kein Treibgut und Wassersportler schon längst nicht mehr«, denkt Claudia Finke, als sie am Bodenseeufer, bei Kressbronn, ein schneeweißes Surfbrett im leichten Wellenschlag dümpeln sieht. Sie schaut angestrengt und glaubt, einen menschlichen Körper darauf zu erkennen. Liegend. »Schläft der?«, fragt sie sich ungläubig.
Claudia Finke ist eine der beiden blondgelockten Dalben-Schwalben der Bodensee-Schiffsbetriebe in Kressbronn. Sie öffnet in der Frühe den Schiffsfahrkartenverkaufsschalter der BSB am Landungssteg und sorgt mit ihrer ebenso blond gelockten Kollegin den ganzen Tag über für das reibungslose An- und Ablegen der großen weißen Personenschiffe. Doch ihre Entdeckung lässt sie in ihrer morgendlichen Routine stocken. Sie will nicht glauben, was sie sieht: ein Surfer, ruhend, splitterfasernackt auf seinem weißen Brett?
Ungläubig lehnt sie sich weit über das Geländer am Steg, um ihre Entdeckung genauer zu erkennen. Die Morgensonne blendet. Sie führt die Handfläche zur Stirn.
Es ist mild für die Jahreszeit. Herbstliche Winde und Sonnenschein locken zwar den einen oder anderen Surfer auf den See, aber ohne Neoprenanzug holt sich jeder den Tod. Die Wassertemperatur liegt bei zwölf Grad; selbst bei sonnigen 20 Grad Lufttemperatur in den Nachmittagsstunden. Warum sollte sich bei solchen Bedingungen ein vernünftiger Mensch nackt auf sein Surfbrett legen? Und dann auch noch morgens um neun Uhr?
Brrr – sie friert.
Entschlossen verlässt sie den Landungssteg und geht zügig Richtung Ufer. Sie streicht sich eine Strähne aus ihrem braun gebrannten Gesicht. Ein kühler Ostwind bläst um ihre spitze Nase. Trotzdem fröstelt sie plötzlich nicht mehr. Es treibt sie innerlich angespannt immer näher an das offensichtlich gestrandete Surfbrett und diesen unheilverkündenden Menschenkörper.
Das Surfbrett ist noch aufgetakelt. Das bunte Segel liegt am Baum aufgezogen flach auf der Wasseroberfläche. Es tänzelt leicht im dunklen rhythmischen Wellenschlag. Die Spitze des Segelbaums hat sich in Schlingpflanzen verfangen. Das Brett mit dem nackten Körper ist auf dem Kies gestrandet und gibt ihm am Ufer Halt.
Claudia Finke hat nur noch Augen für den menschlichen Körper. Es ist ohne Zweifel ein Mann. Deutlich ist seine kräftige Statur zu erkennen, wenn auch ein Teil der Beine von der Takelage verdeckt ist, in der sich der gesamte Körper verheddert hat.
Der ist tot!, schießt es Claudia schließlich mit Gewissheit durch den Kopf. Sie tritt näher heran. Watet, ohne zu zögern, mit ihren Lederstiefeln in das kalte Wasser. Das Rindsleder weist die Nässe kaum ab. Sie steht direkt neben dem Brett und dem Toten. Sieht sein junges Gesicht. Die Augen sind geöffnet. Fast scheint es ihr, als würde er sie anlächeln. Frech sieht er aus, nicht unsympathisch. Braungebrannt sein schlanker Körper, seine blonden Locken hängen patschnass an ihm, die blauen Augen starren sie an.
Unwillkürlich spitzen sich die Lippen zu einem frechen Pfiff. Dann hält sie sich schnell die Hand vor den Mund. Sie fühlt sich beobachtet. Schaut trotzdem noch kurz auf den Penis des nackten Mannes und lächelt. Sie wusste doch, dass es saukalt ist. Abrupt wendet sie sich ab und eilt zu ihrem Kassenhäuschen.
19222 – die Telefonnummer der Rettungsleitstelle. Sie wählt, ohne zu überlegen, und schreit in die Telefonmuschel: »Der ist tot!«
»Wer?«
Sie weiß nichts zu antworten.
»Wer ist am Apparat?«
»Ich«, sagt Claudia. Als sie ihre eigene Stimme hört, löst sich ihr erster Schock und sie erzählt, was sie soeben entdeckt hat.
*
Eine Stunde später ist der Kressbronner Strand großräumig abgesperrt. Die Polizei aus Friedrichshafen ist vor Ort, die Spurensicherung hat Verstärkung aus Ulm angefordert. »Volles Programm«, sagt Horst Weinrich, der Polizeipostenchef von Kressbronn, stolz zu Claudia Finke. Sie winkt ab und antwortet lapidar: »Dann müsstet ihr auf dem See Spuren sichern.«
»Was meinst du?«
»Den hat uns der Rhein gebracht«, ist sich Claudia Finke sicher. »Den hat es genau dort angeschwemmt, wo der Rhein jährlich an unserem Ufer knabbert. Siehst du nicht, wie die Bucht sich hier immer weiter ausfrisst? Das ist der Rhein! Der mündet drüben, auf der anderen Uferseite in den See und drückt sein Wasser samt allem was er sonst noch mitreißt hier zu uns. Und genau da ist ja auch das Brett mit dem Toten gestrandet.«
»Hm«, brummt der Ortspolizist.
»Hätte der Segelmast sein Brett nicht am Ufer festgehalten, wäre er wie alles andere Treibgut längst seeab getrieben.«
»Seeab«, lächelt Horst Weinrich, »lass das die klugen Kriminalbeamten aus Ulm nicht hören. Die halten dich für unzurechnungsfähig. Seeab, tss.«
»Der Rhein fließt bei uns in den Obersee und am Untersee wieder hinaus. Also: Fließt der jetzt im See bei dir bergauf, oder was?«
»Hm«, sucht der Ortspolizist nachdenklich nach Worten, da fallen ihm Blechmusik und Paukenschläge ins Wort. Die Melodie des lokalen Evergreens Die Fischerin vom Bodensee ertönt. Claudia Finke springt auf, beginnt in ihrer Handtasche zu wühlen, zieht schließlich ein kleines Handy heraus. »Ja, Fritz, was willst denn du jetzt?«
Sie fuchtelt mit dem Handy vor dem Gesicht des Polizisten herum. »Privat«, entschuldigt sie sich und weist mit ihren großen dunklen Augen dem Polizeipostenführer den Weg aus ihrem Kassenhäuschen.
»De Fritz«, lacht sie in das Handy, nachdem der Polizist ihr Refugium verlassen hat, »natürlich erinnert sich der alte Griffelspitzer wieder an seine ›Dalben-Schwalbe‹. Woher weißt denn du, was wir uns hier eingefangen haben?«
»Du musst nur den Seefunk hören«, antwortet am anderen Ende der Leitung Lebrecht Fritz, »das ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Polizei an deinem Steg einen toten Mann gefunden hat.«
»Und was willst du jetzt von mir?«
»Okay, ich hab’s ja überlebt«, erinnert sie Fritz an ihre alte Affäre, »ist ja auch schon lange her. Aber ein toter Mann, direkt an deinem Steg …«
»Mach keine Witze, Fritz! Das ist traurig. Zu allem hin sah er auch recht gut aus, ein schöner Verlust für die Frauenwelt.«
»Und er war nackt!«, fällt ihr Fritz ins Wort und unterstreicht das Wort »nackt« deutlich und laut.
»Woher weißt du das? Hat das auch der Seefunk gemeldet?«
»Mein Chef sagt das, deshalb meint er, das sei etwas für mich: nackte Tatsachen!« Lebrecht Fritz räuspert sich und zitiert eine alte journalistische TV-Binsenweisheit: »Nackte Tote und kleine Kinder bringen Quote! – Da Kinder nicht mein Thema sind, soll ich mich um den nackten Toten kümmern. Sag mal: Stimmt das denn, ein Nacktsurfer?«
»Ja«, antwortet Claudia trocken und steckt sich eine Zigarette an. Die X-te an diesem Morgen.
»Bei aller Liebe, Claudia«, wird Fritz vertraulich und spielt auf ihre gemeinsamen Nächte an, »ein nackter Mann unter deiner Liebeslaube, na komm schon …«
»Du spinnst!«, hält Claudia Finke energisch dagegen, »und dann noch auf meiner Massagebank, oder was?«
»Warum auf der Massagebank?«, ist Fritz verunsichert.
»Weil der Tote auf einem Surfbrett dahergeschwommen ist.«
»Hör auf. Ich komm’ vorbei.«
*
Lebrecht Fritz hatte bis zu dem Gespräch mit Claudia Finke gehofft, dass die Meldung über einen nackten Toten im See bei Kressbronn eine Ente ist. Im November! Bei nächtlichen Lufttemperaturen von zehn Grad und zwölf Grad Wassertemperatur. Diese Angaben hatte er sich schnell beim Wetteramt besorgt, nachdem sein Chef, Uwe Hahne, ihm den Auftrag aufs Auge gedrückt hatte. »’ne geile Story«, hatte dieser erkannt und Fritz auf die Fährte gesetzt.
Lebrecht Fritz zählt für Uwe Hahne zu den personellen Altlasten seiner Redaktion. Vor einem Jahr hat er das Regionalstudio Friedrichshafen des Landessenders übernommen. Hahne will eine Crew für moderne Themen. »Quote verdoppeln!«, ist sein Ziel. Journalisten der alten Schule, wie Lebrecht Fritz, sind ihm im Weg. Sie erkennen die Zeichen der Zeit nicht. Der nackte Tote ist für Hahne ein typisches Beispiel. »Nackte Tatsachen!«, hat er gelacht, »das ist doch, was Fritz immer fordert, jetzt soll er sich um die nackte Angelegenheit kümmern.«
Lebrecht Fritz hatte den Auftrag zu Hause angenommen. Er hatte gerade seiner Mutter das Frühstück ans Bett gebracht. Seit Monaten ist Elfriede Fritz meist bettlägerig. Dabei war seine Mutter ihr Leben lang nie krank gewesen. »Nur eine kleine Hüftoperation«, hatte der Herr Professor abgewunken, »Routine, wie wenn Sie über die Straße gehen.« Jetzt liegt seine Mutter im Bett, als wäre sie im falschen Augenblick über die Straße gegangen.
»Ich habe Schmerzen, als wäre ein LKW über meine Hüfte gedonnert«, jammert sie seit Wochen. Und Lebrecht sieht seiner Mutter ihr schweres Los an. »Das zieht wie ein Feuer von der Wade bis in Kreuz«, massiert sie ihr linkes Bein und die Hüfte mit schmerzverzogenem Gesicht, »so schlimm war es vor der Operation nicht!« Zu allem hin kann sie kaum noch gehen. Vom Bett bis zur Toilette benützt sie Krücken. Bei fast jedem Schrittversuch wird sie von Schmerzattacken geplagt, wie sie sie vor der Hüftoperation nicht kannte.
Lebrecht Fritz ist ein Journalist der alten Schule. Er hat sich mühsam hochgeackert. Vom Schreiberling im Lokalblatt zum Fernsehreporter für die Tagesschau. Doch das ist schon lange vorbei. Mit knapp 60 Jahren ist er für seine jungen Kollegen ein Auslaufmodell. Er weiß, dass das stimmt. Wenn er früher mit einem Team vor Ort war, kam er immer mit einer Story zurück. Heute zweifelt er zu oft an dem Sinn der Geschichten, die er umsetzen soll. Kauzig urteilen die Jungen. Kritisch sieht er sich. Auch jetzt ist Fritz wieder ratlos. Ein toter Nacktsurfer? Um Herrgottswillen was für eine Story soll er daraus aufblasen?
In Wirklichkeit interessiert ihn der Tote im Moment wenig. Ob er sich mit Drogen zugedröhnt den Goldenen Schuss gesetzt hat, oder was auch immer passiert sein mag, das soll die Polizei ermitteln. Ihn interessiert viel mehr: warum seine Mutter Wochen nach der Hüft-OP mehr Schmerzen zu ertragen hat als jemals zuvor?
Heute hat er sich vorgenommen zu diesem Herrn Professor in die Klinik zu gehen und mit dem Mann Tacheles zu reden. Für ihn ist klar, die weißen Götter verschweigen seiner Mutter die Wahrheit. Entweder leidet die alte Frau an einer ganz anderen Krankheit, oder die Hüft-OP ging gründlich daneben. Darüber will er mit den behandelnden Ärzten reden.
Auf der anderen Seite kennt Fritz sein Konto. Sein Leben lang hat er sich als freier Journalist durchgeschlagen. Die Auftragslage wurde in den vergangenen Jahren nicht besser. Rosinenpicken konnte er sich früher leisten. Damals war er als Fachjournalist für sämtliche Umweltthemen gefragt. Er hatte die miese Wasserqualität des Sees thematisiert und angeprangert und mehrere Umweltskandale aufgedeckt. Seine Beiträge wurden gelesen und gesehen. Wo er mit seiner schwarzen Lockenmähne und Vollbart auftauchte, gab’s hinterher Zoff.
Die Zeiten sind vorbei. Der Bodensee spendet heute klares Trinkwasser, sein Bart ist ab und seine Haare sind grau. Dafür schiebt ihm Hahne immer wieder die schlüpfrigsten Geschichten zu: »Du bist doch der Spürhund der Redaktion«, hänselt der Schnösel ihn gehässig. Und er, Fritz, muss sich auf die schmierigen Fährten setzen. In seinem Alter! Mit fülliger Figur, Bauchansatz und immer tiefer werdenden Furchen im Gesicht. Auch heute.
Er verabschiedet sich von seiner Mutter, stellt ihr zuvor noch eine Thermoskanne mit frisch aufgebrühtem Kaffee neben das Bett und sein selbstgebackenes Zopfbrot. Ein altes Hausrezept. Hefeteig mit viel Butter, etwas Vanillezucker und mit Ei verstrudelt bestrichen. Gestern Abend hat er es gebacken. Er muss sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Früher hat sie ihn mit ihrer Koch- und Backkunst aufgepäppelt, jetzt ist er dran.
Dann fährt er nach Kressbronn.
Potsdam, am Abend
Ihre rechte Hand schiebt sich ganz langsam durch den Rockschlitz zwischen ihre Beine, sodass es Günther Robert Clausdorff nicht sehen kann, der einfach weiter spricht. Die letzten 20 Minuten scheint Clausdorff nicht ein einziges Mal Luft geholt zu haben. Er hat wild gestikuliert, leidenschaftlich argumentiert und für sich und seine Partei geworben. Jetzt aber kommt er zum Schluss.
»So sieht er aus, der Fahrplan direkt ins Kanzleramt. Sie werden sehen, die Zeichen stehen auf Wechsel. Sie sind die ersten Journalisten, die wir in unsere Pläne für den Wahlkampfendspurt einweihen. Vor allem die so genannten ›Kleinen‹ bekommen endlich ein Recht auf Gerechtigkeit. Das bekommen sie aber nur mit uns!«
Ihre drei Kollegen von der Zeitung haben damit keine Probleme, die scheinen sich tatsächlich alles merken zu können. Kathi nicht. Ihr Kurzzeitgedächtnis funktioniert einfach nicht so wie das der meisten anderen. Deshalb ist sie beim Fernsehen gelandet, wo in der Regel immer eine Kamera mitläuft, die alles aufzeichnet.
Doch jetzt, ohne Kamera, bleibt ihr nichts anderes übrig als ihr alter Trick aus der Schulzeit. Für solche Angelegenheiten hat sie einen langen Schlitz in ihren Rock genäht. Das erleichtert die Sache ungemein, sorgt aber zuweilen für eine gewisse Unruhe unter den anwesenden Kollegen, die von dem versteckten Notizblock nichts wissen dürfen. Wenn Kathi sich zwischen die Beine fasst um auf dem Block ein paar Stichworte zu notieren, bemerkt sie immer wieder die irritierten Blicke ihrer meist männlichen Sitznachbarn. Es ist ihr hoch peinlich, aber was soll sie machen?
Günther Robert Clausdorff sitzt keine zwei Meter von ihr entfernt auf der anderen Tischseite. Der Mann, der in zwei Wochen zum nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden könnte. Clausdorff, 53 Jahre, Spitzenkandidat der Sozialisten. Ein Menschenfänger. Seine Umfragewerte sehen glänzend aus, sodass die politischen Gegner nicht zu Unrecht immer nervöser werden.
Clausdorffs Team plant seinen Wahlkampf generalstabsmäßig. Der nächste Frontalangriff auf die Konservativen steht an. Im Endspurt soll eine groß angelegte Steuergerechtigkeits-Kampagne gestartet werden. Der Kern der Botschaft lautet: kein Steuerabkommen mit der Schweiz, dafür harte Strafen für Steuerhinterzieher. Vor allem die dicken Fische, also die Reichen, sind im Visier der Sozialisten.
Clausdorff hat die vielen einfachen Menschen im Blick, sie sollen in knapp zwei Wochen ihr Kreuz hinter seinem Namen machen. Ab morgen werden in ganz Deutschland Anzeigen in Zeitungen geschaltet und Werbespots im Fernsehen gesendet.
»Dicke Fische im Visier!« Gutes Zitat denkt Kathi und kritzelt es zwischen ihre Beine. Der Kollege der Berliner Allgemeinen Zeitung bemüht sich wegzuschauen.
Kathi spürt wie ihr Gesicht rot anläuft und versucht die Situation mit Frechheit zu überspielen.»Ich kann nicht anders«, flüstert sie ihm zu. Ihr Sitznachbar tut, als habe er nichts gehört.
Wie passe ich eigentlich in diese Runde? Wie sind die auf mich gekommen?, fragt sich Kathi. Sie war schon überrascht gewesen, als sie den Anruf von Clausdorffs Pressesprecherin Ilka Zastrow bekommen hatte. »Das ist eine persönliche Einladung, nur für Sie, Frau Kuschel. Und ich darf Sie noch einmal an die Spielregeln erinnern.«
»Schon klar, niemals von und über solche Hintergrundgespräche reden, ich bin lang genug dabei, Frau Zastrow«, war ihr Kathi beleidigt ins Wort gefallen und hatte aufgelegt.
Jetzt war es also so weit. Ab sofort zählte sie dazu. Kathi Kuschel, 39 Jahre alt, Politik-Redakteurin beim Landessender. Sie kennt Günther Robert Clausdorff schon lange. Sie verfolgt seine Karriere seit Mitte der 90er, als er auf einmal bei den Sozialisten auftauchte. Jetzt macht Clausdorffs Kanzler-Kandidatur Kathi zur gefragten Journalistin. Letzte Woche hatte sie ein Porträt in den Hauptnachrichten untergebracht. Wahrscheinlich bin ich deshalb für Clausdorffs Wahlkampfteam interessant, analysiert sie. Gleichzeitig schmeichelt ihr die Einladung in den exklusiven Kreis. Kathi Kuschel auf dem Weg nach oben, in die erste Liga des Politikjournalismus!
Auf der anderen Seite fühlt sich Kathi etwas beklommen. Diese ganze Heimlichtuerei. Clausdorff ist durch den Hintereingang gekommen, mitten durch die Restaurantküche, vorbei an den italienischen Pizzabäckern, die in Wahrheit alle aus Albanien stammen und trotzdem jeden Gast mit einem herzlichen »buongiorno« begrüßen. Offenbar will Clausdorff bei solchen Terminen nicht gesehen werden. Für das Hintergrundgespräch wurde strenge Vertraulichkeit vereinbart. »Alles unter drei!«, hatte Ilka Zastrow, die blonde und knapp zehn Jahre ältere Ausgabe der »Eurovisions-Lena« gleich zu Beginn klargestellt. »Nichts von dem, was gesagt wird, darf diesen Raum verlassen!«
Kathi hasst solche Spielchen. Was hat das mit der Freiheit der Presse zu tun? Während eines anderen Hintergrundgesprächs mit einer Ministerin hatte Kathi einmal diese »Zensurmethoden« kritisiert, worauf ihr freigestellt worden war, den Raum zu verlassen. Seitdem spielt sie das Spiel mit, aber nach wie vor fühlt sie sich dabei beschissen. Die Absprachen machen sie zu einer gefühlten Komplizin, aber irgendwann nutzt ihr die Information, die sie nur bei solchen Gesprächen bekommt, dann eben doch; das hat sich immer mal wieder gezeigt.
Kathi fasst wieder in ihren tiefen Rockschlitz. »Harte Strafen für steuerflüchtige Millionäre«, das Zitat bedeutet einen Frontalangriff auf den konservativen Finanzminister, der gerade einen neuen Anlauf für ein Steuerabkommen mit der Schweiz unternimmt.
»Herr Clausdorff, man darf ja träumen«, fällt sie ihm unvermittelt ins Wort, »wie wollen Sie denn an die dicken Fische unter den Steuersündern herankommen? Und was, wenn Finanzminister Leiple noch vor der Wahl Nägel mit Köpfen macht und ein unterschriftsreifes Steuerabkommen mit der Schweiz aushandelt?«
»Liebe Frau Kuschel, der Leiple bekommt das ohne unsere Zustimmung im Bundesrat nicht durch.« Clausdorff schaut kurz zu seiner Pressesprecherin und spricht dann weiter. »Eigentlich sollte jetzt auch Rainer hier sein, Rainer Jungschmidt. Irgendetwas muss ihm dazwischen gekommen sein, aber so viel kann ich schon jetzt sagen: Wenn ich Kanzler werde, dann wird Jungschmidt als neuer Finanzminister jede Steuer-CD aus der Schweiz kaufen, die uns, auf welchem Weg auch immer, angeboten wird.«
»Unbedingt recherchieren«, notiert sie auf ihren Block. Seit Monaten streiten die Parteien über das Thema. Der Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen hatte vor kurzem eine CD gekauft. Seine Steuerfahnder waren daraufhin auf fast 3.000 Namen und Kontodaten gestoßen. Viele Steuerhinterzieher hatten sich nach der Bekanntgabe des Kaufs selbst angezeigt, weil das die Strafe verringern kann. Andere wurden medienwirksam vor laufenden Kameras verhaftet und aus ihren Villen abgeführt.
Der Ertrag in Euro für den Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen war trotz der spektakulären Aktion überschaubar gewesen, außerdem gab und gibt es immer noch viele rechtliche Bedenken gegen den Ankauf von solchen CDs. Das sei nichts anderes als Hehlerware, schimpfen die politischen Gegner, die vermutlich genügend Klienten in ihren Reihen haben, die selbst alle ein Nummernkonto im Alpenstaat besitzen, vermutet Kathi.
»Das ist unsere Chance!« Zum ersten Mal meldet sich Holger Frey zu Wort. »Wir grillen die Großen!« Frey ist der Einzige im Raum, der bisher noch nichts gesagt hat. »Wenn wir an der Regierung sind, dann wird es keine Rettung mehr über Selbstanzeigen geben. Rainer Jungschmidt ist an der Sache dran, er führt Gespräche mit Insidern. Schade, dass er nicht hier ist, wir sollten das Treffen mit ihm dringend nachholen. Aber eins ist klar: Wer Steuern hinterzieht, der steht nach unserem Sieg quasi jetzt schon mit einem Bein im Knast. Was meinen Sie«, strahlt er siegesgewiss, »wie das bei den einfachen Leuten ankommen wird? Unsere Wähler sind klassischerweise die, die immer brav ihre Steuern gezahlt haben, und jetzt werden sie endlich erleben dürfen, wie die Betrüger zur Rechenschaft gezogen werden.«
Holger Frey ist kein Politiker für die erste Reihe, er gilt als stiller Beobachter und Strippenzieher im Hintergrund. Er ist Clausdorffs engster Vertrauter und guter Freund. Die beiden wurden zusammen in verschiedenen Zeitungsartikeln als kongeniales Duo beschrieben. Auf der einen Seite Clausdorff, der Hände-Schüttler und Kumpeltyp, einer, der den Menschen das Gefühl geben kann, zuzuhören, selbst wenn ihre Probleme noch so absurd oder unwichtig klingen. Er hat die nötige Geduld und die passenden Gesten. Sein Kopf nickt fast zu jedem Satz seines Gegenübers, kaum merklich, aber für den Gesprächspartner doch spürbar.
Kathi war sich lange sicher gewesen, dass Clausdorff dabei nur eine Rolle spielt, um besser bei seinen potenziellen Wählern anzukommen. Inzwischen hat sie ihre Einschätzung geändert. Kein Mensch kann sich so lange verstellen. Und Clausdorff zieht inzwischen schon über sieben Jahre als Landesminister durch die Städte und Dörfer. Irgendwann ist seine Partei auf diesen Menschenfängertyp aus der Provinz aufmerksam geworden. Jetzt ist er ihr Spitzenkandidat.
Auf der anderen Seite Holger Frey. Er hätte nie im Leben die Chance, eine Wahl zu gewinnen. Er ist keiner, dem die Menschen zujubeln. Keiner, der die Massen mitreißen und für seine Ideen begeistern kann. Frey weiß das, und das wiederum ist seine größte Stärke. Er schätzt die Lage immer realistisch ein. Frey, der Stratege! So hat er sich selbst erfunden und steht jetzt an Clausdorffs Seite im Fahrstuhl nach oben, direkt in die Machtzentrale der Republik. Er gilt als designierter Kanzleramtsminister.
Frey und Clausdorff kennen sich seit der Wende. Damals kreuzten sich ihre Wege, danach sind sie meistens zusammen gegangen. Clausdorff im Rampenlicht, Frey immer dicht dahinter und trotzdem kaum zu sehen. Zusammen haben sie bei einem guten Glas Rotwein so manchen Plan ausgeheckt und auch so manchen Coup gelandet, zum Beispiel Clausdorffs Nominierung zum Spitzenkandidaten der Sozialisten für die Bundestagswahl. Was jetzt nur noch fehlt, ist der letzte kleine Schritt – zum Wahlsieger und somit zum Bundeskanzler.
Der Journalist der Berliner Allgemeinen Zeitung meldet sich zu Wort: »Ein Steuerabkommen mit der Schweiz würde Ihrem zukünftigen Finanzminister aber sofort ein paar Milliarden in die Kassen spülen, mehr als Ihre kleinen Detektivspielchen erbringen, das ist erwiesen …«
»… das ist erwiesener Quatsch«, unterbricht ihn Clausdorff scharf und wirkt dabei trotzdem höflich. »Sie sollten nicht unbedingt glauben was der zukünftige Herr Ex-Finanzminister von sich gibt. Rainer Jungschmidt wird Ihnen unsere Zahlen nachliefern, er hat sich bei den zuständigen Finanzbehörden kundig gemacht und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis.« Clausdorff will weiter ausholen, gerät aber plötzlich ins Stocken. Seit einer gefühlten Ewigkeit brummt ein Handy im Vibrationsmodus irgendwo im Raum vor sich hin.
Kathi greift erschrocken zu ihrer Tasche und wühlt in den unendlichen Tiefen ihrer nagelneuen Luxus-Errungenschaft. Es dauert ungefähr noch einmal so lange, bis sie ihr Smartphone in der Hand hält und den Anruf wegdrücken kann. Die Redaktion! Was für Idioten. Sie hatte ganz klar gesagt, dass sie heute Abend nicht mehr erreichbar sein wird. Was gibt es da bitte nicht zu verstehen?
Das Handybrummen hat Clausdorff aus dem Konzept gebracht. Er stockt, sammelt sich aber schnell wieder. »Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber Rainer Jungschmidt ist da an einer ganz großen Sache dran. Das wird ein Knaller, den wir uns aber für die letzte Woche vor der Wahl aufheben werden.«
Er hat seinen Faden wieder gefunden. »Sozusagen ein Weckruf für alle unentschlossenen Wähler. Kann man das so sagen, Holger?«
Holger Frey zuckt mit den Schultern. Er hat ohnehin schon mehr gesagt, als er eigentlich wollte, und gerade fängt Kathis Handy schon wieder an zu vibrieren. Clausdorff schaut sie inzwischen etwas genervt an, lächelt aber trotzdem.
»’tschuldigung«, murmelt Kathi verlegen.
In diesem Moment gibt auch Freys Handy einen lauten Signalton. Kathi beobachtet, wie er seine Nachricht liest. Frey wirkt wie elektrisiert und reicht das Handy irritiert an Clausdorff weiter. Der wiederum wird mit einem Schlag käsebleich. Sekunden später ist Pressesprecherin Ilka Zastrow an der Reihe. Auch bei ihr kippt die Stimmung von einer Sekunde auf die andere.
»Darf man fragen, was los ist?«, quatscht der Kollege von der Boulevard Zeitung in die plötzliche Stille.
»Wir müssen uns entschuldigen, wir müssen dringend los«, antwortet Clausdorff unvermittelt ungehalten.
Ilka Zastrow und Holger Frey sind schon aufgestanden. Zastrow bedankt sich mit wenigen Worten bei allen für ihr Kommen, dann ist sie weg und eilt ihrem Chef hinterher.
»Abrupter Abgang, man könnte auch sagen überstürzt, wahrscheinlich hat Clausdorff gerade die Steuerfahnder im Haus«, lacht ein weiterer Zeitungskollege.
Kathis Handy beginnt wieder zu vibrieren. Sie holt es erneut aus ihrer Tasche und will rangehen. Diesmal aber ist es eine SMS von ihrer Chefin: RAINER JUNGSCHMIDT WURDE TOT AUFGEFUNDEN. IM KLEINEN WANNSEE. UNTER EINEM KANU. NACKT! MELDE DICH SOFORT!
Dienstag, 22. November
Deggenhausertal, im Morgengrauen
Die Nacht ist sternenklar und saukalt. Lebrecht Fritz stiefelt über den Jahrhunderte alten elterlichen Bauernhof vom Wohnhaus zu den Stallungen. Seit seine Mutter sich kaum mehr bewegen kann, muss er sich um die letzten verbliebenen Tiere des ehemaligen stattlichen landwirtschaftlichen Gehöfts kümmern. Glücklicherweise sind die meisten Viecher längst weg. Lebrechts Vater hatte die Milchkühe mitsamt amtlichem Kontingent zu seinen Lebzeiten verkauft. Nur Bruno, der alte Geißbock, und einige Hühner sowie seit Neuestem auch noch ein Entenpaar meckern, scharren und schnattern in den Verschlägen.
Bruno kann den Morgen kaum erwarten. Er ist schon aus seinem Stadel getrabt und steht, als würde er auf Fritz warten, mitten auf dem Hof. Aus seinem Maul über dem inzwischen grauen Ziegenbart quellen stoßweise helle Nebelschwaden. Kaum hat der Geißbock Fritz gesehen, erklingen seine Hufe auf dem alten Kopfsteinpflaster des Hofs. Als würde der alte Bock tanzen, springt er Fritz entgegen.
Fritz schenkt ihm ein Lächeln, streckt dem alten Zausel seine Hand entgegen und tätschelt freundschaftlich sein noch immer weißes Fell. Fast liebevoll flüstert er dem Tier in sein abstehendes rechtes Ohr: »Bruno, deine Tage sind gezählt! Elfriede kann sich nicht mehr um dich kümmern und ich will nicht.«
Fritz gibt dem ehemals äußerst fleißigen und fruchtbaren Geißbock einen aufmunternden Klapps auf den Hinterschinken und treibt ihn zurück in den Stall. Aus einem Sack angelt er ein paar alte harte Scheiben Brot, bröselt es, mischt es mit Stroh und Heu und gibt einen Eimer grüne Blätter mit Rinde und Reisig hinzu.
Bruno steht dabei. Er beäugt Fritz. Dieser fragt sich, ob der Bock ihn nicht gerade hinterhältig mustert. Dabei geht das Tier unvermittelt zwei kleine Schritte zurück, um plötzlich mit aller Kraft nach vorne auf Fritz zuzuschießen.
Schnell reißt Fritz seine Hände vor seinen Körper, macht instinktiv wie ein Boxer eine Abwehrhaltung und lässt die Wucht des Geißbocks an seinen erhobenen schützenden Handflächen abprallen. Fritz wiegt mit seinen 1,90 Metern fast 100 Kilogramm, trotzdem kann er der Wucht des alten Tieres kaum standhalten.
»Bruno, du Saubock!«, lacht er laut auf und erinnert sich an seine früheren Spiele mit dem Tier. Das ist fast 20 Jahre her, dabei hat er gelesen, dass ein Bock gar nicht so alt werden könne. Als vor zehn Jahren sein Vater starb, wollte Fritz alle Tiere vom Hof haben. Aber Elfriede versprach, sich um Bruno und die Hühner zu kümmern. Sie stand vor ihnen wie die Tierschutzbeauftragte von Peta.
Jetzt hat er ohne lange Diskussion die Stallarbeiten übernommen. In dem Zustand, in dem seine Mutter sich gerade befindet, kann er nicht anders. Also kümmert er sich ebenso gewissenhaft um die Hühner wie um seine Mutter.
Zum Schutz gegen die Füchse verschließt er den Stall jeden Abend. Morgens öffnet er ihn, verstreut ein paar Hände voll Futter, Getreide und Maiskörner. Sofort kommen die Hühner und das Entenpaar angewatschelt. Die beiden Enten versuchen es den Hennen gleichzutun. Mit ihren breiten Schnäbeln picken sie mühsam nach den Körnern. »Da lachen ja die Hühner«, schmunzelt Fritz und denkt: Wenigstens legt das Geflügel Eier. Zwei Hühnereier nimmt er aus einem Nest und ein besonders großes Entenei.
Er kocht die Eier dreieinhalb Minuten, das Entenei fünf. Das Eigelb muss noch flüssig sein. Das wachsweiche Entenei stellt er seiner Mutter aufs Tablett, die beiden anderen auf den Küchentisch. Er schenkt Kaffee in zwei große Tassen, stellt eine auf das Tablett für seine Mutter und will es in das Schlafzimmer tragen, da hört er sie im Flur hantieren.
Er geht in den Gang, sieht die zierliche alte Frau ziemlich hilflos an ihren Krücken hängen. Er greift ihr unter die Arme und hilft ihr, am Küchentisch Platz zu nehmen.
»Noch lebe ich!«, lacht sie aus ihrem alten runzligen Gesicht, »im Bett sterbet d’ Leut. Ich muss da raus!«
Früher hat sie mich an den Tisch gesetzt, heute ich sie, denkt Fritz. Verdammt. Dabei hat er gemerkt, dass seine Mutter kaum mehr etwas wiegt. Bis zu ihrer Hüftoperation stand sie noch ihren Mann bzw. ihre Frau. Mit über 80 Jahren und 70 Kilo hat sie den Haushalt geschmissen und die Tiere versorgt. Und, ja, auch die Wäsche ihres Sohnes gewaschen und gebügelt. Jetzt mag sie noch 50 Kilo wiegen, denkt Fritz, und um den Frauenmist muss ich mich kümmern, so ein Sch…
Aufmunternd sagt er: »Essen hält Leib und Seel’ zusammen.« Dann denkt er: Was für einen Unsinn man redet, und lächelt seiner Mutter hilflos zu.
Elfriede hört gar nicht hin. Sie schlägt mit einem Messer dem schneeweißen Entenei den Kopf ab und stürzt das flüssige Eigelb direkt aus der Eierschale in ihren Mund. Dabei schmatzt sie genüsslich.
»Ich muss gleich weg, nach Vaduz. Der Tote aus Kressbronn kommt wohl aus Liechtenstein. Die Liechtensteiner jedenfalls haben den Fall übernommen, und mein Chef meint, ich muss dranbleiben.«
»Wirsch’t halt Geld verdienen müssen«, nickt ihm Elfriede zu. »Ich komm hier schon allein zurecht.«
Fritz wischt die Brotkrümel über seinem Bauchansatz von seinem dunkelblauen Pulli. Riecht kurz an den Ärmeln und rümpft die Nase. Verdammt, dieser Stinkbock!
Kurz lächelt er seiner Mutter zu, was soll er ihr in diesen Zeiten auch sagen? »Dann geh ich mal«, verabschiedet er sich hilflos.
Fritz bewohnt noch immer sein ehemaliges Jugendzimmer. Das alte Bauernhaus ist zwar groß, aber bewohnbare Räume gibt es nur wenige. Mit einigen Sätzen steigt er die knarrende Treppe hinauf in seine Kammer. Dort stapelt er alle seine Pullis in einem Schrank. Da alle dunkelblau sind, muss er nicht lange überlegen und greift sich wahllos einen frisch gewaschenen. Zu blauen Jeans passt jeder blaue Pulli, darauf kann er sich verlassen.
Er steigt in seinen fast 20 Jahre alten Saab 900, ein Relikt aus besseren Zeiten. Damals hatte jeder kritische Geist, der es sich leisten konnte, einen Turbo aus Trollhättan gefahren. Das Saab-Montagewerk hatte die Fließbänder abgeschafft und menschenwürdigere Arbeitsplätze geschaffen. Von dort lieferten sie Understatementautos. Damals schon 180 PS, aber im handgeschweißten DDR-Look.
Auch heute passt der Wagen noch zu Fritz, denn auch seine Glanzzeiten sind perdu. Fritz hatte am Tag zuvor, wie sein Chef Uwe Hahne es von ihm verlangte, eine kurze Mitteilung zum Tod des nackten Surfers von Kressbronn in den Landesnachrichten abgesetzt. Bis dahin wusste man nicht, dass der junge Tote in Vaduz vermisst wurde. Nach der Sendung hatte Fritz nochmals bei der Pressestelle der Polizei in Friedrichshafen angerufen. Da hatte man ihm mitgeteilt, dass der Fall ab sofort von den Kollegen des Fürstentums auf der anderen Seite des Sees bearbeitet wird.
Hahne hatte ihn angeschissen, warum er nicht vor der Sendung nochmals bei der Polizei angerufen hatte und warum er kein Foto von dem Toten geknipst hatte.
»Nackt?«, hatte Fritz geblufft.
»Hättest ihn ja anziehen können«, hatte Hahne zurückgeblafft.
Sicher war jetzt auf jeden Fall, dass der junge Mann ein Bürger Liechtensteins war. Nähere Informationen versprach die Landespolizei Liechtenstein auf einer Pressekonferenz.
*
Keine 100 Kilometer entfernt, aber eineinhalb Stunden Fahrt bis nach Vaduz. Lebrecht Fritz muss um den halben Obersee kurven, bis er in der Hauptstadt des Fürstentums ankommt. Dabei fährt er von Friedrichshafen aus an Kressbronn vorbei, wo am Vortag der Tote gefunden wurde. Zieht ein Tagespickerl für den Pfändertunnel und fährt durch Österreich auf die schweizerische Rheintalautobahn. Der Grenzübergang in das Fürstentum Liechtenstein wird nur durch Schilder offensichtlich. Ungehinderter Grenzverkehr bietet dank dem Schengenabkommen den leibhaftigen Besuchern die gleiche Reisefreiheit, wie es das Fürstentum jeder Fremdwährung garantiert.
Die Pressekonferenz findet bei der Polizeikommandantur statt. Fritz hat sich leicht verspätet, fragt den Pförtner nach dem Raum und hastet die Treppen hoch in das Konferenzzimmer. Die PK läuft schon. Fritz öffnet die Tür etwas zu laut, platzt in den Raum. Die Journalistenkollegen schauen kurz hoch, sehen ihn, manche lächeln und widmen ihre Aufmerksamkeit wieder dem Redner an der Stirnseite des Raumes.
»Der Leichnam des Surfers zeigt typische Erfrierungsmerkmale. Ursachen des Todes sind vermutlich die klassischen Erschöpfungs- und Erfrierungserscheinungen. Wir müssen dabei die jahreszeitlichen Temperaturen berücksichtigen. Das Seewasser hatte in der Nacht zehn Grad Celsius, spätestens nach 20 Minuten Aufenthalt in dem Wasser bei diesen eisigen Temperaturen stellt sich der Erfrierungstod ein. Diese Annahmen unterstützen die ersten Ergebnisse der Pathologie unserer Kollegen der deutschen Polizei. Zu allem hin fand sich Wasser in der Lunge, sodass der junge Mann, wenn nicht erfroren, ertrunken ist. Seine Überlebenschance war gleich null.«
Daraufhin holt der Polizist tief Luft und schließt mit seiner Einschätzung zur Todesursache ab, worauf alle warten: »Weder unsere deutschen Kollegen noch wir haben bisher Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung registrieren können.« Dabei hebt er seine zu kurzen Arme in die Höhe, wobei die große Uniformjacke die Hälfte seiner Hände verdeckt, und setzt laut nach: »Noch nicht!«
Die Leiterin der PK projiziert mit einem Beamer einige Fotos von der Fundstelle des Toten an die Wand. Auf manchen Bildern ist der Leichnam auf dem Surfbrett zu sehen. Die Aufnahmen halten Distanz. Nur undeutlich ist der Nackte zu erkennen. Danach lächelt ein junger Mann von der Leinwand. »Das ist Reto Welti zu Lebzeiten«, sagt die Pressereferentin. Mehrere Porträtfotos zeigen ihn, blond gelockt, mit frechem Blick und immer mit einem Lächeln um seine Mundwinkel.
Reto Welti war Bankangestellter bei der Liechtensteiner Stiftungsbank. Sein Beruf und sein Sport waren sein Leben. Und noch mal wiederholt die Referentin: »Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung wurden nicht gefunden.«
»Noch nicht!«, wirft der Vorredner erneut ein und wiederholt laut und deutlich: »Noch nicht!«
Die Pressereferentin lächelt, nickt dem Mann zu und dankt der Landespolizei und den Kriminalbeamten für ihre bisherigen Ermittlungen und gibt das Wort an den Polizeichef weiter.
Dieser schaut sehr ernst. Zerrt an dem Knoten seines Schlips, als säße er zu eng, und tritt an das Mikrofon: »Was Sie alle an diesem ungewöhnlichen Fall am meisten interessiert: Warum war der junge Mann nackt?« Sein ernstes Gesicht verzerrt sich zu einem aufgesetzten Lächeln: »Wir wissen es nicht.«
Eine junge Journalistin meldet sich zu Wort. Sie wirkt unsicher, ihre Stimme klingt leise. Vermutlich ist es einer ihrer ersten Einsätze bei einer Pressekonferenz der Polizei. Die Fragen, die sie stellt, hätten aber auch von einem alten Fuchs kommen können. »Was ist mit der Kleidung? Woher hatte der Tote ein Surfbrett? Und wie ist er von Liechtenstein zum Bodensee gekommen? Haben Sie sein Auto bereits gefunden?«
Der Polizeichef zuckt ratlos mit den Schultern. »Alles gute Fragen, die uns auch interessieren. Ich kann sie aber derzeit nicht beantworten.«
»Noch nicht!«, ergänzt der ermittelnde Beamte für alle im Raum gut vernehmbar.
Lebrecht Fritz fläzt in der hintersten Reihe. Er erwartet von dem heutigen Morgen keine sensationellen Erkenntnisse. Er will nur die Beteiligten sehen und erleben. Er beobachtet jeden der Damen und Herren auf dem Podium genau. Die Polizisten scheinen den Fall routiniert zu behandeln. Nur in der Ecke am Ende des Podiums sitzt wie ein Fremdkörper eine junge Frau, die leer und entgeistert vor sich hin stiert. Allerdings, wann immer die Rede von dem Toten ist, schaut sie durch ihre rechteckige, strenge Metallbrille auf, dann flackern ihre Augen und sie hört angespannt zu. Sie hat einen blassen Teint, ihre brünetten Haare sind zurückgekämmt und zu einem Zopf zusammengezurrt, sie trägt ein dunkles Kostüm. Viel zu bieder für ihr Alter, denkt Fritz. Er schätzt sie auf gerade mal 30 Jahre. Trotzdem, sollte ein verwegener Prinz das verschreckte Wesen wachküssen, könnte er seine Freude haben, attestiert Fritz als sachkundiger Frauenkenner.
Die junge Frau wirkt auf dem Podium unter den Beamten des Fürstentums wie eine Fehlbesetzung. Neben ihr sitzt ein älterer Herr, ebenfalls für die Runde überaus seriös und teuer gekleidet und irgendwie zu steif in seiner Haltung. Er ergreift zum Ende der PK das Wort. »Ich bin hier in Vertretung der LieBa, unserer Liechtensteiner Stiftungsbank. Reto Welti war einer unserer jungen fähigen Mitarbeiter, ein Banker voller Hoffnungen und Zuversicht. Sein Tod ist für uns alle unfassbar. Wir hoffen, dass sich die mysteriösen Umstände möglichst bald klären. Wir werden alles uns Mögliche tun, um Ihnen, Herr Polizeichef, bei der Aufklärung des Todes unseres jungen Kollegen behilflich zu sein.«
Auch während der Vertreter der LieBa spricht, beobachtet Fritz die junge Frau auf dem Podium. Sofort nach dem Ende der Rede des Bankers geht dieser zu ihr und reicht ihr mitfühlend die Hand. Sie nickt ihm abwesend zu, lächelt wie aus einer anderen Welt und bleibt steif sitzen.
Kaum ist die PK beendet, schlendert Fritz ebenfalls zielgenau zu der jungen Frau. »Fritz«, stellt er sich vor.
Sie schaut ihn irritiert an.
»Sie kannten Herrn Welti?«
»Wer sind Sie?«, haucht sie mit zerbrechlich dünner Stimme.
»Fritz«, wiederholt Lebrecht Fritz einschmeichelnd lächelnd, »ich würde gerne mehr über Herrn Welti erfahren«, fällt er auf seine Art gleich mit der Tür ins Haus.
»Herr …?«, antwortet die blasse junge Frau verunsichert.
»Fritz, aber lassen Sie das ›Herr‹ weg, jeder sagt einfach Fritz zu mir«, klärt Lebrecht Fritz sie auf, dem sein Vorname schon immer zu peinlich ist. Nur weil sein Vater, zum Trotz gegen den Dorfpfarrer, vor langer Zeit kurzzeitig mit den Zeugen Jehovas sympathisierte, muss er sein Leben lang diesen albernen Vornamen tragen.
»Negele«, gibt die junge Frau ihren Namen preis. Dann ringt sie sich zu einem dünnen Lächeln durch: »Margit Negele.«
»So hat jeder an seinem Namen seine Last«, schmunzelt Fritz, und schiebt mit einem beabsichtigtem breiten schwäbisch nach: »Frau Nägele, in welcher Verbindung standen Sie zu Herrn Wälti?«
Sie verzieht keine Miene. »Ich bin …«, dann räuspert sie sich und korrigiert: »Ich war die Verlobte von Reto.«
»Mein Beileid«, reicht ihr Fritz mitfühlend seine Hand. Gleichzeitig freut er sich über seinen Treffer. Unbeirrt setzt er nach: »Können Sie sich einen Reim darauf machen, warum Reto nackt auf dem Surfbrett gefunden wurde? War er denn Surfer?«
Zum ersten Mal sieht Fritz ein feines Lächeln im Gesicht der jungen Frau: »Reto war leidenschaftlicher Surfer.« Dann erlischt ihr Lächeln. »Er war den ganzen Sommer über auf dem See.«
»Nackt?«, setzt Fritz nach.
Sie schaut ihn fassungslos an. »Natürlich nicht!«, antwortet sie grell.
»Wie erklären Sie sich dann …?«
»Ich war nicht dabei«, fällt Margit Negele Fritz mit kalter Stimme ins Wort, dreht sich ab, um ihn stehen zu lassen.
Fritz aber fasst sie schnell mit der linken Hand am Arm und reicht ihr mit der rechten seine Visitenkarte. »Würden Sie mir Ihre Karte geben?«
Margit Negele reißt energisch ihren Arm frei und geht, ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, zu dem Vertreter der LieBa. Bei ihm hakt sie sich ein und lässt sich von dem Banker aus dem Raum führen.
Potsdam, mittags
Kathis Gedanken kreisen in ungeordneten Bahnen. Gestern Abend gab es nur eine kurze Wortmeldung in der Spätausgabe. Für mehr hatte die Zeit nicht gereicht, außerdem war die Informationslage äußerst dünn.
Heute Morgen hat sie im Badezimmer eine gealterte, ihr fremd wirkende Frau im Spiegel gesehen. Diese wieder einigermaßen in Form zu bringen, hatte viel Zeit gekostet. Jetzt betritt sie ziemlich verspätet als Letzte das Büro der Nachrichtenchefin Tina Jagode. Alle Plätze rund um den schweren Steinplattentisch sind schon besetzt: Der Chef vom Dienst, der Regisseur, der Produktionsleiter und einige Kollegen aus der Redaktion schenken ihr einen leicht genervten Blick. Sie hatten alle nur noch auf sie gewartet. Ralf Marburg, ihr Kollege aus der Politikredaktion, steht sofort auf und überlässt ihr seinen Stuhl, um sich selbst aus dem Nachbarzimmer einen neuen zu holen.
Auf der Mitte der Tischplatte steht eine schwarze Telefonspinne, über die der Chefredakteur zugeschaltet ist. Dr. Michael Wühlbecke erklärt wichtig, dass er in München auf einer zukunftsweisenden Konferenz gebraucht werde, er aber in dieser Situation über jede Entwicklung informiert werden will. Er bittet Tina Jagode, die Sitzungsleitung zu übernehmen, die sofort zur Sache kommt: »Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ihr alle gekommen seid. Die Nachricht sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Die Agenturen melden übereinstimmend, dass es sich bei dem Toten im Kleinen Wannsee um Rainer Jungschmidt handelt. Es ist wohl tatsächlich so: Jungschmidt wurde nackt unter einem Kanu gefunden.«
Ein kurzes Raunen geht durch den Raum. Der Chef vom Dienst informiert, dass ein Kamerateam vor Ort ist. Einen gestandenen Reporter habe er aber so schnell nicht greifen können, deshalb ist der neue Praktikant mitgefahren. Er hat gerade mit ihm telefoniert. Polizei und Spurensicherung sind am Fundort. Bisher hat das Team nicht viel im Kasten, da die Polizei niemanden an die Fundstelle lasse. Der Ort ist weiträumig abgesperrt. Mit dem jungen Praktikanten aber hat man einen pfiffigen Kerl erwischt, denn er hat sich kurzerhand ein Tretboot organisiert und versucht, von der Wasserseite aus ein paar Einstellungen zu bekommen.
»Sehr gut!«, bilanziert Jagode, »die Bilder müssen so schnell wie möglich in den Sender. Wir werden sie für die Mittagsausgaben brauchen. Ralf, du fährst gleich nach der Sitzung zum Kleinen Wannsee und löst den Praktikanten ab. Der soll dann sofort zurückkommen und die gedrehten Kassetten mitbringen.«
»Was wissen wir eigentlich über die Todesursache?«, fragt Kathi ungeduldig dazwischen, »war es ein Unglück? War es Mord? Oder Selbstmord?«
»Er wäre ja nicht der Erste, der sich das Plätzchen im Kleinen Wannsee aussucht«, weiß Ralf Marburg.
»Nur weil Heinrich von Kleist sich da vor 200 Jahren die Birne weggepustet hat, ist das noch lange kein Selbstmord von Jungschmidt«, beweist auch die Chefin, dass sie ihren Kleist kennt.
»Warum aber ist Jungschmidt nackt gefunden worden? Das ist doch die Frage! Es ist saukalt da draußen. Wir haben November!«, bleibt Marburg beim Thema.
Kathi bewundert Ralf schon immer für seine zielgerichteten und scharfen Analysen, für seine zweiten Gedanken, mit denen Ralf meist schon weiter denkt, bevor andere den ersten Gedanken zu Ende gedacht haben. Die beiden sind über die Jahre ein gutes Team in der Politikredaktion geworden. Er ist der Kopf, sie der Bauch.
Weiter insistiert er: »Das gilt es jetzt als Erstes herauszufinden. Offiziell will keiner was sagen, weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft. Es wurde nur bestätigt, dass es sich bei dem Toten um Rainer Jungschmidt handelt. Und der ist nachweislich kein Dichter, sondern ein Politiker, dazu ein nicht ganz unwichtiger. Kathi«, wendet er sich an seine Kollegin, »was wissen wir eigentlich über Jungschmidt? Du kennst ihn noch am besten.«
Kathi greift zu ihrem Block. Über Jungschmidt steht nicht viel drin. Sie blättert trotzdem ein paar Seiten nach vorne und dann wieder zurück. Das bringt Zeit, um sich zu sortieren. »Also: Rainer Jungschmidt ist 58 Jahre alt. Er wurde in Bayreuth geboren. Karriere hat er erst mal bei der Gewerkschaft gemacht, Anfang der 90er Jahre ist er in die Politik gewechselt. Seit 1998 sitzt er für die Sozialisten im Bundestag. Er gilt als Fachmann für Haushalt und Finanzen und soll – oder sage ich jetzt besser sollte – Finanzminister werden, falls Clausdorff die Wahl gewinnt. Ich habe mal gehört, dass Clausdorff und Jungschmidt nicht unbedingt das beste Verhältnis hatten. Sie respektieren sich, aber sie mögen sich nicht. Aus meiner Sicht war es aber klug von Clausdorff, Jungschmidt in sein Team zu holen. Jungschmidt genießt für einen Sozialisten ungewöhnlich hohes Ansehen in Finanzfragen, sogar über die Parteigrenzen hinweg.« Kathi blättert noch einmal in ihrem Block, doch mehr fällt ihr nicht ein.
»Was ist mit seiner Frau? Hat er Kinder?«, will Tina Jagode wissen, »wo wohnen sie?«
Ralf Marburg tippt Kathi kurz auf die Schulter, ein Zeichen, dass er übernimmt, sie kann sich zurücklehnen. »Soweit ich weiß, hat Jungschmidt keine Familie. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Gerüchte, dass er schwul sei. Sein Tod ist für die Sozialisten ein schwerer Schlag. Ich weiß nicht, wer ihn ersetzen soll. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt in den letzten Wahlkampfwochen passiert. Aber ich weiß, wo er wohnt: Ich habe ihn mal vor seiner Wohnung interviewt. Er hatte sich in der Berliner Straße 307, hier in Potsdam, eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet.«
»Du bist die Schönste im ganzen Land!«, eine märchenhaft männliche Stimme, wie aus dem Nichts, ertönt. Alle Köpfe drehen sich zu Kathi, sie selbst spürt, wie sie in Zeitraffergeschwindigkeit rot anläuft. Ihr neuer Klingelton für eingehende SMS ist wohl doch keine so gute Idee gewesen. Verdammt peinlich!
Die Runde lacht laut.
»Liebste Kathi, das wissen wir doch alle, das braucht uns dein Handy doch wirklich nicht sagen, obwohl du heute, ehrlich gesagt, etwas ausgelutscht aussiehst«, frotzelt der Produktionsleiter, »du bist die schönste politische Redakteurin der Runde! – Wenn auch die Einzige!«
Erneut lachen die Kollegen.
»Kinder, Schluss jetzt«, unterbricht die Chefin, »wir haben zu tun.«
Kathi reißt sich zusammen, verzichtet auf unnütze Erklärungen und liest trotzig ihre eben erhaltene Nachricht vor:
ACHTUNG EINLADUNG ZUR KURZFRISTIGEN PRESSEKONFERENZ. 17 UHR. PARTEIZENTRALE BERLIN MITTE.
DIE SOZIALISTEN
»Das übernimmt Kathi«, entscheidet Jagode schnell, »bis dahin dürfte Ralf auch alle Bilder am Kleinen Wannsee im Kasten haben, dann kannst du sein Kamerateam übernehmen.«
Die Telefonspinne beginnt laut zu rascheln, der Chefredakteur in München schaltet sich ein: »Frau Kuschel, ich fände es gut, wenn Sie heute Abend in einem Aufsager eine persönliche Einschätzung abgeben könnten. Ordnen Sie bitte in zwei, drei Sätzen den Fall aus Ihrer Sicht ein. Und eigentlich müssten Sie zusätzlich als Studiogast dem Moderator Rede und Antwort stehen. Wir haben sonst niemanden, der sich so gut mit Jungschmidt und Clausdorff auskennt.«
Kathis rechter Zeigefinger wandert zu ihrer Stirn und tippt ein paar Mal an. Wühlbecke kann das in München nicht sehen. Alle anderen am Tisch aber schon. Ganz offenbar hat Wühlbecke noch nie etwas von Kathi Kuschels legendärer Kameraphobie gehört. Jeder in der Redaktion weiß, dass Kathi eher kündigen würde, als sich vor eine laufende Fernsehkamera zu stellen. Das will sie nie wieder. Einmal ist genug. Damals war sie live zur besten Sendezeit abgestürzt, ungefähr so wie ein Fallschirmspringer, dessen Schirm sich nicht öffnet. Ein endloses, weitgehend sinnfreies Gestottere hatte sie abgeliefert. Die Kassette mit dem Mitschnitt der Sendung hatte Kathi kurz darauf aus dem Archiv verschwinden lassen, seitdem ist sie nie wieder vor eine Kamera getreten. Das ist nichts für ihre Nerven.
Dementsprechend kurz und knapp fällt auch ihre Antwort auf Wühlbeckes Vorschlag aus. »Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt Herr Dr. Wühlbecke? Wir konnten Sie hier alle nicht verstehen? Hallo? Entschuldigung!«, ruft sie unvermittelt laut in das Mikrofon »die Verbindung ist plötzlich schlecht. Hallo? Ich leg mal auf«, dabei drückt sie einfach auf den Ausschaltknopf der Telefonspinne.
Tina Jagode schaut entsetzt und will gerade zu einer ganz grundsätzlichen Standpauke über den korrekten Umgang mit Vorgesetzten ansetzen, besinnt sich dann aber doch eines Besseren. An so einem Tag wie heute kann sie es sich mit ihrer wichtigsten Reporterin nicht verscherzen.
Vaduz, nachmittags
Fritz hat sich nach der Pressekonferenz noch kurz mit Kollegen unterhalten. Doch keiner der Journalisten konnte Erhellendes zu dem mysteriösen Fall beitragen. Selbst der Redakteur vor Ort, Reporter des Liechtensteiner Vaterland, wusste über Reto Welti nichts zu berichten. »Aber wenn der Tote bei de LieBa gsi isch, deno isch’er utadlig«, attestierte er mit Insidermiene und einer nicht zu überhörenden Hochachtung, »d’ LieBa isch solid, do sind älli Mitarbeiter tipptopp.«