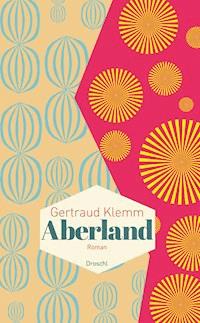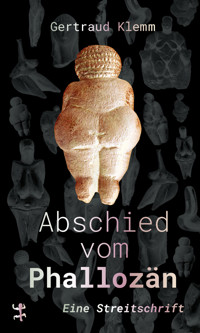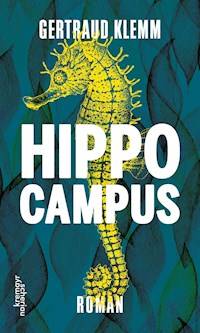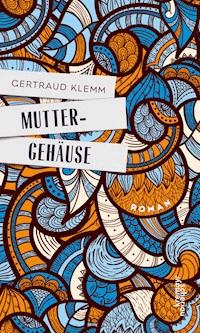Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gertraud Klemm durchleuchtet scharfzüngig und bitterböse, aber auch humorvoll unsere heutigen Zustände. Kein Blatt nimmt sie vor den Mund, wenn sie die verschiedensten Lebensentwürfe von den Nachkriegskindern bis zur Generation Z aus ganz unterschiedlichen Milieus schonungslos auseinandernimmt. Wie kann man in einer von Regeln und Normen durchdrungenen Welt frei leben? Vor nicht weniger als dieser Frage steht die fast 30-jährige Annika, die sämtliche beruflichen und privaten Erwartungshaltungen von sich fernhält. Sie hat ihren sicheren Job geschmissen und lehnt sich mehr kellnernd als studierend nonchalant gegen die unsägliche Erbsenzählerei auf. Karriere, Ehe, Kinder, Eigenheim – das sind für sie belanglose Statussymbole, die andere von der Soll- zur Haben-Seite aufsummieren. Immer wieder durchbricht Annika die Schranken der neoliberalen Leistungs- und traditionellen Wertegesellschaft und entzieht sich den vorgegebenen Lebensentwürfen. Aber wie lassen sich Ideal und Wirklichkeit miteinander vereinbaren, wenn die Gefühlswelt zu ihrem fast doppelt so alten Partner Alfred durcheinandergerät oder sie die »Stieftussi« für dessen 13-jährigen Sohn Elias spielen und Verantwortung übernehmen muss? Ein Roman über die Ökonomie von Liebe und Sexualität, über die Fallstricke der Freiheit und die Kunst, keine Entscheidungen zu treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Literaturverlag Droschl Graz – Wien 2017Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien
Umschlag: & Co www.und-co.at Satz: AD
ISBN 978-3-99059-008-9
Literaturverlag Droschl Stenggstraße 33 A-8043 Graz
www.droschl.com
Gertraud Klemm
Erbsenzählen
Roman
Literaturverlag Droschl
»There is a princess in all our heads: she must be destroyed.«– Laurie Penny Unspeakable Things: Sex, Lies and Revolution
1
Vor der Garderobentür schlagartig Turnsaalgeruch, nicht überraschend, aber in dieser Heftigkeit dann doch, ein Bubengeruch, noch nicht beißend, aber schon eine Spur Raubtier. Das müssen die einschießenden Hormone sein, die Gummisohlen ihrer Schuhe und ihr Milchbubenatem. Sie stehen dicht und wackelnd auf einem Bein, draußen verstopfen sie den Zugang zur Kabine, reden dabei miteinander, ich stehe knapp hinter Elias, warte darauf, ob er sich durchsetzt und vorbeiquetscht.
Lass ihn am besten in Ruhe, lass ihn erwachsen werden, hat Alfred gesagt, alles Übrige ergibt sich schon. Elias entscheidet sich für einen Spind, und ich ziehe mich diskret auf den Gang zurück.
Alfred hat den Literaturkritiker zu Besuch, es sei etwas Wichtiges, sagte er, aber auch das Turnier sei wichtig. Elias hatte keinen Einwand, dass ich anstatt Alfred oder Valerie mitkomme, aber einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck hatte er schon für uns. Er könne das alleine, sagte Alfred, eigentlich könne er alles alleine, was nicht die Eltern für ihn erledigen, aber das ist nicht sehr viel, fürchte ich. Was hat er denn davon, wenn die Stieftussi dasitzt und zusieht, Stieftussi, so sagt er zu mir, wenn ich scheinbar außer Hörweite bin, ich habe es ihn letzte Woche zischen gehört, im Vorraum, zu Alfred, aber es tat gar nicht richtig weh. Man muss ihn nicht mögen, um ihn zu verstehen.
Jedes Kaff hat seinen Fußballplatz, so klein kann es gar nicht sein. Eine Kirche, ein Kriegerdenkmal, einen Fußballplatz, das ist die Grundausstattung, alles andere, Arzt, Bäcker, Feuerwehr, ist Luxus. Kirche am Sonntag, das muss nicht unbedingt sein, Fußball am Samstag schon eher. Den Kindern zuschauen, das ist wichtig. Überwiegend Väter da, mit wenigen Ausnahmen, eine der wenigen Ausnahmen hat Permanent Make-up auf den Augenlidern, angeblich wird das tätowiert. Man müsste mich narkotisieren. Manche stehen schon unter dem Vordach der Kantine, manche verschwinden in der Kantine, manche richten es sich im Zuschauerbereich auf den Plastikstühlen und Bänken ohne Lehne gemütlich ein. Nur wenige gehen noch mit zu den Kabinen. In der Früh herbstelt es schon voll, sagt die mit den tätowierten Augenlidern zu niemand Bestimmtem, während sie sich tiefer in ihre winterlich aussehende Jacke verkriecht. Spricht sie mit mir? Ich flüchte zum Spielfeldrand und sehe auf die Uhr.
Die Väter beim Fußball, die Mütter bei allen anderen Veranstaltungen, so viel habe ich in den letzten eineinhalb Jahren beobachten können, bei den wenigen Events, bei denen ich Elias’ Mutter ausnahmsweise, wie Alfred gerne sagt, vertreten durfte. Ausnahmsweise auf dem Fußballplatz beim Match zusehen, ausnahmsweise vom Training abholen, ausnahmsweise zu einem Freund bringen. Elias’ Mutter ist sehr bemüht, die Ausnahme nie zur Regel werden zu lassen, und dabei so freundlich: Sag doch Valerie zu mir, wenn wir uns schon die Familie teilen, sollten wir keine unnötige Distanz aufbauen.
Eine dunkelgraue Wolkenbank schiebt sich über den frühherbstlichen Fußballplatz. Sie sieht nach Hagel aus, nach nahem Winter, nach einem eiskalten Regenguss und durchnässten vorpubertären Buben, nach einer Nebenhöhleneiterung, die ich Elias eingebrockt habe, weil ich meinen Stiefmutterpflichten nicht nachgekommen bin und kontrolliert habe, ob er die Vereinsregenjacke mitgenommen hat. Ob sie noch im Alfa liegt? Ich gehe meiner Verantwortung nach, zum Auto, tatsächlich, die Regenjacke auf der Rückbank, ich nehme sie, trage sie in das Nebengebäude und bleibe vor dem Umkleideraum stehen, an die Wand gelehnt, so wie zwei Väter. Wenn er aus der Kabine kommt, werde ich sie ihm mit einem schwesterlichen Augenzwinkern unterjubeln, darauf bedacht, keinen Funken Bevormundung aufkommen zu lassen. Die Tür zur Kabine ist angelehnt, man hört die Buben lachen und cool reden. Ich stelle mir vor, wie Elias seine Sachen in den Spind stopft, die Hose verdreht und das T-Shirt auch, so wie zu Hause, wahrscheinlich die dreckigen Schuhe oben auf. Diese Sache mit der Wäsche, warum stört mich das so an ihm, muss ich seine Wäsche waschen und bügeln? Nein, das macht Valerie, warum also unbeliebt machen und es ansprechen, es überhaupt andenken. In ein paar Stunden ist er wieder bei Mama, und in ein paar Jahren ist er ganz aus dem Haus, und Alfred und ich haben einander und endlich Ruhe. Theoretisch. Wenn ich mir das so überlege, ist das die Schokoladenseite des Elternseins, die Spitze der Bedürfniserfüllungspyramide, ganz unten das Gebären und die Windeln, darüber gleich das ständige Putzen, das Kochen, die Wäsche, das Einkaufen, so klettert man jahrelang hinauf, Hausaufgaben, Lernen, Trösten, und ich darf auf der Spitze der Pyramide sitzen und die schöne Aussicht auf ein U14 Match genießen und die gute Luft, alles völlig unverdient! Andere würden sich darum reißen.
Hier kann ich sitzen und passiv meine Patchworkpflichten abdienen, ich kann mir diese völlig absurde Fußballwelt einmal hautnah ansehen, es ist wie eine Exkursion an einen Ort, den man nicht mögen muss, um ihn, für einen kurzen Zeitraum zumindest, spannend zu finden. So wie eine Kläranlage. Eine Kläranlage ist kein Ort der Erbauung, aber wichtig, sie muss funktionieren, so wie diese Fußballnachmittage mit den Kindern funktionieren müssen. Ohne Kläranlage und ohne Fußballkinderwelt gibt es keine funktionierende Gesellschaft, zumindest nicht für Alfred und mich.
Wenigstens müssen Elias und ich einander keine Stief-Liebe vortäuschen. Ich nehme mein Handy heraus und tippe ein bisschen darauf herum, lösche mechanisch SMS und alte Fotos. So sieht das also aus, das harmonische Familienleben. Der Vater zu Hause in einen Dialog über Knausgård vertieft, Mutter in Venedig, Sohn und Stieftussi am Sportplatz. Valerie ist dort auf einem Kongress, sie hält sogar einen Vortrag, irgendwas mit Gender. Endlich wieder eine gute Auftragslage, endlich wieder voll im Stress, hat sie erleichtert geseufzt, als sie schwungvoll um den Golf herumgegangen ist, um ihrem Sohn die Tasche herauszunehmen, dabei sind ihre ausgeföhnten, honigfarbenen Locken im Takt auf- und abgewippt. Elias ließ sich einen Kuss auf die Wange drücken und stand zerzaust da. Ich vergönne Valerie Venedig, das ist das Schlagobers zum Alltag, und von mir aus vergönne ich ihr ein Liebesabenteuer, das ist die Karamelsoße darauf. Darüber weiß ich aber nichts. Alfred hält sich bedeckt, um mich oder sich selbst zu schützen, oder vielleicht weiß er wirklich nichts.
Ein paar Buben kommen aus der Umkleidekabine und steuern das Klo an, ich sehe kurz, durch den geöffneten Türspalt, dass Elias noch immer nicht im Dress ist, sein nackter Oberkörper nicht mehr kindlich, mager, knabenhaft, es zeichnet sich bereits ab, dass er Alfreds leptosome Arme bekommen wird. Er reißt gerade den schön gefalteten Fußballdress achtlos aus seiner Tasche, immer dieses Zornige in seinen Bewegungen, als würde er zu jeder einzelnen Handlung in seinem kleinen Bubenleben gezwungen. Die vorbeidrängenden Spieler riechen blümchenfrisch, diese Frauen verwenden alle Weichspüler, mit dem halten sie den Knabengeruch in Schach, so wie Valerie, der ganze Familiengeruch wird unter »Regenfrisch« oder »Sommerwind« begraben. Wenn Elias am Wochenende bei uns schläft, zieht er diesen Geruch hinter sich her wie einen synthetischen Geist.
Ich hasse Fußball, ich habe Bälle immer schon gehasst. So ein Ball ist eine Waffe, wenn man kein Ballgefühl hat, das Wort Gefühl ist völlig fehl am Platz, es sollte Ballgewalt heißen. Was hat sich Mutter Natur nur dabei gedacht, dieses Ball-Gen in den Genpool zu werfen, es so sorglos den ohnehin schon Stärksten und Gröbsten zu überlassen? Wahrscheinlich war das, was man als Ballgefühl bezeichnet, einmal als Früchtegefühl vorgesehen, damit man vom Baum fallendes Obst besser fangen kann, oder es war ursprünglich als Steingefühl gedacht, denn so ein Stein soll gut in der Hand liegen, bevor man ihn einem anderen Neandertaler über den Schädel zieht. Aber vermutlich hat sich Mutter Natur gar nichts dabei gedacht, wie so oft, da war einfach ein dominantes Gen, das einen grandiosen evolutionären Vorteil gebracht hat, und das wiederum wäre eine Erklärung für die Besessenheit der Gesellschaft von dieser Ballspielerei, ihre Hysterie bei jederEM,WM, Olympiade.
Der Trainer kommt auf uns zu, verkaterter Eindruck, er trägt eine Kappe, aus der die blonden Haare hervorsprießen und über die verschwollenen Augen hängen, er nimmt die Kappe kurz ab, kratzt sich den niedergetretenen Binsengraspolster, setzt sie wieder auf, die Nase zu großporig für das Alter. Er nickt uns zu, geht in die Kabine, zieht die Tür zu, wir hören gerade noch, wie er sagt: Morgen, Teambesprechung.
Jetzt setzen sich die Eltern in Bewegung, ich stehe da mit meiner Jacke, soll ich klopfen? Ich sehe Elias vor mir, peinlich errötet, sich für mich schämend, die Stieftussi, die unnötigerweise mit der Regenjacke im Weg herumsteht. Ich lasse es gut sein und gehe hinter den anderen her, zurück auf den Platz, wir sind eine pflichtbewusste Prozession, wir verteilen uns gleichmäßig im Zuschauerbereich. Samstäglicher Präsenzdienst am Nachwuchs, damit der Nachwuchs Teamfähigkeit lernt, Zusammenhalt, so etwas lernt man nicht mehr im alltäglichen Leben, überall nur sitzender Frontalunterricht und jeder gegen jeden und dazwischen alleine vor dem Bildschirm, also: Mannschaftssport.
Ich setze mich auf die Bank, der Wind ist von einer novemberhaften Bösartigkeit, keine Spur mehr von Spätsommer, meine Jacke ist zu dünn. Warum kann man bei so einem Wetter nicht schon drinnen spielen? Wir sitzen in Blöcken, es gibt vier Mannschaften und vier unterschiedlich gut bestückte Blöcke, manche Gemeinden haben einfach bravere Eltern als andere.
Wieso können Kinder nicht Sport treiben, ohne dass ihre Eltern ihnen dabei zusehen müssen? Beim Tennis haben die Eltern auch immer zugesehen, und die Geschwister, wir saßen immer alle durcheinander, die Gegner und wir, mein Bruder Daniel in der knappen Hose auf dem Platz, nervös trippelnd, den Schläger in der Hand drehend, Vater und Mutter brav bei jedem Spiel dabei, und ich auch, mit meinem Lackköfferchen, Annika, pack deine Puppen ein, Annika, pack dein Steckspiel ein, na, was weiß denn ich, pack halt ein Buch ein oder was auch immer, jetzt frag doch nicht immer, Annika! Mutter dann doch ungeduldig, denn irgendwann war der Tank leer, der Leistungssport hat einen hohen Verbrauch, Kalorien, Zeit, viel Geduld und Ausdauer, Ausdauer, das musste man immer zweimal sagen, zur Bestätigung, das zweite Ausdauer war wichtig, denn sonst wäre es nur ein ordinäres Hobby gewesen. Und als es endlich mit dem Tennis zu Ende ging, kam das Nesthäkchen, die Klette, die als ungeplante Spätgeborene – Mutter war immerhin schon zweiundvierzig – in unserem Alltag detonierte, und ich reifte direkt vom Barbie-Alter ins große Schwestern-Alter, und von da an hing die Klette an mir, zehn Jahre lang, und wenn ich nicht mit achtzehn ausgezogen wäre, hinge sie immer noch an mir.
Der erste Kaffee in Pappbechern wird geholt, und geraucht wird immer noch, trotz der Kinder und der Vorbildfunktion, nichts hilft gegen das Rauchen, nicht einmal das Kinderhaben. Im hinteren Teil des Sportplatzes wird jetzt aufgewärmt, die zwei Mannschaften, die beginnen, laufen, springen und schießen sich in Form, die Wolke ist vorbeigezogen, ein kurzer Wärmemoment, bevor die nächste Wolke kommt. Ist das ein Klima für Sport, ist das ein Klima für einen Samstag? Es ist kein Klima für mich.
Wie oft Alfred wohl bei einem Fußballspiel dabei war? Er hat sich bis jetzt fast immer herausgewunden aus der Verpflichtung, Valerie war bislang dafür zuständig, aber Valerie hat jetzt auch etwas anderes zu tun, die Metamorphose von der Mutter zur Frau geht genauso schleichend wie die von der Frau zur Mutter, und man kann es ihr nicht verübeln, das geht jetzt wohl seit knapp dreizehn Jahren so, dass sie eigentlich für fast alles zuständig ist. Ich kann mir Alfred schlecht mit Baby-Elias vorstellen, auch wenn die Fotos in seiner Stadtwohnung bezeugen, dass er ihn gehalten hat, ihn und sich ins Bild gesetzt hat, liebevoll und mit diesem Gesichtsausdruck, der immer ein bisschen überwältigt wirkt. Valerie habe sich bald nach Elias’ Geburt von Alfred entfremdet, erzählte er, oder hat er sich von ihr entfremdet? Aus der Entfremdung wurde jedenfalls eine saubere Entwöhnung, die ohne große zwischenmenschliche Katastrophen auskommen durfte, woran Alfreds großzügige Alimente, die er vollmundig Reparationszahlungen nennt, sicherlich nicht unbeteiligt sind. Valerie und Elias jedenfalls sind fest miteinander verwachsen, aber irgendwann gehöre auch diese Nabelschnur durchtrennt, sagte Alfred, irgendwann gehöre dieses Gebrauchtwerden ausgeschlichen, und am besten geht das anscheinend, wenn so eine Betreuungspflicht von der Mutter an den Vater delegiert wird, der kann es dann an die junge Geliebte weiterdelegieren, bis der verwöhnte Fußballfratz irgendwann kein Zuschauerkomitee mehr braucht.
Alfred und der dicke Literaturkritiker saßen einander gegenüber, als ich mich heute Morgen verabschiedet habe, sie waren schon tief ineinander verkeilt, Knausgård wurde besprochen, schon wieder, leere Espressotassen, die Morgensonne streifte die Buchrücken hinter ihnen, den Staub auf dem Bücherregal, und die beiden haben die Köpfe gedreht und mich angesehen, da hat sich eine Erinnerung in mir breitgemacht, ich bin schon einmal so angesehen worden, nur – wo?
Die Kinder rennen wie verrückt herum, schon bevor das Spiel mit einem Pfiff überhaupt begonnen hat. Wie sie einander rempeln, wie sie foulen, ohne zu foulen, immer dieses Gegeneinander. Ohne Gegeneinander gibt es kein Miteinander, ohne Verlieren kein Gewinnen, ohne Krieg keinen Frieden. Völkerball mussten wir in der Schule spielen, es hätte Völkerkrieg heißen müssen, verstecken ging nicht, das Einzige, was half, war, sich möglichst früh abknallen zu lassen, am besten von einem Mädchen, die schossen die Bälle nicht so scharf, außer den zwei Barbaras, die gut werfen konnten, die zielten den Mädchen vorsätzlich auf den sprießenden Busen und den Buben in den Schritt.
Das Wort Völkerball haben die Reformpädagogen angeblich aus dem Turnunterricht-Lehrplan herauskorrigiert, so wie sie den Neger aus den Schulbüchern korrigiert haben und die Bundeshymne ganz konsequent mit Töchtern singen. Aber leider nur das Wort, sie haben es einfach umbenannt, Merkball heißt es jetzt, aber der Ball ist geblieben, und Leuten wie mir hilft so etwas auch nicht.
Jetzt der Anpfiff und gleich das erste Tor gegen Elias’ Mannschaft, zweites Tor gegen Elias’ Mannschaft und das schon in der dritten Spielminute, ich habe keine Ahnung von den Regeln, aber es sieht nicht gut aus für uns. Der Trainer beginnt auf und ab zu gehen und mit dem Kopf zu schütteln. Immer, wenn ich mich auf das Regelwerk konzentrieren will, verschwimmt das Spiel vor meinen Augen, aber da sind die Schreie der Zuschauer und die Pfiffe des Schiedsrichters, die retten mich. Jetzt fällt mir plötzlich ein, woran mich Alfred und der Literaturkritiker erinnert haben. Joschi und sein Freund Lukas in Joschis Jugendzimmer auf dem Bett, wir waren sechzehn, und Lukas war völlig entwurzelt, als ich zur Tür hineinkam, in dem Raum gab es keinen Platz für drei, so eine Dreierkonstellation in diesem Alter ist absurd. Aber Joschi versuchte, abwechselnd mit mir in Körperkontakt zu treten und mit Lukas über das 22-er Modul seiner neuen Vespa zu sprechen, bis Lukas entnervt das Feld räumte und Joschi mir in seiner Verzweiflung die Zunge noch ein bisschen tiefer in den Rachen steckte als sonst.
Wenn mein Block grölt, mache ich auch ein Geräusch, ein Raunen muss reichen, ich spüre, wie sie mich beobachten, von der Seite, 0:3, Uuuuh macht unser Block. Der Trainer beginnt, sich desillusioniert sein Gesicht zu reiben. Diese seitlichen Stielaugen, die sich so schnell zurückziehen können, wenn man dann den Kopf wendet, wer ist denn das, das ist aber nicht die Mama, die neue Jungevom Radiomoderator, oder vomOpi, der aber der Papiist.
Ein Fußballverein lebt vom Tratsch der Eltern, vom Alkohol des ersten Spritzers, bei so einem Turnier ist viel Zeit zum Schauen und Reden, wenn die anderen Mannschaften spielen und man trotzdem zusehen muss. Ich spüre die Neugier, aber auch das Verständnis. Man versteht Alfred ohne langes Nachdenken, dass er sich eine Jüngere sucht. Man versteht auch, warum sich die Junge ausgerechnet Alfred ausgesucht hat. Alfred ist der silberschläfige Kulturradio-Moderator mit der Waldhonigstimme, die man auch aus den Universum-Fernsehsendungen kennt und aus der Werbung. Diese Stimme, die einen dunkel und packend überrollt, sie kriecht einem ins Ohr und von dort weiter in den Bauch, während man hört, warum das Tölpelweibchen kein Futter finden kann, wer das Klavierkonzert dirigiert hat und dass es nur eine Versicherung gibt, die tatsächlich auf unserer Seite ist. Weil Alfred berühmt ist, ist er auch entsprechend gut vernetzt, und wie alle, die so gut vernetzt sind, muss er auch reich sein, und eine nicht mehr ganz junge Kunstgeschichtestudentin ohne große Ambitionen und ein alternder, renommierter Kulturredakteur beim Radio, das passt wie die Fliegen auf den Scheißhaufen, das habe ich unlängst in einem dieser Wirtshäuser gehört, in denen Alfred so gerne zu Mittag isst, eines dieser Gasthäuser, wo sie die Gerichte noch nach Tierarten sortieren: Vom Rind, Vom Schwein bekommen je eine eigene Kategorie, Huhn, Forelle und Pangasius hingegen müssen sich unter G’sund & G’schmackig zusammendrängen, neben den Fertig-Gemüselaibchen.
Was man sich jedoch nicht vorstellen kann, trotz langen Nachdenkens, ist erstens die Sache mit den Kindern und zweitens, dass eine Frau es in Kauf nimmt, dass sie dann übrig bleibt und noch ein paar Jahre überlebt, wenn der Radiomoderator früher stirbt. Vor allem die Frauen können das nicht verstehen, dabei sollten gerade sie es besser wissen, denn bleiben nicht so gut wie alle Frauen übrig, weil die Männer früher sterben? Und sind Kinder wirklich das einzig Wahre, das man auf gar keinen Fall versäumt haben darf? Kann es nicht auch eine Atlantiküberquerung, ein Medizinstudium, eine Everestbesteigung, der Jakobsweg, vielleicht sogar Eremitentum sein? Was ist es bei mir? Wenn ich das wüsste.
Seit dem ersten älteren Mann, dem Bildhauer, interessieren mich die jungen Männer mit ihrem biografischen Pflichtenkatalog nicht mehr. Der Bildhauer fackelte nicht lange herum, er holte sich, was er brauchte, und gab, was im Überfluss da war. Beides war nicht besonders viel. Aber es ging um nichts anderes als um ihn und mich. Und nicht um ungeborene Kinder und ungebaute Häuser und schemenhafte Karriereleitern. Dieses Tanzen und Saufen gehen, das hat aufgehört, ab Mitte zwanzig wurden alle ernst und die belanglosen Gespräche über Musik, Politik und Weltschmerz verschoben sich zugunsten der Gespräche über die Berufe und die Erfolge, über das Vorankommen, eine einzige Erbsenzählerei. Man pickt sich die schönsten und größten Erbsen heraus, Gebrauchtwagen, 50-qm-Wohnung, und vergleicht sie mit den Erbsen anderer; und natürlich gibt es immer noch schönere und noch größere Erbsen, die man haben wollen soll, Neuwagen, Investmentfonds, Eigenheim, Wochenendhaus, Urlaube und natürlich der Nachwuchs, alles wird auf Facebook gepostet und beim zehnjährigen Maturatreffen auf den Tisch gekippt.
Seit ich Mitte zwanzig bin, habe ich das Gefühl, dass die Beziehungen in meiner Umgebung zu profanen Werkzeugen des Kapitalismus verkommen sind. Vordergründig mag es um Gemeinschaft und Sex gehen, aber im Hintergrund bastelt die Gesellschaft an der nächsten Generation von Weicheiern und Versagern, die es nicht erwarten können, sich vom Erwerbsleben versklaven zu lassen. Da überkommt mich eine Müdigkeit, für die es doch viel zu früh ist, da fühle ich mich schon alt, ohne zuvor richtig erwachsen geworden zu sein. Alfred hat die Taschen schon voller Erbsen. Mit ihm muss ich mich keinem gesellschaftlichen Zwang unterwerfen, mit ihm kann ich länger jung sein, obwohl er so viel älter ist. Das ist es, was keiner versteht, warum ich mit Alfred so weiterleben kann, von einem Tag zum anderen, als Mensch ohne Arterhaltungstrieb, ohne Erbsensammeln, als Jetztling.
Elias geht natürlich nicht mit diesen Dorfgazellen, die hier vor dem lokalen Eissalon die Zeit totschlagen, in die Schule, sondern fährt schön brav am Sonntag nach dem Mittagessen nach Wien und am Montag ins Lycée, dort wird er wieder vom Landmief des Wochenendes rehabilitiert, auf Französisch und Alsergrundisch.
Wie lange dauert so ein Match? Und wie lange dauert das Turnier? Elias’ Mannschaft spielt heute gegen Mannschaften der umliegenden Gemeinden, die Gemeinden haben Namen, an die ich mich nicht gewöhnen will, es sind Namen, die nicht einmal nach Kuhmist riechen, sondern nach Bobo-Land, nach zentralen Kompostieranlagen, und in Sehweite immer das Fachmarktzentrum. Da ist so ein abstruser Biedermeier rund um die Großstadt, mit seltsamen Paarungen: Aufgeklärtheit und Erstkommunion, Sternparkett und Ackerkrume, Freigeist und gebundenes Kapital. Warum will Alfred hier freiwillig wohnen? Weiß Alfred überhaupt, wo das wirklich ist, das richtigauf dem Land?
Dreckstetten, Fertigteilhausen, Schiachenkirchen, das wären doch Namen für diese Speckgürtelgemeinden um Wien. Ich forme sie lautlos mit den Lippen und klappe dabei die Unterlippe nach unten, man muss das ganz wienerisch heraussuppen lassen, Schiachnkiachn. Alfred wäre gekränkt, gefällt er sich doch in der Rolle des Schönkirchner Wochenendschönwetterbauern. Manche Stadtmenschen ziehen ins Grüne, wenn die Kinder kommen, aber die Intellektuellen warten länger damit und ziehen nur am Wochenende ins Grüne, wenn die Zeit gekommen ist für das Erdige, das Gärtnern, das bisschen Fensterrahmen-Lackieren und Holzhacken, wenn die Hände sich nach Blasen und Schwielen sehnen, der Vollständigkeit halber. Noch einmal ein bisschen Naturmensch spielen, im Weinviertel, im Waldviertel, das wahre, warzige Segment des Lebens, das noch fehlt, das man aber nicht versäumt haben darf, solange die Bandscheiben mitspielen. Wie er immer unterstreicht, dass es der alte Bauernhof seines Großonkels mit eigenem Brunnen ist, aber der Brunnen ist nitratverseucht und das Haus nicht mehr als ein kleines Nebengebäude, das stehen geblieben ist, während der eigentliche Hof weggeschimmelt ist. Er hat sogar ein paar Zeilen Weingarten, die im Erbe enthalten waren, die bewirtschaftet ein Winzer für ihn; der darf den Löwenanteil des Ertrags behalten und Alfred bekommt fünfzig Bouteillen seines eigenen Veltliners. Wie er den Arm um mich legt, wenn wir beide auf der Bank unter dem Klofenster sitzen und seinen Veltliner und unsere Portion Abendstimmung einnehmen. Wie er das sagt: Lass uns ein bisschen Abendstimmung einnehmen. Und wie seine Fingerkuppen kaum merklich über den abgeplatzten Lack der Lehne streichen, fast als würde er das Holz an meiner Statt streicheln, den Rahmen um das Biedermeierbild: älterer Mann, junge Frau, die abgewitterte Bank, das Glas Wein und die späte Sonne. Abendstimmung einnehmen. Als wäre sie ein Medikament. Wogegen nur?
Dass er morgens vor das Haus tritt, in den niederösterreichischen Himmel blinzelt und sich theatralisch streckt, kann ich ihm noch nachsehen. Aber wenn er abends seinen Schneckenrundgang macht, die braunen und roten Nacktschnecken aufsammelt, erst auf das Kinderschäufelchen, dann in das Essiggurkenglas mit der (aus Gründen des »humanen Tods« nachgesalzenen) Essiggurkenmarinade, das er mit diesem minimalen Nicken verschraubt, als hätte er tatsächlich etwas geleistet, dann muss ich ins Haus gehen.
Tag für Tag diese kleinbürgerliche Posse. Das passt so gar nicht zu ihm. Es ist nicht die Spießbürgerlichkeit der Aktion oder die verblüffende Effektivität, nämlich die völlige Auflösung der Tiere binnen zweier Tage. Es ist das Bild vom alternden Städter mit Gurkenglas und Schäufelchen, der sich dem Irrglauben beugt, es mit der Nacktschneckenpopulation aufnehmen zu können, die von der Umgebung millionenfach nachsickert. Ich könnte es schrullig finden, originell, aber ich finde es unangemessen, dass ein erfolgreicher Radiomoderator so einen kleinkalibrigen Krieg führen muss. Um solchen Szenen zu entgehen, habe ich Felix verlassen. Habe ich mich gegen Kinder entschieden. Habe ich den Job im Spital aufgegeben und arbeite, bis mir etwas Besseres einfällt, als Kellnerin. Habe ich ein Kunstgeschichtestudium begonnen, bis mir etwas Interessanteres einfällt. Verzichte ich auf die Vorzüge einer geordneten Biografie. Das Schneckenglas bringt eine Seite von Alfred zu Tage, die fast ein bisschen faschistoid ist. Seine Liebe für die »Häuserlschnecken«, wie er sie nennt, die er dann zärtlich aufhebt und sie an den Fühlern kitzelt. Früher hat er sie mit einem Edding registriert. Daran darf ich nicht denken, wenn ich mit ihm schlafe. Wenn ich mit ihm zu Abend esse und er Essiggurken in Scheiben schneidet und dabei erzählt. Wie Elias noch klein war, und sie das Häuschen in Lainz hatten. Einen sozialistischen Wohnbau aus den 1930ern, mit Vorgarten und einem Gärtchen hinten hinaus, da gab es Weinbergschnecken, und immer saß in der Früh eine innerhalb der Lupine, obwohl Valerie eine unüberwindliche Barriere um ihre geliebte Lupine errichtet hatte, und weil er einen Verdacht hatte, dass es sich um ein und dieselbe, also eine besondere Schnecke handeln musste, hat er alle Schnecken numeriert, und tatsächlich – die akrobatische Schnecke war immer dieselbe, es war die Nr. 15, und die taufte Elias, damals noch süß und klein und noch nicht zu cool für Actionfiguren, dann Spider-Schneck. Die Schneckenseite an Alfred muss ich immer aufs Neue schnell überblättern. Aber es ist nur diese eine Seite. Ich tröste mich damit, dass andere Menschen lange blättern müssen, wenn sie nach der liebenswerten Seite ihrer Partner suchen.
Der städtische Alfred in seiner schönen Altbauwohnung im Achten ist mir jedenfalls lieber, der einfach Kaffee für sich macht und leise in sein Arbeitszimmer geht, um an seinen Beiträgen zu schreiben. Wenn ich aus dem Bett komme, sitzt er vor dem Laptop oder er ist über ein Buch oder eine Zeitung gebeugt, einen Füller in der Rechten und die Linke fährt immer wieder zwischen seine Schulterblätter und über seinen Nacken, eine Geste, die ich wahnsinnig erotisch finde. Das ist unsere Zeit, vormittags unter der Woche, nach meinen Diensten im Namenlos, wenn Elias in der Schule ist und nicht in Alfreds hellhöriger Wohnung, dann lege ich ihm die Hand auf die Schulter und er greift nach ihr, ohne sich umzudrehen, macht sich noch schnell eine Notiz und wir gehen ins Schlafzimmer. Ich weiß nicht, warum bei mir das Hirn mitlieben muss. Junge Männer haben vielleicht die beständigeren Erektionen und seltener Kreuzweh, aber sie können nur mit den Geschlechtsteilen lieben, bestenfalls mit dem Stammhirn. Alfred liebt mit dem ganzen Körper, mit dem Intellekt, mit seiner Lebenskunst, seiner Erfahrung, seiner Bibliothek, mit dem Wissen, dass er nicht ewig lebt. Von seiner Liebe kann ich so viel lernen, ohne dass es sich wie lernen anfühlt.
Alfred stapft ungeschickt im Beet herum und schneidet die dürren Sonnenhüte, obwohl man die bis in den Frühling stehen lässt, wegen der Vögel. Hier, in Schönkirchen, ist seine Kompetenz lückenhaft. Ich habe ihm nichts erzählt von Onkel Friedrich mit der schwitzigen Stoppelglatze, von der schreienden Sau, vom Geruch nach versengten Borsten, vom Darm, der grau und glänzend aus dem Bauchschlitz gestürzt war, mit diesem monumental schlatzigen Geräusch, und davon, dass ich mindestens fünf Sommer Bauernkind gewesen bin, ausmisten kann und Kühe melken und – theoretisch – ein Huhn rupfen. Es würde das Ungleichgewicht durcheinanderbringen, es würde mich in meiner landwirtschaftlichen Kompetenz erhöhen, und er würde doch nur gekränkt sein, dass ich bis zum zwölften Lebensjahr so viel mehr Blut, Scheiße und Erde an den Händen gehabt habe, als er jemals aufholen kann. Außerdem war es keine wichtige Erfahrung, es waren ein paar Sommerferien in meiner Kindheit im Mühlviertel, wenn Daniel von einem Turnier oder Trainingslager zum anderen hasten konnte, wohingegen es Annika doch am Hof beim Friedrich so gut gefiel.
Ich wusste, ich weiß immer noch, die Tenniskarriere des Bruders ist fest eingebrannt in mein Pflichtenheft, ein ewig erster Posten in der Liste ist Daniel, und das ist er immer noch, obwohl längst alles vorbei ist und die Karriere als Controller bei einer Baumarktkette gut genug. Große Geschwister sind die ersten in der Reihe, und als kleines Geschwisterchen gewöhnt man sich von Geburt an ans bedingungslose Zu-jemandem-Aufschauen, so lange bis der Nachzügler einem sogar diese unbequeme Position streitig macht und man in der Mitte zusammengequetscht wird.
Würde ich, wenn ich die Erstgeborene wäre, Alfred weniger Dilettantismus durchgehen lassen? Würde ich ihn mir, so wie große Schwestern es machen, zur Brust nehmen und ihm zeigen, wie man einen Garten richtig umsticht?
Viel lieber als zu Onkel Friedrich wäre ich zu meiner berühmten Patentante Hilda gefahren, Vaters Schwester, die Pianistin mit den Wohnungen in London, Wien und Zürich, und überall stand angeblich so ein glänzender Fazioli wie in Wien. Auf dem Foto meiner Taufe hält sie mich ein wenig unbeholfen, von mir ist nicht viel zu sehen, aber ihr Blick ist wild begeistert und ihre schwarzen Locken umrahmen uns wie ein Gnadenmantel.
Glaubst du etwa, die hat nichts Besseres zu tun, sagte meine Mutter. Im Gegensatz zu meinem Onkel Friedrich, Vaters Bruder, der den Bauernhof übernommen hatte und mich trotzdem betreute, konnte der berühmten Hilda kein Kind zugemutet werden, nicht einmal ein Patenkind, das gerne still danebengesessen wäre, bei Konzerten, beim Üben, bei den Interviews, auch schon mit acht.
Friedrich war nett, er war okay, naja, er war halt da. Jemand, der Schweine, Hühner und Kühe hat, aber keine Kinder, macht nie Urlaub und muss immer da sein, niemand kommt, um das Vieh zu versorgen, so wie Alfreds Nachbarin kommt, um das Beet zu gießen, wenn er am Sonntagabend wieder in die Großstadt zurück muss, sein Beet, das ein Witz ist.