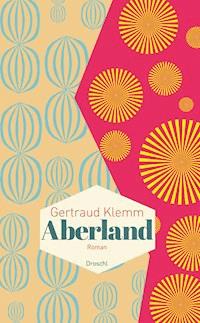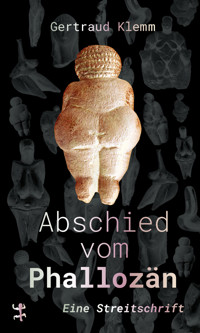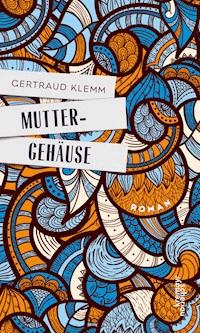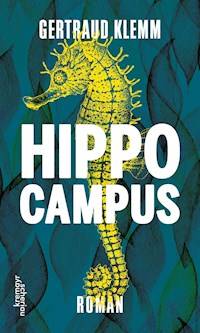
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helene Schulze, vergessene Autorin der feministischen Avantgarde, ist tot. Jetzt wird sie als Kandidatin für den Deutschen Buchpreis gehandelt. Ihre Freundin Elvira Katzenschlager soll den Nachlass sortieren und findet sich unversehens in einer Marketingmaschinerie voll Gier, Neid und Sensationsgeilheit wieder. Empört bricht sie ein großes Nachruf-Interview ab und begibt sich mit dem wesentlich jüngeren Kameramann Adrian auf einen Roadtrip durch Österreich, um die verzerrte Biografie ihrer Freundin richtigzustellen. Was als origineller Rachefeldzug beginnt, wird immer mehr zum Kreuzzug gegen Bigotterie und Sexismus. Sie verkleiden Heldenstatuen, demontieren Bildstöcke und stören Preisverleihungen. Immer atemloser, immer krimineller werden die Regelbrüche der beiden auf ihrem Weg nach Neapel, wo die letzte Aktion geplant ist. Gertraud Klemm legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Am Beispiel der Literaturbranche zeigt sie, wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen tatsächlich steht; und dass es mehr Rebellion und Mut braucht, um wirklich etwas zu verändern. "Symbole allein, das weiß sie schon, funktionieren nicht als Protest, denn Symbole tun niemandem weh; und wenn es nicht wehtut, berührt es nicht, und wenn es nicht berührt, kann man es gleich bleiben lassen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERTRAUD KLEMM
HIPPOCAMPUS
ROMAN
I saw it written and I saw it say
Pink moon is on its way
And none of you stand so tall
Pink Moon gonna get you all
Nick Drake
Inhalt
1. Adrian
2. Elvira
3. Adrian
4. Elvira
5. Adrian
6. Elvira
7. Adrian
8. Elvira
9. Adrian
10. Elvira
11. Adrian
12. Elvira
13. Adrian
14. Elvira
15. Adrian
16. Elvira
17. Adrian
18. Elvira
19. Adrian
20. Elvira
21. Adrian
22. Adrian
Appendix
1.
Adrian
Wien, Anfang August
Adrian weiß, wie man ein gutes Frühstück zubereitet, eines, das auch gegessen wird. Vorsichtig schließt er die Flügeltür zum Schlafzimmer. Körperliches Engagement kommt gut an: Orangen pressen, Saft kalt stellen, Obst und Gemüse schälen, schneiden und schön auf einem Teller anrichten. Schuhe anziehen und zum Bäcker gehen. Frauen mögen Dienstleistungen. Da manifestiert sich die Zuneigung, da wird sie greifbar.
Er überlegt, das Fahrrad zu nehmen, geht dann aber lieber zu Fuß. So oft ist er frühmorgens nicht unterwegs. Auf der Straße ist es noch ruhig. Die Luft vom Regen der Nacht nassfrisch. Endlich, nach diesen heißen Tagen. Keine Autos, die Fluchten der Straßenbahnschienen verlieren sich perspektivisch ungestört gegen Osten. Fast ärgerlich, dass er nicht nackt gehen kann an so einem Tag. Er fühlt sich wie auf einer leeren Bühne, die frisch aufgewischt ist, aber niemand sieht ihm zu, wie er sein Leben spielt. Heute spielt er das Stück: Der siegreiche Eroberer macht Frühstück. Denn heute hat er etwas zu feiern. Zu Hause schläft Katalyn in seinem Bett. Gestern Nacht hat er sie, nach so vielen Monaten, zu sich ins Bett geholt und endlich mit ihr geschlafen.
Adrian genießt die Stille, aber eigentlich sehnt er sich nach Städten, an denen es am Sonntag nicht ruhig sein muss. Städte, die nicht jedes Wochenende ins wohlverdiente Koma fallen, weil Gott, an den niemand mehr so richtig glaubt, an diesem einen Tag zu ruhen befiehlt. Wo Sonntagsmärkte aufgestellt werden und wo Schönwetter, Wochenende und Urlaub keine Lebensziele sind. Wo nicht immer der Sonntag angebetet wird, das Nicht-Arbeiten und der Sonnenschein. Irgendwie hat das Unglück der Österreicher mit dem Sonntag zu tun. Mit diesem Nine-to-five, Montag bis Freitag, und mit diesen gesetzlichen Feier- und Urlaubstagen. Von einem Feiertag wird zum nächsten gejammert, im Winter zum Frühling hingejammert, im Frühling wird der Sonnenschein herbeigesehnt, und wenn es mal im Mai heiß ist, jammern alle wegen des Klimawandels. Die Menschen vor den Fernsehern und Radios haben immer den Freitag im Blick, damit endlich Samstag und Sonntag folgen. So will er niemals werden. So wird er niemals werden. So kann er niemals werden, weil seine Arbeit keine Wochenenden und kein Schlechtwetter kennt, nur gute oder schlechte Auftragslage und Fristen. Er stellt sich beim Bäcker in die Reihe, vor ihm wird Dinkelkuchen gekauft, dann Vollkornwecken, hefefreies Brot. Er nimmt sich vor, niemals auf einen Nahrungsallergietrend aufzuspringen, wie um das zu besiegeln, kauft er zwei fettig glänzende Krapfen, Laugengebäck und drei Semmeln, alles aus Weißmehl. Und dann gibt er der Verkäuferin zwei Cent Trinkgeld, wobei er sich gleich blöd vorkommt.
Als er aus der Bäckerei tritt, scheint die Luft ein paar Grad heißer geworden zu sein. Morgen Früh muss er nach Vorarlberg. Er muss den ersten Zug nehmen, im Auto ist kein Platz für ihn. Dort sitzen schon die Tiertrainer und ihr kleiner dressierter Zoo in Transportboxen: ein Biber, eine Ratte, zwei Füchse, ein paar dressierte Krähen und Raubvögel. Oder sonst irgendetwas, damit sie auch gutes Material zusammenbringen, falls Flora und Fauna des »Naturjuwels Bodensee« sich rar machen. Naturfilmen ist die Königsdisziplin, nichts ist so anfällig für Totalversagen wie diese wilden Tiere, die sich nie ans Drehbuch halten. Deswegen muss der Regisseur immer eine Geschichte im Ärmel haben, die auch mit vierbeinigen Schauspielern, die mit Brekkies, Wurst und Hundefutter in Stellung gebracht werden, erzählt werden kann.
Und obwohl er das alles weiß und jetzt schon seit zwei Jahren dabei ist, deprimiert ihn immer mehr, wie viel Illusion erzeugt werden muss, um die Zuschauer für eine Naturdokumentation bei Laune zu halten. Vogelkinder mussten ihre Mütter verlieren, Löwenmütter ihren Kindern beim Gefressenwerden zusehen, die Elemente mussten rebellieren und der Lebenskampf toben. Erst wenn Natur mit Storytelling und Mitleidhaschen gespickt wird, ist sie so richtig essfertig für den Durchschnittstrottel vor dem Bildschirm.
Aber noch ist Sonntag und noch liegt Katalyn in seinem Bett. Adrian wird zuerst ein Frühstück für sie beide machen, und es wird sich lohnen. Katalyn ist keine, die anorektisch an einem bisschen Obst und Gemüse herumschnäbelt. So viel Erfahrung hat er mit Frauen: Salat und Obst gehen fast immer. Weißmehl und Zucker wird schon schwieriger. Und mit Frittiertem, allem voran frittiertem Schweinefleisch, kann man diese Frauengeneration garantiert verjagen. Ätherische Speisen, so nennt Adrian all die Salate und Smoothies, die er schon in Frauen verschwinden gesehen hat, und die er nie mit Sättigung in Verbindung bringen würde, es sei denn, man isst den ganzen Tag davon, wie ein Rind.
Katalyn mag am liebsten dick gebutterte Semmeln mit Auflage und Kakao. Sie mag Leberkäse, Käsekrainer, Pizza. Gegessen haben sie schon oft miteinander, meist nachts zwischen zwei Clubbesuchen. Aber Frühstück hatte er erst einmal für sie machen dürfen. Und auch nur, weil Katalyn plötzlich Fieber bekommen hatte. Sie waren unterwegs gewesen, erst in einem Club und dann an einem Würstelstand und dann in einer Bar, als sie plötzlich über Kopfschmerzen klagte. Er bot an, sie nach Hause zu begleiten, und auf dem Weg in den 17. Bezirk kamen sie durch den 15. und er hat sich ein Herz gefasst und vorgeschlagen, dass sie noch ein Bier bei ihm trinken könnten. War es nur Faulheit oder doch das Fieber, das sie mitkommen und sich in seinem Bett zusammenrollen ließ? Aber der Schlaf kam schnell und mit feinem Schnarchen, das ihn eigenartigerweise in den Schlaf wiegte und nicht störte, genauso wenig wie ihre ausladende Körperhaltung. Katalyn hatte sich nur die Jeans ausgezogen, sie lag auf dem Bauch, das linke Bein war gerade aus dem Bett herausgestanden, auf der Hinterseite der Oberschenkel ein paar vereinzelte, lange, krause Haare. In der Früh war sie wieder gesund gewesen und Adrian hatte Hoffnung geschöpft, eine Zuneigung hätte sich über Nacht aufgebaut. Aber sie räkelte sich nur wohlig, setzte sich mit nackten Beinen an den gemachten Tisch und verschlang eine Honigsemmel, eine Salamisemmel und ein weich gekochtes Ei, kommentarlos, als wäre Adrians Küchentisch ein Frühstücksbuffet. Und dann ging sie, ohne Danke zu sagen und ohne ihren Teller zum Waschbecken zu tragen. Nur einen trockenen Wangenkuss hatte sie ihm gegeben.
Diesmal würde er sie vielleicht überreden, noch den Vormittag, vielleicht auch den Nachmittag miteinander zu verbringen. Jetzt, nach dem wirklich passablen Sex, wie zumindest er fand. Mit den Rädern in die Lobau fahren, Nacktbaden und danach einen Steckerlfisch essen. Einen Sonntag, von dem er ein bisschen würde zehren können. Etwas, an dem er sich festhalten könnte, wenn er morgen im Zug saß und den Leuten beim Jausen zusehen und beim Telefonieren zuhören musste. Den Geschäftsmännern in ihren Anzügen vor ihren Laptops. Oder, schlimmer noch, den Pensionistenehepaaren.
Wenn Ehepaare miteinander altern, wachsen die Frauen über sich hinaus und über ihre Zuständigkeiten. Dann wachsen sie um die Männer herum und ersticken sie mit ihrer Fürsorglichkeit, damit sie im Alter noch jemanden haben, den sie dank günstiger Seniorentickets durch die Welt schleifen können. Frauen schicken ihre Männer zur Arbeit, zum Arzt, sie untersagen ihnen das Rauchen, sie ernähren sie mit Gemüse und Getreide und rationieren den Alkohol. Zur Belohnung für die Beschneidungen ihrer Bedürfnisse können jene Männer ein paar Jahre älter werden als die ohne Partnerin. Er sieht das bei seinen Eltern und bei den Eltern seiner Freunde und auch bei Fremden. Überall schwingt die Kontrolle der Ehefrauen mit. Diese paar Jahre zusätzliche Lebenserwartung bezahlen die Ehemänner mit Bemuttertwerden und Quasikastration. Sie müssen sich sagen lassen, wie und wo sie ihre Schuhe hinstellen, ihr Sakko aufhängen, wie oft sie Blutdruck messen müssen, und im Zug müssen sie sich Jausenbrote in Alufolie aushändigen lassen und halbe Äpfel, aus denen die Frauen vorsorglich das Kerngehäuse mit dem kleinen Taschenmesser, das sie ja immer dabeihaben, herausschneiden und mit einem Stück Küchenrolle auffangen. Nie im Leben möchte Adrian so enden wie diese pensionierten Ehepaare, nie möchte er solche kleinen Reisen machen, die immer mit einer Mahlzeit eröffnet werden. Nie möchte er alle paar Stunden essen müssen. Diese regelmäßigen Mahlzeiten sind der Anfang vom Ende. Bevor der Bauch leer wird und eine Hungerkatastrophe eintritt, bevor das Bausparkonto leer wird, immer muss oben nachgestopft werden. Das wird ihm alles nicht passieren, denn in seinem Leben ist das Essen Nebensache. Außer man holt Frühstück für Katalyn.
Das Ungute am Leben ist das Altern, denkt er, als er das Haustor aufsperrt, und das hat schon etwas mit den Frauen zu tun. Mit ihnen kommen die Kinder ins Spiel, und mit den Kindern kommt das ganze Uhrwerk ins Laufen, regelmäßiges Einkommen, regelmäßiges Essen, alles miteinander. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, wird man die Regeln nicht mehr los und das Maß auch nicht, man ist aneinandergekettet und es gibt kein Entrinnen. Das kann er bei den wenigen Freunden beobachten, die schon Kinder haben. Und bei seinen Eltern. Wie sie morgens schon voreinander davonlaufen, ein Ausweichen, das über den ganzen Tag hinweg famos choreografiert wird. Vater treibt es in die Werkstatt, auf den Tennisplatz, in die Stadt, und Mutter in den Garten, zum Einkaufen, auf den Friedhof, in die Kirche. Wie oft seine Eltern das Wort Besorgungen verwenden! Da ist die Sorge ja schon gut ins Wort und in den Tag gepackt und irgendwelche unnötigen Einkäufe noch dazu. Weil sie sich nicht trennen können und wollen, bauen sie die Trennung in ihre alltäglichen Wege ein. Dieses Trennen, das sich nach so vielen gemeinsamen Jahrzehnten so mühelos ergibt wie das Auseinanderweichen von Öl und Wasser. Lieber gleich allein bleiben. Oder so ein bisschen on-off-lieben wie mit Katalyn.
Während er zügig die vier Stockwerke hinaufgeht, fragt er sich, wie das gehen kann: Zukunft mit Frau und Kindern, aber trotzdem seine Würde bewahren. Wie kastrierte Rüden, die nicht mehr raufen und aufreiten, dafür aber umso mehr fressen wollen, so kommen ihm die meisten Jungväter vor. Ihre schnell wachsenden Bäuche sind zu groß für das coole T-Shirt vom Vorjahr, aber der Stoff dehnt sich ja eh. Manche haben schon eine Glatze und eine kleine gerötete Speckrolle im Genick, und sie halten sich verzweifelt an Fußball, Grillzange und Bier fest, der heiligen Dreifaltigkeit der Durchschnittlichkeit.
Adrian kann sich nicht vorstellen, jemals dick oder glatzig oder specknackig zu werden, dazu haben seine männlichen Vorfahren auch als alte Männer zu viele Haare behalten. Aber er kann sich vorstellen, wie all die Pflichten das freie Leben beschneiden, ja zerhacken in Arbeits- und Urlaubszeiten, Monatsfristen, Lebensereignisse, Acht-Stunden-Arbeitstage, monatliche Kreditraten, Kindergeburtstage, Weihnachten, Ostern … und einmal im Monat die aus dem Leim gegangene Frau besteigen. Da ist aber auch dieses Bild einer ungeschminkt schön aussehenden Frau, sie trägt ein rosiges Kleinkind durch einen Loft mit alten Fabrikfenstern und setzt es auf den warmen Holzfußboden ab. Jetzt fällt ihm auf, wie harmonisch ausgeleuchtet und inszeniert dieses Bild ist, dass es wohl aus einer Werbung stammen muss. Mit seinem Alltag und seinem Verdienst braucht er gar nicht darüber nachdenken. Und doch. Im Gegensatz zu Milan oder Paul will er es sich vorstellen können.
Als er die Wohnungstür aufsperrt, überlegt er, ob Katalyn noch schläft. Ob er sich nochmal zu ihr ins Bett legen soll oder nicht. Während er seinen kurzen Flur entlanggeht, fragt er sich, ob Katalyn sich vielleicht davor gerne die Zähne putzen wollen würde. Und als er die Semmeln und Krapfen auf dem Küchentisch ablegt, denkt er, dass sie sicher nicht so eine Sauberfrau ist, was ihm nur recht ist. Er fasst Mut und öffnet leise die Flügeltür zum Schlafzimmer, nur um das Bett leer vorzufinden. Ist sie auf dem Klo? Er horcht in die Stille des Sonntagmorgens hinein. Es dauert ein paar Sekunden, bis er realisiert, dass Katalyn weg ist. Einfach so. Mit hängenden Schultern steht er im Türrahmen. Er sieht noch einmal nach, ja, ihre Schuhe sind auch weg, dafür hat sie ihren Abdruck in seinem ungemachten Bett hinterlassen. Er setzt sich auf die Bettkante und weiß nicht, ob er wütend sein soll oder traurig, also wird er geil. Und wenn er an gestern Nacht denkt, noch geiler. Aber zum Masturbieren ist er zu wütend, und wenn er ehrlich ist, zu enttäuscht. Da fällt ihm Milan ein. Und er hat schon das Handy in der Hand, und als Milan rangeht, ist Adrian so erleichtert, dass es ihm fast schon unheimlich ist.
2.
Elvira
Hintermoos, Anfang August
Als Elvira, steif vom Schlaf, auf dem Weg zum Klo durch das Zwergenhaus schlurft, fällt ihr Blick durch das kleine gelbe Glasfenster der Eingangstür über den Zaun auf die Straße. Der Müll wird scheinbar heute abgeholt, denn vor jeder Haustür steht eine schwarze Mülltonne. Auf dem Land muss man ja seinen eigenen Dreck spazieren führen. Sie geht gehorsam in den Garten, rollt die Tonne aus ihrem Eck hinaus, über den Gartenweg, vor das Haus. Die Tonne fühlt sich sehr leicht an. Elvira widersteht der Versuchung, den Deckel zu öffnen und Helenes allerletzten Müll anzusehen. Stattdessen wirft sie einen Blick die Straße hinunter. Wie Wächter stehen die schwarzen eckigen Behälter ausnahmslos vor jedem Haus, dort, wo früher vielleicht die Milchkannen gestanden haben. Auf der anderen Straßenseite wurde ein Windelsack an die Mülltonne gelehnt. Ein großer, transparenter Sack, prall mit routiniert gefalteten, blauen und weißen Riesenwindeln gefüllt. Etwas weiter die Straße hinunter steht noch so ein Sack.
Sie geht schnell wieder ins Haus. In der Großstadt wird so eine Ungeheuerlichkeit diskret entsorgt. Nicht hier. Wie ein museales Freiluft-Altersheim ist dieses Dorf. Der Tod springt einem an jedem Eck in den Nacken. Leere Häuser, Todesanzeigen beim kleinen Supermarkt, Windelsäcke vor der Tür. Und Menschen unter sechzig hat sie hier so gut wie gar nicht gesehen, die rumänische Pflegerin und das eine oder andere Enkelkind mal ausgenommen. Vielleicht würde ich das auch machen, wenn ich Kinder hätte, denkt sie. Die Fürsorgearbeit für die Kinder der Kinder übernehmen. Vielleicht wäre sie auch eine dieser braven Omis, ohne die nichts geht. Die einspringen, wenn die Tochter krank ist oder auf Urlaub oder arbeiten oder geschieden. Die im Kinderdienst ist, wenn nicht gerade Altenpflegedienst ansteht. Gestern hat sie hier ein Kind gesehen, das einbeinig dastand und sich, während eine Mittsechzigerin vor ihm hockte und wohl ein Steinchen aus dem kleinen Schuh ausbeutelte, an den Haaren der Frau festhielt. Es sah ganz beiläufig den Vögeln beim Vorbeifliegen zu und verkrallte sich in einer großmütterlichen Haarsträhne. Man konnte sehen, wie die Frau litt und nichts sagte. Wie sie ihr ganzes Leben schon nichts sagte. Elvira biss sich tapfer auf die Zunge, um nicht über den Zaun hinweg die Großmutter anzupöbeln und das Kind gleich dazu.
Sie geht wieder ins Haus, wieder am Spiegel vorbei. Die Jahre haben grobe Hände gehabt. Der Tränensack unter dem rechten Auge ist groß wie eine Dörrzwetschke, nur feister. Elvira berührt die Schwellung, es ist eine nachgiebiges, trauriges Stück Fleisch. Wieso heißt es Tränensack, wenn es vom vielen Weinen nicht kleiner wird? Oder ist es nur der linke Tränensack, der leergeweint ist, und jetzt kommt der rechte dran? In Helenes Haus hängen zu viele Spiegel. Die Spiegel verfolgen Elvira, das Haus ist zu klein, als dass man ihnen ausweichen könnte.
Sie geht barfuß in den Garten, durch das taunasse Gras, es ist noch angenehm kühl, sie pflückt ein paar Melissenblätter, die sie in die Tasse mit heißem Wasser wirft, und setzt sich auf das schiefe Holzbänkchen an der Hausmauer in die Morgensonne. Sie sollte ihre Dehnungsübungen machen. Sie schließt die Augen. Nur das Geräusch einer fliegenden Hummel, das in den Ohren kitzelt. Daran könnte sie sich gewöhnen. Auch daran, dass es hier nie so richtig heiß wird im Gegensatz zur Stadt. Nicht gewöhnen kann sie sich an die Stille der Nacht, nicht an das Vogelgezeter in den frühen Morgenstunden, nicht an das Knarzen des Bodens, nicht an die kleine gelbe Laus, die jetzt in ihrem Tee aufsteigt. Sie inspiziert ihre Fußsohlen, die fast schwarzen Ballen und Fersen. Für so eine Art Dreck braucht man eine Hornhautfeile. Gibt es so etwas beim Supermarkt in Hintermoos?
Sie steht auf, streckt sich im Gehen, bleibt vor dem Gemüsebeet stehen und sieht ratlos auf die ausgewachsenen Pflanzen, riesige Stauden, von denen sie keine Ahnung hat. Auf die Löcher in den Blättern, die mehr werden, auf die gelben Blätter selbst. Sie hat nicht die geringste Ahnung, was zu tun ist. Gießen, ja. Aber wann? Täglich? Morgens oder abends? Und wie viel? Ernten? Was ist das hier, Kohlrabi? Kraut? Wann ist das reif, wann wird es bitter, holzig, ungenießbar? Sollen doch die Schnecken kommen und sich bedienen. Verdammt, Neni, ich habe nicht darum gebeten, deinen blöden Garten zu pflegen! Jetzt muss sie gleich wieder weinen. Sie wischt sich die Tränen aus den Augen. Es wäre schön, glauben zu können. Daran, dass Neni ihr zusehen kann. Etwas zuflüstern kann über die Barriere hinweg. Trost – oder zumindest Gartenexpertise. Elvira hat am ersten Tag ein bisschen Unkraut gezupft und gegossen. Gebückte Gartenarbeit, mit viel Heulen dazwischen. Erde an den Händen. Wie sie trocknet und sich die Haut spannt, die dreckigen Fingernägel. Nach einer Woche hat sie schon genug von Helenes Tod.
Nächste Woche wird diese Kulturredakteurin zu ihr kommen. Sie wollen einen Kurzbeitrag machen, mehr als ein Nachruf: ein Feature. Die Vorbereitung auf das bisschen Unsterblichkeit, das Helene scheinbar zusteht. Jetzt ist Helenes Tod noch frisch, jetzt kann man ihm noch Aufmerksamkeit abtrotzen. Vor einer Woche ist Rainers Anruf gekommen. Gleich nach der Todesnachricht die verzweifelte Bitte. Du hast sie doch am besten gekannt!, hatte er ins Telefon gejammert. Und er hätte ja keine Ahnung, was da beruflich und was privat und was in Helenes Sinne! Bitte! Neunundzwanzig Jahre verheiratet, zwei gemeinsame Kinder und keinen Tau, denkt sich Elvira. Sie hatte sich am Anfang gesträubt, aber Rainer war hartnäckig geblieben. Er war es auch, der sie hierhergebracht hat, mit dem Auto. Der sie hereingelassen und mit hilfloser Geste auf den Schreibtisch gezeigt hat.
Siehst du dieses Chaos?, hat er gesagt. Ich kann das nicht machen. Schon gar nicht im Hinblick auf das Buch.
Was für ein Buch, hat Elvira verwundert gefragt, Helene hat doch nicht mehr geschrieben! Anscheinend doch, hat Rainer zerknirscht gesagt. Es geht ja auch um den Nachlass. Du kannst so lange hier wohnen, wie du willst.
Na, herzlichen Dank. Ob das Erbe die Triebfeder seiner Sorge ist? Ob er sich etwas erhofft? Ob er weiß, wie dauerpleite Helene war? Oder will er seine Mitschuld nachträglich herausradieren aus den Briefen, den E-Mails, den Fotos?
Das letzte Mal hat sie Helene im Herbst gesehen. Es war in Wien gewesen. Elvira erinnert sich an wenig. Nur daran, froh gewesen zu sein, als sie ihre Freundin wieder zur Tür geleiten konnte. Sie erinnert sich an Helenes verbitterte Tiraden. An ihr Trinken, schon am Nachmittag, an diese Nase, die wie nachträglich an das Gesicht angewachsen aussah wie ein Baumschwamm. Ich hab uns einen Prosecco mitgebracht!, hat sie gesagt. Wenn sie von einem neuen Buch geredet hätte, könnte sich Elvira daran erinnern. Ein neues Buch war undenkbar, seit Jahren schon.
Mit dem Laptop hat sie begonnen. Es war komisch, ihn einzuschalten, das Passwort einzutippen, das auf einem gelben Post-it am Bildschirmrand klebte: seepferde. Vor zwei Wochen saß Helene noch hier, an diesem Tisch, die Fingerkuppen über die staubige Tastatur schwebend, ihr zerknautschtes Gesicht spiegelte sich im fleckigen Bildschirm. Vielleicht fiel ihr Blick nachdenklich aus diesem undichten Fenster, vielleicht ist die Fliege auf dem Fensterbrett, die jetzt im Tod die Beinchen so artig gefaltet hält, noch gegen die Scheibe geflogen, wieder und wieder. Vielleicht hat die Fliege dabei zugesehen, wie Helene zusammengebrochen ist. Wie sie vielleicht mit dem Tod gerungen hat. Das Blut, das sie auf die Waschbetonplatten erbrochen hat, wurde von jemandem weggespült, wenn auch nicht ordentlich. Elvira musste sehr genau mit dem Schlauch auf die Ritzen zwischen den kleinen Steinchen zielen, bis alles sauber war. Sie hat dann den Laptop bald wieder ausgeschaltet.
Seit fünf Tagen ist sie nun da, schläft in Helenes Bett, trinkt aus Helenes Tasse, raucht ihr Zigarettendepot leer. War das Haus immer schon so feucht und dunkel? Nur die Veranda und der Schreibtisch, der vor dem Fenster zur Veranda platziert ist, wirken bewohnt. Eine Wolldecke in Griffweite, ein voller Aschenbecher, zwei leere Kaffeetassen. Am liebsten würde Elvira auf der Veranda schlafen. Sie meidet die anderen Räume. Den größten Bogen macht sie um die Abstellkammer, in der sich Kisten mit Leergut stapeln. Nur am ersten Tag ging sie hinein und sah auf die Etiketten: Weiß- und Rotwein, Cognac, Sekt. Helene hat sich nicht mit Fusel zu Tode gesoffen, sondern hat einen gepflegten Alkoholismus betrieben. Sie hat mit Weißweinspritzern die Stimmung gehoben, mit Rotwein sanft den Schlaf angesteuert, mit Sekt andere zum Mittrinken geködert, mit Cognac die Verzweiflung in den Schlaf geschaukelt. Mehr wollte Elvira gar nicht wissen. Aber natürlich fand sie die kleinen Schnapsfläschchen, mit denen man sich schnell über eine blöde Situation retten kann: in einer Jackentasche, in der Handtasche, im Küchenschrank. Und Mariendistelpräparate zur Stärkung der Leber in der Küche. Getrunken hat sie schon immer, aber wann war aus dem Trinken Saufen geworden? Elvira stellt sich den Alkohol als Vehikel vor, mit dem Helene durch den Tag steuerte, mit dem sie untertags in eine arbeitsfähige Stimmung abheben und abends wieder im wohligen Gefühl des Zuhauseseins landen konnte. Dazwischen musste sie nur um die Hindernisse herumlenken: um Gespräche, Gedanken, Fristen, Rechnungen. Oder Einsamkeiten. Mit Vehikeln passieren eben Unfälle, mit Autos Blechschäden, mit Alkohol Leberschäden, Gefäßschäden, Ösophagusvarizen. Man hätte etwas tun sollen. Warum ist ihr das nicht aufgefallen? Oder Rainer? Oder den Kindern? Und selbst wenn? Was dann? Entzug wider Willen? Lächerlich. Anrufen? Lächerlich. Sich in den Weg stellen? Beharrlich bleiben? So nahe waren sie sich nicht gewesen. Und auch niemand anderer. Elvira hatte die Tür zur Alkoholkammer wieder zugezogen und Helenes geliebte silberne Birkenstock davor gestellt, wie zwei Wachposten. Beim Sterben hat sie die nicht getragen. Sie ist in den stickigen grünen Gartenschuhen aus Plastik gestorben, auf dem Weg zum Gemüsebeet. Ausgerechnet der Obersenatsrat hat sie entdeckt, als er unterwegs zu seinem Hochstand war. Aus seiner erhöhten Sitzposition in seinem Mercedes Geländewagen hatte er einen guten Blick über den Zaun, auf die umgekippte Helene. Er war es, der den Notarzt rief, und nach einer Ewigkeit waren zwei Samariter gekommen, die bei der Wiederbelebung eine Menge Blut aus Helene heraus-, aber das Leben nicht mehr in sie hineinpumpen konnten.
Jetzt muss Helene unter die Erde. Nicht in einen Ofen und dann in eine Urne und dann unter die Erde, wie sie es sicher lieber gehabt hätte. Wieso hat sie nicht beim Notar hinterlassen, ob sie begraben oder verbrannt werden will? Wieso hat sie nicht hinterlassen, was Nachlass ist und was nicht? Was privat und was dienstlich? Elvira weiß immer noch nicht, ob sie es tatsächlich schaffen wird, dem Begräbnis fernzubleiben. Ob sie es schaffen wird, hinzugehen. Beides scheint undenkbar. Wenigstens wird kein Geistlicher dabei sein. Das hat Rainer versprochen. Sicher hat er stattdessen einen Grabredner besorgt, irgend so einen Berufsquatscher. Elvira atmet tief ein. Sie muss in kleinen Schritten auf Helenes Tod zugehen.
Sie macht Kaffee in der Espressokanne, geht zum Briefkasten, freut sich über die Zeitung in der Post. Helenes Abo muss gekündigt werden, denkt sie, als sie zurück zum Haus geht. Wann wird Rainer das machen, oder werden das die Söhne tun? Sie sind die Erben. Sie müssen jetzt die Zeitung bezahlen.
Wie viel bringt so ein Nachlass? Sie setzt sich mit der Zeitung auf das Bänkchen auf die Veranda. Das würde sie jetzt zu Hause auch machen. Im Café Zeitungen lesen, eine nach der anderen. Danach den grauen Peter im Krankenhaus besuchen, danach über den Markt schlendern. Sie vermisst Wien. Eine tote Fliege liegt auf dem kleinen Klapptisch, der nie von Helene eingeklappt wurde. Sie wischt die Fliege in die Handfläche und geht den Steinplattenweg entlang der Hausmauer ums Eck zur Gartenhütte, wo sich eine fette Kreuzspinne ein Netz gebaut hat, und wirft die tote Fliege hinein.
Es war dieses Dorf, das Helene zuerst um den Verstand und dann zum Saufen gebracht hat. Diese Gegend. In der Stadt wäre das nicht passiert. Sie lässt sich wieder auf das Bänkchen fallen. Ein Flugzeug ist abgestürzt, eine neue islamische Terrormiliz verbreitet in Nordafrika Angst und Schrecken, ein US-Republikaner verteidigt nach einem Massaker mit vierundzwanzig toten Jugendlichen den Waffenbesitz. Manchmal hat sie das Gefühl, in einer Zeitschlaufe gefangen zu sein. Wenn man sich zurücklehnt und sich die Welt ansieht, kann man dem Unglück beim Zirkulieren zusehen. Sie blickt auf die Rotweinränder, die nicht abgewischt wurden.
Man könnte als Grabbeigabe eine Stelle aus dem »Rauhreif« lesen, damals noch mit stummem H. Man wird das nicht. Man wird sich hüten. Das Buch ist ja auch nicht wirklich revolutionär. In dem Buch leidet eine Frau in ihrem bürgerlichen Gefängnis vor sich hin, während um sie herum die kulturelle Revolution der 68er-Bewegung in einem Meer aus Blumenkränzen, Drogen und sexuellem Freigeist wogt. In dem Buch geht es darum, dass die größte Freiheit nichts hilft, wenn sie nicht für alle gilt. Wenn der Schlüssel zur Freiheit zu groß für das kleine Schloss ist, das ein kleiner Geist geschmiedet hat. Wenn der Kopf in einem engen moralischen Verlies sitzt, ist auch die dazugehörige Muschi nicht befreit, egal wie lüstern, nackig und bekifft man durch die Freiheit taumelt. Nein, »Rauhreif« gibt für ein Begräbnis nicht wirklich viel her. Auch wenn es der große Erfolg war. Man wird den üblichen faden Sermon über die Trauergemeinde kippen, mit ein paar Glitzersteinchen darin: erfolgreich, unvergesslich, eine Stimme der Generation, liebevolle Mutter, irgendetwas in der Art. Man wird Helene wieder nicht zu Wort kommen lassen, man wird der Toten noch das Maul verbieten. Es wird diese Art Abschied werden, die Elvira sich zu nehmen weigert, derentwegen sie nicht mehr auf Begräbnisse geht. Sie wird die Grabrede für mich selbst lesen müssen, es hilft nichts, ein Dokument, das ihr beim ersten Blick auf Helenes Desktop aufgefallen ist.
Zuerst wird sie noch Milch und Brot holen. Sonst wird sie nichts kaufen. Sondern endlich den Kohlrabi ernten und ihn in Butter braten und ein Glas Rotwein auf Helene trinken. Dann noch eines. Es wird vielleicht einfacher, die Grabrede beschwipst, oder noch besser, besoffen zu lesen, so besoffen, wie sie vielleicht auch geschrieben wurde. Und wenn sie sich direkt vor dem Begräbnis noch einmal betrinkt, dann kann sie den Text vielleicht lallend vortragen. Das wäre witzig. Pietätlos. Idiotisch. Hätte Helene es so gewollt? Sie müsste sie zuerst lesen. Die Grabrede für mich selbst ist sicher wehleidig und Wehleidigkeit ist unverzeihlich. Gerade posthum.
Sie geht die Straße entlang. Früher waren da sicher keine Ligusterhecken und keine Thujenmauern. Keine Ruhestandshäuschen für die betuchten Pensionisten. Keine Gärten, die tagfüllende Gartendressur in gebeugter Haltung nach sich zogen. Keine Alten, die man wickelte, fütterte und medizinisch versorgte. Keine VW Polos, die die Straße verstellten. Keine Mähroboter, die die Wiesen gehorsam surrend abweideten. Früher wurde hier Holzwirtschaft betrieben, Milchvieh gehalten, die Wiener Wasserleitung gebaut, die Ziegenherde durchs Dorf getrieben. Heute werden Greise durch die gute, frische Luft geschoben. Helene hat die Alten beobachtet. Beobachten war ihre Spezialität. Vielleicht hätte sie ein Theaterstück darüber schreiben müssen. Über die alte Frau, die man morgens und mittags guttural durch die Mauern bis in Helenes Garten schreien hört, dass man zusammenzuckt. Und den Einbeinigen mit dem debilen, festgefrorenen Grinser. Zweimal täglich kreuzen sich wohl die Wege der Greise bei der kleinen Bank unter dem Haselstrauch, weil die Pflegerinnen sich dort verabreden. Weil sie sich in ihrer Muttersprache austauschen wollen, wie sich Mütter mit Kinderwägen in ihrer Pflegerinnensprache austauschen wollen. Elvira hat in den letzten Tagen schon ein paar dieser Rollstuhlbegegnungen unweit von Helenes Häuschen beobachten können. Es sind launige Treffen, kurze Dialoge auf zwei Ebenen: greise Gesten und schwerhöriges Krächzen auf der Rollstuhlebene, Lachen und Flüstern auf der Schieberinnenebene. Elvira stellt sich vor, dass in diesen Momenten kein Platz ist für die schweren Themen, wie Krankheiten, die nicht mehr geheilt werden, Schmerzen, die nicht mehr weggehen. Helene hätte die Dialoge aufgefettet, sie hätte die Alten aufeinander losgehen lassen, wie sie die Mütter in den Szenen ihres Theaterstücks »Zahnkampf« aufeinander losgehen ließ. Mütter, die vorsorglich ihre Babys abschnallten und sie mit ihrer kleinen Rassel auf eine Decke legten, bevor sie mit den Kinderwägen aufeinander eindroschen. Helene hätte vielleicht wieder Requisiten durch den Bühnenraum fliegen lassen. Rollatoren, Krücken und volle Erwachsenenwindeln. Zugegeben, es wäre ein mühsames Theaterstück geworden, dem Publikum würde es bestimmt einen deprimierenden Kulturabend bescheren. Vielleicht wäre auch wieder jemand verletzt worden.
Sie und Helene haben sich noch im Herbst darüber unterhalten, warum der Einbeinige das Sterben heiter nimmt und die Schreierin so schwer. Dem Einbeinigen wird das Lachen schon noch vergehen. Oder doch nicht? So wie beim Gebären sind die Männer vielleicht auch beim Sterben in der Zuschauerposition, vielleicht geht sie das Kommen des Lebens genauso wenig an wie das Gehen. Bis sie mitbekommen, dass sie auch vom Tod betroffen sind, ist es schon zu spät und sie haben es hinter sich.
Helenes Trauerfeier wird von Rainer ausgerichtet, in Kaiserbad. Steht alles auf der Parte. Im selben alten Bürgerhaus, in dem die beiden ihre Söhne aufgezogen haben, bis Helene ihren Erkenntnissturz gehabt hat. Die Erkenntnis kam mit der Erbschaft der Tante, dem Häuschen in Hintermoos. Die Erbschaft markierte den Endpunkt einer Entwicklung, die sich im Verdeckten vollzogen hatte. Eine Art Metamorphose innerhalb der Mutti-Puppe. Das Mutti-Puppenstadium war damit vorbei, die Schriftstellerin durfte jetzt schlüpfen, nicht nur so halbherzig, wie es die Dreiundzwanzigjährige versucht hatte. Sondern richtig. Mit derselben fokussierten Besessenheit, mit der Genies seit Jahrhunderten arbeiten – ohne die geringste Ablenkung. Wenn sie wieder ernsthaft schreiben wollte, musste sie sich zurückziehen. Durfte sie. Das Haus stand leer und wartete auf sie. Vorerst auf Zeit, ließ sie Rainer wissen, aber an Rainer dachte sie als Letzten. Nichts ist mehr ohne dich, so wie es war, doch du lebst weiter in unseren Herzen. Wer hat diesen Spruch auf der Parte ausgesucht? Rainer, der erst so entsetzt und dann so froh war, dass seine in vielerlei Hinsicht nicht mehr funktionierende Ehefrau sich ohne große Kollateralschäden vom gemeinsamen Leben abgekoppelt hatte. An den Wochenenden komme ich wieder heim, oder du kommst zu mir. Rainer trieb zwei Jahre durch Kaiserbad wie ein fetter, vom Haken gefallener Köder durch einen Fischteich, bis Therese ihn aufspürte und zuschnappte. Die Scheidung war reine Formsache. Helene hatte ihr Häuschen, ihre kleine Pension, ihre Freiheit. Rainer hatte wieder eine Frau an seiner Seite, eine neue Verwalterin für sein Haus, seine Freizeit, seine Blutwerte.
Helene gab es zwar erst Jahrzehnte später zu, aber mit der Ehe und der Schwangerschaft war sie in eine Falle getappt. Sie hatte Depressionen nach der Geburt des ersten Kindes und mit dem zweiten Kind begann der Alkoholmissbrauch. Das Haus sei ein Gefängnis, sagte sie, der Ort eine Strafkolonie, überall nur Vorstadtfrauen mit perfekten Frisuren und bourgeoisen Lebensprinzipien. Aber in die WG zurückzuziehen, wäre nicht infrage gekommen. Nicht mit den Kindern. Wir hätten sie zurückgenommen, denkt Elvira, auch mit Kindern. Stattdessen hat sie sich ihr Gefängnis so schön eingerichtet und dekoriert, bis es wie ein Zuhause aussah. Helene hat Zwischenwände niederreißen lassen, damit Räume zu Hallen verschmelzen konnten, in denen der Kinderlärm mit seinen spitzen Synkopen auch in die letzten Winkel des Hauses vordringen konnte. Therese hat angeblich die Wände wieder eingezogen, obwohl keine Kinder mehr gekommen sind. Jetzt ist die Stille in viele Kammern unterteilt. Diesen Grind, den die erste Ehe mit sich bringt. Eine Patina aus angeschmierten Wänden, Unterhaltszahlungen, abgeschleckten Glasscheiben und einer Vergangenheit, die nicht nachgeholt werden kann. Alles kein Problem für Therese. Sie hat die Spuren ihrer Vorgängerin übermalen lassen.
Elvira wird nach dem Begräbnis in dem sauber geleckten Haus herumstehen und alle beobachten in ihren schwarzen Sommerroben, wie sie gedankenverloren über ihre Sektflöten streichen und sich nebenbei austauschen über die wunderbare Helene, die sich tief ins Höllental zurückgezogen hatte, um all das nicht mehr hören zu müssen. Über die wunderbaren Bücher und Theaterstücke von Helene, die niemand von ihnen gelesen oder gesehen hat, weil ihre Werke das Gift der alternden Krawallemanze ausdünsten. Vielleicht werden sogar Literaturkritiker da sein, oder irgendwelche Kulturfuzzis, die so ein Begräbnis als Netzwerktreffen nutzen.
Man müsste diese Windelsäcke, die immer am ersten Montag im Monat vor den Haustüren stehen, sammeln und sie der Gesellschaft zu Füßen legen wie eine kostbare Ikone der Wahrheit. Unter die Nase reiben. Diese Windelsäcke als Mahnmale, dass es uns alle treffen kann und wird. Das Altern vielleicht, der Tod sicher. Man müsste die Windelsäcke als Readymades betrachten, man dürfte sie nicht so ungenutzt verschwinden lassen, wie das in den großen Städten geschieht, so wie man auch diese Alten nicht so verschwinden lassen dürfte. Das Altern und Sterben müsste viel mehr im Weg herumstehen. Man müsste die Alten mit ihren Rollatoren Gehsteige blockieren lassen, sie in den feinen Restaurants füttern, man müsste sie in die Vorstandsetagen schieben und mit ihnen Aufzüge von Finanz- und Versicherungstürmen verstopfen. Alle müssten viel öfter an ihren eigenen Tod erinnert werden. Dann würde es weniger Größenwahn geben. Man müsste so etwas wie Windelsäcke auf Plätzen anhäufen, vor das Parlament karren, vor Schulen und Universitäten. Aber die Erinnerungskultur ist zu sehr auf Ästhetik fixiert: Kirchen-, Politik- und Kulturmänner, Heilige, Kriegshelden, nackte Weiber als Allegorien auf Stelen. Niemand will an den Tod erinnert werden.
Die Windelsäcke haben Elvira jetzt den Tag vermiest.
3.
Adrian
Wien, Anfang August
Milan steht leicht zurückgelehnt da, die schwarzen Locken künstlerisch gesträubt und den Adamsapfel auf seine Bewunderer gerichtet. Für ihn läuft es gut, vier rote Punkte sind schon auf seinen Kisten, die er Arbeiten nennt. Milan hat einen bulgarischen Vater, der sich, wenn man genau hinhört, in Milans Konsonanten mischt. Gerade das macht ihn ganz und gar zum Wiener, mehr als es Adrian mit seiner kleinen niederösterreichischen Klangfarbe je werden könnte. So jemand wie Milan braucht gar keinen Akzent, um sich in Szene zu setzen. Da steht er, das Hemd weiter offen als nötig, überschäumende Männlichkeit, wäre da nicht im Nest seiner protzig zur Schau gestellten Brusthaare dieses unsägliche kleine Holzkreuz, das bei jedem anderen lächerlich wirken würde. Milan behauptet, an Jesus zu glauben, schlimmer noch, das Kreuz sei ein Köder, um die guten Menschen anzuziehen. Adrian glaubt ihm kein Wort. Milan inszeniert sich als raffinierte Gesamtkomposition, in der das Kreuz dieselbe Rolle spielt wie eine Prise Salz in einem süßen Gericht, also jene Art Widerspruch, den die Menschen – oder sagen wir es doch gleich –, die Frauen so interessant finden.
Ob es diese Kleinigkeiten sind, die Milan so attraktiv machen? Wie immer wird er umrudelt. Von Frauen, von Käufern, und auch von Leuten, die sich einfach so neben charismatische Typen stellen. Nicht, dass Adrian neidisch wäre. Er ist ja selbst so ein Kommunikationsparasit. Er stellt sich gerne neben Leute, die viel und interessant reden, so wie er sich gerne neben die Eingangstüren von Bäckereien stellt, aus denen es gut herausriecht.
Irgendetwas hat ihn in Vorarlberg in die Waden gebissen, er muss sich beherrschen, sich nicht ständig zu kratzen. Rechts hat er vier Dippel, links fünf und drei – er hat sich schon blutig gekratzt. Das viele Gerede, das hier in die Luft geworfen wird, ist ihm zu beliebig. Oder zu anstrengend. Eine junge blonde Frau mit steingrauen Augen und Lederhut hat Position bezogen und beginnt ihre Milan-Anhimmelung mit bemühtem Interesse, verschränkten Armen und einer leichten Schieflage des Kopfes. Sie nickt und lächelt und nickt und spielt mit einer Haarsträhne. Er kennt diese Gesten nur aus der Entfernung. Das Galerielicht fängt sich in ihrem Haarglanz und Adrian möchte mit so einer richtig grandiosen Liebhabergeste in ihre blonden Locken greifen. Aber er ist nicht gebaut für grandiose Liebhabergesten. Erstens müssen die von oben nach unten erfolgen – und dafür ist er zu klein. Zweitens hat er dafür nicht den richtigen Beruf. Wenn er beim Spielfilm gelandet wäre, oder wenn er Regisseur wäre, oder ein richtiger Kameramann, wäre es vielleicht etwas anderes. Aber Adrian ist kein Darsteller. Er ist für das gebaut, was nach dem Posen kommt. Für Semmelholen und Kaffeekochen und Obstteller anrichten, denkt er verzagt. Für den schön inszenierten Frühstückstisch, vor dem er dann allein sitzt.
Die Luft atmet sich, als wäre sie schon durch ein paar Lungen zirkuliert. Adrian ekelt sich davor, sie einzuatmen, ihm ekelt vor dem warmen Weißwein, vor den feucht aneinanderklebenden Lachsbrötchen mit der gelben Mayonnaiseschnecke darauf, vor der aufgedonnerten Schachtel neben dem Minister und vor dem Spaniel, der den Raum diagonal durchtrabt und den Gästen sein fettiges Fell präsentiert. So eine kleine pelzige Hure auf vier Beinen. Wie er sich an die Waden der alten Damen drückt und Berührungen einfordert. Der weiß schon, wer in die Knie gehen wird, um ihn zu streicheln. Vor dem ekelt ihm auch ein bisschen, wie er jetzt durch die Blonde mit dem Hut hindurchsieht. Andere würden vielleicht denken, das wäre Kalkül. Aber das ist es bei ihm nicht. Seit er das kleine Atelier in einem ungarischen Nest hat, ist Milan abgedriftet. Vielleicht sind es aber auch nur die Drogen. Milan baut in seinem ungarischen Garten Gras an, verborgen zwischen den mächtigen Brennnesselstauden und dem Komposthaufen, und das, was er nicht verkauft, raucht er selbst. Er experimentiert auch mit halluzinogenen Pilzen und Stechapfeltees, was man seinen Bildern zunehmend ansieht. Die gebeugten Figuren, die er früher gemalt hat, wurden immer mehr an den Rand gedrängt, immer häufiger malte Milan ein Loch in die Mitte seiner Bilder, immer größer und saugender wurde das Loch, und dann malte er Figuren in die Löcher, das sah aus wie etwas, das Adrian für sich insgeheim als James-Bond-Wirbel interpretiert. Irgendwann verließ er die zweite Dimension als Konsequenz der Brisanz. Seitdem baut er Kisten mit Löchern und ohne Löcher und rätselhafte Türmchen aus Hausrat daneben auf. Die James-Bond-Wirbel sind geblieben, sie tauchen als kleine Symbole überall auf, als eine Art Markenzeichen. Adrian traut sich nicht zu fragen, was er daran verstehen sollte. Milan würde ihn doch ohnehin nur mit unverständlichem Schwachsinn abfüttern, wie schon so oft. Adrian interessiert sich eigentlich gar nicht für Kunst, weder für Milans noch für irgendeine andere. Er ist nur aus Freundschaft zu Milan da.
Einmal hat er Milan in Ungarn besucht, eher aus Langeweile als aus Interesse. Er hat die Hände in den Hosentaschen vergraben und genickt, als Milan ihn durch das Atelier geführt und ein paar Arbeiten aus den Fächern und Depots gezogen hat, um ihm zu zeigen, worum es ihm momentan geht. Adrian sah hin und bemühte sich: rätselhafte Kisten, Spiralen mit trotzig vom Betrachter abgewandten James-Bond-Typen, alles in Schattenfarben. Adrian nickte, denn mit Nicken kann man nie viel falsch machen. Später haben sie den alten Ofen angeheizt, ein paar Bier getrunken, alte ungarische Jazzplatten gehört, die Milan im Keller des Ateliers gefunden hatte, und ein bisschen Gras geraucht. Milan hat ins Feuer gestarrt, die Augen zu Schlitzen verengt, die Zigarette im Mundwinkel, und gesagt:
Das Dorf hat knapp zweihundert Einwohner und ich habe mit fast allen geschlafen. Er stellt sich Milan vor, wie der von den alten, zahnlückigen Bauern, die Adrian über die Straße schlurfen sah, zum Beischlaf animiert wird. Er stellt sich runzlige Geschlechtsteile in einem Nest aus gelblichweißen Schamhaaren vor und verschwitzte, pannonische Hausfrauen in Haushaltskitteln aus Kunststoff. Und er ärgert sich über die Dreistigkeit Milans, der überaus heterosexuell und wählerisch ist, so etwas zu behaupten.
Jetzt gerade steht ein untersetzter Mann, den er als Zahnarzt und Milans Sammler in Erinnerung hat, neben Milan und ereifert sich über einen Vergleich mit einem koreanischen Künstler.
Na, wie hieß der doch gleich? Der Verdauungskünstler, der den Denker von Rodin auf rosa Klopapier nachgebaut hat und unten in der Kiste den nackten Hintern in das Loch … Sie wissen schon! Es liegt mir auf der Zunge!
Milan versteinert. Cody Choi, sagt er frostig. Der Zahnarzt fuchtelt begeistert mit den Händen. Genau! Dieser Cody Choi hat doch genauso wie Sie … und weiter geht es, bla, bla, bla. Milan ist sichtlich nicht begeistert, mit dem Verdauungskünstler verglichen zu werden. Aber der Zahnarzt zahlt seine Miete und seine Betriebskosten und jenen Teil seines Drogenverbrauchs, der nicht in seinem Garten wächst, und so jemandem widerspricht man besser nicht.
Adrian hat genug gehört. Es gibt nur ein einziges Klo und das ist besetzt. Ohne lange nachzudenken, geht er auf die Straße, überlegt, wohin er pinkeln könnte, ohne Aufsehen zu erregen. Hunde dürfen das, Kinder dürfen das, nur erwachsene Menschen nicht, auch nicht, wenn nur ein Klo da ist für achtzig Leute, die einen Gespritzten nach dem anderen trinken. Er mag das nicht, das öffentliche Markieren an Bäumen, Laternenmasten oder Zaunpfosten, und er kann es auch nicht leiden, wenn Frauen ihre Kinder am Straßenrand entleeren, er hasst es, wenn Menschen neben ihm ausspucken, ja, er will überhaupt nicht mit den Ausscheidungen von Fremden belangt werden. Auf der anderen Straßenseite ist ein Gemeindebau mit Bäumen und Sträuchern schütter bewachsen, der Boden von den Kinderfüßen und Hundepfoten plattgetrampelt. Aus den Fenstern kommen Küchengeräusche, Fernsehgeräusche. Die Mitte des Hofes ziert eine stinkende Müllinsel, in deren Schutz gibt er sich Mühe, auf einen dreckigen Lumpen zwischen den Containern zu zielen. Als er fertig ist und abschüttelt, legt er den Kopf in den Nacken. Fast alle Fenster sind beleuchtet, dabei ist es noch nicht einmal Nacht. Die Menschen machen Licht, bevor es dunkel ist, sie heizen, bevor es kalt wird, sie sterben, bevor sie leben.
Vor Katalyn war Marion gewesen, vor Marion war Elke gewesen und dazwischen hat sich immer wieder etwas ergeben. In seiner Schulzeit war er ein paar Mal verliebt, während er auf der Akademie war, hatte er keine Zeit für aufwändige Beziehungspflege. Überhaupt, der Aufwand. Er war den Mädchen nachgelaufen und hatte sich bemüht, aber sobald sich die kleinste sexuelle Ausbeute einstellte, musste er irgendwie dafür bezahlen: Mit Marion durfte er sich in Gesprächen und Trostspenden durch ihre selbstmitleidigen Krisen arbeiten. Elke begleitete er bei ihrer Magersucht und stand ihr als Hand- und Fußwärmer zu Diensten. Bei beiden Frauen wurde er ausgetauscht, gegen einen, der weder größer noch älter oder sonstwie begehrenswerter als er selbst schien. Aber das ist besser geworden. Er hat viel Zeit damit verbracht, Frauen verstehen zu wollen und trösten zu müssen, aber ihm kommt es vor, als wären die Frauen heute nicht mehr so zerbrechlich wie früher. Von der spinnenbeinigen Elke, deren Mund so verrucht nach Rauch und Minze schmeckte, träumt er noch manchmal. In diesen Träumen treibt sie ihn mit anklagendem Blick vor sich her, durch die unendliche Zimmerflucht ihrer Altbauwohnung, durch eine Flügeltür nach der anderen, während er verzweifelt rätselt, wie es nur dazu hat kommen können, dass er sich tatsächlich wieder mit ihr eingelassen hat.
Diese Kluft zwischen ihm und den Frauen ist kleiner geworden, von alleine. Frauen sind selbstbewusster, lustiger, aber auch oberflächlicher geworden. Manchmal, wenn er auf einer Party steht und ein Mädchen kennenlernt, hat er das Gefühl, am Filmset zu stehen und das Drehbuch schon zu kennen. Irgendwann hat man alles schon mindestens einmal gehört und gesehen.
Er geht wieder zurück, quert aber nicht die Straße, ein Widerstand lässt ihn abrupt auf dem Gehsteig stehen bleiben. Der hell erleuchtete Kubus der Galerie mit den immer noch herumstehenden Gästen: Das erinnert ihn an eine Videowall, auf der ein Promo-Spot in Endlosschleife läuft, oder an ein Aquarium im Haus des Meeres, in dem die Besucher im Dunkeln umhergehen und die Fische unausweichlich in Licht getaucht werden. Das wird heute nichts mehr, denkt er, ab jetzt dreht sich alles im Kreis und zieht nach unten, dieser Abend, dieses Wochenende. Corioliskraft, denkt Adrian. Diese Woche seines Lebens ist vorbei, nächste Woche geht es weiter, zuerst mit dem Bodensee-Dreh, dann mit einem Job, den er reinbekommen hat, er springt für einen Kollegen ein. Ein Nachruf, ein Interview mit einer alten Frau, über eine tote Schriftstellerin, irgendwo bei der Rax. Er beschließt, zu Fuß nach Hause zu gehen, durch die menschenleere Stadt. Lieber will er fernsehen, in seiner kleinen, aber eigenen Wohnung, in der er von niemandem gestört wird. Zum »Tatort« seine Wäsche, die schon seit fast zwei Wochen auf dem Wäscheständer hängt und im Gang im Weg steht, herunternehmen, glattstreichen und zusammenlegen. Unter der mauen Abendstimmung regt sich wieder Zorn auf Katalyn. Er sieht auf sein Handy, nichts. Ob er sie anrufen soll? Oder doch lieber eine WhatsApp-Nachricht?
Seine Stimmung ist ihre Schuld, denkt er und geht schneller. Ein Typ mit Hipsterbart und Hipsterbrille kommt ihm entgegen, und er ballt seine Wut auf Katalyn, die wenigstes eine Nachricht hätte schreiben können. Sie weiß doch, wie schwer es für ihn ist, oder? Sein Zorn umgibt ihn wie eine Rauchwolke, in die der Hipster jetzt eintaucht und im letzten Moment eine elegante Ausweichbewegung macht. Diesen kleinen Sieg zumindest, denkt Adrian, kannst du mit in die nächste Woche nehmen.
4.
Elvira
Hintermoos, Anfang August
Zeit für Kaffee und Zigarette. Sie streckt sich, die Hände ins Kreuz gelegt. Es knackst wie Holz im Ofen. Nenis Tasse mit den vielen kleinen blauen Pferden darauf hat eine verdiente Kräuterteepatina, die sie nicht auswaschen wird. Gehört die auch in den Nachlass? Wenn die Redakteurin kommt, darf sie nicht vergessen, ihr eine von den sauberen Tassen anzubieten. Je älter man wird, desto unmerklicher wird die Trennlinie zwischen Uneitelkeit und Ungepflegtheit. Nur, weil sie sich nicht als ungustiös empfindet, muss das ja eine Dreißigjährige nicht auch so sehen. Elvira findet sich ausreichend gepflegt. Sie findet sich ja auch ganz brauchbar gealtert. Aber Altern ist ja völlig aus der Mode gekommen. Altern muss man heimlich, hinter verschlossenen Türen und unter straffer Haut. Vor allem die Frauen müssen das Altern um jeden Preis verhindern. Aber auch den Männern machen sie schön langsam Druck. Altern ist diesen Generationen nach uns nicht zumutbar, denkt sie. Früher mussten sich alte Menschen gar nicht pflegen. Gepflegtheit unterliegt ja auch einer Mode, die mit der Zeit geht. Früher durfte man im Alter verlottern und vertrocknen. Als Kind hatte ihr vor vielen Alten geekelt, vor deren gelben Zähnen und vor den strähnigen Haaren, ihrer speckigen, mit Flecken übersäten Kleidung. Vor den Muttermalen, die so krebsig aussahen. Jetzt ist sie selbst bald sechzig, und auf den Händen und im Gesicht hat sie auch schon ein paar Flecken. Wie riecht sie? Sie hebt den Arm. Nach nichts, findet sie. Wie die jungen Frauen heute wohl riechen? Mit jungen Menschen hat sie nichts mehr zu tun. Riechen die nach Naturkosmetik, und gibt es wieder Achselhaare? Wachsen dieser Generation überhaupt noch Achselhaare?
Elvira kippt den letzten Schluck Tee in die Wiese, geht ins Haus, setzt sich an den Schreibtisch und versucht dort weiterzumachen, wo sie gestern Abend abgebrochen hat. Dass Helene offensichtlich noch immer nicht genug hatte vom Literaturbetrieb, das hat Elvira immer noch nicht verdaut. Noch ein Buch schreiben. Noch einmal der Canossagang zum Verlag, Streiterei mit den Lektoren um jedes Wort, mit den Grafikern um das richtige Cover, noch einmal die Mühsal der Lesereisen, das Erdulden der Kritik, das bisschen Bestätigung, das man aus dem Gros der Kränkungen und Häme herauskletzeln muss. Meine Güte, Neni, du hattest doch schon genug! Du hattest doch schon ausgeschrieben!