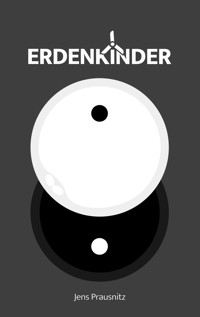
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wucht
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2020 beginnt für dich mit einer Achterbahnfahrt: Deine Freunde brechen den Kontakt zu dir ab, Familiengeheimnisse erschüttern dich und dein Vertrauen wird missbraucht. Immerhin verliebst du dich, ehe die Kontaktsperren der ausbrechenden Pandemie alles zum Stillstand bringen und deinen Arbeitsplatz in der Kinderklinik zum nächsten Prüfstein werden lassen.Es liegt allein an dir, ob du langsam durchdrehst, wie einige Verwirrte, oder dich zusammenreißt und auf die Seite der Vernunft schlägst. Du hast deine Lektion von 1989 gelernt und erkämpfst dir eine zweite Chance. Lassen sich gerade in der dunkelsten Stunde entscheidende Weichen für die Zukunft stellen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Beschreibung und Kurzbio
Widmung
010120
020120
060120
080120
100120
110120
120120
160120
180120
190120
200120
210120
220120
230120
240120
250120
270120
280120
010220
020220
030220
040220
050220
060220
080220
110220
120220
140220
150220
190220
200220
220220
240220
260220
010320
020320
030320
040320
050320
070320
080320
090320
120320
130220
140320
150320
160320
170320
180320
190320
200320
210320
220320
230320
250320
010420
020420
030420
040420
060420
080420
090420
100420
120420
130420
140420
170420
210420
240420
270420
010520
020520
030520
040520
050520
060520
080520
090520
100520
110520
130520
160520
190520
210520
220520
230520
270520
010620
020620
030620
070620
090620
110620
140620
160620
170620
190620
200620
210620
230620
260620
290620
010720
030720
040720
080720
090720
140720
150720
160720
170720
180720
190720
210720
230720
260720
280720
010820
020820
030820
040820
050820
080820
120820
150820
160820
Anmerkungen
Danksagung + Literatur
Guide
Cover
Contents
Start of Content
Erdenkinder
Ein Tagebuch der Generation 89 - Band 2
1. Auflage
© 2024 Jens Prausnitz
Umschlaggestaltung: Jens Prausnitz, Edgar Bąk, www.edgarbak.info
Korrektorat: Veronika Moosbuchner, www.lektorat-moosbuchner.de
Kontakt via: www.generation89.de
ISBN E-Book: 978-3-989-95977-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Handlungen und Personen dieses Werkes sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
2020 beginnt für dich mit einer Achterbahnfahrt: Deine Freunde brechen den Kontakt zu dir ab, Familiengeheimnisse erschüttern dich und dein Vertrauen wird missbraucht. Immerhin verliebst du dich, ehe die Kontaktsperren der ausbrechenden Pandemie alles zum Stillstand bringen und deinen Arbeitsplatz in der Kinderklinik zum nächsten Prüfstein werden lassen.
Es liegt allein an dir, ob du langsam durchdrehst, wie einige Verwirrte, oder dich zusammenreißt und auf die Seite der Vernunft schlägst. Du hast deine Lektion von 1989 gelernt und erkämpfst dir eine zweite Chance. Lassen sich gerade in der dunkelsten Stunde entscheidende Weichen für die Zukunft stellen?
Band 2 des fiktiven, zweiteiligen Tagebuchs von Johann Mayr
Band 1, „Wunschkinder“ ist 2023 erschienen und als Taschenbuch sowie E-Book erhältlich
Über den Autor:
Vater, Ehemann, Freund und Filmemacher.
Ein Schreibender, immerfort. Aufmüpfig und verzettelt.
Geboren in Deutschland, lebt in Polen, ist in Europa zu Hause.
für
alle Kinder dieser Erde
01.01.20
Sehr merkwürdig, ein Jahr so verschwommen anzufangen. Dabei begann es eigentlich noch harmlos: Kurz vor Mitternacht klingelte ich auf einer fremden Silvesterparty im Haus, um nach einer Schere zu fragen, weil meine eigene so stumpf war, dass man sich damit ein Haar höchstens krümmen konnte. Manfred, den Gastgeber kannte ich gar nicht, obwohl wir seit Jahren im gleichen Haus wohnen. Es war allerdings schon zu spät, um bei Nachbarn zu klingeln, die ich kannte, auch wenn die wegen des Lärms eben jener Party bestimmt nicht schlafen konnten. Ich fragte mich gerade „Was reimt sich eigentlich noch auf Glück?“, als jemand gegen Widerstände von Innen die Wohnungstür aufruckelte und mir anschließend Bier auf das T-Shirt schäumte.
„Ups“, sagte die übersprudelnde Partybesucherin.
„Kein Problem“, erwiderte ich seufzend und verschluckte mich fast an der mir entgegenströmenden tropischen Luft aus dem Wohnungsinneren.
Sie taumelte im völlig überfüllten Flur unwiderstehlich an die Wand. „Willst du nicht reinkommen?“ Jedenfalls glaubte ich, das ihren Lippen abzulesen, denn ich hörte nur noch dreistellige Dezibelwerte.
„Nein, ich bin gar nicht eingeladen, sondern ein Nachbar aus dem zweiten Stock“, erwiderte ich verführerisch brüllend mit dem Vokabular eines Steuerprüfers.
„Ach.“ Sie neigte den Kopf keck zur Seite und fragte: „Was gibt’s denn?“
„Ich wollte …“ Ich sah hilfesuchend auf das Klingelschild. „M Punkt Vukojević sprechen? Also wenn man das überhaupt so ausspricht.“
„Manfred? Der legt gerade auf. Aber niemand nennt ihn so. Alle sagen Vuko zu ihm.“ Dann hatte sie eine Eingebung, bei der erneut ein Schluck Bier aus dem Flaschenhals entkam und an die Wand klatschte wie Insekten gegen eine Windschutzscheibe. „Darf ich ihm vielleicht einen Musikwunsch ausrichten, Herr Nachbar aus dem zweiten Stock?“
„Nein, vielen Dank. Und, äh, Johann. Hallo. Ich wollte mir eine Schere ausleihen.“
„Bastelst du gerade etwas, Johann Der-sich-eine-Schere-ausleihen-will? An Silvester?“
„Ich will mir die Haare schneiden.“ Zum Beweis warf ich meine inzwischen eher bescheidene Mähne über die Schulter.
„Geil. Warte hier, ich schau mal“, sagte sie und blieb gleich wieder stehen. „Nein, hol dir in der Zwischenzeit einen Drink in der Küche, ja?“ Und weg war sie.
Damit es nicht so ins Treppenhaus lärmte, betrat ich den Flur, zog die Tür hinter mir zu, blieb wie angewurzelt stehen und nickte lächelnd den anderen Leuten im Gang zu, wenn sie in meine Richtung guckten. Es war so laut, dass sie bestimmt nichts von unserem Gespräch mitbekommen hatten. Immerhin etwas. Auffallend gut angezogen waren die Gäste, ich kam mir in meinem ausgebleichten Rush-T-Shirt und den alten Jeans noch mehr fehl am Platz vor als für gewöhnlich. Es lief irgendetwas aus der Rocky Horror Picture Show, oder was auf dem Soundtrack nicht fremd gewirkt hätte. Vereinzelt sangen Leute mit, aber hier im Flur war eher Verschnaufpause angesagt. Und Knutschen. Betreten sah ich zur Seite und nickte James Baldwin zu, der mich aufmerksam von seinem Poster aus ansah.
Dann kam die Bierverkipperin zurück und reichte mir eine kleine Schere. „Vorsicht, die ist scharf.“
„Danke. Ich bring sie gleich zurück.“
„Du meinst nächstes Jahr?“
Ich grinste schmerzhaft und war so schnell wieder aus der Tür, wie ich nur konnte.
Während draußen die ersten Raketen explodierten, stand ich vor dem Spiegel in meinem Badezimmer und versuchte mir die Haare zu schneiden. Das war gar nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Alle Bewegungen muss man spiegelverkehrt ausführen und wenn es knallt, sollte man weder zusammenzucken, noch versehentlich – schnipp. Außerdem hatte ich keine Haarklammern, sondern nur Haargummis – und Wäscheklammern taugten nicht als Ersatz, um die Strähnen voneinander zu trennen. Die ersten Haare waren trotzdem bald ab und hingen mir jetzt zur Abwechslung in die Augen, was das Schneiden zusätzlich erschwerte. Wahrscheinlich hätte ich hinten anfangen sollen, wo man sowieso nicht sieht, was man anrichtet. Also durchtrennte ich mit schnellen Schnitten den Zopf, um Tatsachen zu schaffen, ehe ich einen Rückzieher machen konnte. Dann kam der Moment der Einsicht, dass ich es wahrscheinlich nur noch schlimmer machen würde, wenn ich weiter herumdilettierte. Also ließ ich es so, obwohl mir die Haare büschelweise wie geschmolzene Orgelpfeifen um den Kopf hingen. Ich könnte ja später eine Mütze zur Arbeit tragen und dann morgen zum Friseur gehen. Ich gähnte und sah auf die Schere in meiner Hand. Ach Mist.
„Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt, oder?“, fragte die jetzt etwas stabiler als vorhin stehende Besucherin, die mir erneut die Tür geöffnet hatte. „Olga.“
„Hallo Olga, ich bin immer noch Johann“, sagte ich. „Stehst du schon den ganzen Abend hinter der Tür?“
„Nee, Leichtathletin. Der Impuls, Erste zu sein ist stärker als ich.“
„Ich glaub, ich kann nicht ganz folgen …“
„Startschuss Türklingel?“
„Ah, okay.“
„Und?“
„Was?“
„Ja, was führt dich jetzt zu uns, Johann?“, wollte Olga wissen. „Jetzt doch Lust auf Party?“
„Ich? Nein.“ Ich hielt ihr die Schere hin. „Ich wollte die hier zurückbringen.“
„Bevor du rausgehst.“
„Wieso?“
„Na, wegen der Mütze?“
„Ach, nee, das … ist ne lange Geschicht… hey!“
Olga hatte mir die Mütze vom Kopf gezogen und schnappte nach Luft. „Heilige Sch…“ Dann zog sie mich mit ihrer freien Hand tiefer hinein in die Wohnung und das Gemenge. „Aus dem Weg! Das ist ein Notfall!“, rief sie und es bildete sich eine Rettungsgasse. Einen Augenblick später stand ich umringt von Partygästen im Wohnzimmer, die das Massaker auf meinem Kopf lachend bis schockiert bestaunten.
„Bringt einen Stuhl und ein Handtuch in die Küche!“, rief eine sehr tiefe Stimme. Sie war so tief, dass ich nicht einmal gleich sagen konnte, woher sie kam. „Das rücke ich wieder gerade.“ Dann trat ein durchtrainierter Mann in hautenger Lederhose und etliche Nummern zu kleinem Feinripp Unterhemd vor mich, dessen muskelbepackte Oberarme dick wie Schwimmreifen waren. Ich schluckte. „Zeig mal“, sagte er zu Olga, die ihm die Schere reichte. In seinen Pranken sah sie aus wie ein Spielzeug. Er exte seinen Drink und warf jemandem das leere Glas zu, murmelte irgendwas mit „Krone“ und „damit könne man arbeiten“. Dann griff er mit der anderen Hand in seine Gesäßtasche und zauberte einen Kamm hervor. Ich sah mich hilfesuchend um, ob ich Manfred, Vuko, oder beide irgendwo ausfindig machen könnte, aber dann fiel mir wieder ein, dass ich gar nicht wusste, wie der Gastgeber der Party aussah. „Na dann wollen wir mal“, brummte die noch einmal tiefer gelegte Stimme. Eine kleine Traube aus Menschen schob mich und den Ledertyp in die Küche, während hinter uns im Wohnzimmer die Musik da weiterspielte, wo sie eben unterbrochen worden war. Jemand fragte mich beim Herausgehen nach einem Musikwunsch, also drehte ich ihm meinen Oberkörper zu, damit er mein Rush-Shirt sehen konnte, und schon waren wir aus seinem Blickfeld verschwunden.
In der Küche wurde ein Tisch zur Seite geschoben, der bestellte Stuhl in die Mitte platziert und ich darauf drapiert. Olga legte mir ein Handtuch um den Hals und ich suchte nach Worten – oder besser einer Ausrede – wie ich aus dieser Situation wieder herauskam. Außer „Hilfe“ fiel mir nichts ein und mein Mund war so trocken, dass ich nicht mal das über die Lippen brachte.
„Trink das“, sagte der Hüne und drückte mir ein leeres Glas in die Hand, dann warf jemand auf sein Kopfnicken hin eine Handvoll Eiswürfel hinein. Währenddessen nahm er einen kräftigen Schluck aus einer Wodka Gorbatschow Flasche, mit der er anschließend mein Glas füllte.
„Könnte da ein bisschen Platz für Tonic bleiben? Oh, nicht? Dann vielleicht beim nächsten Drink. Was ich Sie fragen wollte …“
„Für dich immer noch Herr Diodato. Bis ich mit dir fertig bin. Dann kannst du Thomas zu mir sagen.“ Er gab mir die Hand, so dass meine Knöchel aneinanderklackten wie bei einem Kugelpendel.
„Aah, danke Tho…, äh, Herr Dio…dato. Ich wollte keine Umstände machen und sie vom Feiern abhalten, weil …“
„Junge, du hast einen Ottifanten-Friedhof auf dem Kopf. Willst du etwa so das neue Jahr beginnen? Als Witzfigur?“ Er wandte sich mit fragendem Blick an die Umstehenden in der Küche, von denen einige den Kopf schüttelten.
„Nein, nein, es ist nur …“
Diodato ging vor mir in die Knie und ich verstummte. Sein Gesicht war jetzt direkt vor meinem. Der Alkohol in seinem Atem ließ meine Augen glasig werden. „Ich versteh dich. Ich bin hier, um zu helfen.“
Ich nickte.
Ein Synthesizer legte nebenan einen Soundteppich und das Wohnzimmer verwandelte sich umgehend in einen johlenden Hexenkessel. Ich erkannte das Lied nicht sofort, auch weil die Partygäste jedes Wort zu laut mitsangen. Doch dann schnitt die glasklare Stimme von Jennifer Rush mit dem Refrain von „The power of love“ durch jede Faser meines Körpers und Gänsehaut ließ mich kurz erschauern.
„Sieh mir in die Augen“, hörte ich da den Muskelberg sagen und tat, wie mir geheißen worden war. Er betrachtete besorgt meine aufgestellten Haare auf dem Arm. „Hab keine Angst. In einer Viertelstunde ist alles gut und du kannst wieder in einen Spiegel sehen.“ Er legte mir seine Pranke auf die Schulter und stand mit einem leichten Keuchen, das nur ich hören konnte, wieder auf.
Während ich innerlich noch mit Jennifer haderte, kam mir ein letzter Geistesblitz. „Ich hatte nur den Eindruck, die Schere sei etwas stumpf. Sieht man ja an mir.“
„Ach so ist das?“ Diodato nickte, dann zog er sich sein Hemd vom Bauch weg und schnitt es sich in einer flüssigen Bewegung unter dem Jubel der Anwesenden vom Nabel bis zum Hals auf. „Scharf genug für mich!“ Die Meute johlte vor Vergnügen und Olga flüsterte mir ins Ohr, Thomas sei ein preisgekrönter Friseur und ich solle ihn nicht weiter ärgern. Womit ärgerte ich ihn denn? Aber ehe ich sie das fragen konnte, war sie schon wieder weg und gab den Blick frei auf die seine Brust bedeckende Tätowierung: links ein Alien, Rechts ein Predator, die abwechselnd zum Sprung ansetzten, wenn er demonstrativ die Muskeln zucken ließ.
„Mamma mia“, wimmerte ich und schluckte den Wodka herunter. Die Eiswürfel in meinem Glas klirrten leise mit meinen klappernden Zähnen um die Wette. „Ich glaub, ich brauch noch einen.“
„Now we’re talking!“, rief Diodato, die Küche gröhlte und so nahm das „Schnippsal“ seinen Lauf.
Einige Partygäste versuchten mich zwischendurch mit Knabberkram zu füttern, aber das wurde unterbunden, weil … „Kauen geht jetzt gar nicht! Da verrutscht die ganze Kopfhaut! Picasso würde doch auch niemand das Papier bewegen, während er drauf zeichnet, ihr Banausen!“, beschwerte sich Diodato, ehe er ebenfalls in den Jennifer begleitenden Chor einstimmte – so text- wie trinkfest.
„Was ist mit Drinks?“, wollte jemand wissen, der nicht ich war.
Diodato überlegte kurz. „Das geht in Ordnung. Schlucken geht immer.“
Beim zweiten Refrain brach mein letzter Widerstand und ich ließ alles über mich ergehen – mit Tränen in den Augen. Tränen der Erleichterung. Kamm und Schere bewegten sich flink an meinem Kopf, mit einer Zärtlichkeit und Präzision, die in angenehmen Wellen kribbelte, so dass ich die Augen schloss. Ob das jetzt Tingles waren? Bei dieser Lautstärke? Ich begann mich wirklich zu entspannen.
Soweit ich das beurteilen konnte, fielen nach dem Unterhemd nur abgeschnittene Haare zu Boden und mir lief nirgendwo heißes Blut aus klaffenden Wunden über den Hals. Da sich mein Coiffeur nicht vom Fleck bewegte, konnte er auch keinen Drehwurm kriegen. Stattdessen drehte Diodato mich mitsamt dem Stuhl, weil angeblich das Licht in der Küche nur aus dieser einen Ecke seinen Ansprüchen genügte. Vielleicht wollte er auch ein bisschen angeben und zwischendurch seine Feinmotorik lockern, was weiß ich. Es war jedenfalls alles gut, bis DJ Manfred als nächstes „Stuck in the middle with you“ von Stealers Wheel auflegte. Auf den Filmwechsel in meinem Kopf hätte ich gerne verzichten können.
„Als ich sagte ‚leg was mit Madsen auf‘, meinte ich die Band, nicht den Schauspieler!“, rief Olga. Ein paar Anwesende lachten.
„Sind doch eh alle miteinander verwandt“, mutmaßte ein Experte mit der Betonung auf Ex.
Diodato stöhnte. „Dieser Haarwirbel zum Pony hin ist echt tricky …“ Er sah so aus, als wäre ihm der zuletzt konsumierte Alkohol inzwischen zu Kopf gestiegen.
„Den hab ich von meiner Mutter.“ Ich schluckte. „Mit dem haben alle Probleme.“
„Na, na, na, so redet man nicht über seine Mama“, schimpfte Thomas und watschte sich ins Gesicht – Vorhand, Rückhand, beide Wangen –, und machte dann kleine Tanzschritte, vier vor und drei zurück. „Das bisschen Wirbel ist doch kein Problem für mich.“ Dann sang er auch diesen Refrain mit, gefühlt drei Oktaven unter dem Original, dass es mir im Bauch kribbelte. Resonanzfrequenz. Oder Schmetterlinge im Bauch, die sich zu verstecken versuchten.
Lange Rede, kurzer Sinn, die Haare waren abgesehen von einem unglücklichen Pikser nach zwanzig Minuten ab, Thomas bekam für das Ergebnis Applaus von den Anwesenden, und ich blieb danach noch eine halbe Ewigkeit auf der Party. So gut habe ich mich lange nicht amüsiert und beinahe hätte ich noch mit Olga geknutscht, aber der war so schlecht, dass sie vorher einschlief.
Thomas wäre, glaube ich, gerne für sie eingesprungen, aber ich redete mich auf meine Frühschicht raus, die gar keine war. Geld wollte er auch keins von mir nehmen, er meinte, das sei eh Werbung für ihn gewesen und Spaß hätte es ja auch gemacht.
„Und das Unterhemd?“
„Ach, das mache ich auf jeder Party. Nur normalerweise mit den Händen.“ Ich schluckte, nickte lächelnd und flutschte aus der Wohnung. Im Treppenhaus war es kühl und vergleichsweise still. Mir pfiffen die Ohren.
Meine Wohnung kommt mir jetzt viel kleiner vor, dabei ist sie genauso geschnitten wie die von Manfred, nur spiegelverkehrt. Aber das ist es nicht. Sie ist leerer. Ruhig. Nicht so … lebendig. Tja, und jetzt bin ich traurig. So schnell kann es gehen. Die Party kann ich immer noch toben hören. Ob ich noch einmal hochgehe?
Als mich die Sonne Stunden später in meinem Bett wachkitzelte, dachte ich kurz, dass ich das alles nur geträumt habe, bis ich meinem Spiegelbild beim Zähneputzen begegnete. Ich traf den offenen Mund nicht, weil meine Augen an den kurzen Haaren klebten. Selbst nüchtern betrachtet sah das immer noch gut aus. Eine Seite stoppelig rasiert, wo ich mich in der Länge verschätzt hatte, darüber aber stufig längere Haare, die ich mir wahlweise hinters Ohr klemmen konnte, und der Rest passte harmonisch dazu, obwohl nichts daran symmetrisch war. Mit Haarlack könnte ich mir auch einen kleinen Iro machen, hatte Thomas gemeint, aber das werde ich schön bleiben lassen.
Noch bemerkenswerter als meine Frisur war die Tatsache, dass ich ausgeschlafen war. War, war, war. War was?
Das Gefühl hielt den ganzen Tag an, sogar in der Arbeit. Wobei dort die erschrockenen Gesichter meiner Kolleginnen dazu führten, dass mir am Ende der Schicht schon die Mundwinkel vom vielen Grinsen wehtaten. Aufgerissene Augen, Hände vor dem Mund, daneben gekippte Muttermilch.
„Was denn?“, fragte ich in die Runde.
„Und das Pflaster am Hinterkopf? Am Haaransatz?“
„Ach, kannst du mir das bitte abmachen? Das ist die Visitenkarte vom Friseur. Eine Anspielung auf Pulp Fiction, dabei hat er mich ja woanders geschn… – Au!“ Ich rieb mir den Nacken. „Danke.“
„Du, da steht tatsächlich eine Adresse drauf. Auf der Innenseite, wo sonst die Wundauflage ist.“ Tina kicherte. „Und bei dem warst du?“
„Nein, der war bei mir im Haus. Wieso, was steht denn da?“
„Du trägst jetzt Ostfriese.“
So gewappnet konnte das neue Jahr kommen.
02.01.20
Die Straßen sind noch immer von Böllerhülsen und Scherben übersät, Erbrochenes klebt angefroren auf den Gehwegen wie die in Blei gegossenen leeren Versprechungen der Silvesternacht. Ich lief Slalom zu meiner Wohnung und erlitt beinahe einen Herzinfarkt, als ein Knallfrosch verspätet aus seinem Sauf-Koma aufwachte und meinte, es sei Neujahr. Immerhin wurde mir durch den unerwarteten Adrenalinstoß etwas wärmer. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist der gleiche wie in den letzten Jahren: Ich wünsche allen knallenden Erbsenhirnen, dass deren Haustiere ihnen wochenlang die Wohnung vollkotzen.
Kaum dass ich vor meiner Haustür angekommen war, klingelte drinnen schon das Telefon. Konnte eigentlich nur meine Mutter sein. Umso überraschter war ich, dass stattdessen Nadja auf mich einredete. „Einen Reiskocher?“ Sie schnaubte vor Wut. „Du schenkst meiner Tochter einen Reiskocher zu Weihnachten?“
„Ich dachte, sie würde sich darüber …“
„Sie hat sich darüber gefreut!“, brüllte sie. „Gefreut! Über ein Kochgerät! Was kommt als Nächstes? Ein Wischmop zum Geburtstag?“
„Das war … weil … wir hatten in Berlin zusammen koreanisch gekocht, nachdem Mario …“
„Du weißt echt noch immer nicht, wann du besser die Klappe halten sollst, oder?“ Nadja schnaubte und mir war, als wäre der Telefonhörer heißer geworden. Mario zu erwähnen, war dann wie Wasser auf kochendes Öl zu kippen: ziemlich doof von mir.
„Clara gehört nicht an einen Herd, sondern …“
„… sondern als Schäferhündin zu einer Herde?“, versuchte zur Abwechslung einmal ich den Satz zu vervollständigen.
Da stutzte sie. „Ach Johann, du Schafskopf.“
„Wegen ihrer Führungsqualitäten“, fügte ich schnell hinzu. „Bei den Klimaprotesten ist sie immer vorn mit dabei.“
Nadja seufzte. „Mehr als zuletzt in der Schule.“
„Also das ist ein Satz, den ich von dir nicht erwartet hätte.“
„So war das auch nicht gemeint.“
„Aha! Da darf man also differenzieren, aber bei einem Reiskocher hört der Spaß auf.“
„Red’ doch keinen Scheiß, Johann!“
Ups. Anscheinend war ich noch gar nicht vom Haken. „Ich verspreche ja, mich zu bessern. Mir geht jetzt jeden Tag ein Licht auf.“
„Schön.“ Nadja hielt kurz inne. „Ach so, der Wecker. Das funktioniert?“
„Erstaunlich gut sogar. Ich mag’s.“
„Werde ich ausrichten. Wie geht es Lukas?“
„Er ist noch ganz der Alte“, sagte ich, aber es hörte sich falsch an. „Gleichzeitig viel reifer. Das ist schwer zu beschreiben. Ihr solltet ihn besuchen.“
„Ach, Johann …“
„Nein, im Ernst. Wie wär’s mit Ostern? Packt die Kinder in ein Auto – ich meine einen Zug – und ab in den Süden. Wir könnten uns alle gemeinsam dort treffen.“
„Proxi, ich muss noch über was anderes mit dir sprechen.“
Mir wurde es ganz anders. „Schieß los.“
„Du musst mich endlich vergessen, hörst du?“
Mir brach der Schweiß aus. „Was meinst du?“
„Ich hab seit einer Weile den Eindruck, dass du … wie soll ich sagen … dass du zu viel an uns und früher denkst“, sagte Nadja. „Ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, nur … weißt du, wenn …“
„Jaja“, sagte ich und schloss die Augen. „Du hast ja recht. Das … aber ich habe da gestern vielleicht jemanden …“
„Das hast du schon so oft gesagt“, warf sie enttäuscht ein.
„Okay“, sagte ich. „Ich versprech’s. Mach dir keine Sorgen.“
„Oh, ehe ich es vergesse: Ich soll dir von Daniel ausrichten, dass er Lukas anrufen wird. Du hast ihn wohl überzeugt.“
„Das freut mich zu hören.“ Dann fragte sie mich, was da gestern gewesen wäre und ich erzählte es ihr. Sie kriegte sich gar nicht mehr ein vor Lachen und das vertrieb endlich den Schleier ihrer schlechten Laune. Wie kann etwas so guttun und einem gleichzeitig das Herz brechen?
Proxi hat sie mich auch schon länger nicht mehr genannt. Wie war das noch mal? Es hatte was mit Alpha Centauri zu tun, der eigentlich gar kein Stern ist, sondern zwei. Nein, sogar drei? A B C … ich weiß es … nee. Es sollte zum Ausdruck bringen, dass ich zur Familie gehöre. Weil ich für sie da gewesen bin, als Clara und Dennis auf die Welt gekommen sind.
Eigentlich schon während der Schwangerschaft. Ihre Ängste waren riesengroß, obwohl sie diesmal unkompliziert verlief. Aber das war bei Valentin auch lange so gewesen, und ich versuchte sie zu beruhigen, rief fast jeden Tag an und fuhr so oft hin, wie es mein Dienstplan erlaubte.
Von den Ultraschalluntersuchungen wussten sie schon, dass Zwillinge unterwegs waren, nur deren Geschlecht wollten sie nicht auch noch vorab erfahren.
Als die beiden Rabauken dann zur Welt kamen, gesund und quicklebendig, waren Nadja und Daniel zum ersten Mal wieder so entspannt, wie zuletzt in … Dings – Bad Kissingen! Wo wir uns zuletzt alle getroffen hatten. Nach der Geburt baten mich die frischgebackenen Eltern um Hilfe. In ihrem Umfeld gab es ja keine Großeltern, die hätten einspringen können, oder Babysitter, die länger als für einen Abend zu buchen waren. Das ging so weit, dass wir jeden Tag miteinander telefonierten und ich ihnen Tipps gab. Manches von dem, was mir inzwischen im Beruf begegnet war, behielt ich allerdings für mich. Ein Jahr lang hatte ich Angst vor dem plötzlichen Kindstod und zählte die Tage bis zum ersten Geburtstag herunter wie einen magischen Countdown, nach dem für immer alles gut sein würde. Außerdem waren es keine Patienten, sondern die Kinder meiner besten Freunde. Hier übernahm nicht mal eben eine Kollegin für mich, wenn ich aufs Klo ging, sondern für 180 Sekunden blieben zwei Unfallmagneten unbeaufsichtigt. Man hat nie Feierabend, ist immer in Bereitschaft, räumt leise auf und kann nicht einschlafen, weil das Gedankenkarussell eine Ehrenrunde dreht. Wenn man aber die Zeit allein mit zwei fiebernden Kleinkindern überstanden hat, die mit Brechdurchfall kämpfen und einen natürlich anstecken, dann weiß man, was Eltern tagein, tagaus leisten. Kaum war ich weg, fehlten mir die beiden. Dann hustend und zittrig im Zug nach Hause zu sitzen, dabei aber zufrieden und vor Stolz grinsend, hat man sich ein Abzeichen verdient. Freischwimmer oder so. Zu meinem Glück haben Nadja und Daniel nicht lockergelassen. Sie waren von Anfang an davon überzeugt, dass ich mit den beiden zurechtkäme. So war es dann ja auch. Jetzt, wo sie älter sind, kommt es mir wie das Normalste der Welt vor, dabei ist dieses Vertrauen natürlich gewachsen.
Den beiden live dabei zugucken zu dürfen, war aber auch besser als Fernsehen: Als sie sich endlich auf den Bauch drehen konnten und aus dem angepeilten Nach-vorne-krabbeln ein Nach-hinten-schieben wurde. Dennis stieß vorwärts an ein Regal und Clara rückwärts an eine Wand. Beide konnten sich dort wackelig aufrichten und haben dann diese komischen Kniebeugen gemacht, wie sie nur Babys mit unsicherem Stand beherrschen, verblüfft über die eigene Leistung. Bald darauf folgten erste Schritte und viele von Windeln abgefangene Stürze auf den Allerwertesten. Immer weiter, niemals aufgeben. Wo ist dieser Enthusiasmus hin, den wir als Baby noch alle hatten? Er wird uns ausgeredet. Bis wir es irgendwann glauben und etwas in uns stirbt.
Mit Clara und Dennis habe ich so etwas wie Frieden gefunden, von dem ich nicht einmal geahnt hatte, dass ich ihn brauchte. Ich liebe sie wie meine eigenen Kinder, die ich nie haben wollte. Jetzt ist es zu spät dafür, und dass ich nichts vermisse, verdanke ich allein ihnen. Nadja und Daniel waren immer erreichbar und hätten im Ernstfall jeden Urlaub abgebrochen, aber ich wollte damals, dass sie Zeit für sich haben und wieder richtig zueinander finden. Nur auf Vornamen legten sie sich diesmal nicht vorher fest. Als ob das etwas mit Valentins Tod zu tun gehabt hätte. Aber ausreden wollte ich es ihnen auch nicht. Auf die Namen haben sie sich dann noch im Kreißsaal geeinigt. Zuerst kam Clara zur Welt und vier Minuten später Dennis. Zuerst war Klara noch mit K, aber beim Standesamt änderten sie es in Clara mit C, weil es dem D von Dennis direkt vorausging. Es brachte ihre Vornamen näher zusammen: CD. Der Tonträger passte zu Daniel, auch wenn er V-i-n-y-l vorgezogen hätte, aber deswegen Fünflinge zur Welt bringen zu müssen, lehnte Nadja dankend ab.
„Seid froh, dass ihr nicht Hänsel und Gretel heißt!“, erzählte ich ihnen später.
„Wieso?“, fragte Clara erschrocken und sah ihren Bruder schon im Ofen sitzen.
„Weil eure Mama euch im tiefen Wald zur Welt gebracht hat, darum!“
„Nicht in Marzahn?“
Ich schüttelte den Kopf. „Im Wald.“
Manchmal machte ich mir auf Spielplätzen einen Spaß daraus, sie bei falschen Vornamen zu rufen. „Hans! Sophie! Kommt mal rüber und seid diesem Sandkasten-Nazi ein Dorn im Auge.“
Sollten doch die anderen Kinder Großeltern, Opas und Omas, zwei Mütter oder mehrere Väter haben, für die beiden war ich ihr Märchenonkel, den sie alles fragen konnten und der auf alles eine Antwort wusste. Sie hatten eben einen Johann und kein Kindermädchen.
Ich guckte meine Post durch und ein Brief aus Berlin gab mir Rätsel auf. Erst dachte ich, die Zwillinge hätten mir einen Streich gespielt, weil mir „Deutsche Dienststelle (WASt)“ nicht gleich etwas sagte, und die wollten, dass ich ihnen Geld (16 EUR) überweise. Dann erinnerte ich mich: Vor – Was? Zwei Jahren? – hatte ich online einen Nachforschungsauftrag gestellt, um herauszufinden, wo mein Großvater im Zweiten Weltkrieg gedient hatte. So wie Opa vergessen wollte, dass er überhaupt im Osten gewesen war, habe ich inzwischen vergessen, dass ich es herausfinden wollte. Jetzt hielt ich die Antwort in Händen. Ach, Wehrmachtsauskunftstelle soll das heißen.
Viel erzählt hat er nicht und selbst daran kann ich mich erinnern. Irgendetwas war immer nicht richtig: ich noch zu jung, Mama nicht Mann genug oder sie hätte selbst dabei sein müssen, um es zu verstehen. Und so versandete alles nach unbefriedigenden Halbsätzen. „Im Osten … Zehen abgefroren …“ oder „Ihr wisst ja gar nicht was Hunger ist …“ Aber jetzt konnte ich selber nachschauen. Trotzdem musste ich vorher eine rauchen.
Nachdem ich jetzt mehrere Ortsnamen zusammen mit „Wehrmacht“, „Opfer“ und „Zivilbevölkerung“ gegoogelt habe, ist mir schlecht. Dass man vielleicht einmal nichts mitbekommen hat, würde ich wahrscheinlich noch akzeptieren, aber so oft? Dass man nur sich selbst in Birkenwäldchen eingegraben hat und eisige Nächte überstehen musste? Immer rein zufällig die Ohren zugehalten, während es gleichzeitig überlebenswichtig war, den Feind schon beim Anschleichen zu ertappen? Oder dass das im Krieg „normal“ sei – es war doch sein erster! Oder dass man die Einheimischen nicht als Menschen wahrgenommen hat. Ja, als was denn sonst? Giraffen oder was? Das hieße ja, man hätte die Nazipropaganda eben doch verinnerlicht, das Rassengeschwafel, die Nürnberger Gesetze. Wie das gehen soll, kann ich nicht begreifen. Das geht mir nicht in den Kopf.
Das ist, als würde man dir erzählen: übrigens, die Hexe hat in Wahrheit Hänsel und Gretel verspeist, und eigentlich war das deine Großmutter, die auch den domestizierten Wolf von Rotkäppchen gepökelt hat. Du weißt schon, die, bei der du deinen Kummer darüber, dass die Nachbarskinder auf einmal verschwunden waren, aufgegessen hast.
Ob das bei Kriegserinnerungen so ähnlich ist wie mit den Diensthandys, die sich magisch von selbst löschen? Oder wie Neujahrsvorsätze?
Und wie bringe ich das jetzt eigentlich Mama bei?
06.01.20
Schweißgebadet aus dem Schlaf aufgeschreckt wie in einem schlechten Film. Die Albträume sind wieder da. Wieder die Schule, aber anders. Ich war im Kolleg-Café. Dass es das gab, hatte ich total vergessen. Ein Zimmer allein für uns, mit einer röchelnden Kaffeemaschine, alten Sofas und einem Tisch, auf dem wir Backgammon spielten und Zigaretten drehten. Rauchen konnte man die dort offiziell nicht, aber heimlich haben wir es trotzdem gemacht. Wir tranken viel zu viel Kaffee, bis wir zittrig wurden und die Würfel ganz von allein in unserer Hand klackerten. Wahrscheinlich ist der Raum früher mal als Büro genutzt worden, aber jetzt war er unsere Oase.
Das Kolleg-Café lag im ersten Stock des B-Baus über dem Haupteingang oder dem, was einst der Haupteingang gewesen sein musste. Denn der B-Bau ist das älteste Gebäude der Schule, das anfangs sogar die ganze Schule war. Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, den Keller voller Leichen. Also in meinem Traum. In echt lagerten dort die Schulbücher. Und was war da noch? Ich glaube der Computerraum. Aber nicht Server, sondern alte IBM-Maschinen mit Grünmonitor. Heute Museum, damals gefühlt modern, bis sie vom C64 überholt wurden, der alles auf den Kopf stellte, was wir bisher über Computer wussten.
Die 8. Klasse war, glaube ich, unten, die 9. oben. Klassen steigen eben immer von unten nach oben auf, selbst wenn in den Klassenzimmern eigentlich etwas anderes unterrichtet wird. Darunter lag im Keller die Bildung selbst in Büchern – noch über den Opfern, deren Geschichten es nicht in sie hineingeschafft hatten.
Inzwischen ist mein Puls wieder normal und ich kann den Traum genauer unter die Lupe nehmen. Die Kaffeemaschine aus dem Kolleg-Café war mit Rohren verbunden, die in den Keller führten, an die jemand klopfte. Erst habe ich es für Tropfen gehalten, dann wurden die Schläge aber langsam lauter. Ich musste da sofort raus, so viel war klar. Über die naheliegende Treppe runter, oder besser an den Klassenzimmern vorbei und die hintere nehmen? Der längere Weg erschien mir sicherer. Dort könnte ich immerhin unten zurück Richtung C-Bau fliehen, zu dem ich mal die Schlüssel hatte, oder in die andere Richtung zum A-Bau, der mir im Traum als die klügere Wahl erschien.
Ich schob mich mit dem Rücken an der Wand entlang die Treppe hinunter und mit jedem Schritt wurde es dunkler. Auf dem unteren Treppenabsatz angekommen war es stockfinster und das einzige Leuchten kam natürlich aus dem Keller. Statt zu entkommen, wie ich es eigentlich bis dahin vorgehabt hatte, ging ich weiter hinunter. Unter meinen Fußtritten knisterte es; dort lagen überall Briefe herum, die mir an den Schuhen kleben blieben. Die Rohre der Kaffeemaschine waren natürlich am anderen Ende des Ganges, dazu musste ich aber an einer offenen Tür vorbei, aus der es rötlich schimmerte. Was auch sonst? Das war keine Essensausgabe, so viel wusste ich. Jetzt lagen nicht nur Briefe am Boden, sondern ebenso Schuhe und abgeschnittene Haare, dazwischen vereinzelt Schulbücher, Urkunden und Koffer. Ich ahnte, woran mich das erinnerte, erschrak, Hände griffen von hinten nach meinen Schultern, ich versuchte mich zu befreien … und hier sitze ich nun: unfähig auch nur an Schlaf zu denken.
Was noch schlimmer ist: Ich muss mich für die Arbeit fertig machen und hier gleich ins dunkle Treppenhaus. Nach unten. Wie soll ich das denn bitte anstellen? Mich vom Balkon an aneinandergeknoteten Bettlaken abzuseilen, erscheint mir gerade als logische Alternative.
Ich habe dann doch die Treppe genommen. Dabei legte ich mich zwar beinahe auf die Fresse, aber als ich draußen war, konnte ich zum ersten Mal heute wieder richtig aufatmen. Und als ich endlich anderen Menschen begegnete, hatte der Traum schließlich seine Macht über mich verloren und ich fuhr zur Arbeit. Ab morgen habe ich frei und hätte am liebsten spontan mit jemandem getauscht. Dann brachte mich Schwester Anita komplett durcheinander, als sie mich fragte, wann ich denn gedachte mal wieder eine Nachtschicht zu machen. Da nahm ich dann doch lieber die freien Tage. Nach der Schicht stattete ich Dr. Heßler einen Besuch ab.
Davon war der aber gar nicht so begeistert, wie ich gehofft hatte. Er wirkte wütend und verwirrt, auf seinen Händen waren Flecken, und ich dachte schon, dass er über Silvester gealtert sei, aber dann bat er mich um Entschuldigung. Und herein.
„Ach, es ist wegen deiner Farbbänder. Ich hab es mit dem grünen probiert, aber mir war die ganze Zeit, als hätte ich etwas mit den Augen. Das hat mich so geärgert, dass ich nicht mehr wusste, was ich schreiben wollte, also habe ich stattdessen versucht, das Band schwarz zu färben.“ Er hielt seine Hände zum Beweis hoch. Von einem Chirurgen hätte ich eigentlich mehr Fingergeschick erwartet als von mir, aber andererseits war das eine Operation ohne Assistenz und unter nicht optimalen Bedingungen, wie ein Blick in seine Küche bestätigte, aus der er zwei Bierdosen holte. „Aber die Farbe ist nicht überall gleichmäßig haften geblieben, also eher außen. Jetzt kommt nach zwei Seiten schreiben schon wieder das Grün durch, und es hat mich aus dem Absatz gehauen.“ Die Dosen zischten, als er sie gleichzeitig einhändig öffnete und mir eine reichte.
„Das tut mir leid.“
„Ach, schon gut. Das hat mir gezeigt, wie sehr ich zu Hause in einem Trott gefangen war, wenn mich schon die kleinste Abweichung aus der Kurve trägt. Also danke für die Lektion.“ Er stieß mit mir an. „Die tat not.“
„Äh, bitte“, sagte ich verunsichert, schob noch ein „glaub ich“ hinterher und nahm schnell einen Schluck.
„Was führt dich zu mir? Schon wieder Musikwünsche?“
„Nein, das ist es nicht. Oh, und vielen Dank natürlich.“ Ich sammelte mich und Heßler wartete geduldig.
„Habe ich dir von dem Rechercheantrag erzählt, den ich über meinen Großvater gestellt habe? Wo er im Zweiten Weltkrieg war?“
Heßler schüttelte den Kopf.
„Gestern kam die Antwort. Im Kessel von Demjansk. Bis gestern wusste ich nichts darüber und heute mehr, als ich jemals wissen wollte.“ Wir setzten uns. „Das war so ähnlich wie ein zweites Stalingrad, aber es ist nicht der soldatische Teil, der mich beschäftigt.“
„Dachte ich mir.“ Heßler legte mir eine Hand auf die Schulter. „Weiß deine Frau Mutter davon?“
„Frau Mutter?“
„Was denn, noch nie gehört? Ich mag die Formulierung, weil es nicht nur als Anrede funktioniert, sondern die Frau wieder von der Mutterrolle entbindet.“
Ich sah Heßler perplex an, ehe ich den Faden wieder aufnahm. „Nein, das kommt noch dazu.“
„Sprich besser mit ihr darüber, nicht mit mir. Ich hab meine Gefechte mit meinen Eltern, die noch selber Kriegsteilnehmer waren, schon vor Jahren ausgefochten.“
„Als sie noch lebten?“
„Das wäre mir lieber gewesen, aber nein.“ Er stand auf und klopfte nach kurzer Suche auf ein paar seiner Ordner im Regal. „Hier irgendwo fing es an und dann zog es sich …“ Er nickte.
„Inwiefern?“
„Na bis dort drüben.“ Heßler nickte noch einmal zum nächsten Regal, dessen Bretter sich bogen.
„Oh.“
„Da drin steht alles, was ich weiß. Vielleicht ist es später mal jemandem von Nutzen.“
„Aber wie sollen sich andere ohne ein Inhaltsverzeichnis darin zurechtfinden?“
„Indem jemand viel Zeit mitbringt. Die müsste man aber erst wieder haben.“
„Und wenn vorher alles vernichtet wird?“
Er zuckte mit den Schultern. „Pech gehabt.“
„Pech gehabt? Das ist deine Antwort? Wieso keine Kopie anfertigen, auf CDs brennen oder auf Memorysticks abspeichern?“
„Das kann dann sowieso keiner mehr öffnen. Ich weiß nicht einmal, ob man diese Ausgabe dann noch lesen kann, ob sich die Sprache selbst nicht zu sehr verändern wird.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Ich auch nicht, aber vielleicht zukünftige Leser. Ich schreibe für ein Hinterher, das wir nicht mehr erleben. Einen Brief an die Zukunft.“
„Du spinnst doch.“
Er lächelte. „Beweise es. Außerdem hab ich nichts Besseres zu tun. Im Hier und Jetzt helfe ich Kindern als Arzt und mit dem, was ich schreibe, vielleicht deren Kindeskindern in der Zukunft. Für mich gehört das zusammen.“
„Mein Großvater im Krieg auch?“, fragte ich verdutzt.
„Unbedingt. Wenn dich das Thema so sehr interessiert, lies was von Sabine Bode. Das hat mir sehr geholfen. Sie hat auch über die Enkelgeneration geschrieben, also deinesgleichen.“
„Werd’ ich mir merken, danke.“ Im Gehen fiel mir noch etwas ein und ich blieb stehen. „Was hältst du eigentlich von dieser Lungenkrankheit in China? Muss man sich da Sorgen machen?“
„Würdest du einem Augenarzt vertrauen, der von der offiziellen chinesischen Linie abweicht und behauptet, dass es sich um eine SARS-Variante handelt?“
„Ist wieder grippeähnlich, oder? Bei den letzten Malen ist es doch auch gut gegangen, und das Virus blieb dort.“
„Und wenn es nicht gut geht?“, fragte er.
„Dann holt es sich gerade Stempel in seinem Reisepass“, hörte ich mich zu meinem eigenen Erstaunen sagen.
Wieder zu Hause, wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich setzte mich aufs Sofa und musste an Olga von der Silvesterparty denken. Die würde ich eigentlich ganz gerne wiedersehen. Ich könnte ja raufgehen und klingeln, vielleicht gibt mir Manfred ihre Nummer? Nur weiß ich leider noch immer nicht, wie der aussieht. Es könnte ja jeder aus dem Treppenhaus sein. Umgekehrt würde es vermutlich genauso laufen: „Wer will das denn wissen?“
„Äh, ich. Johann? Von der Silvesterfeier?“
„Ich hab keinen Johann eingeladen.“ Rumms. Tür zu. Ach, dann eben kein Date. Frauke war mir da sowieso eine Lehre.
Ich stand auf und zog einen Film aus dem Regal. Full Metal Jacket. Nee, das pack ich jetzt nicht. Mutter mochte es nie, wenn ich Kriegsfilme guckte. Und nicht nur Kriegsfilme, einfach alle, bei denen Kämpfe oder gewaltsam ausgetragene Konflikte eine Rolle spielten. Meistens versprach bereits der Titel den zentralen Konflikt: Die Brücke von Remagen,Die Brücke am Kwai, oder einfach nur: Die Brücke. Im Grunde ging es immer darum, von einem Ufer ans andere zu gelangen oder genau das zu verhindern. Sehr viel klarer geht es kaum.
In vielen Kriegsfilmen gibt es ja zunächst eine Liebesgeschichte, ehe dann der Mann patriotisch verblendet in den Krieg zieht, die Hölle durchlebt und als gebrochener Mann heimkehrt. Geläutert zwar, aber zu spät. Die Frauen wussten es schon vorher besser, nur wollte das doch keiner sehen! Kein Junge wünscht sich, Liebespaare zu sehen oder die diplomatische Lösung eines kriegerischen Konflikts. Wo bleiben da die versprochenen Explosionen, die Bomben und das Knattern der Maschinengewehre? Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in Remagen – wer hätte da eingeschaltet?
Auch Katastrophenfilme folgen ja einem ähnlichen Muster. Würde von Anfang an auf die warnenden Wissenschaftler gehört werden, wären alle Städte rechtzeitig evakuiert und leergefegte Straßenzüge gingen stumm alleine unter. Dafür geht man doch nicht ins Kino! Nur leider wiederholen wir später im echten Leben, was wir in diesen Filmen gelernt haben. Wenn wir auf die Wissenschaft hören, von der wir wissen, dass sie recht hat, dann haben wir keinen Spaß beim Zugucken. Nur dass Spaß in diesem Fall bedeutet, dass wir selbst um unser Leben rennen müssen und nicht die Helden auf der Leinwand. Und geben wir es zu: Keiner von uns ist so in Form wie der Dauerläufer Tom Cruise, der sich seit 35 Jahren vor laufenden Kameras auf den Tag X vorbereitet.
Aber wo laufen wir eigentlich hin? Oder wovor weg? Es ist mehr das Weglaufen, oder? Wie es mein Vater gemacht hat. Man kommt mit der Frau zusammen, die man liebt, sie wird schwanger und plötzlich ist alles der Familie untergeordnet. Man hört selber auf, Kind zu sein und muss Verantwortung übernehmen. Oder man ergreift die Flucht. Flieht man in Friedenszeiten, dann ist man ein Feigling wie mein Vater. Aber verlässt man Frau und Kind für „höhere Motive“ im Kriegsfall, dann ist man plötzlich ein Held. Krieg und Kampf sind etwas, das Männer der Kernfamilie vorziehen, obwohl sie um den vermutlich desaströsen Ausgang wissen. Lieber auf dem Schlachtfeld bleiben, als Verantwortung für ein gemeinsames Leben tragen zu müssen. Ist Opa mehr an der wartenden Kleinfamilie zerbrochen als an der Kriegsgefangenschaft? Hat er sich kaum daheim angekommen schon wieder nach Sibirien zurückgesehnt? Wie traurig das alles ist.
Erst laufen wir den Frauen nach und kaum, dass sie einen erhören, laufen wir wieder vor ihnen davon. Bei Frauen scheint es genau umgekehrt zu sein: Erst laufen sie vor einem weg und wenn sie sich einem dann zuwenden, werden sie kurz darauf von uns alleingelassen. In den Krieg flüchten, vor der Weiblichkeit, und dann dort mit dem Blut nicht klarkommen. Da zuckt jedes Mädchen nur müde mit den Schultern. Jeder Mann fühlt sich wie ein General, der Millionen Spermien in die Schlacht schickt, den Tod der vielen in Kauf nehmend und nicht einmal der eine, der durchkommt, kehrt zurück. Oder ist es andersherum und die Gebärmutter ist wie ein Mikroskop, die ähnlich wie bei einem Gänseblümchen flüstert: „Den lieb ich nicht, und den nicht, den auch nicht …“ – und eine Million „den auch nicht“ später „Hab ich dich!“ ruft? Das Rennen geht halt immer weiter.
Nein, Mutter hat wie so oft auch hier recht behalten, aber es mich selbst herausfinden lassen. Keine Kriegs- und Katastrophenfilme mehr. Es ist Zeit für Geschichten, in denen gemeinsam etwas aufgebaut wird und die den Weg in eine Zukunft weisen, für die es sich zu kämpfen … nein, für die es sich zu leben lohnt.
Habe mir eine warme Jacke angezogen, mich eine Stunde auf den Balkon gesetzt und in die Sterne geguckt. Erst sah der große Bär wie ein Spermium für mich aus: großer Kopf, langer Schwanz. Dann löste sich selbst diese primitive Form auf und mit ihr endlich meine Unruhe.
08.01.20
Habe mir gestern einen Tag in den Carolus Thermen gegönnt. Das ist deutlich angenehmerer Schweiß als nach einem Albtraum. Ob die das als Werbespruch für sich benutzen würden, bezweifle ich allerdings. So entspannend das war: Warum fühlt sich ein Wellnesstag für mich nach Parallelgesellschaft an? Als würde ich dort nicht hingehören. Vielleicht liegt es an den Säulen? Bei denen denke ich an römische Senatoren, die einander hinterrücks erdolchen, und ich bin halt nur eher der Typ Sklave, der erst die Trauben vorbeibringt, dann das Blut in der Sauna aufwischt und sich kurz wegen Übelkeit hinsetzen muss. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt entspannter.
Oder war ich, denn laut WWF sind über eine Milliarde Tiere in den Feuern in Australien gestorben. Eine. Milliarde. Nicht Ameisen oder Insekten, sondern Koalas, Kängurus, Wombats und andere Fledermäuse. Bis jetzt. Weitere müssen später verhungern, weil es nichts mehr zu fressen gibt. Nein, auch nichts Gegrilltes, haha. Die Videoaufnahmen der verletzten wilden Tiere, die sich bereitwillig von Menschen anfassen und helfen lassen, zerreißen einen. Wobei das aus Sicht der Tiere vielleicht eine „Jetzt ist’s eh schon wurscht“-Haltung ist. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es ein „Wir sitzen alle im gleichen Boot“-Gedanke ist, der hier besser passt. Die Arche brennt. Kann das mal jemanden den Christen stecken? Auch das passiert gerade jetzt. Ich kann es nacheinander im gleichen Kopf denken, aber nicht verarbeiten. Spenden, wählen gehen, demonstrieren … All das erscheint mir als nicht genug. Und jetzt? Bin ich wieder verspannt.
Ich wollte auf etwas einprügeln und holte die Drumsticks heraus, die ich zu Weihnachten bekommen hatte. Irgendwo im Schrank müsste noch mein Übungspad sein, aber ich konnte es nicht finden. Darum habe ich meine Kissen zusammengetrommelt, die wenig überraschend jeden Rebound vermissen ließen. Auf dem Tisch hätte ich den zwar, nur dann auch garantiert viele kleine Dellen drin. Das hätte mir früher nichts ausgemacht, aber jetzt hält mich doch etwas zurück. Was noch schlimmer ist: Selbst für Kissen bin ich zu sehr außer Form, physisch wie rhythmisch.
Für das Tablet gibt es eine App, in der man dann mit den Fingern trommelt. Ernsthaft jetzt? Und da dann mit dem großen Zeh die Bassdrum spielen, oder was? Das ist doch albern. Ich will alles aus mir rauslassen, stattdessen tippe ich hier verkrampft über Kreuz, als hätte mir jemand zuvor Handfesseln angelegt.
Seit ich bei Lukas war, fehlt mir da etwas. Habe sogar damit angefangen, mir Schlagzeug-Videos anzusehen, nur um dann nicht selber proben zu können, obwohl es mir in den Gliedern juckt. Wo sollte ich auch mein Set hinstellen? Nur dafür einen Proberaum mieten? Ich weiß nicht. So weit geht die Liebe dann doch nicht.
Die Zwillinge haben durchgebimmelt. Eigentlich nur Dennis, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, dass Clara nicht weit ist. Oder umgekehrt. Als wüssten sie immer genau, wo der andere gerade ist.
„Wo steckt denn Clara?“, wollte ich wissen.
„Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder im Kino mit Mario.“
„Du klingst gar nicht mehr so ablehnend“, stellte ich vorsichtig fest.
„Was bleibt mir denn auch anderes übrig? Alle haben ihn über die Feiertage ins Herz geschlossen, Mama auch. Und sogar Papa.“ Dennis seufzte und fügte kleinlaut hinzu: „Selbst ich. Brauchst gar nicht so zu grinsen!“
„Entschuldige.“ Ich konnte nicht anders. Wir haben eben doch etwas aus den Fehlern unserer Eltern gelernt. Nadja und Daniel auf jeden Fall. Sie legten den frisch Verliebten keine Steine in den Weg, sondern nahmen Mario stattdessen in ihr Zuhause auf, und selbst Dennis ist der lebende Beweis, dass jeder Groll mit der Zeit verschwindet. „Warum funkst du mich eigentlich an?“
„Ich wollte mich noch für den Gutschein bedanken …“
„Jaja, kein Problem. War ein bisschen aus der Verlegenheit heraus, dass ich dieses Jahr nicht wusste, welche Spiele gerade angesagt sind. Ehrlich gesagt war ich mir gar nicht mehr sicher, ob du überhaupt noch zockst.“
„Über die Feiertage schon. Ich bin widerwillig Dirt Rally 2.0 gefahren.“
„Wieso widerwillig?“
„Lach bitte nicht, aber um mir von Mario nicht meine Echtzeit-Strategiespiele madig machen zu lassen. Er meint, die hätten nichts mit richtiger Politik und der echten Welt zu tun.“
„Gibt es denn kein Spiel, in dem man in der überfüllten S-Bahn sitzt und versucht, ein Buch zu lesen? Und dann darf man irgendwann Fernzüge benutzen?“
„Sehr witzig“, sagte Dennis müde. „Er kann viel besser über alles reden und ich mag mich nicht streiten. Darum spiele ich lieber heimlich.“
„Und dann bist du vom vielen Autofahren zu müde?“
„Ja, auch, aber eigentlich eher gekränkt“, gestand Dennis. „Weil so einfach sind die wirklich nicht. Man muss alles in Balance halten, wenn man nicht mit Gewalt durchgreifen will, was auch nur reicht, bis man gewonnen hat – aber wie ginge das Leben hinterher weiter? Verstehst du, was ich meine?“
„Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, was dir gefällt. Lass ihn reden.“
„Wenn das nur so einfach wäre …“ Er schnaubte. „Weißt du, das ist immer ein bisschen von oben herab, weil er älter ist.“
„So ähnlich wie wegen der paar Minuten, die Clara vor dir auf die Welt gekommen ist? Das renkt sich schon noch ein“, ermunterte ich ihn. „Wahrscheinlich ist er deinetwegen nur nervös, weil du deine Schwester auf eine Art und Weise kennst, die er nie verstehen wird. Vielleicht merkt er nicht einmal, dass er das kompensiert, indem er dir Dinge madig macht.“
Dennis lächelte. „Danke, Smörre. Da ist aber noch was. Weißt du, Clara macht, seit sie Mario kennengelernt hat, Fotos von sich vor dem Spiegel, wie sie auf ihr Telefon guckt.“
„Du meinst Selfies?“
„Nein, da würde sie in die Kamera schauen. Sie fotografiert ihr Spiegelbild. Von weiter weg, verstehst du? Dass man mehr von ihr sieht? Sie kontrolliert, wie ihr Körper aussieht, in welcher Pose.“
Das war mir in der Klinik auch schon begegnet, als übliches Verhalten von Mädchen in dem Alter. Ich dachte zuerst, das sei heute besser als früher, weil die Bildschirme so klein sind, aber die zoomen leider darin herum und sehen jedes Detail als Problemzone. Die Filter machen es natürlich noch schlimmer, weil sie genau das Natürliche herausrechnen. Und es bleibt nicht mehr im eigenen Kinderzimmer, sondern die Meinung der halben Welt wird eingeholt. Was für eine Seuche.
„Niemand geht mit Bildern aus“, sagte ich zu Dennis. „Eine Frau ist schön, wenn sie sich in ihrem Körper wohlfühlt. Da gibt es keine Problemzone mehr, sondern nur noch Amazone.“
„Das gefällt mir. Darf ich dich zitieren?“
„Nur zu. So wie du deine Schwester anguckst und sie dich, so müssen das auch alle anderen tun und aushalten. Wenn nicht, sind sie eh nicht die Richtigen für euch.“
Das erinnert mich daran, als ich die Zwillinge einmal aus der Vorschule abgeholt habe und wir zu Hause zum ersten Mal gemeinsam Pizza backen wollten. Weil sie sich auf keinen Belag einigen konnten, durften beide ihre eigene nach Lust und Laune belegen. Während sich die Mehlschwaden in der Küche langsam legten, wurden auch sie endlich ruhiger, aber Dennis schien etwas auf der Seele zu brennen.
„Soll ich Salamischeiben abschneiden?“, fragte ich versuchsweise.
Dennis presste die Lippen fester aufeinander und schüttelte den Kopf.
„Er isst keine Salami mehr, seit er weiß, dass dafür Tiere sterben müssen“, erklärte Clara für ihren Bruder.
„Ah, okay. Gibt ja auch genug andere leckere Sachen, die man auf die Piz…“
„Es geht überhaupt nicht um die Pizza, sondern um Gesine! Die ist doof! Und hässlich!“
„Dennis, wie fändest du es, wenn jemand so über deine Schwester reden würde?“
Clara sah auf und dann ihren Bruder betreten an.
„Da weiß ich ja, dass es nicht stimmt, aber Gesine ist doof. Und wie sie dann immer guckt … Da werde ich wütend.“
„Stimmt das?“, fragte ich Clara.
„Ich hab nicht mit ihr gespielt.“
„Das tut eigentlich eh nichts zur Sache…“, sagte ich kopfschüttelnd und fuhr fort, „… weil … Also hast du das überhaupt laut gesagt? Also im Kindergarten?“
„Weiß nicht.“
Ich sah Clara an, deren Blick zwischen mir und Dennis hin und her ging, dann nickte sie kaum wahrnehmbar.
„Das hast du gehört? Ihr wart doch draußen!“, beschwerte er sich.
„Du warst so laut …“
„Okay, dann möchte ich, dass du dich morgen bei ihr entschuldigst“, sagte ich mit so viel Autorität, wie ich aufbringen konnte.
„Was? Wieso denn? Sie hat doch gemogelt und zu früh mit dem Suchen angefangen.“
„Ihr habt also Verstecken gespielt?“, fragte ich.
„Ja.“
„Und die anderen haben sich schneller verstecken können, als du?“
„Vielleicht.“
„Woher weißt du denn, dass sie gemogelt hat?“
„Weil ich’s gesehen hab. Als ich ein anderes Versteck suchen musste. Sie hat durch ihre Finger geguckt. So.“ Dennis machte es vor und fächerte seine mit Zutaten verklebten Finger vor dem Gesicht auf.
„Verstehe. Aber weißt du auch, dass Mädchen ein Gedächtnis wie Elefanten haben? Sie vergessen nichts, was jemals zu ihnen gesagt worden ist. Auch wenn es nur ein Spiel war.“
„Sie ist aber trotzdem hässlich! Und Martin sagt das auch!“
„Dennis, dir gefällt nur Gwen von Ben 10“, stellte ich fest. „Und die ist nicht mal echt.“
„Stimmt nicht!“
„Doch“, widersprach seine Schwester.
„Clara, das war ein Geheimnis!“
„Das war noch nie ein Geheimnis, das sieht man dir an. Aber glaubst du, dass das so bleibt? Das du nur Zeichentrickmädchen magst? Wenn ihr größer seid, dann erkennt ihr euch kaum wieder. Dein Geschmack ändert sich, genau wie bei der Salami.“
„Ich will Gesine nicht auf meiner Pizza!“
„Das … So habe ich das nicht … Was ich sagen wollte, ist, dass sie in ein paar Jahren das schönste Mädel der Klasse sein kann und du dich dann für Mädchen interessierst.“
„Das passiert nie! Versprochen!“, sagte Dennis mit großer Erleichterung in der Stimme.
„Und was, wenn doch? Klar, du kannst dir das jetzt nicht vorstellen, aber deswegen kann es trotzdem so kommen. Das ist wie mit Windpocken: Die will auch niemand haben und man kriegt sie trotzdem. Und wenn du dann auch andere Mädchen als deine Schwester toll findest, aus … Gründen, dann werden dir deine heutigen Worte auf die Füße fallen.“
„Als wäre ein Elefant darauf getreten?“, fragte Dennis verunsichert.
„So ähnlich.“
Dennis guckte nachdenklich zu seiner Schwester. „Wenn dich einer doof oder hässlich nennt, hau’ ich ihm auf die Nase.“
„Ich weiß“, sagte Clara, und wie sie dabei lächelte, bereitete mir gleich neue Sorgen.
Dennis sah mich an. „Du meinst, das hat Gesine wehgetan?“
„Bestimmt. Oder hat dich ihr Bruder verhauen?“
„Die hat keinen, sie … oh.“
Jetzt war der Groschen gefallen.
„Das wollte ich nicht.“ Dennis ließ die Schultern hängen. „Ich guck sogar selber heimlich durch die Finger, wenn ich dran bin. Aber nur ein bisschen.“ Er krümelte etwas geriebenen Käse von seinen Fingern. „Martin sagt sowieso zu allen, dass sie hässlich sind. Weil er sich immer im gleichen Schrank versteckt.“
Damit war die Sache gegessen und die erste Pizza endlich im Ofen.
Als ich die beiden am nächsten Tag abholen kam, war Dennis erst recht eingeschnappt. „Weißt du was? Mädchen sind doof!“
„Was ist denn passiert?“
„Ich hab mich bei Gesine entschuldigt.“
„Und dann?“
„Dann hat sie gesagt, ich sei noch blöder als Martin!“
„Autsch.“ Ich konnte mir das Grinsen kaum verkneifen.
„Das ist überhaupt nicht lustig! Ich rede kein Wort mehr mit ihr! Nie mehr!“
In gewisser Weise behielt er damit sogar recht, lag aber dennoch daneben. Denn Nadja erzählte Wochen später am Telefon, dass Dennis mit einem Mädchen beim Doktorspielen erwischt worden sei. Sie hätten sich versehentlich im gleichen Schrank versteckt und seien auch dringeblieben, als sie niemand gefunden hat. Ich tippte auf Gesine und es stimmte. Nadja war beeindruckt und ich erzählte ihr die Vorgeschichte.
Das muss um die Zeit gewesen sein, als Nadja wieder damit begonnen hatte, in einem Hostel auszuhelfen. Zunächst nur in Teilzeit, später voll. Sie liebte von Anfang an den Kontakt mit jung gebliebenen Menschen aus aller Welt, die sie an sich selbst und Daniel erinnerten, wie sie 1990 in Berlin angekommen waren: mittel- und planlos, in Wohncontainern. Sie genossen heute zwar eine ungekannte Freiheit, waren aber immer noch auf der Suche nach etwas. Weil Nadja an der Rezeption arbeitete, wurde sie so oft gefragt, was man in Berlin ansehen sollte, wie man hierhin oder dorthin käme, dass sie anfing, davon genervt zu sein. Bis sie auf die Idee kam, ihnen eine Art Kompass zu sein, der sie auf die richtige Spur brachte. Dann schickte sie die Leute zum Beispiel in ein Museum oder eine Bibliothek – Hauptsache an einen stillen Ort, wo sie zunächst mal mehr in sich selbst hineinhorchen konnten, und nicht in die lauteste Disco, die alle inneren Impulse übertönte.
Dabei hörte sie immer genauer hin, was die Neuankömmlinge erzählten, wo sie herkamen, welche Sprachen sie wie gut beherrschten, welche Lieder sie sangen. Nadja sah manchen bereits an ihrem Gepäck an, wie sie tickten und entwickelte ein intuitives Gespür dafür, was sie erleben sollten. Es sei wie nach einem fehlenden Puzzlestück zu suchen, das von der Tischkante gerutscht war, beschrieb Nadja ihre Einstellung. Noch vermisste es niemand, so sehr am Anfang der Motivsuche standen viele. Ein Puzzle ohne dazugehörige Schachtel. Was Nadja ihnen gab, war ein Stück vom Rahmen, eine Kante, an der sie sich stoßen würden, wo es für sie nicht weiterging. Eine Perspektive, etwas, wogegen man mit dem Rücken gelehnt stehen konnte und einen Überblick auf das bekam, worauf man in seinem Leben Einfluss hatte.
Manche Gäste hatten sich über Nadja beschwert, weil sie glaubten, absichtlich zur falschen Adresse geschickt worden zu sein, andere bedankten sich überschwänglich, so dass die Geschäftsleitung nicht so recht wusste, was sie von diesem Feedback halten sollte – also beschäftigte man sie weiter. Das war ihr Glück, denn Nadja wurde mit der Zeit immer besser in dem, was sie tat, und als dann die ersten Gäste kamen, die aufgrund der Empfehlung anderer ihretwegen dort abstiegen, obwohl es billigere Hostels in der Stadt gab, bot man ihr eine Vollzeitstelle an.
„Für mich ist das wie der Weltraumbahnhof, auf den ich immer wollte“, erzählte sie später. „Aber nicht um als Kosmonautin selbst zu den Sternen zu reisen oder um die Reisen anderer vom Boden aus zu betreuen, sondern … Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.“
„Du liest ihnen die Karte, bist ihnen das Navigationssystem, die Versorgungskapsel?“, fasste ich zusammen. „Ein Leitstern. Wie für Seefahrer auf dem Meer, die die Orientierung verloren haben.“
Daniel war anfangs nicht so begeistert von ihrer Entscheidung gewesen, aber andererseits verdienten beide jetzt auch ohne Studium gut genug, um über die Runden zu kommen. Ich musste immer seltener einspringen und die Besuche verlagerten sich wie von selbst in Richtung der Schulferien. So haben wir zu dritt die Care-Arbeit bestritten und ich kann noch immer kaum glauben, dass die Kinder bald volljährig sind.
10.01.20
Gestern war ich nach der Arbeit im Altersheim. Zum Glück, denn Schwester Heide hätte mir sonst noch unbedingt mein Jahreshoroskop vorlesen wollen. Sie versprach, es nachzuholen. Eigentlich wollte ich nur Mutter wie besprochen abholen und bei dem Griechen um die Ecke was mit ihr essen gehen, aber wie so oft musste sie „vorher noch kurz was machen“. Also stand ich zunächst ein paar Minuten blöd rum, dann eine weitere Viertelstunde, bis ich mich schließlich hinsetzte und aus dem Fenster guckte. Draußen war es schon dunkel, genau wie drinnen, wo noch niemand auf die Idee gekommen war, Licht anzumachen, als mich plötzlich eine Stimme aus dem Nichts ansprach.
Ich zuckte zusammen, weil der Ohrensessel neben mir bis eben leer gewirkt hatte. Darin verbarg sich ein alter Mann, dessen Haut so eingefallen und blass war, als hätte jemand im Vorbeigehen ein Laken über ein Skelett geworfen. Mein an den Kehlkopf hüpfendes Herz morste mir eine Antwort: „Bitte was?“
Der Mann räusperte sich, was so klang, als ob er mit einem stumpfen Werkzeug Buchstaben aus seinen hoffentlich dritten Zähnen hobelte. „Ob Sie gedient haben.“
„Was? Ach so, ja.“ Ich entspannte mich nach dem ersten Schreck etwas.
„Einheit?“
„Ja, genau um die Zeit herum. In einem Krankenhaus.“
„Verletzt worden, wa? Osten oder Westen?“
Ich seufzte leise. Es war zwecklos, hier etwas erklären zu wollen. „Westen.“
„Gut verheilt“, sagte er und deutete auf meine Handgelenke. Wie hat er das im Dunkeln überhaupt gesehen? „Ich hab welche gesehen, die es damit nicht mehr bis ins Lazarett geschafft haben, oder nicht mehr von dort wieder zurückkamen. Finger zu zittrig, zu tief geschnitten. Andere hat die Blutvergiftung geholt. Gut verheilt, alles.“
„Na ja, ‚verheilt‘ hat sich damals doch das ganze Land“, scherzte ich.
„Bitte?“ Er lehnte sich vor und ich fürchtete, sein Schädel könnte ihm vom Hals in meinen Schoß rollen.
Schnell das Thema wechseln. „Wo waren Sie denn im Lazarett?“
„Nirgends. Nicht einmal“, erwiderte er und versank wieder im Schatten. „Ein Wunder, sag ich dir. Ich war überall dabei, um mich herum hat es alle erwischt – und ich immer durch. War mir unheimlich. Und dann kriegt dich nach dem Krieg der Krebs. Meer konnte ich noch nie leiden. Gebirgsjäger halt“, sagte er entschuldigend. „Hier schimmelt alles.“
Stille breitete sich zwischen uns aus, die Worte glitten zu Boden und verschmolzen mit dem Fliesenmuster. Meine Mutter ließ immer noch auf sich warten, also konnte ich auch versuchen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Wer wusste schon, ob nicht sein Leben davon abhing? Oder daran wie an einer Angel, die ich nur vorsichtig einzuholen brauchte. „Fehlen Ihnen die Berge?“
“Ach wo, jetzt ist schon jede Treppe eine Herausforderung, vor der ich kapituliere. Unter wem hast du noch mal gedient?“
„Oberst Keuch, Heeresgrippe Nord, obere Atemwege.“
“Kenn ich nicht. Was’n das für ein Dienstgrad?“
Herrgott, was stand noch in den Unterlagen von Opa? Böck oder Bock? „Äh, General Berentz…en?“
„Hans Boeckh-Behrens, Generalleutnant! Selber verwundet gewesen und doch immer wieder gekommen.“
„Jaja. Der.“ Als ich die Sprache meines Großvaters sprach, die mir nichts sagte, verstand er mich plötzlich. Oder etwas. Die rostigen Worte hatten langsam eine Tür geöffnet: Sesam, öffne dich.
„Kirchensittenbach.“
„Ich versteh nicht …“





























