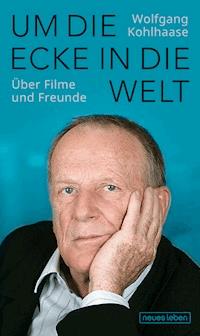Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Mit seinem Witz, seiner melancholischen Brillanz und seiner novellistischen Durchschlagkraft ist dieser Erzählband schlicht ein Meisterwerk." Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung Wolfgang Kohlhaase gilt als einer der wichtigsten Drehbuchautoren der deutschen Filmgeschichte – sein schriftstellerisches Werk hingegen ist kaum bekannt. Lebensklug und gelassen, voller Sprachwitz und dabei durchaus lakonisch, manchmal eher komisch, manchmal eher melancholisch sind diese Erzählungen: Ihren Anfang haben sie noch in der Kriegszeit und werfen dann Schlaglichter auf das Leben wie es war, danach, im Osten des geteilten Lands. Die Titelgeschichte erzählt von dem Studenten Straat, der behauptet, persisch zu können, um sich im Lager eine Überlebenschance zu sichern. Nun soll er dem Kapo, der nach Kriegsende nach Persien will, Sprachunterricht geben. Es bleibt ihm nur der Ausweg, eine Sprache zu erfinden … Die Erzählung ist Grundlage für den 2020 in die Kinos gekommenen Film Persischstunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erzählungen erschienen erstmals 1977 unter dem Titel Silvester mit Balzac und andere Erzählungen im Aufbau Verlag in Berlin und Weimar.
E-Book-Ausgabe 2021
© 2021 für diese Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Mit freundlicher Genehmigung der henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH
© für das Nachwort: Andreas Dresen
Covergestaltung: Julie August.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143136
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3335 9
www.wagenbach.de
Erfindung einer Sprache
Man ruft zehn Nummern durch den Lautsprecher, die zehnte ist seine. Straat fühlt weder Angst noch Hoffnung. Er tritt aus der Reihe, taumelt zwischen Rücken und Gesichtern bis zum Ende seines Blocks, schwenkt nach rechts und geht mit mühsamen Schritten auf den Mann zu, der ihn aufgerufen hat und der auf einem Podium steht, vor sich ein Pult mit Papieren und ein Mikrofon.
Es ist April, im Jahr vierundvierzig. Straat, der zehnte in der Reihe, die sich aufstellt, mit dem Gesicht zur Wand, ist zum Sterben müde, obwohl es früh am Tag ist, obgleich er so jung ist. Der Himmel, in den er sieht, wenn er den Blick über das Dach des Wachhauses hebt, ist niedrig und naß. Ein Stück unter den Wolken entlang, ein Stück um die Erde herum, liegt Holland. Von dort hat man Straat hergebracht, mit fünf anderen, vor hundert Tagen, vor langer, langer Zeit. Warum? Damit er schwitzt, damit er friert, damit er Steine trägt, Prügel kriegt, im Dreck liegt, auf Brettern schläft, faules Gemüse frißt und endlich aufhört zu sein. Aber vorher, noch atmend, noch blickend, soll er vergessen, wer er war. Er hat es auch schon fast vergessen. Undenkbar, daß es dort, unter dem Himmel entlang, noch immer den Ort gibt, an dem er geboren wurde, Erde und Wasser, die Eltern, die Abende, den anderen Geruch der Mädchenklasse, die Geräte hinter der gläsernen Schranktür, die Physik. Sechs Semester davon, undenkbar. Denn das Gesetz von der Erhaltung der Energie gilt ja nicht mehr. Gilt nicht für die, die mit den Steinen über die große Treppe laufen, unter den Knüppeln, vor den Visieren, von Dunkelheit zu Dunkelheit. Sechs Physikstudenten, fünf sind hin. Der letzte, zum Sterben müde, ist Straat. Und er geht an diesem Tag nicht in den Steinbruch, weil seine Nummer aufgerufen wird.
Zehn Mann, wohin aber gehen sie? In den Bunker? Ins Revier? Vornweg läuft ein Kapo in weißer Jacke, der führt sie in die Küche. Haus aus Stein, innen gekachelt. Sechs blitzende Kessel, darin wird die stinkende Suppe gekocht. Aber wegen der Suppe holt man sie nicht. Man holt sie wegen der Kartoffeln.
Der Kommandant veranstaltet einen Kameradschaftsabend. Die Posten, die Totschläger, die Zahlmeister, die Aufseher, die Materialverwalter, die Folterer, die Schreibstubenkräfte, der Arzt sitzen bei solchem Anlaß an langen Tischen gemütlich beisammen. Und der Abend ruht auf drei Säulen: erstens Kameradschaft, zweitens Bier, drittens Schweinebraten mit Kartoffelsalat. Deshalb stehen zehn Schemel in der Lagerküche, zehn Körbe mit Kartoffeln daneben, zehn Schüsseln für Abfall davor, ein Metallkübel in der Mitte, und auf einem der Schemel hockt Straat.
Es ist warm und still in der Küche. Der nahe Steinbruch ist weit weg. In einem Verschlag neben der Tür sitzt ein SS-Mann und liest. Nur der Kapo stellt sich mal zu den Kartoffelschälern und sieht ihnen zu. Keine Bosheit, fachliches Interesse. Dennoch beginnen Straats Finger zu zittern, er ist nicht geübt, die Schalen werden zu dick, es geht zu langsam im Schatten des Kapos, der ihm auf die Hände blickt. Der geht weg und kommt wieder. Straat arbeitet hastiger, aber es hilft nichts, schon hört er die Frage: »Was hast du denn früher gemacht, du?«
»Student«, sagt Straat und sieht nicht hoch und hört nicht auf, mit flatternden Händen zu schälen. Doch gleich wird er einen Tritt kriegen. Der SS-Mann hinter der Scheibe wird von seinem Buch aufblicken. Und dann? Der Kapo sagt aber nur: »Aus mit Studieren, was?«
Mittags kriegen sie eine Schüssel dampfende Suppe, von oben, wo ein paar Fleischfasern schwimmen. Dann eine zweite Schüssel, voll bis zum Rand. Straat lehnt draußen an der Wand des Küchengebäudes mit all der Suppe im Skelett, ruhig. Plötzlich kein Hunger mehr. Nicht der Steinbruch. Kein Geschrei. Entfernt, unter dem elektrischen Zaun, wo niemand zu laufen hat, entdeckt er einen Schimmer Grün, und er erinnert sich: Man hat April. Der Kapo beobachtet ihn und schlendert heran und fragt: »Was hast du denn studiert, Mann?«
»Physik.«
»Verstehe«, sagt der Kapo im Ton eines Eingeweihten.
Nachmittags hat Straat weniger Angst, wenn der sich neben ihn stellt. Ein bißchen Sonne fällt schräg in die Küche, die Kartoffeln plumpsen ins Wasser, das Stammkommando, in weißen Schürzen, schneidet Brot für den nächsten Tag, wer kann glauben, daß jetzt hier und da einer stirbt, im Sand, nicht weit ab. Der Kapo steht wieder bei Straat und hat ein Bedürfnis, sich mitzuteilen.
»Verflucht, wenn ich hier rauskomme«, sagt er, »nach dem Krieg, dann gehe ich nach Persien.«
Der Kapo hat nämlich, erzählt er Straat, einen Bruder in Persien, der ist gerade noch rechtzeitig weg, neununddreißig, und jetzt sitzt er da und ist ein großer Geschäftsmann, und der Kapo sitzt hier und ist ein Idiot.
»Du bist Holländer«, sagt der Kapo. »Was meinst du, ist Persien gut?«
»Bestimmt gut«, sagt Straat. Er schält und schält, nur schält er nicht mehr so schnell. Der Kapo, im weichen Nachmittagslicht, nickt wie jemand, der sich verstanden fühlt, und kommt ins Seufzen.
»Schade nur um die Zeit, die schöne Zeit. Wenn man hier wenigstens Persisch lernen könnte.«
Er blickt bekümmert, redliche Kumpelfalten im Gesicht, ein Mann nahe Vierzig und ausreichend ernährt, verglichen mit den Ruinen, die da im Kreis sitzen, das Schicksal hat ihn geworfen und dann erhoben, aber angeschissen ist er doch. Ja, ja, mein Lieber. Straat hört sich plötzlich sagen: »Ich kann Persisch.«
Der Kapo sieht ihn aus blassen blauen Augen lange an, erst ungläubig, dann zweifelnd, dann beinahe zärtlich.
»Du kannst Persisch?«
Straat nickt mit starren Zügen.
»Komm mit.«
Der Kapo rennt vor, Straat folgt ihm stolpernd in den Büroverschlag.
»So, jetzt sag mir mal, woher du Persisch kannst.«
Es gibt schon keinen Rückweg mehr für Straat. Mit einem Kapo macht man keine Witze, schon gar nicht, wenn man nur noch einen Stoß braucht, um zu fallen und nicht mehr aufzustehen. Straat will auch keinen Witz machen, er will nur nicht mehr in den Steinbruch, wo er verrecken wird, er will in der Küche bleiben, wo er wie ein Mensch auf einem Schemel sitzt und Kartoffeln schält und wo er Suppe kriegt. Er hat nur Angst, daß seine Stimme versagt, die verläßt ihn aber nicht, die ist nur sehr leise. Er sagt: »Ich war in Persien, vor dem Krieg.«
»Mensch, weißt du, was dir passiert, wenn das nicht stimmt?«
Straat hat soviel Schreck im Blick, daß der Kapo sicher ist, der weiß, was ihm blüht.
»Los, was heißt Guten Tag?«
»Dalam«, sagt Straat.
»Und Scheiße?«
Straat überlegt zu lange, der Kapo wird gleich ungeduldig.
»Es muß doch ein Wort für Scheiße geben.«
»Tupa«, sagt Straat.
»Tupa«, wiederholt der Kapo ergriffen. Dann sagt er: »Jetzt schälst du um dein Leben.«
Soweit, was sie reden. Es bewirkt viel. Zum Beispiel, daß der Küchenkapo Battenbach den Rottenführer Roeder abfängt, der nach ausgedehnter Tischzeit wieder erscheint. Er stellt ihm dar, daß er seit langem einen Mann mehr im Kommando brauche, nie hätte der Richtige sich gefunden, aber jetzt sei ihm jemand aufgefallen durch besondere Anstelligkeit. Der Rottenführer nickt zu dieser Rede. Er hat auch nichts dagegen, sich einen so hervorstechenden Mann einmal anzusehen. Battenbach hinter sich, stelzt er zu den Kartoffelschälern hinüber und betrachtet sich den halbverhungerten Holländer, vormals Physikstudent, sechs Semester lang, aber was interessiert das Roeder. Was den interessiert, das sieht er schon, und zwar sieht er, daß dieser Mann nicht einmal ahnt, wie man Kartoffeln schält, so verzweifelt er sich auch anstrengt. Aber darauf kommt es nicht an, weil der Rottenführer zweimal die Woche ein Stück Wurst mitnimmt, sonntags einen Braten und immer mal einen Würfel Margarine. Das alles kommt von Battenbach. Also nickt Roeder ein zweites Mal und geht wieder in seinen Verschlag zurück und schreibt Namen und Nummer auf einen Zettel. Der gelangt später am Tag zur Arbeitsstatistik. Von dort zum Arbeitsdienstführer. Und am nächsten Morgen, der feucht über den Appellplatz steigt, kehrt Straat als einziger von zehn Kartoffelschälern in die Küche zurück, wo Battenbach ihm freundlich auf die Schulter haut.
Denn Straat ist nun Battenbachs Mann. Der soll nicht zu Knochenasche verbrannt werden, der kriegt Suppe und Brot, damit er wieder hochkommt. Um so einen Kopf ist es schade, sagt sich Battenbach und reibt sich die Hände, weil man ihn zwar eingesperrt hat, wegen Zuhälterei, unpolitisch, aber daß er nun Persisch lernt, das verhindern sie nicht. Das kann auch Roeder nicht wissen, der die ersten Tage um Straat herumstreicht und sich etwas zu denken versucht, das kann er nicht wissen, daß den satten Kapo und den hungrigen Holländer eine besondere Sprache verbindet. Aber daß es diese Sprache gar nicht gibt, das kann selbst Battenbach nicht wissen. Das weiß nur Straat. Er allein bestimmt über Regeln und Wörter. Wie viele Wörter wird er brauchen, an wie vielen Tagen?
Mittags, sobald der Rottenführer Roeder zum Essen weg ist, ruft Battenbach Straat in die Schreibstube und setzt sich gesammelt hinter den Tisch, vor sich geglättetes Papier und einen Bleistiftstummel, bereit, sich Persisch anzueignen. Am ersten Tag will er auch Allgemeines über Persien hören. Straat läßt es dort heiß sein und läßt die Frauen schön und die Armen arm und die Reichen reich sein. Battenbach ist befriedigt, so hat er es sich vorgestellt. Er selbst kommt aus der Vergnügungsbranche, gibt es das auch? Puffs? Straat weiß nicht gleich, Battenbach macht sich verständlich. Ja, natürlich, unbedingt, sagt Straat. Und Battenbach nickt, es ist, wie er dachte. Aber jetzt will er ein paar Wörter wissen: Schnaps, Polizei, danke, bitte, Tisch, Stuhl, Bett, Kantine, Kotelett. Straat darf nicht zögern, nicht am ersten Tag. Er nennt alles der Reihe nach: alan, monato, laps, nam, toki, sol, oltok, runidam, kotelett. Das ist ein Leihwort, sagt Straat, das ist international.
Mit schwerer Hand schreibt Battenbach sich alles auf. Abends, unter der zerlumpten Decke, an seiner Schulter die Schulter des Nachbarn, der mit ihm die Pritsche teilt, eine lähmende Mattigkeit hinter den Augen, abends sucht Straat nach Wörtern, vor allem aber nach einem System, mit dessen Hilfe er sie sich merken kann. Der schwere Atem der Erschöpften umgibt ihn, der Mann neben ihm stöhnt im Schlaf, Straats Lippen formen Bedeutungen, die nie jemand gehört hat: or, tal, mel, met, meb, das heißt: ich, du, er, sie, es.
Battenbach schlägt ihm die Faust zwischen die Augen, tritt ihn vor das Schienbein, stößt ihn gegen die Wand, Battenbach zittert vor Wut und Enttäuschung. Es ist wegen runidam, dem persischen Wort für Kantine. Straat hat es am ersten Tag erfunden und nun, wo Battenbach ihn danach fragt, hat er es vergessen. Und Straat wußte, daß ihm etwas entfallen war, aber Battenbach hat ihn keinen Blick auf seinen Zettel werfen lassen und hat zwei Tage gewartet und hat neue Wörter notiert und hat sie sich buchstabieren lassen, nur damit Straat ihm nicht über die Schulter sieht, und jetzt hat er ihn zwischen den Fäusten und wird dieses holländische Schwein überführen, noch ehe die Mittagspause vorbei ist. Zehn Jahre ist es her, schreit Straat verzweifelt, seit er in Persien war, er war noch ein Kind und runidam ist ein sehr seltenes Wort, es ist ihm nur zufällig eingefallen, Kantine heißt eigentlich mardam, aber wenn er nicht Papier und Bleistift kriegt, kann er seine Erinnerung nach so langer Zeit nicht auffrischen.
»Ich lasse dich krepieren«, sagt Battenbach. Dann schweigen sie. Straat lehnt an der Wand und sieht den Kapo mit bangen Augen an, und der starrt auf die Stirn des Jungen, über die sich grau die Haut spannt, er sieht die Ader in der Schläfe klopfen, verflucht, wenn er dem in den Kopf blicken könnte. Ein Zweifel schleicht sich in sein Mißtrauen, ein Zweifel, dem er nachgeben möchte. Denn schon hat sich in wenigen Tagen die Sprache in sein Gemüt gehakt. An den leeren Abenden, an denen er von seinem Fenster über den Appellplatz sieht, erfüllt von einem stumpfen Haß auf die Welt, heimgesucht von Erinnerungen an Weiber, ist er, mit Hilfe der schwierig zu erlernenden persischen Vokabeln, mit einem Mal ein Mann geworden, der die Stunden nutzt und weiterdenkt und der seine geheimen, weitreichenden Pläne hat.
»Junge, wenn du mich betrügst. Wenn du nicht Persisch kannst«, sagt Battenbach, und die Ungeheuerlichkeit des Gedankens läßt seine Stimme schwanken. »Ich kann«, sagt Straat. »Ich kann Persisch. Es ist nur lange her.« Fortan verfügt Straat über Bleistift und Papier, Reichtümer, für die man in den Bunker kommen kann. Wenn sie ihn damit erwischen, weiß Battenbach von nichts. Straat verbirgt den Bleistift im Schuh und das Papier in der Mütze. Über dem Hirn, zwischen dem geschorenen Haar und dem Mützenstoff trägt er die Sprache. Beim Appell muß er aufpassen, vor allem beim Kommando »Mützen ab«. Die Sprache kann herausfallen. Sie kann entdeckt und ihm weggenommen werden. Dann ist er, was immer geschieht, verloren, seine Wächter oder sein Schüler werden ihn erschlagen. Allabendlich verbirgt er auch Brot oder ein paar Kartoffeln in seiner Kleidung, er bringt sie einem Pritschengenossen, einem Elektriker aus Groningen, Steinbruchkommando, der wiegt noch neunzig Pfund.
An seiner Sprache arbeitet Straat nachts. Er verdreht Buchstaben und Silben, so erfindet er Wörter. Die besonderen deutschen Einrichtungen, die ihn umgeben, gehen in seine Sprache ein. Wenn er ihnen einen Klang gibt, der ihn fortträgt, nicht nach Persien, aber in eine fremde und stille Welt, in solchen Momenten entkommt er ihrer furchtbaren Bedeutung. Rium, rema, matori, muro, kemato, ikre, tarne, muir, rotam, kretum, orite, mekor, kumo, emati, katu, meri, tamku, taritora.
Das alles gewinnt er aus Krematorium. So geht es mit Arrest und Baracke, mit Steinbruch und Stacheldraht und selbst mit Battenbach, seinem Beschützer, der auf diese Weise aus sich selbst lernt. Aus dem fetten, schwarzen Rauch wird hacur, der Wind.
Straat schreibt sich seine Wörter im Dunklen auf sein Papier, so klein wie möglich. Er versteckt das Papier in der Mütze und packt die Mütze unter den Strohsack. Er erfindet nicht mehr als fünf Vokabeln in der Nacht, dreißig die Woche, das reicht auch für Battenbach. Den Sonntag lassen sie aus. Straat ißt zwei Teller Suppe an jedem Tag, er wird kräftiger, er bemerkt, wie es Sommer wird, von entfernten Feldern kommt ein Geruch von blühender Lupine. Ein Holländer aus der Arbeitsstatistik wartet in der Latrine auf ihn.
»Was machst du mit dem Kapo in seinem Verschlag jeden Mittag?«
»Was geht es dich an«, sagt Straat mißtrauisch.
Der andere sieht ihn nachsichtig an. Er sagt: »Du bist nicht zufällig zum Kartoffelschälen gekommen. Wir haben dich dazugeschrieben, weil du der letzte von den Studenten warst. Damit du dich einen Tag erholen kannst.« Er macht eine Pause, er sagt: »Und dann hat Battenbach dich angefordert. Warum?«
Stille, bis auf das Gesumm der grünschillernden Fliegen. Und Straat sieht in den Augen des anderen nicht nur Verdacht, sondern Angst und Mitgefühl, aber auch Unnachsichtigkeit und Härte, er ahnt in diesem Augenblick, daß ihn die Sprache, die nur er kennt, nicht nur schützen, sondern auch verderben kann, weil sie ihn über seinen Nächsten erhebt. Aber er fürchtet sich, sein Geheimnis zu verraten, auch dem nicht, der sein Freund sein kann, denn wer ist wirklich sein Freund? Am ehesten vielleicht der Junge aus Groningen, auf der Pritsche neben ihm, dem er Brot, Kartoffeln und Mut mitbringt, doch auch den weiht er nicht ein.
Sommer vierundvierzig. Die Silberschnüre der Bomber ziehen sich über den deutschen Himmel. Straat macht ein Wort für Leben, er nennt es: sawal. Und ein Wort für Apfelbaum, zum Spaß, das heißt pollimolli. Nicht Battenbach zuliebe. Der lernt Zahlen und Redewendungen und Gegenstände aus der Vergnügungsbranche, auf eigenen Wunsch. Wenn Battenbach Launen hat, erfindet Straat Rachewörter. Eins heißt: suliduladornatlam. Battenbach will sich weigern, er braucht, sagt er wütend, ein praktisches Persisch für den Alltag. Aber Straat erklärt ihm, daß so die landesübliche Begrüßung lautet, man kommt durch keine Tür in Persien ohne suliduladornatlam.
»Tupa«, sagt Battenbach wie ein alter Perser.
Es sterben übrigens, während Straats an der Physik geschulter Verstand, nicht mehr von Hunger gelähmt, nicht mehr von Angst betäubt, das Gerüst einer Sprache ersinnt, ringsum täglich an die fünfzig Männer, Woche um Woche, ihr Fleisch verbrennt, ihr Hirn verzischt, ihre Seelen fahren in die Himmel ihres Glaubens, vorher hat ihr Mund vielleicht ein letztes Wort gesprochen, das sich auf einen langen Weg macht, durch Menschen, durch Länder, am Ende, mag sein, kommt es zu denen, die darauf warten.
Straats Sprache wird keinen anderen erreichen als Battenbach, sie wird keine Botschaft tragen, sie stellt nichts dar als sich selbst, sie rettet den einen, der sie ausdenkt, und einen zweiten, der sie mühsam lernt, einen krummen Hund, keinen Bluthund, macht sie sanfter. Sonst ist sie unnütz. Aber Straat braucht die Phantasie der großen Entdeckungen, den Mut der großen Hypothesen, die Mühe der großen Versuche für seine Sprache. Und Battenbach, Küchenkapo, Zuhälter aus Hamburg, braucht die fleißige Einfalt, mit der er vor langem in einer Schulbank saß.
An einem Augustmorgen, sein Gesicht ist fleckig, die Zunge quillt ihm aus dem Mund, trägt man Straat vom Appellplatz, wo er hingestürzt ist, ins Revier. Drei Tage liegt er in Fieberträumen, auf Stroh, auf dem Fußboden, die Pfleger hören ihn ein wirres Holländisch reden, aber er stammelt auch unverständliche Laute, Wortketten ohne Sinn. Dann ist abzusehen, daß er durchkommen wird, er ist kräftiger als andere, aber ist er noch bei Verstand? Der Lagersanitäter geht mit der Spritze durch die Reihen, mit Luft heilt er alle Schmerzen, wer tot ist, ist nicht mehr krank. Wenn er Straat schreien hört, wird er ihn für verrückt erklären, er wird seine Nummer notieren, dann wird er ihm den Ärmel hochschieben und nach der Vene suchen. Der Pfleger zieht Straat an den Füßen in einen Nebenraum, da liegen die Gestorbenen, da hört ihn niemand, da sucht ihn niemand. Da kommt Straat zu sich. In einem warmen Sonnenlicht, das durch zwei Fenster hereinscheint, sieht er seinesgleichen, erstarrt, in den lächerlichen Verrenkungen des letzten Augenblicks, Pupillen, für immer fixiert, Münder, aufgerissen ohne Schrei. Lebt er denn selbst? Er hat eine Stimme, mit der kann er heulen wie ein Wolf, und er kann Wörter mit ihr aussprechen, über die sich jeder wundert, nur seine schweigenden Gefährten nicht. Gehört er also zu ihnen?
Ehe der mit Zinkblech ausgeschlagene Leichenwagen kommt und rückwärts an die Fenster heranfährt, trägt man Straat, der im Fieber um sich schlägt, in ein Bett. Anderntags ist er ruhiger. Der Pfleger, ein Deutscher, betrachtet ihn kopfschüttelnd. »Kumpel, was hast du bloß für ein seltsames Zeug geschrien. Wir dachten, dich hat es erwischt.«
Und er tippt sich gegen die Stirn. Straat ist sehr schwach, er vergißt alle Vorsicht.
»Es ist Persisch«, sagt er. »Aber es ist kein richtiges Persisch. Ich denke es mir aus.«
»Was denkst du dir aus?«
»Eine Sprache«, sagt Straat.
Also haben sie doch einen mit einer Macke gerettet, so scheint es dem Pfleger, das Schicksal ist blind, große Geister gehen kaputt, dieser Holländer hat Glück. Hat überhaupt Glück, denn der Küchenkapo läßt seine Beziehungen spielen und schickt ihm mehrmals einen Kanten Brot ins Revier. Straat erholt sich, und als ihn der Pfleger noch einmal nach seiner Sprache fragt, gibt er vor, sich an nichts zu erinnern. Und auch den Schreck verbirgt Straat, den Schreck darüber, daß er seine Mütze verloren hat. Er kommt in seinen Block zurück, ein von den Toten Auferstandener, er sieht neue Gesichter, auch auf seiner Pritsche. Er wartet auf den Blockältesten, der drückt ihm die Hand. »Komm mit, ich hab was für dich.«
In der Blockführerstube ist eine Diele gelockert, darunter holt der Blockälteste einen schmutzigen Fetzen Stoff hervor, nein, keinen Stoffetzen, eine Mütze, Straat dreht sie in den Händen und fühlt das Papier, auf dem seine Sprache steht.
»Der neben dir lag, der Elektriker, hat sie vom Appellplatz mitgebracht.«
»Wo ist er?« fragt Straat.
»Er ist nach dir krank geworden«, sagt der Blockälteste. »Er kommt nicht wieder.«
Der Blockälteste hat einen pfeifenden Atem, als wäre etwas in seiner Nase zerbrochen. Er sagt: »Bring auch in Zukunft was aus der Küche mit. Es sind viele da, die es brauchen.«
So geht alles weiter seinen Gang. Straat tritt wieder im Küchenkommando an, in Battenbachs blaßblauen Augen leuchtet Genugtuung, Battenbach läßt keinen umkommen. Mittags, wenn der Rottenführer Roeder gegangen ist, setzt er sich hinter den Tisch, den Bleistiftstummel in der Hand, im Gesicht die Demut des Lernenden, lernen heißt lifu. Und Straat schmuggelt Papier und Bleistift und Brot und Kartoffeln durch das Gebrüll der Appelle, und abends, die Schulter an der Schulter eines neuen Nebenmannes, ersinnt er Redewendungen und Sätze und konstruiert eine Konjugation und eine Deklination. Nicht mehr nur für Battenbach, dem das Pensum reicht. Jetzt ist es die Sprache selbst, die ihn treibt. Noch einmal droht ihm Entdeckung. Battenbach hat erfahren, daß ein Perser eingeliefert worden ist. Ein lebender Perser, Mensch. Zwei Tage lang streift Battenbach durch das ganze Lager, mit Hilfe aller Tricks, die er kennt, und versucht, ihn zu finden. Dann hat er ihn, es ist aber kein Perser, es ist ein Inder. Einen weiteren Tag lang schimpft Battenbach. »Ein Drecklager ist das. Unter dem ganzen Gesocks haben sie nicht mal einen Perser.«
»Der Führer ist nur nicht so weit gekommen«, sagt Straat tröstend. Und er denkt: Armer, verlassener Mann aus Indien.
Es wird Herbst, und es wird Winter. Über den Appellplatz weht ein eisiger Wind und wirbelt über die gefrorene Erde den dünnen Schnee. Durch das Tor zieht eine Kolonne in Lumpen, unendlich langsam, Fuß vor Fuß, kommt aus anderen Lagern in dieses Lager, hat den Marsch noch überdauert und zieht nun ein in die Zelte, die von Drahtgittern umgeben sind, um still zu vergehen, nachts, unter hoch stehenden Sternen, tags unter schnell ziehenden Wolken, manchmal scheint die Sonne.
Hinter dem Fenster des Küchengebäudes, dort ist es warm, probt Straat mit Battenbach eine erdachte Szene in Persisch. »Ich bin ein Herr aus dem Ausland. Ich bin Geschäftsmann. Darf ich mit der Dame tanzen? Ta muli asa okadir. Ta muli lern basarmelko. Neli ta ramadamda donga?«
Ein Maitag wird kommen, an dem die Tore offen sind, an den Straßen blühen die Kastanien, wer lebt, geht, wohin er will. Straat wird nach Holland zurückkehren, er wird seine Physik zu Ende bringen, Lehrer werden. Er wird leicht ermüden sein Leben lang. Niemals mehr wird er etwas so Großes tun, wie er vollbracht hat, er hat eine Sprache erfunden, die er allmählich vergißt. Battenbach wird nach Persien gelangen, in das Kaiserreich Iran, verwundert über das seltsame Persisch, das man dort spricht.
Inge, April und Mai
Am dreißigsten März habe ich Inge Kaliska geküßt, ihre Lippen schmeckten nach einem fremden Salz. Ich hatte sie am Ende eines Ringkampfes auf den Parkweg gelegt, hockte über ihr, beugte mich nach vorn und dachte, ich müßte sie festhalten, aber sie wehrte sich nicht. Dann standen wir auf, sie klopfte den Sand von ihrem laubfroschgrünen Mantel und kicherte und streifte Gerdchen Pachähl mit einem Blick, meinen Freund Gerdchen, der sie vor mir hatte küssen wollen. Ich legte den Arm um sie und führte sie weg, und daß sie sich ein bißchen ziehen ließ und über die Schulter zurücksah und noch immer kicherte, hatte nichts zu bedeuten. Hinter uns kreischte Uschi Nitzelbach, weil sie wieder mit dem Kopf auf die Bank gestellt wurde, die Beine hoch, die Beine fest geschlossen. Mit glucksender Stimme teilte sie mit, daß sie unter dem Rock, der ihr über die Augen fiel, nichts sehen könne. Wir aber gingen davon, aneinandergedrückt in ungleichem Schritt, mein rechter Schenkel an Inge Kaliskas linkem. Schließlich blieben wir stehen, und ich drehte sie an der Schulter zu mir herum. Sie wandte die Augen nicht ab, aus denen ein Lächeln langsam verschwand; wir waren uns fremd und vertraut. Unser zweiter Kuß war zart, und unsere Nasen störten sich nicht, wie ich befürchtet hatte. Unser zweiter Kuß dauerte unglaublich lange, und in seinem Verlauf öffnete Inge Kaliska die Lippen, erst wenig und dann immer weiter, unsere Zungen berührten sich, unsere Zähne stießen aneinander, und ich dachte überwältigt: So also wird es gemacht. Das war anders, als die Kinoküsse aussahen, und eine meiner Ahnungen war schlagend bestätigt: Im Film ist das wahre Leben nicht zu sehen, jedenfalls nicht in Filmen unter achtzehn.
Aber noch erstaunlicher war vielleicht, daß sie, als wir über die leere, verdunkelte Bismarckstraße gingen, nach meiner Hand griff, nicht ich nach ihrer, nein. So gingen wir den ganzen Weg bis in die Laubenkolonie »Süßer Grund«, wir schwiegen, weil unsere Finger miteinander redeten. Nur einmal, als wir am Markt um die Litfaßsäule herum wollten – ich zog nach links und sie nach rechts –, ließen wir uns los. Am Bretterzaun des Fußballplatzes blieben wir stehen; denn bis vor ihre Tür wollte sie mich nicht mitnehmen. An ihrem Mantel steckte ein schwalbenförmiges Leuchtabzeichen, ihr Kleid hatte einen geschlossenen weißen Kragen, sie trug eine Haarklemme über der Stirn. Das alles erschien mir sehr schön. Ich fragte: »Wollen wir zusammen gehen?« Sie schwieg, und ich spürte verwundert, daß ich ein Herz hatte, als ich weiterfragte: »Oder willst du lieber mit Gerdchen gehen? Oder mit Äffchen Lehmann?«
»Hör mal, der ...«, sagte sie. Ich wollte sie wieder küssen, aber sie drehte das Gesicht weg. Dann sagte sie: »Das Entscheidende ist, glaube ich, daß man sich treu ist.«
»Klar«, sagte ich ergriffen, ohne zu zögern, »das ist natürlich das Entscheidende.«
Auf der anderen Seite der ungepflasterten Straße rief eine Männerstimme den Namen Inge. Der Mond schien, doch der Bretterzaun warf einen Schatten. Wir waren still, bis die Stimme noch einmal gerufen hatte und ein eigentümlich tappender Schritt sich entfernte.
»Er hat ein Bein verloren«, sagte Inge Kaliska. »In Jugoslawien.«
»Ach so«, sagte ich.
Weiter war nichts. Wir gaben uns förmlich die Hand. Sie ging und sah sich nicht um. Ich stand noch eine Weile da und stellte mir vor, wie sie in die Stube treten würde. Die Stube, nahm ich an, war klein, eine trauliche Lampe hing über dem Tisch, die Mutter und der einbeinige Vater saßen beim Abendbrot, und ich konnte nicht anders, ich hielt sie für freundliche Leute.
Endlich trabte ich los, quer durch die Lauben, in einer von ihnen, Karsteiner Weg 4, hatte mein Mitschüler Buzahn gewohnt. Wie ich so lief, linker Fuß, rechter Fuß, tanzte sein Gesicht vor mir, sommersprossig, mit einem grünen und einem braunen Auge. Wirklich, er hatte verschiedenfarbige Augen und war der einzige Mensch in der Art, den ich je gesehen habe. Er hatte auch ein Buch über Jiu-Jitsu, und wenn er einem den Arm auf den Rücken drehen wollte, konnte man wenig dagegen machen. In einer Augustnacht mitten im Krieg fielen vier Bomben in unsere Gegend, in ziemlich gerader Reihe, und die letzte fiel genau in den Splittergraben der Kolonie »Süßer Grund«, um den ich Buzahn immer beneidet hatte, weil er militärischer aussah als unser langweiliger Luftschutzkeller. Ich war gerade zu Besuch bei meiner Tante Johanna in Pommern, und als ich wiederkam, war Buzahn nicht mehr da, sondern lag mit neun anderen Leuten auf dem Friedhof unter einer Holztafel, auf der auch die Namen seiner Mutter und seiner Schwester standen. Da lag er, und da vergaßen wir ihn. Jetzt schien es mir unendlich lange her zu sein, daß es ihn und seine merkwürdigen Augen gegeben hatte.
Jetzt sammelten selbst Sechsjährige keine Bombensplitter mehr. Wir spielten nicht mehr Soldat, sondern Grammophon. Daß die Welt kopfstand, war eine alte Sache. Aber daß wir Uschi Nitzelbach auf den Kopf stellten, war ein Ereignis von neuer, einschneidender Bedeutung. Das heißt, ich selbst hatte auch das schon hinter mir. Ich wußte jetzt, daß ich auf eine tiefere Art und vermutlich für immer Inge Kaliska liebte, deren Lippen fremd und salzig schmeckten. Während ich nach Hause rannte, durch die hohen Tonbogen des Voralarms, selbst noch, als ich durch die kürzeren Wellen des Vollalarms hinab in unseren Keller tauchte, vor die vorwurfsvollen Augen meiner Mutter, schmeckte ich es nach.
Früher mußte ich rein, wenn die Laternen angingen. Jetzt erst, wenn die Leuchtbomben fielen, strahlend, langsam und lautlos, an einer zerfransenden Schnur aus hellem Rauch. Ich kam aus dem Park, der schmal zwischen Hinterhäusern lag, ein Buddelplatz, ein Rechteck Rasen, ein paar Pappeln und Gesträuch. Oder ich kam aus dem Kino »Central«, das nach Bohnerwachs roch. Sechsmal sah ich, wie ein preußischer Major, der die Gnade seines Königs verloren hatte, den Tod nicht achtend, einen Stollen unter die Österreicher trieb, doch immer, wenn die schwarzbärtigen Kroaten und Panduren hochgeblasen werden sollten, wodurch der König erkannt hätte, was er in dem Major für einen Mann hatte, immer, wenn es gerade soweit war, fiel in der Vorführkabine vernehmlich eine eiserne Klappe, die Leinwand verdunkelte sich, der Ton verendete jaulend, ein Seufzen der Enttäuschung ging durch das halbleere Kino, die Holzsitze klappten einer nach dem anderen hoch, und von draußen hörte man den auf- und abschwellenden Chor der Sirenen.
Später, nachdem sie ein langes, gleichmäßiges Geheul ausgestoßen hatten, und irgendwo sah man den Widerschein von Bränden, fanden sich die Leute, die was auf sich hielten, wieder im Park ein. Wenn seine Mutter in der Teerfabrik Spätschicht hatte, auch mein Freund Gerdchen. Auch Uschi Nitzelbach, wenn die Berichte stimmten. Was dann geschah, während alle Zigaretten rauchten, und Äffchen Lehmann sogar Zigarren, und während Äffchen Lehmanns Grammophon »Hallo, Mc-Brown, was macht Ihr Harem?« spielte, was dann zwischen Büschen und Bänken geschah, stellte, wenn die Berichte wiederum stimmten, die Veranstaltungen des frühen Abends, die sich vor allem auf Uschi Nitzelbachs Kopfstand stützten, bei weitem in den Schatten.
Leider fehlte ich dabei. Meine sanfte, stille Mutter war in diesem Punkt von eiserner Härte. Sie brachte eine Menge Dinge vor, die von ihrem Unverständnis zeugten, und regte mich zusätzlich an, mir vorzustellen, was mein ferner Vater zu mir sagen würde.
Ich kroch gekränkt ins Bett und stellte mir lieber etwas anderes vor. Manchmal dachte ich an meine schöne Tante Johanna, die ich nackt gesehen hatte, in den Ferien bei ihr, Sonntag früh in der Küche. Da stand sie und trank Wasser aus der Schöpfkelle. Sie behielt die Ruhe, sah mich seltsam an und sagte: »Dummer Bengel, was machst du hier?« Und ich kehrte verstört um und verschwand wieder in meiner Kammer. Meine Tante war Verkäuferin und mit einem berittenen Artilleristen verheiratet, der auf dem Hochzeitsbild einen langen Säbel trug. Jetzt hatten wir lange nichts mehr von ihr gehört, und meine Mutter hatte Tränen in den Augen, wenn sie von ihr sprach, denn in Pommern waren schon die Russen.
Manchmal dachte ich auch an Heini Panzlaus Schwester, die eine Zeitlang mein Einschlafen in die Länge zog, und ich glaube, nicht nur meins. Denn Heini hatte uns versprochen, daß sie uns etwas zeigen würde, das die meisten von uns, obgleich wir das nicht so ausdrückten, in dem Frühling damals dringlicher sehen wollten als beispielsweise den Führer.
Natürlich wollten wir erst nicht glauben, daß sie es wirklich tun würde, weil sie schon sechzehn war und sich mit uns nicht abgab. Aber Heini erklärte großzügig: »Sie macht es. Wenn ich es ihr sage, macht sie es.«
Eine Woche oder länger versammelten wir uns, wenn es dunkel wurde, auf Heinis Hof und warteten.
»Macht sie es heute?« fragten wir.
»Bestimmt, heut macht sie es.«
»Geh rein und hol sie.«
»Sie kommt auch so.«
»Geh lieber rein.«
Er kam wieder und sagte: »Sie ißt noch.« Wir warteten weiter.
»Wo bleibt sie denn?«
»Sie wird schon kommen.«
»Geh noch mal rein.«
Er kam abermals wieder. »Jetzt badet sie.«
»Und dann kommt sie raus?«
»Möglich«, sagte Heini unbestimmt.
»Was heißt denn möglich? Hast du ihr überhaupt gesagt, worum es sich handelt?«
»Na klar habe ich das«, schrie Heini beleidigt, aber er wurde von Tag zu Tag kleinlauter, und am Ende erwies er sich als völliger Versager. Doch zum Glück wurde ich mächtig abgelenkt von dem Problem mit Panzlaus Schwester. Ich hatte Inge Kaliska geküßt, und alles war anders.
Ich machte im Bett die Augen zu und sah mich an ihrer Seite die Bismarckstraße entlangschlendern; wer mich traf, hatte Staunen und Neid im Blick. Ich malte mir aus, wie wir im Kino Platz nahmen, letzte Reihe, wenn das Licht ausging, legte ich den Arm um Inge Kaliskas Schulter. Im Freibad »Neptun« lagen wir auf dem Bild, das ich von uns entwarf, auf einer Decke und spielten nicht Einkriegezeck, sondern sonnten uns träge wie die Großen. Selbst der hausgemachte Kartoffelsalat im Marmeladenglas, den meine sorgende Mutter unter dem Motto »Kartoffelsalat bleibt kühl« meinem bisherigen Badeleben unerbittlich beigeordnet hatte, erschien mir, künftig mit Inge Kaliska genossen, durchaus bekömmlich. So plante ich unser Zusammenleben bis Juni oder Juli voraus und kam fast davon ab, an Großdeutschland zu denken, um das es in diesem April schlecht stand, schlechter als je. Aber indem ich wuchs, im Ganzen und in Teilen, und überall erstaunlich in die Länge, entwuchs ich unmerklich der Schicksalsgemeinschaft der Germanen, der ich mich kindlich hingegeben hatte, ausgerüstet mit einem Schuhkarton Elastolin-Soldaten, umsponnen von der Nibelungen Not und dem Geruch von Uhu-Alleskleber, mit dessen Hilfe ich Papierflugzeuge baute.
Unmerklich sage ich, weil ich nicht weiß, ob mein Abschied den Frühling lang dauerte oder nur den feuchten, schummrigen Abend lang, an dem ich Inge Kaliska küßte.