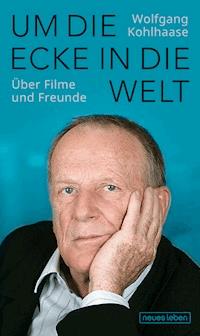
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der preisgekrönte Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase ist ein geübter Beobachter und Meister des feinen Dialogs. Drehbücher könne er schreiben wie Billy Wilder, bestätigen ihm Filmkenner und -kritiker. Und was Kohlhaase über die Leute sagt, die seinen Weg kreuzten oder mit denen er an wichtigen Filmen arbeitete, gibt tiefe Einsichten, teilt genaue Beobachtungen mit und liefert manch hintergründig-komische Anekdote. Alle diese Texte füllen ein Buch, das so nah an Wirklichkeit und Geschichte ist und so unterhaltsam und lebensnah wie seine Filme. Texte über Konrad Wolf, Frank Beyer, Andreas Dresen, Bernhard Wicki, Hermann Kant, Renate Krössner, Peter Hacks, Kurt Maetzig, Werner Stötzer, Wieland Herzfelde, Ulrich Plenzdorf, Eberhard Esche und andere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Die Texte folgen den Originalen der Drucke und den Überlieferungen in den Archiven. Auslassungen des Herausgebers sind mit (…) gekennzeichnet.
Verlag Neues Leben –
eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage
ISBN E-Book 978-3-355-50014-2
ISBN Print 978-3-355-01903-3
2., aktualisierte Auflage 2021
© 2014 Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
mit freundlicher Genehmigung der
henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von picture-alliance/ZB
www.eulenspiegel.com
Inhaltsverzeichnis
Laudatio für Wolfgang Kohlhaase
von Andreas Dresen
ÜBER EIGENE UND ANDERE FILME
Hilfe Filme! Ein Volontär geht ins Kino
BERLIN – ECKE SCHÖNHAUSER
Eine Erinnerung
DER FALL GLEIWITZ
Eine Erinnerung
DIE BESTEN JAHRE
Sowjetische Filme
ICH WAR NEUNZEHN
Der deutsch-sowjetische Leutnant
Ein Brief
DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ
Filmmotiv
MAMA, ICH LEBE
Weder Nippfigur noch Kieselstein
Interview zu den Dreharbeiten
SOLO SUNNY
Ein glückliches Ende ist doch unser aller Hoffnung
Werkstattgespräch vor der Uraufführung
DER AUFENTHALT
Zwei Briefe
Auszug aus einer Diskussion mit Schülern
DIE STILLE NACH DEM SCHUSS
Zwei Interviews
SOMMER VORM BALKON
Zwei Interviews
MENSCHEN AM SONNTAG
Bei Ansicht eines alten Films
ALS WIR TRÄUMTEN
Interview mit Wolfgang Kohlhaase und Clemens Meyer
IN ZEITEN DES ABNEHMENDEN LICHTS
Gespräch mit Wolfgang Kohlhaase und Matti Geschonneck
ÜBER FILM UND LEBEN, KUNST UND GESCHICHTE
Aus dem verbotenen Heft
Antwort auf eine Umfrage
Das Einzige, was uns hilft: Realismus!
Diskussionsbeitrag auf dem II. Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden
Vergnügen stiller Art
Wie ich lesen lernte
Ortszeit ist immer auch Weltzeit
Diskussionsbeitrag auf dem VII. Kongress des Schriftstellerverbandes
Filme, die von uns selbst handeln
Diskussionsbeitrag auf dem III. Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden
Das Bedürfnis nach Emanzipation richtet sich an alle Kunst
Diskussionsbeitrag auf dem VIII. Kongress des Schriftstellerverbandes
Dass man das Publikum nicht aus dem Auge verliert und das Handwerk nicht missachtet …
Werkstattgespräch für Sinn und Form
In den eigenen Fragen die gemeinsamen suchen
Diskussionsbeitrag auf dem IV. Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden
Poesie meint immer die größere menschliche Möglichkeit
Zwei Beiträge zum Thema Technologie und Humanismus heute
Dank für den Helmut-Käutner-Preis der Stadt Düsseldorf
Ich will nicht ohne Spur leben
Interview mit Rosemarie Rehahn für die Wochenpost
Zur Person
Interview mit Günter Gaus
Blicke auf die deutsche Geschichte
SOLO SUNNY und die Schwierigkeit, heute Filme zu machen
Interview mit Arno Widmann
Die sinnliche Erfindung des filmischen Augenblicks
Gespräch in »Schreiben für den Film«
Ermutigung ist angenehm in jedem Alter
Dank für den Preis der DEFA-Stiftung
Schreiben in zwei Systemen
Werkstattgespräch für den »Drehbuch-Almanach scenario«
»Auf Wiedersehen« war mehr als eine Redensart
Gespräch über Berlinale-Besuche
Dank für die Verleihung des Goldenen Ehren-Bären
Poesie und Gebrauchsanweisung
Dank für den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises
Nachrichten aus der Welt – Das Kino in der DDR
ÜBER KOLLEGEN UND FREUNDE
Edith Hancke
Slatan Dudow
Gerhard Klein
Walter Gorrish
Bruno Apitz
Wieland Herzfelde
Günther Rücker
Für Koni
Rosemarie Rehahn
Ludwig Turek
Konrad Wolf
Wieland Herzfelde
Werner Bergmann
Walter Beltz
Karl Kohlhaase
Konrad Wolf
Alfred Hirschmeier
Renate Krößner
Ulrich Schamoni
Bernhard Wicki
Ludwig Engelhardt
Günter Reisch
Klaus Wischnewski
Peter Hacks
Eberhard Esche
Frank Beyer
Hermann Kant
Willy Moese
Ulrich Plenzdorf
Werner Stötzer
Jutta Hoffmann
Kurt Maetzig
Horst Pehnert
Andreas Dresen
Doris Borkmann
Ortszeit ist immer auch Weltzeit
Nachwort des Herausgebers
Filmografie
Danksagung
Laudatio für Wolfgang Kohlhaase
von Andreas Dresen
»In den folgenden drei Tagen werde ich Ihnen erklären, wie man ein Drehbuch schreibt. Am vierten Tag bin ich weg, denn dann würden Sie merken, dass ich es selbst nicht weiß.« So spricht Wolfgang Kohlhaase gerne, wenn er beispielsweise Studenten etwas über seine Arbeit erzählen soll.
Das ist keine Koketterie, sondern die Klugheit eines Mannes, der weiß, auf welch rätselhaftem, unerklärlichem Gelände man sich von Zeit zu Zeit bewegt, wenn man Filme erfindet …
Ich bin mit Wolfgangs Geschichten aufgewachsen. Manche zielten auf die Jahre, in denen er noch ein Kind war, den Krieg, die Nazizeit, andere mitten in die Gegenwart: ICH WAR 19, DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ, SOLO SUNNY, DER AUFENTHALT. Filme, die Wolfgang geschrieben hat. Sie haben meine Sicht auf die Welt und das Kino nachdrücklich geprägt.
Die Kunst von Wolfgang ist Poesie in Kurzform. Pathos oder Sentimentalität sind ihm fremd. Er beschreibt komplizierte Dinge mit einfachen Worten. Seine Texte sind klar und direkt. In ihrem Lakonismus treffen sie trotzdem mitten ins Herz. Das hat damit zu tun, dass er die Menschen und seine Figuren mit Liebe betrachtet.
Kleine Leute und ihre großen Träume. Bei Wolfgang ist das lustig, aber nie lächerlich. Er wirkt mit seinen vielen Jahren manchmal wie ein großer Junge, der sich gerade einen neuen Streich ausgedacht hat. Im Gespräch reibt er sich bisweilen die Hände an der Brust, so wie andere sich an der Stirn kratzen. Es ist eine unbewusste Geste, als wolle er sich im Gedankenflug seiner Körperlichkeit versichern, sich konzentrieren, ohne grüblerisch zu sein. So bleibt er im Nachdenken offen.
Die gemeinsame Arbeit ist wunderbar unkompliziert. Es geht darum, eine Sache so gut wie möglich zu machen, da ist Wolfgang pragmatisch und vollkommen uneitel. »Dramaturgie ist ein System von Regeln gegen die permanente Bereitschaft eines Publikums, sich zu langweilen.«, sagt er. Sätze wie dieser führen einen in Versuchung, ständig mitzuschreiben.
Wolfgang hat ein unglaubliches Gedächtnis für besondere Dialoge, besondere Begebenheiten. Manchmal scheinen sie Jahrzehnte bewahrt, bis er die passende Szene für sie gefunden hat …
Jede Art von Künstlerattitüde ist ihm fremd, intellektuelle Phrasendrescherei sowieso. Seine Kunst hat immer etwas mit Partnerschaft, Freundschaft zu tun. Wolfgang trifft sich nicht nur mit Menschen, um mit ihnen zu arbeiten. Er möchte mit ihnen das Leben teilen. Er ist treu. Gerhard Klein, Konrad Wolf, Frank Beyer hießen einige seiner wichtigsten Weggefährten.
Große historische Brüche haben sein Leben geprägt. Das Ende der Nazizeit, der Bau und Fall der Mauer. Alles auch in seiner Stadt, hier in Berlin. Dass er sich immer für Menschen interessiert hat und nicht für Ideologien, machte die Übergänge in Bezug auf die künstlerische Arbeit leichter …
In unserem Film WHISKY MIT WODKA wird der Regisseur von einem Bühnenarbeiter gefragt, was denn nun eigentlich die Botschaft seines Drehbuchs wäre. Wolfgang lässt ihn antworten: »Die Botschaft, wie Sie es meinen, gibt es vielleicht nicht. Man macht einen Film ja nicht, weil man Bescheid weiß, sondern um etwas zu entdecken. Film ist Vermutung, verstehen Sie? Es geht um immer neue Bilder für die Dinge, die sich immer wiederholen. Wie soll ich es ausdrücken? Die großen Phänomene. Die Liebe, der Tod und das Wetter.«
Wolfgang Kohlhaase sagt: »Ein Drehbuch schreiben ist das Notieren einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung.« So einfach ist das. Und doch so schwer.
2014
ÜBER EIGENE UND ANDERE FILME
Hilfe Filme! Ein Volontär geht ins Kino
Wirklich gute Filme sollen noch unsere Vorfahren gesehen haben. Abgesehen von den Klavieren, die damals im Hintergrund der Kinos standen und während der Vorführung bedient wurden, der Inhalt, der machte es damals. Da gab es immer ein armes Mädchen und immer einen reichen Grafen, sie liebten sich immer, und sie heirateten sich immer, und alles war so wundervoll unbekümmert kitschig.
Heute hat sich der Film entwickelt. Der Kitsch ist veredelt und will alles andere sein: Kunst, gute Unterhaltung, leichte Unterhaltung, beschwingte Unterhaltung, nur nicht Kitsch. In den alten Filmen liebte man sich oder nicht, man lebte oder starb, und wenn jemand tot war, blieb er tatsächlich liegen. Heute darf man in dieser Hinsicht vor dem letzten Bild nie sicher sein.
Das ist symbolisch für die Situation der Hersteller und ihrer Kreise. Sie wissen selbst nicht genau, ob sie leben oder tot sind. Früher war auch eine Fliege eine Fliege; seit die Fliegen ein Theaterstück sind, ist das nicht mehr so sicher. So teilt man sich in schlechte Philosophen und in gute Geschäftsleute oder verbindet beides. Dementsprechend sehen viele Filme aus, jedenfalls die am Kurfürstendamm:
MIRANDA (England)
Hier hat ein Mädchen einen Fischschwanz, das ist ein neuer, ziemlich blöder Einfall. Drei Männer lieben dieses Mädchen vergebens, wobei die geliebten kleinen männlichen Schwächen offen zutage treten; das ist ein alter, ziemlich abgedroschener Einfall. Aus der Verbindung dieser Einfälle besteht der Film (Produzent: J. Arthur Rank).
DER DOPPELADLER (Frankreich)
Hier ist der Kitsch, der mehr sein will, unter der Regie Jean Cocteaus. Eine aus der Nähe schaurige und aus der Distanz lächerliche Geschichte. Ein Anarchist will die Königin-Witwe ermorden, doch sieht er ihrem verstorbenen Gatten ähnlich, worauf sie sich zu lieben beginnen. Nach mancherlei Verwicklungen aber erdolcht er sie doch, nicht ohne vorher Gift geschluckt zu haben. Sie fallen anschließend beide sterbend eine Treppe hinunter. Diese Treppe nach unten ist symbolisch.
HERZKLOPFEN (Frankreich)
Dabei fängt es ganz gut an. Es gibt eine Schule für Taschendiebe, wer arbeitslos ist, wer keine Papiere hat, besucht sie. Ja, es bleibt ihm auch kaum etwas anderes übrig, als Taschendieb zu werden. Bis dahin ist der Film nicht unglaubwürdig. Aber dies Stück groteske Wahrhaftigkeit ist nur ein Ausflug, vielleicht sogar ein unfreiwilliger. Zum Schluss bekommt die arme Taschendiebin den Diplomaten, dem sie die Taschenuhr stahl: Danielle Darrieux verkürzt die Längen etwas.
DER ENGEL MIT DER POSAUNE (Österreich)
Der Engel mit der Posaune ist ein Firmenschild, nicht etwa die auf den Plakaten groß angekündigte Paula Wessely. Sonst allerdings macht diese alles. Sie hat zuerst einen Liebhaber, dann einen Ehemann, dann zwei Söhne, mehrere Enkel und meistens den Kopf oben. Im Laufe des Films wird sie fast achtzig Jahre alt. Dem Zuschauer wird die Zeit nicht ganz so lang.
DIE LETZTE ETAPPE (Polen)
Die Aufführung des polnischen Films DIE LETZTE ETAPPE in Deutschland verlangt mehr als fachliche Stellungnahme. Es ist der Film über das Frauenlager des Konzentrationslagers Auschwitz, Frauen aus allen Ländern des unterdrückten Europas zeigend, in einem Maße erniedrigt wie vielleicht niemals zuvor. Menschen, kämpfend leidend, verzweifelt, sterbend oder auf den Sieg der Freiheit hoffend. Die Nummern, die in ihre Haut gebrannt waren, wurden in deutschen Listen geführt, die Ermordeten aus deutschen Listen gestrichen, die ihnen abgeschnittenen Haare von deutschen Stellen gesammelt, das Lager von Deutschen ausgedacht, errichtet und bewacht. Das alles sagt der Film. Er beweist einen Teil des ungeheuren Verbrechens, das im Namen Deutschlands begangen wurde. Wir Deutschen müssen es wieder gutmachen. Mit den Menschen aller Welt teilen wir die Erschütterung, die dieser Film weckt. Aber sie bekommt nur wirklichen Sinn, wenn durch sie unsere Kraft gestärkt und unsere Bereitschaft gefestigt wird, unser Bestes daranzusetzen, eine Wiederholung der barbarischen Taten der Vergangenheit unmöglich zu machen.
Fachlich ist genug Lobendes zu diesem Film zu sagen. Seine dokumentarische Darstellung des Konzentrationslagers ist ungewöhnlich stark. Aber daneben tritt die künstlerische Dichte der Spielhandlung nicht für einen Augenblick zurück, sie erscheint, wenn man so sagen darf, gar nicht als Spielhandlung, sie verschmilzt so mit der furchtbaren Kulisse, dass nur ein Bild bleibt in jedem Ausdruck jeden Gesichts: Auschwitz. Es ist schwer, aus dieser geschlossenen Leistung internationaler Schauspieler einzelne Namen hervorzuheben. Barbara Drapińska war die polnische Hauptdarstellerin. Gurezkaja und Winogradowa ihre sowjetischen Kolleginnen. Wanda Jakubowska, die Regisseurin, war bis zur Befreiung selbst in Auschwitz.
Dies ist, wie gesagt, kein Film nur zum Ansehen. Seine große Handlung, der Kampf um die Menschlichkeit, ist nicht abgeschlossen, und wir besonders müssen dazu beitragen, das positive Ende zu erringen.
ROTATION (Sowjetische Besatzungszone)
Ein deutscher Arbeiter, von den Nazis verfolgt, weil er Kommunist ist, von manchem alten Freund nicht verstanden, in einer der ersten brennenden Nächte des Krieges in Berlin, sagt: Man muss die Menschen lehren, sich zu lieben.
Der Satz könnte als Motto über dem Film stehen, der thematisch das Gegenteil aufzeigt. Was geschah, weil wir uns nicht liebten, weil wir uns nicht verstanden, weil wir nicht zusammenhielten, weil nicht die Vernunft uns beseelte, die uns unsere gemeinsamen Interessen erkennen ließ? Der Arbeiter Hans Behnke lebt das Leben von Millionen. Im Elend der Krise um 1930 drohen ihm Frau und Kind fast zu verhungern, er ist verbittert gegen die da oben. Gegen wen eigentlich da oben? Sein ehrliches Gefühl wird nicht zur klaren Erkenntnis. So ist er näher daran, an den Wänden hochzugehen, als die Tür ins Freie zu finden.
Ein paar Jahre später ist diese Tür von innen nicht mehr zu öffnen. Behnke ist bestimmt kein Faschist, aber auch kein Antifaschist. Behnke ist Maschinenmeister. Man drängt ihn in die Partei. Er lässt sich drängen. Man holt die Juden aus dem Haus. Er lässt es zu. Erst in der Nacht, als die Nachbarhäuser brennen und seine eigenen Fenster zerbrechen, als ihn sein Schwager, der Illegale, oben erwähnt, besucht und seine Hilfe beim Drucken von Antikriegs-Flugblättern fordert, kehrt Behnke um. Er verliert die Freiheit (sein in der HJ erzogener Sohn denunziert ihn), er verliert seine Frau (sie stirbt in den letzten Tagen des Kampfes um Berlin); und er gewinnt die Erkenntnis, die man nicht mehr verlieren kann, wenn man sie einmal besitzt: Das alles geschah, weil wir nicht zusammengingen. Das alles würde wieder geschehen, wenn wir nicht zusammengingen.
Der Regisseur Wolfgang Staudte beherrscht die Form der in sich geschlossenen kleinen Szene, er reiht so Motiv an Motiv, nicht alle sind gleich gelungen, nicht jedes stimmt genau auf das folgende, aber doch entsteht schließlich ein Streifen von ausgezeichneter Wirksamkeit. Manche Szenen werden lange unvergessen bleiben. So einmal, als die lapidare Benachrichtigung vom Tod des Schwagers im KZ ins Haus kommt; die Frau liegt vom Weinen geschüttelt auf dem Bett, während der Teekessel, von niemandem beachtet, laut und schrill pfeift, und der Mann nimmt langsam einen Aschenbecher vom Tisch und wirft ihn in das »Führer«-Bild. Oder der Augenblick, in dem die letzten Überlebenden des Moabiter Gefängnisses erschossen werden sollen, und sowjetische Soldaten eindringen. Die Gefangenen stehen in einer Ecke des Hofes zusammengedrängt, während das Gefängnis den Besitzer wechselt, ganz langsam gleitet die Kamera an ihren Körpern entlang, und in ihren Augen und Gesichtern erwacht die Erlösung.
Paul Esser spielt den Arbeiter Behnke, einfache Gedanken einfach aussprechend und in die Tat umsetzend, ohne zu vereinfachen, ohne das Gefühl zu erwecken, er stiege »hinunter«, wie das bisher im bürgerlichen »Kino« üblich war. Ein für den deutschen Film bisher ungewöhnlicher Darsteller, Reinhold Bernt, macht den Antifaschisten Kurt Blank zur geschlossensten Gestalt des Films. Es gab viele neue Gesichter: Irene Korb, Brigitte Krause, Karl-Heinz Deickert, wohltuende neue Gesichter, die man gern wiedersehen wird. Bruno Mondi führte die Kamera sehr sauber und eindringlich. Er machte das Experiment, sich auf keine Experimente einzulassen.
ROTATION gibt den Menschen eine gute Gewissheit: dass es immer und gerade heute am Menschen selbst liegt, was aus ihm wird.
DER HELLE WEG (Sowjetunion)
Verdienstvoll ist es zweifellos, die Welt der Operette (oder Filmoperette) mit der wirklichen Welt in Einklang zu bringen; sie wegzuführen aus den Bereichen adliger Familienkonflikte und hin zu den Problemen des Publikums. Diese locker zu behandeln, wäre ihre Aufgabe.
Der sowjetische Film DER HELLE WEG ist ein Versuch in dieser Richtung. Interessant und gut ist der Vorwurf. Es ist die alte Geschichte vom Aschenbrödel. Im Märchen holt sie ein Prinz in sein Schloss, das Glück kommt von außen zu ihr, ohne ihr Zutun, wie in moderneren Märchen der Geldbriefträger. In diesem Film aber ist das Schloss eine Fabrik. Und Tanja, das kleine, unscheinbare Mädchen vom Dorf, erarbeitet sich das große Glück des freien, schöpferischen Menschen. Sie kommt dahinter, dass man mehr Maschinen bedienen kann, als bisher üblich, sie wird ausgezeichnet, ihr Name steht in den Zeitungen, schließlich ist sie Ingenieurin.
Aber leider bringt ein gutes Thema die gute Form nicht zwangsläufig mit sich. DER HELLE WEG hat viele Fehler, fundamentale und weniger schwerwiegende. Ihm fehlt die durchgehende große Linie, die Schnur, auf die man die Perlen reihen könnte. Aber auch die einzelnen Szenen sind keine Perlen. Es gibt Bilder wie auf einer bedruckten Bonbonschachtel, und andere, die sich um eine belehrende Aussage bemühen, sie folgen übergangslos aufeinander. Unmotivierte Groteske wechselt mit Szenen, die ernst genommen werden wollen. Auch die Personen sind wenig organisch entwickelt, bei mancher Gelegenheit plastisch und anschaulich, dann wieder pathetisch und unpersönlich. Regie führte G. Alexandrow, in der Hauptrolle Ljuba Orlowa.
ES WEHT EIN FRISCHER WIND (Sowjetunion)
Der Tanker »Derbent« wird im Wettbewerb von seinem Schwesternschiff überholt, weil auf der Werft seine Maschinen schlecht überholt wurden. Nach diesem Ergebnis aber beginnt ein frischer Wind zu wehen, weniger auf dem Kaspischem Meer, als auf dem »Derbent«, der es befährt – zu langsam befährt. Der Ingenieur Bassow hatte auf der Werft an den »Derbent«-Motoren gearbeitet. Aber kein Mensch wollte auf ihn hören, als er sagte, dass er schlecht gearbeitet habe. Er wurde als Nörgler versetzt, eben auf diesen »Derbent«, wo er nun als Obermechaniker Dienst tut. Auch seine Frau, Telegraphistin einer Küstenstation, verstand ihn nicht. Hier setzt die Handlung eigentlich ein. Bassow, die Landratte, hat fünf Maschinisten unter sich, Seeleute. Natürlich gibt es anfangs Spannungen, doch dann wird gezeigt, dass eine tüchtige Landratte und fünf tüchtige Seeleute zusammen sechs tüchtige Sowjetbürger sind. Sie überholen die Maschinen auf See, sie entdecken den Fehler, der die Tourenzahl drückte. Schließlich, als der Schwestertanker defekt auf See liegt und in Brand gerät, reißen sie das Steuer herum, das der herzverfettete Kapitän und der Steuermann, ein »Romantiker des Meeres«, auf den die dummen Mädchen hereinfallen und dem die gewitzten Ohrfeigen geben, in Fluchtrichtung gestellt hatten. Sie rudern zu Hilfe, der Brand wird gelöscht, das Schiff wird gerettet.
Das ist kurz und grob der Inhalt des Films, an dessen gutem Ende der Tanker »Derbent« und seine Besatzung im Hafen gefeiert werden, und Bassow auch seine Frau wiederfindet. Es ist der Sieg der Tatkraft über die Gleichgültigkeit, der Triumph der selbstkritischen Arbeit über die behagliche Selbstzufriedenheit.
Der Film hat das Milieu vollkommen eingefangen oder das Milieu ihn. Die fünf Maschinisten vertuschen mit seltenem Erfolg, dass sie im Nebenberuf Schauspieler sind. Wo sie sitzen, weht die Luft einer kleinen, abgelegenen Hafenstadt, wo sie arbeiten, arbeiten wirkliche Schiffsmotoren. Sie vereinen breiten, urwüchsigen Volkshumor mit der gerissenen Pfiffigkeit alter Seefahrer. Die Fotografie von Sergej Iwanow ist ausgezeichnet, ganz der Verdichtung der Atmosphäre zugetan, obgleich sie und der Regisseur Alexander Fainzimmer sich beim Brand des Tankers auf hoher See einige Möglichkeiten entgehen ließen. Einige Namen aus der unvollkommenen Liste der Schauspieler: A. Krasnopolski, W. Merkurjew, W. Kuznezow und A. Gorjunow.
CASANOVA (Frankreich)
Obgleich vom Titel nicht viel zu erwarten ist, hätte man von den Franzosen doch etwas mehr Temperament erwartet. Aber die Liebe wird in jedem besseren schlechten Film interessanter demonstriert als hier. Casanova säbelt im Duell einige Gegner nieder, in zunehmendem Maße bekommt auch der Zuschauer Stiche im Herz. Der alte Casanova, obgleich wir ihn nicht kennen, war sicher doch kein Operettenheld wie dieser hier. Die Fotografie, sonst oft Lichtblick auch schlechter französischer Filme, bietet ebenfalls wenig. In der undankbaren Hauptrolle: Georges Guétary.
1949
Die Ostberliner Jugendzeitschrift Start erschien als »illustriertes Blatt der jungen Generation« wöchentlich mit 12 Seiten im schwarz-weißen Bleisatz: erste Ausgabe 7. Juni 1946, letzte Ausgabe 2. Dezember 1949, anschließend wurde das Personal der Redaktion von der FDJ-Tageszeitung Junge Welt übernommen. W.K. arbeitete beim Start zunächst als Volontär, dann als Redakteur und Autor. Er schrieb zahlreiche Texte: Reportagen, Feuilletons, Miszellen etc., oft unter dem Pseudonym Wolf Haase und auch zusammen mit anderen Autoren. Die Auswahl sammelt die Texte Kohlhaases mit Bezügen zu Film.
MIRANDA, GB 1948, Regie Ken Annakin, DER DOPPELADLER (L’Aigle à deux tétes), F 1948, Regie Jean Cocteau, HERZKLOPFEN, auch ZUM KLEINEN GLÜCK (AU PETIT BONHEUR), F 1946, Regie Marcel L’Herbier, DER ENGEL MIT DER POSAUNE AU 1948, Regie Karl Hartl, in: Start Nr. 22/1949, DIE LETZTE ETAPPE, (OSTATNI ETAP) P 1949, Regie Wanda Jakubowska, Produktion Film Polski, in: Start Nr. 36/1949, ROTATION, SBZ 1949, Regie: Wolfgang Staudte, Produktion DEFA Potsdam-Babelsberg, in: Start Nr. 39/1949, DER HELLE WEG (SWETLY PUTJ), UdSSR 1940, Regie Grigori Alexandrow, Produktion Mosfilm Studio Moskau, in: Start Nr. 46/1949, ES WEHT EIN FRISCHER WIND (TANKER DERBENT) UdSSR 1940, Regie Alexander Fainzimmer, Produktion Filmstudio Odessa, in: Start Nr. 48/1949, CASANOVA, (LES AVENTURES DE CASANOVA), F 1948, Regie Jean Boyer, in: Start Nr. 49/1949, (unterzeichnet mit Wolf Haase, dem Pseudonym Wolfgang Kohlhaases).
BERLIN – ECKE SCHÖNHAUSER
Eine Erinnerung
Bei BERLIN – ECKE SCHÖNHAUSER ging es mal wieder darum – es ging ja immer darum! –: Wie ist die Welt? Darauf konnte man sich schwer einigen, und wenn man darüber einig wurde, hieß die abgeleitete zweite Frage: Wie soll man sie dann zeigen? Darum ging es eigentlich vierzig Jahre lang.
Wir hatten uns damals zum Neorealismus bekannt, wenn wir nach unseren Vorbildern gefragt wurden. Andere fielen uns nicht ein. Einige entgegneten, der kritische Realismus, auch der sozialkritische, kann doch für die Fragestellung des Sozialismus kein Vorbild sein. Wo ist das Positive? Gut, zugegeben, es gibt solche jungen Leute an der Straßenecke, aber es gibt doch auch ganz andere, und warum wird der Film über die gemacht und nicht über die anderen?
Bei irgendeiner Abnahme hatte ein hochrangiger Mann geäußert, er hätte jetzt einmal genau hingesehen: Das sei ja wohl ein Film über das Alltagsleben der Jugend in der DDR, so müsse man es ja sehen, und in diesem Film scheine nur dreimal die Sonne. Und er setzte sich. Einige Leute waren durch diesen Satz etwas angeschlagen, denn er war von großer Beweiskraft. Ich weiß noch, wie ich erwiderte – wir waren ja nicht so verängstigt: »Um zu einer solchen Beobachtung zu kommen, muss man allerdings bis drei zählen können.« Aber es gab auch andere Leute, die den Film – auch aus politischen Gründen – mochten und sagten: »Das ist gut, auch solche Leute muss es auf der Leinwand geben. Aber im nächsten Film muss gezeigt werden, dass es auch eine andere Jugend gibt.«
Es ging darum, welche Rolle die FDJ spielte, die kommt im Film ja nur einmal vor. Es gab den Wunsch, dass die politischen Institutionen des Alltagslebens, die Partei- und FDJ-Sekretäre, die es in jedem Betrieb gab, in einem Film, der dort spielt, auch vorkommen sollten. Und die schlechteren Filme hatten ja auch zuweilen solche Pfeife rauchenden Weisheitszähne. Man hatte wohl auch die illusorische Vorstellung, man könnte eine so flüchtige und gerade erst auf die Welt gekommene Institution mit dem Gewicht eines Priesters oder Pfarrers ausrüsten, aber die sind schon seit 2000 Jahren da, sind also Standardmodelle. Man dachte, wenn die einen Pfarrer haben, haben wir unser Pendant. Ein FDJler ist nur einmal drin, den spielt Hartmut Reck. Er und Ekkehard Schall haben einen kurzen Dialog. Die Figur, die am ehesten für die Gesellschaft stand, spielt Raimund Schelcher, er ist Volkspolizist, der sich mit Behutsamkeit und Respekt zu schwierigen Fragen verhielt. Das war nicht listenreich von uns.
Ich habe damals viele Polizeiakten gelesen und auch mit Leuten geredet, denn der Stoff, der sich in Aktenlagen und in Delikten zeigte, hatte sehr viel mit der allgemeinen Realität zu tun. Wenn man mit Leuten von der Volkspolizei sprach, traf man Realisten, die waren auf der Straße und wussten, es hilft ihnen oft wenig, was im Neuen Deutschland steht. Ich wollte Leuten wie diesen in einer solchen Figur gerecht werden und mir kein Zaubermännchen ausdenken.
Dann kam der Film heraus und wurde bei Teilen der Kritik und beim Publikum ein deutlicher Erfolg. Damit waren die Leute, die ihn nicht so mochten, nicht in der besten Position. (…) Unter den politischen Funktionären oder denen, die im engeren Sinne das Filmwesen zu verwalten hatten, traf ich in all den Jahren Simplifikateure, aber auch Freunde des Kinos, die wussten, wir kommen nur mit der Wahrheit ein Stück weiter, anders wird es wohl nicht gehen. Beides gab es. Auch unter Kollegen habe ich Leute getroffen, die mit drei Handgriffen ganz gut zurecht kamen. Wenn man sie ihnen angeboten hat, haben sie sie auch benutzt. Es war nicht so simpel. Hier ist das permanent gute Gewissen, was verletzt ist, und hier ist die permanente Uneinsichtigkeit.
Der Film hatte also auch ein paar Freunde. Er wurde auf irgendeiner Konferenz kritisiert, wohl auf der Filmkonferenz, auf der ich auch geredet habe, wofür mir hinterher Martin Hellberg dankbar war, an den ich aber nicht gedacht hatte. (…) Ich habe, nebenbei gesagt, immer gedacht, es wäre merkwürdig, wenn man Filme über eine konfliktreiche Welt machen will, dass man dabei selbst keine Konflikte hätte. Ich dachte, unser Konflikt ist das Wunschdenken und die Wirklichkeit, die Utopie und die Realität, worüber man sich wohl ein Leben lang streiten wird. Also ich war nicht erschrocken oder habe gedacht, wer diesen Film nicht liebt, bringt mein Weltbild durcheinander.
1957
In: Spur der Filme. Zeitzeugen über die DEFA. Hrsg. Ingrid Poss, Peter Warnecke. Ch. Links Verlag Berlin 2006, S. 120f.
DER FALL GLEIWITZ
Eine Erinnerung
Der Film hatte einen politischen Gedanken. Wir befanden uns im Kalten Krieg. Da war der Luftkorridor, und es waren immer Zwischenfälle möglich. Wenn man die Definitionshoheit hat, kann man ein Ereignis herstellen, wie man will. Und sollte man zu solcher Mechanik, an einem historischen Beispiel, nicht einen Film machen? (…) Und natürlich kannten wir Hitlers Satz vor den Generälen am 20. März 1939: »Ich werde Grund zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig, ob glaubhaft.« (…)
Dieser Stoff kam uns sofort entgegen. (…) Wir wollten Leute zeigen, die in bestimmten Zusammenhängen funktionieren, und zugleich noch etwas anderes versuchen, nämlich etwas vom Gemüt des Faschismus in Deutschland zeigen.
Also wir wollten keinen über Einfühlung hergestellten Bericht über den Fall Gleiwitz. Und irgendwann verband sich dieser Stoff mit der Erinnerung an den tschechoslowakischen Film DIE WEISSE TAUBE von František Vláčil, mit dieser Symmetrie der Bilder und ihrer Kälte und Nüchternheit. Und wir überlegten, ob wir das nicht auch so machen könnten, und guckten uns Fotos aus der Nazizeit an. Auch bei Leni Riefenstahl findet man das: die Mittelachse, den einen Mann, der durch alle anderen geht, die Blöcke, die Symmetrie, die die Perspektive vermeidet. Wir wollten dem Publikum ein kaltes Bild dieser Vorgänge vermitteln.
Wir wollten uns den Film von Vláčil in Prag noch einmal ansehen und den Kameramann befragen. So lernten wir Jan Čuřík kennen, und der wollte unseren Film machen und war auch für unsere Überlegungen zu gewinnen. Rücker und ich schrieben im Kontakt zu Klein das Drehbuch im Bewusstsein der beabsichtigten Stilistik. (…)
Wir fuhren nach Gleiwitz und fanden dort noch den Sendeturm und das Original-Sendehaus und besichtigten alles. Der Sendeturm bot auch wieder die Symmetrie an, denn der stand beim Blick von der Straße aus wirklich symmetrisch dahinter. Wir überlegten, ob wir eventuell auch etwas von oben machen könnten, und stiegen auf den Turm. Er hatte eine Holzkonstruktion und knarrte wie ein altes Segelschiff. Ich bin nach zwanzig Metern wieder abgestiegen. Klein stieg etwas weiter, der Kameramann noch ein Stück höher und unser Regie-Assistent Erwin Stranka ist bis ganz hoch geklettert, und alle bewunderten ihn. Als er wieder unten war, stellte er fest, dass er sein Drehbuch mit allen Eintragungen oben liegen gelassen hatte. Es folgte ein bitterer zweiter Aufstieg. Er brauchte fast eine Stunde und ging wortlos ins Bett.
Aber es passierte noch etwas anderes: Am letzten Abend vor dem Drehen, alles war abgesprochen, hatten wir noch Zeit und gingen in Gleiwitz ins Kino. Dort lief ein ganz schöner, auf jeden Fall respektabler Film von Jerzy Kawalerowicz, NACHTZUG. Čuřík fand den Film ausgezeichnet, und Klein fand ihn gut, aber schlecht. Und da beide ernsthafte Menschen waren, endete das Gespräch nach einer Stunde damit, dass Čuřík sagte: »Ich reise ab, das Ganze ist ein Missverständnis, wir können den Fall GLEIWITZ nicht zusammen drehen.« Die beiden beschlossen, nicht mehr miteinander zu reden, es war laut geworden. Die ganze Nacht gingen Emissäre im Hotel umher und fragten, ob man sich nicht doch noch am nächsten Morgen versuchsweise treffen könnte. So war es dann auch. (…)
1961 kam DER FALL GLEIWITZ heraus, gleich nach dem Bau der Mauer. Er hatte es nicht leicht beim Publikum, weil er bestimmte Sehgewohnheiten nicht bediente. Konsequenz unserer Inszenierung war auch, dass der Film beim Schnitt immer kürzer wurde. Damit hatten wir ein Problem: Wenn er noch kürzer würde, würde er dem Studio gar nicht als Spielfilm abgenommen werden. Wir wollten ihn aber auf keinen Fall länger machen, als er nach dem Zwang der Bilder sein musste. (…)
Die Abnahme im Studio war durchwachsen. Dudow gefiel er, ihm gefiel die Radikalität. (…) Völlig unvermutet traf uns der Verdacht, wir könnten den Faschismus ästhetisiert haben. lch glaube, das war in erster Linie durch Alfred Kurella angestoßen. Ihm fehlte auch völlig das Positive. Es reichte nicht, dass diese große stumme Figur im Film das erste Opfer eines Krieges ist, der am Ende 50 Millionen Menschen das Leben kostet. Wo ist der Widerstand? Das war der alte Hut: Wo ist das Positive? Aber der neue Hut war: Ästhetisierung des Faschismus. Das war der Riefenstahl-Vorwurf. Ich meine aber, dass dieser Film eine Gegenposition aufbaut und dass er die kalte Mechanik nicht verklärt, sondern darstellt.
1961
In: Spur der Filme. Zeitzeugen über die DEFA. Hrsg. Ingrid Poss, Peter Warnecke. Ch. Links Verlag Berlin 2006, S. 168
DIE BESTEN JAHRE
Ein Mann kommt aus dem Krieg. Die Vorgeschichte wird nicht erzählt, nur so viel ist klar; es ist nicht die Heimat, in die er zurückkehrt; die war in Böhmen. Ein Hund läuft ein Stück mit ihm, dem erzählt er davon; dort waren Berge, und die Pferdeschlitten hatten Glöckchen. Wird man hier leben können?
Der Mann hat einen Einweisungsschein als Untermieter, eine Frau öffnet die Tür einer Baracke, man begrüßt sich förmlich, sie hat einen Teller Suppe übrig; erst als er schon isst, bemerkt er, dass sie auch ein Kind hat. Er borgt sich einen Bogen Papier und schreibt einen Aufnahmeantrag für die Partei. Er legt sich ins Bett, zur Wand gedreht, die Frau tritt zu ihm, um ihn zuzudecken, er greift nach ihrer Hand, sie gibt nach. Anderntags geht er in die Fabrik, die demontiert wird, anderntags schlachtet er den Hund, der wieder hinter ihm herläuft, anderntags träumt er, vom Hundefleisch satt, neben der Frau auf dem Sofa den Traum vom Tucheweben oder von einer Neulehrerstelle, wegen der besseren Lebensmittelkarte.
So der Anfang. Am Ende, zwanzig Jahre danach, steigt ein Mann aus einem Tatra, derselbe Mann, hat den ersten Herzanfall hinter sich und ein Ministeramt vor sich. Die Zeit dazwischen umschreibt der Titel des Films DIE BESTEN JAHRE und meint wohl beides, die besten, die man hat, und die besten, die man zu geben hat.
Günther Rücker (Buch und Regie) hat seinen ersten Film gemacht. Er hat vorher Drehbücher, Dokumentarfilmtexte und Hörspiele geschrieben und hat auch inszeniert, vor allem im Funk. Daraus haben sich offensichtlich für die vorliegende Arbeit einige Vorteile ergeben, vor allem ein genauer, sprachlich differenzierter Dialog, der des Zitierens wert ist, aber auch eine ausgezeichnete Führung der Schauspieler. Drinda, Lissy Tempelhof, Hindemith, Grosse leisten Vorzügliches, jeder ist gewissermaßen neu zu entdecken, jeder fügt dem Bild, das man sich in den letzten Jahren von seiner Filmarbeit machte, ein paar wesentliche Züge hinzu. Und Hoppe, bisher wenig bekannt, liefert als Lehrer Klein eine ungewöhnlich perfekte Episodenfigur.
Die Geschichte des Ernst Machner und seiner besten Jahre wird unspektakulär erzählt, den wirklichen Begebenheiten angepasst, in denen es wenig Sensationen gab, aber viel Mühe und zu lange Diskussionen und zu kurze Nächte. Fünfzehn Jahre im Leben Machners meinen fünfzehn Jahre alltäglicher Revolution. Rücker teilt etwas über einen Mann mit, der dabei war, und der künftig dabei sein wird. Wie ist er durchgekommen? Nicht mit Glanz und Gloria. Nicht mit dem fertigen Plan der Zukunft in der Tasche. Mit Schweiß. Mit Pervitin-Tabletten. Mit sehr langsam wachsendem Selbstvertrauen. Mit einem Herzknacks. Aber dennoch: Machner, der einmal nichts wollte, als sich satt essen und Tuche weben, und der, als er kaum Lehrer war, schon eine Schule leiten musste, und den man, als er sich an die Dorfschule gerade gewöhnt hatte, als Rektor in ein Gymnasium schickte, der die Bücher einen Tag vor seinen Schülern las, und der Französisch nicht verstand und Englisch falsch aussprach, und der nun auf das Ministerium losmarschiert und schon weiß, dass die gerade fertigen Lehrpläne schon morgen nicht ausreichen werden, Machner ist durchgekommen. Und indem darüber berichtet wird, erfahren wir etwas von dem offenen Geheimnis, warum wir alle durchgekommen sind, und mit uns dieses nüchterne und fantastische Unternehmen DDR.
Die Ankunft Machners im Gymnasium und seine Führung durch Haus und Friedhof und Bibliothek zähle ich zu dem Besten, was zum Thema der deutschen Teilung im DEFA-Film gemacht worden ist, da ist alles, was so oft als fehlend gerügt wird; geschichtlicher Aspekt und klassenbedingte Haltungen in einem zwangsläufigen, völlig glaubwürdigen Vorgang. Machners Gegenspieler, der nun nach dem Westen gehen wird, ist als Vertreter historischen Unrechts, doch persönlich durchaus im Recht, schmerzliches Berührtsein wird beiden Seiten zugestanden, und die Ironie, mit der Rücker die Szene ausstattet, lässt der Tradition doch die Würde, die ihr zukommt. Das Motiv wird später noch einmal verwendet, wenn Machner selbst die junge Lehrerin durchs Haus führt, der Spaß kehrt sich gegen ihn, aber er klingt wie ein Echo aus der Vergangenheit, und deutlich wird, wie Tradition aufgehoben worden ist, in jenem bekannten doppelten Sinn.
Ein sich änderndes Motiv wird noch ein anderes Mal verwendet, Machners jeweiliger Protestruf gegen seine zu frühen Berufungen, der da lautet: »So kann man doch nicht mit Menschen umgehen.« Gegen Schluss übernimmt Machners junge Frau den Text, es ist ihr so ernst, wie es ihm war, und er sitzt in komischer Resignation dabei. Auch hier hat die Situation einen ironischen Ton, gerade dadurch bleibt sie ernsthaft.
Die gewisse Relativierung seines Helden scheint mir ein Vorzug des Films zu sein, es geht nicht darum, einen Mann zu rechtfertigen, sondern von ihm zu berichten, so wie man über ein Wegstück spricht, das man hinter sich hat. Dass da Platz auch für Traurigkeit ist, etwa in der ersten Liebesgeschichte, und für Zweifel an der eigenen Kraft, dass nicht nur von erreichtem Glück die Rede ist, sondern auch von dem, das nicht erreicht wird, darin liegt die Redlichkeit den wirklichen Machners gegenüber, ohne die die Parteinahme für sie künstlerisch wenig produktiv wäre. Und es zeigt sich da auch, dass eine Sache zu erzählen zugleich verlangt, sie moralisch zu verarbeiten.
Die Notwendigkeit, viele Jahre im Leben Machners in den Blick zu bekommen, hat Rücker mit Recht zu einer epischen Erzählweise veranlasst, er gibt die Essenz der Vorgänge, er springt in die Pointe, er zeigt Resultate. Das ist kaum anders möglich. Rücker hat versucht, den Stil seines Films aus den oft vor allem gedanklichen Vorgängen seiner Geschichte zu entwickeln, er rechnet mit der möglichen Dramatik gehirnlicher Aktion, er hat nicht nach Tricks, Finessen, nach einem Korsett aus filmischer Form gesucht. Von Peter Krauses Kameraarbeit in diesem Sinn unterstützt, hat er gerade so eine Anzahl ausgezeichneter Szenen geschaffen, Vorgänge voller intellektueller Substanz, welche die häufig gehandelten Vorstellungen, wie viel davon wohl für eine Filmszene zuträglich sei, vielleicht ein wenig erweitern. Ich glaube aber, dass er sich einige Möglichkeiten, Konflikte direkt vorzuführen, nicht hätte entgehen lassen sollen, weil er damit einen exemplarischen Beleg für die ganze Entwicklung Machners hätte liefern können, der dem möglichen Einwand vorgebeugt hätte, Machners Weg sei nicht konfliktreich genug dargestellt. Eine solche direkte, wenn man will naturalistisch-dramatische Behandlung einer Situation wäre beispielsweise bei der Übernahme des Geschichtsunterrichtes durch Machner denkbar gewesen. Der, für sich genommen, schöne Robespierre-Text führt die Szene zu schnell und zu glatt ins Gleichnis.
Was ist sonst zu tadeln? Meiner Ansicht nach vor allem ein Mangel an Fabel im letzten Teil des Films, ein Missverhältnis zwischen der Summe der aufgeworfenen Probleme und den dafür vorhandenen naiven Belegen, ohne die Poesie schwer möglich ist. Der Besuch des Kybernetikers, der die Methoden der Schulbildung in Frage stellt, führt zu einem glänzenden Dialog über Mathematik und Menschenbildung und die technische Revolution und letztlich über die Dialektik von Geduld und Ungeduld, aber was sich dahinter verbirgt, für Machner, in der Mitte seines Lebens, wird mehr genannt als bewiesen. Machners zweite Liebe könnte in verschiedener Richtung erzählt werden, man erfährt zu wenig davon. Machner zieht in eine neue Wohnung in einer neuerbauten Stadt, er soll ein ganzes Schulkombinat übernehmen, das heißt, man hört davon, denn Machner verlässt die Stadt schon wieder, um nach dem Tod Schmellers nach Berlin zu gehen. Hier sind, etwas überspitzt gesagt, die Vorgänge durch die Information über sie ersetzt. Der Film, der seinen Zuschauer durch behutsame Genauigkeit gewonnen hat, verletzt, die Gangart wechselnd, seine eigene künstlerische Ökonomie, zu viel ist zu wenig, zu knapp ist zu glatt, und ein Mangel an ästhetischer Verarbeitung rächt sich an der Realität: sie erscheint geebnet und Machners Weg künftig weniger beschwerlich. Dieser Eindruck entsteht, obwohl Rücker verschiedentlich deutlich macht, etwa im Dialog mit dem Kybernetiker und in den Gesprächen mit Schmeller, dass er dies gerade nicht meint. Aber »gesagt ist gesagt« gilt nicht im Film, wenn nicht Entsprechendes gezeigt wird, die Figur Machners verliert in diesem Abschnitt an Repräsentanz und Verbindlichkeit für den Betrachter, und darum ist es schade, weil die Höhe des Vergnügens, womit hier die Summe der Wirkungen eines Films gemeint ist, natürlich maßgeblich vom Ende einer Geschichte bestimmt wird.
So viel ist allerdings klar; hier liegt kein simplifizierender Blick auf die Gegenwart vor, sondern ein nicht gelöstes Arbeitsproblem in einem Film, der insgesamt ein bemerkenswertes spezifisches Gewicht hat, einen sehr eigenen Ton, eine Reihe von Schönheiten. Und vor allem eine Qualität, die letzthin nicht immer anzutreffen war; in einer Geschichte in Bildern gibt er ein Stück Geschichtsbild.
Er ist einer der Wichtigsten der letzten Jahre.
1966
In: Filmwissenschaftliche Mitteilungen Nr. 1/1966, S. 217ff.
Sowjetische Filme
Die ersten Filme aus der Sowjetunion sah ich bald nach Kriegsende in demselben Berliner Vorortkino, in dem die Filme meiner Kindheit gelaufen waren, gute und böse. Nun schritt Iwan der Schreckliche über die gewohnte Leinwand, Matrosen stürmten das Winterpalais, und wenn ich versuche, das Bild von damals von später hinzugekommenen Eindrücken zu trennen, so leben in meiner Erinnerung Szenen mit scharfen Schwarz-Weiß-Kontrasten, Menschenmassen in dynamischer Bewegung, Bojarenbärte, die alten Maschinengewehre mit den Handwagenrädern, dazu spielt eine fremde, heroische Musik.
Vielleicht gewannen wir, die damals Vierzehnjährigen, aus dieser ersten Begegnung nicht mehr, aber auch nicht weniger, als eine Ahnung von einer großen, uns bis dahin unbekannt gebliebenen Welt. Was das Verständnis für diese Welt anging, so wurden Bücher für mich zunächst ergiebiger als Filme, Gorki war zu entdecken, Scholochow, Gladkow, Makarenko.
Als ich anfing, für den Film zu arbeiten, beeindruckte mich am stärksten der italienische Neorealismus. Bis heute scheint mir, dass es in den frühen fünfziger Jahren nirgendwo sonst eine Filmkunst gab, die ihrer philosophischen und sozialen Position so konsequent ästhetischen Ausdruck verlieh. Die Erwähnung des Neorealismus gehört insofern zur Sache, als man weiß, wie viel er dem revolutionären sowjetischen Film verdankt. Und vielleicht ist das etwas Wichtiges, was zum Lob der Kunst eines Landes gesagt werden kann, dass sie über Grenzen hinweg nicht nur Genüsse, sondern auch Erkenntnisse liefert, und dass sie Impulse gibt, die humanistisches Engagement und künstlerische Entdeckungen fördern, bei Freunden, bei Abseitsstehenden, manchmal sogar bei Gegnern.
In den letzten Jahren habe ich verschiedene sowjetische Filme gesehen, die ich für bedeutsam halte, Beispiele der moralischen Verantwortung, der intellektuellen Redlichkeit und der poetischen Kraft sozialistischer Filmkunst. Ich nenne Romm, Jutkewitsch, Tschuchrai, Tarkowski; aber ihre Namen sollen auch für andere stehen, vor allem auch für junge Regisseure, Schriftsteller, Kameraleute und Schauspieler. Von ihnen allen, dessen bin ich sicher, ist Qualität zu erwarten; es ist schön und ermutigend, sich befreundet und verbündet zu wissen.
1967
Antwort Wolfgang Kohlhaases auf eine Bitte der Redaktion an verschiedene Filmkünstler der DDR, über die Einflüsse des sowjetischen Films auf ihre persönliche Entwicklung zu berichten. In: Filmwissenschaftliche Mitteilungen Nr.2/1967, S. 401
ICH WAR NEUNZEHN
Der deutsch-sowjetische Leutnant
Ein Brief
Liebe Freunde, sich über die eigene Arbeit im Voraus zu äußern, über ein Buch, das noch nicht erschienen, einen Film, der noch nicht aufgeführt ist, das ist ein Unterfangen, dem ein Autor sich nicht gern unterzieht. Vor allem deshalb nicht, weil er sich ja angestrengt hat, das, was er mitteilen will, in eben seiner Arbeit auszudrücken. Und eine Gänsehaut befällt ihn, wenn er sich der Erwartung ausgesetzt sieht, er solle das Stück Welt, das er sich abzubilden bemüht hat, nun etwa katalogisieren und dem Besucher eine Liste der zu erhoffenden Einsichten zur Eintrittskarte mitliefern: die Moral von der Geschichte in der Vorschau. Täte er das, müsste er der Schlüssigkeit des von ihm Gelieferten misstrauen, aber auch der Fähigkeit und Lust des Zuschauers, Entdeckungen selbst zu machen und gerade dadurch etwas zu gewinnen. Gewiss, Filme wie andere Kunstprodukte werden nach gewissen Regeln gemacht, und nach gewissen Regeln wollen sie auch verbraucht werden. Aber das sind keine Vorschriften. Eher ist es eine bestimmte Erfahrung, mit Kunst umzugehen, die wie jede Erfahrung durch Übung gewonnen wird, eine Fähigkeit des Gefühls und des Verstandes, ein Buch oder ein Bild oder einen Film als einen auf eine besondere Weise geordneten, verdichteten Ausschnitt Leben zu verstehen und sich selbst darin zu finden, aber auch anderes, als sich selbst und andere Möglichkeiten von sich selbst.
Natürlich wünscht sich ein Filmmacher einen produktiven Zuschauer, der auf die Abenteuer des Lebens aus ist und auf den Sinn dahinter. Auf ihn baut er, seinen Ansprüchen will er genügen, mit ihm will er reden, aber er will ihm nichts vorsagen. Denn so sehr wir uns wünschen, dass Film ein Massenbedarfsartikel sei, so spielt doch die Gebrauchsanweisung dabei nicht die gleiche Rolle wie beispielsweise bei Büchsenöffnern.
Ich will auch nicht die Handlung des Films ICH WAR NEUNZEHN erzählen, nur dass runde zehn Tage im Leben eines Neunzehnjährigen gezeigt werden, und die hatten es in sich, denn es waren die letzten Tage des letzten Krieges, Ende und Anfang, und der Junge war ein Deutscher, und zugleich war er ein Leutnant der sowjetischen Armee. Er begegnet Menschen und wechselt Worte und Schüsse. Und was ihm dabei widerfährt, ihm und seinen sowjetischen Genossen, ist so etwas wie eine Bestandsaufnahme deutscher Haltungen. Wird Euch das interessieren? Das haben wir uns oft gefragt.
Wenn man mit der Arbeit zu einem Film beginnt, geht man jedes Mal von neuem auf die Suche nach dem Publikum. Man hat eine Geschichte zu erzählen und will sie so erzählen, wie sie erzählt werden muss, und manchmal hat man wenig Lust, sich um etwas anderes zu kümmern als um die Schwierigkeiten, die in der Sache selbst stecken. Aber selbstverständlich will man die Geschichte jemandem erzählen. Und falls man einen Film macht, muss man sich darauf einrichten, sie vielen Leuten zu erzählen, unterschiedlich nach Alter, Bildung und Interessen, und das in einem bestimmten, mehr oder weniger zufälligen Moment, nämlich dann, wenn der Film herauskommt.
So viel war klar, als wir ICH WAR NEUNZEHN machten: Von den vielen, an die wir uns wenden, sind uns besonders wichtig die Jungen, zugespitzt gesagt, die, die heute neunzehn sind. Ihnen vor allem soll ihr Altersgenosse Gregor Hecker begegnen, wenn er mit seinem klappernden SIS über die Oder kommt und in ein ihm unbekanntes Land einfährt, von dem man ihm sagt, es sei seine Heimat. Das ist jetzt über zwanzig Jahre her, eine lange, kurze Zeit. Was sollen die heute Neunzehnjährigen davon lernen?
Möglicherweise nichts, wenn jemand meint, man könne aus einem Film wie aus einer Fibel lernen. Aber wenn Ihr die Geschichte eines Burschen sehen wollt, der zu jung für den Krieg ist und ihn doch bestehen muss, ein Deutscher in der Uniform eines Russen, einer, der gern lacht, aber man sieht ihn weinen, ein Leutnant, der von Moskau bis Berlin gekommen ist, aber nur bis zur siebenten Klasse, wenn Ihr so einen sehen wollt und was er verliert und was er gewinnt, dann kann es sein, dass Euch der Kinositz nicht hart wird. Es kann sein, dass Ihr für eine Weile einsteigt in den Lautsprecherwagen, der damals am nördlichen Rand der Schlacht um Berlin mit kochendem Motor seinen Weg machte. Es kann auch sein, dass Ihr diesem deutsch-sowjetischen Leutnant und seinen Prüfungen zuseht, und durch den Sinn geht Euch dieser und jener Vergleich mit Eurem eigenen Leben, das dem seinen ganz unähnlich ist, aber nur unähnlich? Es kann schließlich auch passieren, in Eurer Fantasie, dass Gregor Hecker aus seiner Zeit in unsere herübertritt und sieht aus wie einer von heute.
Denn auch heute muss sich einer sein Vaterland erwerben, sein sozialistisches Vaterland, um es wirklich zu besitzen. Auch heute muss einer seinen Freunden Freund und seinen Feinden Feind sein und muss herausfinden, wer das eine und wer das andere ist. Auch heute muss einer sein Wissen und Gewissen an einer Welt erproben, die gleichermaßen voller Hoffnung und Bedrohung ist.
Der Mai 1945 hat seine Vorgeschichte und seine Nachgeschichte und die Geschichte danach, das sind wir. Was wir erreicht haben, wofür wir uns Mühe geben, was wir bewachen, nichts von dem wäre ohne diesen Mai. Und von ein paar Tagen und ein paar Leuten in jenem Frühjahr berichtet unser Film, weil alle Geschichte die Geschichte von Menschen ist. Wenn Ihr Euch anseht, was wir gemacht haben, so hoffen wir sehr, Eure Meinung zu hören, auch Widerspruch, auch Fragen. Wir, das sind Konrad Wolf, der damals neunzehn war, ich, der vierzehn war, Jaecki Schwarz, der noch nicht geboren war, und alle anderen, die auf dem Vorspann stehen, der einem im Kino meist zu lang vorkommt.
1968
An die Leser der FDJ-Tageszeitung Junge Welt zur bevorstehenden Premiere von ICH WAR NEUNZEHN. In: Junge Welt 30. Januar 1968
DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ
Filmmotiv
1
Ich berichte von zwei Männern. Der eine ist Bildhauer. Der andere war Bauleiter, er lebt nicht mehr. Er ist gestorben in der Mitte seiner und unserer Jahre. Ich habe bei dem einen gesessen und bei dem anderen, sie haben erzählt, und ich habe mir etwas aufgeschrieben.
2
Ein Anruf: Wollen Sie etwas für die Kunstausstellung machen, Herr E.?
Ich bin dicke in der Arbeit, andererseits brauche ich Geld, ich antworte: Ein Porträt ja. Nur nichts Größeres.
Ausgezeichnet, Sie wissen, wir brauchen vor allem Porträts von unseren Schrittmachern. Ihr Partner ist der VEB Tiefbaukombinat Berlin. Am besten, Sie melden sich beim Direktor.
Ich habe an sich nicht viel Lust, einen Arbeiterkopf zu machen. Ich bin da einfach unsicher, wenn man so will; das verändert sich alles, die Gesichter, die Haltungen, aber andererseits herrscht so eine statische Vorstellung, wie ein Arbeiterkopf auszusehen habe. Arbeiterklasse, den Blick geradeaus usw., ich vereinfache jetzt natürlich.
Ich melde mich beim Direktor, der hat nicht viel Zeit, ist aber freundlich, verschafft mir einen Betriebsausweis, wünscht mir viel Glück und weist mich dem Betriebsteil 3 zu, das ist der Tunnelbau. Der Chef dort ist ein forscher Mann, ein Ingenieurstyp, nicht unsympathisch. Wo kann ich die für Sie wichtigen Leute sehen? Ohne Aufsehen. Vielleicht in der Kantine? Du kannst gleich mitkommen in die Baracke, da ist eine Besprechung.
Ich möchte einfach beobachten.
Er läuft mir voran zur Baracke, in einem Raum sitzt ein Mann in Zimmermannskluft, Mitte fünfzig. Komm mal mit, Willi. Dann kommen wir in ein anderes Zimmer, da sitzt einer krumm am Tisch und kaut an seiner Stulle. Der Chef sagt: Hanne, hier will einer einen Kopf von dir machen. Oder von dir, Willi.
Das ist genau die Situation, die ich nicht wollte.
Da wird nichts draus, sagt der am Tisch und isst weiter.
Wenn einer, dann du, sagt der, der Willi heißt.
Nee, nee, sagt der am Tisch.
Ich bin wirklich in einer blöden Lage. Denn so viel ist mir auf den ersten Blick klar, mich interessiert der, der am Tisch sitzt. Aber wie vermeide ich es, den anderen zu kränken, zumal dieser Hannes sagt: Nee, nee, machen Sie mal den Kopp von Willi. Mit mir wird das nichts. Ich will das nicht.
Mir ist es völlig egal, sagt Willi, und ich lächle etwas verkrampft in seine Richtung.
Gut, überlegen Sie sich das, sage ich zu dem Mann am Tisch. Ich komme in drei Tagen wieder.
Sie können kommen, sagt er. Aber es wird nichts. Und falls Sie irgendwelchen Ärger haben sollten, schicken Sie die Leute zu mir. Vierzehn Tage lang gehe ich alle zwei, drei Tage hin, meist treffe ich ihn nicht an. Ist Herr B. da? Nee, der wird aber gleich kommen. Ich sitze und warte und komme mit der Zeit ins Gespräch. Wie machen Sie denn das, so einen Kopf? Aus was für Material? Innen ein Gestell? Hält denn der Gips? Wird die Bronze rübergegossen? Nein, das ist ein Sandguss. Wie man ein Maschinenteil gießt …Wo haben Sie denn das gelernt? Studiert? Was verdient man dabei? Kann viel sein oder mager. Je nachdem, wie schnell man ist. Und ob man Aufträge kriegt. Und ob man mehrere Abgüsse verkaufen kann … Und der muss sich also hinsetzen und stillhalten? Zeichnen Sie den erst?
Nur B., wenn er kommt, fragt nie etwas. Er spricht mit keinem Wort von der Sache. Die anderen reden ihm zu: Na mach doch, Hanne. Du wirst in Bronze gegossen, Mensch …
Was ich von B. erfahre, höre ich nicht von ihm. Er war in der Wismut, ein Held der frühen Jahre, hoch dekoriert, sehr jung. Dann Staublunge, Schluss. Anscheinend sah es eine Weile so aus, als ob er unterginge, aber er ging nicht unter, er fing von vorn an, machte seinen Bauingenieur, und jetzt leitet er eine Schicht beim Tunnelbau.
Schließlich, von den anderen genötigt, fragt er doch mal: Wie stellen Sie sich denn das vor? Ich sage, dass ich ihn etwa zwanzigmal eine Stunde brauchte, er müsste vielleicht über Mittag zu mir ins Atelier kommen, es wäre nicht weit.
Das wird nichts, sagt er, ich kann hier nicht weg.
Der Betriebsleiter hört davon: Der kann natürlich weg. Ich spreche mit ihm. Nein, sprechen Sie nicht mit ihm, sage ich.
Einmal lässt einer in der Baracke einen Text los, Künstler und nackte Weiber usw. B. sagt, ohne die Stimme zu heben: Setz dir mal die Mütze gerade. Und der andere geht gleich raus. Aber ich komme nicht weiter.
Ich war, wie schon gesagt, ein bisschen allergisch gegen proletarische Typen, mein Bild davon wandelt sich. Aber als ich B. sah, wusste ich, dass der noch einmal meine ganze Aufmerksamkeit weckt. Je öfter ich ihn sehe … Alle Formen fesseln nicht. Das ist so, das ergibt sich auch aus der Geschichte der Bildhauerei. Aber er fesselt mich. Er ist klein und drahtig, unbrechbare Energie im Gesicht. Und vielleicht, scheint mir manchmal, auch ein Schleier von Tragik, seine Vergangenheit oder vielleicht Krankheit.
Aber ich komme nicht weiter.
Mal scheint er weich zu sein, dann wieder nicht.
Dann kommt mir ein Gedanke. Vielleicht kann ich ihn dort machen. Nicht im Atelier. Ich sage seinen Kollegen, ich könnte ihn dort machen, wenn sie einen Raum hätten. Das lässt sich machen. Nun hat B. kein Argument mehr, er muss ja nicht weg. Aber es gibt keinen Raum mit Oberlicht … Kein Problem, denn nun nehmen alle ein ziemliches Interesse an der Sache, alle außer B. Sie installieren zwei Baustellenscheinwerfer, die gegen die Decke strahlen, besorgen eine Drehscheibe von einem alten Lkw-Hänger, bauen ein Podest, auf dem B. sitzen kann, weil es günstiger ist, man hat den Kopf in Augenhöhe, wenn man im Stehen modelliert. Bis wann brauchen Sie das? Na ja, es ist natürlich schon viel Zeit verloren … Na, kommen Sie morgen mal vorbei.
Als B. merkt, dass er auf einem Podest sitzen soll, besteht er darauf, dass der Raum abgeschlossen wird. Die Fenster werden zugehängt. Wenn ich weggehe, muss ich den Schlüssel bei ihm abgeben. Wenn er reinkommt, ehe er Platz nimmt, schließt er von innen ab. Mir ist es immer peinlich, wenn einer meinethalben stillhalten muss. Das ist ein Problem für mich, mich von der eingebildeten Not des anderen zu befreien.
Ich bringe ein paar Reclam-Hefte mit und lege sie ihm hin, etwas von Sarah Lipman und etwas über den Bau eines Staudamms in Afrika. Er sieht sie sich an, legt sie weg und sagt: Da bringe ich mir selber was mit. Das nächste Mal liest er: Schomburgk, Erlebnisse mit Tieren.
Er kommt auf die Minute pünktlich um vier Uhr. Guten Tag, guten Tag, er setzt sich. Können Sie Ihren Kragen ein bisschen aufmachen? Er tut es. Ich lege meine Uhr hin. Nach einer Stunde sage ich: Es ist fünf. Er steht auf, knöpft seinen Kragen zu und geht.
Nach vier Sitzungen fragt er: Haben Sie schon öfter solche Köpfe gemacht? Ja. Er stellt keine weitere Frage. Beim fünften oder sechsten Mal sagt er: Meine Kumpels haben mir zugeredet. Wenn Sie hier auf die Angebertour hergekommen wären, wäre es nichts geworden. Aber so, und wo Sie auch nicht ganz gesund sind … Man will ja einem Menschen auch gefällig sein …
Mit der Zeit schlägt er seinen Kragen von allein um. Ich setze mich auch mit dazu, wenn er mit seinen Kollegen Skat spielt, und beobachte ihn aus verschiedenen Blickwinkeln. Er lässt es zu. Einmal kommt jemand hereingestürzt: Die Grube säuft ab …
B. sammelt ohne äußere Aufregung die Karten ein, aber sein Gesicht lebt auf. Im Krieg hat es Leute gegeben, die aus Stumpfsinn Stoßtrupps machten, gleichgültig auch gegen das eigene Leben. Das war es nicht. Es war eher eine kaum gezeigte Lust daran, dass jetzt Entscheidungen zu treffen waren. Und wenn es schwierig wird, wird er ruhig, scheint mir. Auch darauf beruht seine Autorität. Als die Arbeit dem Ende zugeht, frage ich ihn: Können wir den Kopf vielleicht jemand zeigen? Den Kollegen vielleicht?
Er sagt: Gut. Aber das mache ich … Ich sage Ihnen dann, was die gesagt haben.
Vielleicht sollte eine Diskussion sein?
Nein.
Verstehen Sie, ich bin auch nicht so scharf darauf, aber gewöhnlich soll so eine Sache doch benutzt werden, um Interesse an Kunst zu wecken …
Nein, nein, in diesem Fall nicht. Wenn Sie Ärger haben, schicken Sie die Leute zu mir.
Ich habe keinen Ärger.
Na gut.
Der Kopf steckt auf einer Eisenstange. Als er fertig ist, muss er abgeschnitten werden. Ich trage ihn in die Schlosserbude. B. kommt mit seiner Truppe vorbei. Nun sagen Sie mal was …
Alle sind verlegen. Na ja, das ist er … Das ist Hannes, klar … Er selbst sagt kein Wort. Was wird denn nun damit? fragen die anderen. Na ja, mal sehen. Er kommt auf die Ausstellung … Ach so.
Ich nehme den Kopf mit und verabschiede mich von B.
Wir sind allein. Also, Herr B., dann sind wir fertig …
Ja.
Also dann möchte ich mich bedanken …
War ja nichts bei.
Wir geben uns die Hand, er geht. Dann dreht er sich noch mal um und lächelt, höflich, nicht mehr fremd, ein bisschen wie ein Komplize vielleicht, jedenfalls wie zu jemand, den man kennt. Ich bin froh, dass ich ihn getroffen habe und dass ich ihn kenne, und ich würde ihn gern noch besser kennen. So einen Nachbarn könnte man sich wünschen. Wie soll ich es ausdrücken? Wenn mein Auto kaputt wäre, würde ich gern sagen: Sehen Sie mal mit rein, Herr B. Ich würde gern mit ihm zusammen daran rumbauen. Mir geht es immer mehr so: Nur die sinnlichen Beziehungen sind eine Bereicherung. Man kann sie nur haben durch Aktion. Etwas miteinander machen … In dem Mann war auch irgendetwas Müdes, Hoffnungsloses, ihm selbst vielleicht gar nicht bewusst. Er war einmal eine Figur, ein Held, und wenn er wollte, könnte er es vielleicht noch sein. Aber er hat keinen Ehrgeiz außerhalb seiner Lebensgewohnheiten. Am Anfang, als er sich weigerte, Modell zu sitzen, sagte er: Womöglich noch lächeln, was?
Ich hätte gern seine Frau kennengelernt, darauf ist er nicht eingegangen. Einmal, als er in sein Auto stieg, er wohnt in Potsdam, sagte ich: Na, vielleicht komme ich in Potsdam mal vorbei …
Ja, sagte er, soll schön sein dort.
Der Betrieb hat nie nach dem Kopf gefragt. Der Kopf war ausgestellt und steht jetzt bei mir zu Hause. Es ist komisch, vorher hatte ich den LPG-Vorsitzenden S. gemacht, der kam in die Ausstellung »Das Gesicht unseres Zeitgenossen« und schlug ein wie eine Bombe. Es war eine Kettenreaktion, ich habe ihn in vierzehn Tagen viermal verkauft, er wird überall hingeschleppt, gehört zu den Standard-Porträts. Der B. ist nicht schlechter, glaube ich, aber keiner will ihn.
3
Ein Mann steht in einer Baubude am Ofen und wartet. Auf den ersten Blick sieht er schmächtig aus, auf den zweiten sieht man, dass er zäh ist und wahrscheinlich kräftig. Er spricht leise, lächelt oft dabei.
E., ja ich weiß. Der hat es nicht leicht mit mir gehabt. Ich bin an sich nicht dafür. Auch nicht, dass dauernd Bilder in der Zeitung sind oder so was. Jedenfalls nicht von einem Mann. Das sieht so aus, als wenn nur einer arbeitet. Die meisten Kollegen sind hier nicht für so was, da können Sie fragen. Oder dass man zum Beispiel lächeln soll, wenn einer fotografiert wird, so was wirkt immer künstlich. Ja, wenn man sowieso gerade lacht, weil einer einen Witz erzählt, oder so, das ist was anderes. Wie gesagt, ich wollte erst nicht. Aber er war hartnäckig und kam immer wieder. Und schließlich habe ich mir dann gesagt, du tust ihm einen Gefallen. Es ist ja sein Lebensunterhalt. Er war auch nicht unsympathisch. Wir waren ihm auch anders behilflich, mit Scheinwerfern und so. Wir hatten so ein Gestell und oben noch ein Stuhl drauf, auf dem musste ich sitzen. Die Kollegen waren natürlich neugierig und wollten immer mal einen Blick reinwerfen. Aber es war zugeschlossen, den Schlüssel habe ich nicht aus der Hand gegeben. Wenn da noch einer zugesehen hätte, hätte ich es nicht gemacht. Jeder ist eben kein Schauspieler. Die haben natürlich auch versucht, durchs Fenster zu linsen, es waren Milchglasscheiben, aber manchmal stand es offen. Na ja, aber das habe ich verhindert. So etwa zwanzigmal habe ich da gesessen. Ich habe mir dann immer was zu lesen mitgebracht, weil es ziemlich langweilig war. Manchmal hat sich auch eine Stunde lang an dem Kopf nichts verändert, er hat nur was abgekratzt. Na ja, das ist sicher schwierig. Der Kopf soll wohl in Bronze gegossen worden sein, aber ich habe ihn nur in Ton gesehen. Was soll ich sagen? Es ist ja keine Fotografie, es kommt vielleicht nicht nur auf die Ähnlichkeit an. Die Kollegen fanden ihn auch ähnlich. Nur warum die Augen geschlossen sind, haben sie nicht verstanden, das war eine Frage. Meine Frau fand es wieder nicht ähnlich, allerdings hat die nur ein Foto davon in der Zeitung gesehen, da kann man sich vielleicht keine richtige Vorstellung machen. Der Betrieb hat keine Notiz von der Sache genommen, ich wüsste nicht. Nur dass er von der Direktion aus hergeschickt worden war. Zuerst bin ich ausgewichen, auch wenn er angerufen hat. Aber als er immer wieder herkam, wollte ich ihm schließlich den Gefallen tun. Er hat mir auch mal erzählt, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Das ist ja sein Lebensunterhalt, diese Arbeit, das muss er ja machen. Obgleich, wenn er forsch angekommen wäre, mit ›das muss jetzt sein‹ oder so, dann wäre vielleicht nichts daraus geworden.
In so einer Ausstellung war ich noch nicht. Ich habe ein Bild zu Hause, im Schlafzimmer. Ja, eine Landschaft. Ja, ich glaube, auf einem Bild muss was Schönes drauf sein, aber es muss ja nicht so wie früher sein, nackte Elfen oder so was …
Ja, damals war ich bei der Wismut. Zuerst sollte es nur ein Jahr sein, dann sind sechs daraus geworden. Ja, ich bin ziemlich hoch ausgezeichnet worden, Nationalpreis und Held der Arbeit und so … Aber ich bin dann da weg. Ich hatte ja eigentlich keine richtige Ausbildung, hatte ja als ungelernter Häuer angefangen. Ich hätte natürlich auch im Bergbau bleiben können. Aber meine Eltern wohnten inzwischen in der Gegend von Potsdam, und da bin ich hierher und habe mit Tiefbau angefangen. Zuerst habe ich ein Jahr Maurer gelernt. Ich hätte ja vielleicht auch andere Möglichkeiten gehabt, aber ich wollte die Sache von Grund auf lernen. Zuerst war die Haltung von den Kollegen immer ein bisschen abwartend, was ist denn das für einer mit so viel Orden. Aber wenn sie dann gemerkt haben, dass man ein Mensch wie jeder andere war …
Während wir uns unterhalten, läutet in der Baubude das Sprechfunkgerät, verschiedene Nummern werden gerufen, zwei oder dreimal auch die Nummer von B. Man fragt ihn, er gibt Anweisungen. »Acht Lastwagen Schutt, können wir die nicht mal schnell kriegen?«
B., der Bauleiter ist, spricht über sein Metier, den Tiefbau.
Ich will nichts gegen den Hochbau sagen, aber in gewissem Sinne bauen die einfach nach Vorlage. Beim Tiefbau dagegen ist es jedes Mal anders. In dieser Gegend zum Beispiel Schichtenwasser. Da muss man sich auskennen. Jetzt ist ein Bauleiter gekommen, von Eberswalde, ein alter erfahrener Mann, bestimmt, aber der sieht sich ganz schön um.
Ich habe ein Segelboot gehabt, so zehn Quadratmeter, bei Potsdam ist ja viel Wasser. Aber seit ich den Wagen habe, komme ich nicht mehr so dazu. Jetzt habe ich einen Angelkahn, aus Plaste, ich angle, und da kann auch der Schäferhund mit, ohne was zu zerschrammen mit seinen Pfoten.




























