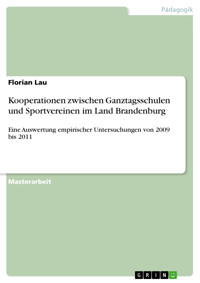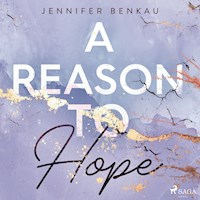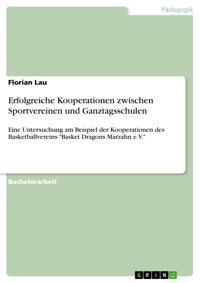
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 1,0, Universität Potsdam, Sprache: Deutsch, Abstract: Da für Kinder und Jugendliche in Deutschland der organisierte Vereinssport am Nachmittag eine sehr große Rolle spielt, kommt es zwischen Schule und Sportverein zu einem Interessenkonflikt. Spannend ist die Frage, wie diese Konflikte in der Praxis gelöst werden und ob dabei sogar wertvolle Synergieeffekte entstehen können. Dazu sind natürlich von allen Beteiligten Voraussetzungen zu schaffen, damit die Zusammenarbeit gelingen kann. Um einen Überblick über das Thema zu erhalten, werden in dieser Arbeit die bisherige Entwicklung der Ganztagsschulen in Deutschland nachgezeichnet und die Kooperationspartner Schule und Verein vorgestellt. Dabei wird die besondere Bedeutung von Sportvereinen für die Ganztagsbildung dargestellt. Anschließend werden die bisherigen Publikationen zu dem Thema „Gelingensbedingungen“ miteinander verglichen und im Kontext der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - StEG“ bewertet. Aus diesen Ergebnissen werden eigene Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen abgeleitet und neuformuliert. Diese Gelingensbedingungen werden exemplarisch in einer Evaluation der Schul-Kooperationen eines Berliner Basketballvereins angewandt und damit ihre Anwendbarkeit an einem Fallbeispiel überprüft. Aus diesen Erkenntnissen werden anschließend Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen Schulen und Sportvereine die Qualität ihrer Zusammenarbeit erhöhen können. Diese berücksichtigen sowohl die Zufriedenheit der kooperierenden Akteure als auch eine pädagogischen Ausrichtung, der jede Zusammenarbeit von Schule mit außerschulischen Kooperationspartnern unterliegen sollte. Das Ziel von Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen muss sein, die Bewegungsintensität und die Qualität des Sports im Schulalltag zu erhöhen und somit einen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung der Ganztagsschule zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Vorstellung des Themas
2 Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland
3. Sportvereine als außerschulische Kooperationspartner
3.1 Die Bedeutung von Sportvereinen in der Bildungslandschaft
3.2 Bedenken der Vereine gegenüber der Ganztagsschule
3.3 Motive der Sportvereine zur Kooperation
4 Schulen als Kooperationspartner für Sportvereine
4.1 Motive für Schulen zur Kooperation mit Sportvereinen
4.2 Kooperationsmodelle „Schule - Verein“
4.2.1 Additive Kooperationsmodelle
4.2.2 Intearatives Modell
5 Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation von Sportvereinen mit Ganztagsschulen
5.1 Vorbereitung der Kooperation
5.1.1 Ausgangsbedingungen analysieren
5.1.2 Formulierung der Kooperationsziele
5.1.3 Schaffen von Rahmenbedingungen
5.2 Durchführung der Kooperation
5.2.1 Aufbau einer erfolgreichen Kommunikation
5.2.2 Zusammenarbeit und gemeinsame Qualifikation
5.2.3 Öffentlichkeitsarbeit
5.3 Auswertung der Kooperation
5.3.1 Abgleich der Ziele mit dem Erreichten
5.3.2 Reflexion der eigenen Rolle
5.3.3 Kontinuität gewährleisten
5.4 Einfluss und Gewichtung der formulierten Gelingensbedingungen
6. Untersuchung der Ganztagsschulkooperationen des Basketballvereins „Basket Dragons Marzahn e.V.“
6.1 Interviews mit den Kooperationspartnern
6.2 Bewertung der Kooperationen
7. Fazit
8 Literaturverzeichnis
9 Internetquellen
1 Vorstellung des Themas
Kein bildungspolitisches Thema wurde in den letzten zehn Jahren so intensiv diskutiert wie die Einführung der Ganztagsschule. Obwohl die Einführung oft als Reaktion auf die PISA-Studie von aus dem Jahr 2000 gesehen wird, wurde bereits in den 1970er-Jahren darüber diskutiert (Holtappels & Rollet, 2009, S. 63). Die Befürworter versprechen sich von der Ganztagsschule institutionelles Mittel gegen soziale Ungleichheit und für die individuelle Förderung von Schülern. Darüber hinaus sollen Kinder mit Migrationshintergrund besser integriert werden. Die Ansätze der Ganztagsschule werden von den Fachgremien als besonders reformorientiert charakterisiert. Sie richten die Schulentwicklung auf ein „Leben und Lernen“ in der Schule aus (Böcker & Laging, 2010, S.9). Mit dem Slogan „Ganztagsschulen. Zeit für mehr“ (BMBF, 2010a) wirbt die Bundesregierung für einen Schultyp, welcher der Bildung einen größeren Anteil am Alltag der Schüler zusichert. Damit vollzieht sich derzeit im deutschen Bildungssystem eine „mentale Wende“ (Schultz, 2011, S. 3) von der Halbtagsbildung zur Ganztagsbildung. Diese Ausweitung des Schultages auf den Nachmittag geht mit einer verringerten Freizeit zu Ungunsten der Familien, der Freunde und des organisierten Sports einher. Da für Kinder und Jugendliche in Deutschland der organisierte Vereinssport am Nachmittag eine sehr große Rolle spielt, kommt es zwischen Schule und Sportverein zu einem Interessenkonflikt. Spannend ist die Frage, wie diese Konflikte in der Praxis gelöst werden und ob dabei sogar wertvolle Synergieeffekte entstehen können. Dazu sind natürlich von allen Beteiligten Voraussetzungen zu schaffen, damit die Zusammenarbeit gelingen kann. Um einen Überblick über das Thema zu erhalten, werden in dieser Arbeit die bisherige Entwicklung der Ganztagsschulen in Deutschland nachgezeichnet und die Kooperationspartner Schule und Verein vorgestellt. Dabei wird die besondere Bedeutung von Sportvereinen für die Ganztagsbildung dargestellt. Anschließend werden die bisherigen Publikationen zu dem Thema „Gelingensbedingungen“ miteinanderverglichen und im Kontext der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - StEG“ bewertet. Aus diesen Ergebnissen werden eigene Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen abgeleitet und neuformuliert.
Diese Gelingensbedingungen werden exemplarisch in einer Evaluation der Schul-Kooperationen eines Berliner Basketballvereins angewandt und damit ihre Anwendbarkeit an einem Fallbeispiel überprüft. Aus diesen Erkenntnissen werden anschließend Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen Schulen und Sportvereine die Qualität ihrer Zusammenarbeit erhöhen können. Diese berücksichtigen sowohl die Zufriedenheit der kooperierenden Akteure als auch eine pädagogischen Ausrichtung, der jede Zusammenarbeit von Schule mit außerschulischen Kooperationspartnern unterliegen sollte. Das Ziel von Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen muss sein, die Bewegungsintensität und die Qualität des Sports im Schulalltag zu erhöhen und somit einen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung der Ganztagsschule zu schaffen.
2 Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland
Abb.1: Schulen nach Form des Ganztagsangebot 2006 (Quelle: KMK, 2008, S. 5)
In der PISA-Studie der OECD wurden im Jahr 2001 erstmals international schulische Leistungsdaten parallel zu den Schüler-, Schul- und Bildungssystemmerkmalen analysiert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse wurde in Deutschland sehr stark von den Medien begleitet, sodass die Studie schon vor der Präsentation eine enorme Beachtung fand und sogar von einem „PISA-Schock“ gesprochen wird. Von den 32 teilnehmenden Industrienationen landete Deutschland auf dem 22. Platz. (vgl. OECD, 2001). Die Studie offenbarte eklatante Mängel an der Struktur des deutschen Bildungssystems. Alarmierend war die Tatsache, dass in keiner anderen Industrienation die Bildungschancen so stark von der sozialen Herkunft bestimmt sind. Insbesondere Schüler mit Migrationshintergrund werden im deutschen Bildungssystem behindert. Das manifestiert sich in einer unterproportionalen Beteiligung an weiterführenden Bildungsgängen, die zu einem höheren Schulabschluss führen (OECD, 2003, S. 67). Und so setzte nach der Veröffentlichung der Studie eine bildungspolitische Debatte mit der zentralen Forderung einer Ganztagsschule ein, die u.a. eine Vergrößerung der sozialen Chancengleichheit und die bessere Integration von Kindern mit Migrationshintergrund begünstigen sollte (Holtappels et al., 2009). Im Mai 2003 wurde von der rot-grünen Regierung das „Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung“ auf den Weg gebracht. Dieses auf sechs Jahre angelegte Programm sollte mit vier Milliarden Euro den Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen unterstützen (ebd.). Als Ganztagsschulen werden solche Schulen verstanden, die den Schülern an mindestens drei Tagen der Woche ein ganztägiges Angebot von wenigstens sieben Zeitstunden zur Verfügung stellen (KMK, 2008, S. 5).
Die Schulen müssen an den entsprechenden Tagen ein Mittagessen anbieten und ein Konzept nachweisen, welches eine konzeptionelle Verzahnung des Vormittagsunterrichts mit dem Nachmittagsprogramm vorsieht. Coelen und Otto (2008, S. 17 ff.) prägten den Begriff der „Ganztagsbildung“ und konstatierten, dass Bildung nicht nur in der Schule stattfinden sollte. Hildebrandt- Stramann (2010, S.48) sieht Bildung ebenfalls in der Verknüpfung von Lernorten, „die sich (...) lokal als Bildungslandschaft präsentieren“. Neben diesen allgemeinen