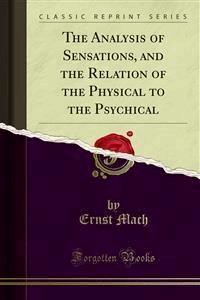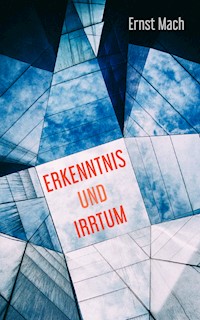
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Erkenntnis und Irrtum" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ernst Mach (1838-1916) war ein österreichischer Physiker, Sinnesphysiologe, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker sowie ein Pionier der gerade entstehenden Wissenschaftsgeschichte. Nach Ernst Mach ist die Mach-Zahl benannt, welche die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit beschreibt. Neben Problemen in der Physik und deren Lösungen beschäftigte er sich aber auch mit Fragen der Philosophie. Er gilt als einer der einflussreichsten Vertreter oder Mitbegründer des Empiriokritizismus. In der Sinnesphysiologie machte er wichtige Experimente zum Gleichgewichtssinn des Menschen, zu Reizschwellen und zu optischen Täuschungen. In der Psychologie wurde er ein Wegbereiter der Gestaltpsychologie bzw. Gestalttheorie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Erkenntnis und Irrtum
Inhaltsverzeichnis
Wilhelm Schuppe
in herzlicher Verehrung gewidmet.
Vorwort
Ohne im geringsten Philosoph zu sein oder auch nur heißen zu wollen, hat der Naturforscher ein starkes Bedürfnis, die Vorgänge zu durchschauen, durch welche er seine Kenntnisse erwirbt und erweitert. Der nächstliegende Weg hierzu ist, das Wachstum der Erkenntnis im eigenen Gebiet und in den ihm leichter zugänglichen Nachbargebieten aufmerksam zu betrachten, und vor allem die einzelnen den Forscher leitenden Motive zu erspähen. Diese müssen ja ihm, welcher den Problemen so nahe gestanden, die Spannung vor der Lösung und die Entlastung nach derselben so oft miterlebt hat, leichter als einem andern sichtbar sein. Das Systematisieren und Schematisieren wird ihm, der fast an jeder größeren Problemlösung immer noch Neues erblickt, schwerer, erscheint ihm immer noch verfrüht, und er überläßt es gern den darin geübteren Philosophen. Der Naturforscher kann zufrieden sein, wenn er die bewußte psychische Tätigkeit des Forschers als eine methodisch geklärte, verschärfte und verfeinerte Abart der instinktiven Tätigkeit der Tiere und Menschen wiedererkennt, die im Natur- und Kulturleben täglich geübt wird.
Die Arbeit der Schematisierung und Ordnung der methodologischen Kenntnisse, wenn sie im geeigneten Entwicklungsstadium des Wissens und in zureichender Weise ausgeführt wird, dürfen wir nicht unterschätzen.1 Es ist aber zu betonen, daß die Übung im Forschen, sofern sie überhaupt erworben werden kann, viel mehr gefördert wird durch einzelne lebendige Beispiele, als durch abgeblaßte abstrakte Formeln, welche doch wieder nur durch Beispiele konkreten, verständlichen Inhalt gewinnen. Deshalb waren es auch besonders Naturforscher, wie Kopernikus, Gilbert, Kepler, Galilei, Huygens, Newton, unter den neueren J. F. W. Herschel, Faraday, Whewell, Maxwell, Jevons u. a., welche dem Jünger der Naturforschung mit ihren Anleitungen wirkliche Dienste geleistet haben. Hochverdienten Männern, wie J. F. Fries und E. F. Apelt, denen manche Teile der naturwissenschaftlichen Methodik so ausgiebige Förderung verdanken, ist es nicht gelungen, sich von vorgefaßten philosophischen Ansichten ganz zu befreien. Diese Philosophen, wie selbst der Naturforscher Whewell, sind durch ihre Anhänglichkeit an Kantsche Gedanken zu recht wunderlichen Auffassungen sehr einfacher naturwissenschaftlicher Fragen gedrängt worden. Die folgenden Blätter werden darauf zurückkommen. Unter den älteren deutschen Philosophen ist vielleicht nur F. E. Beneke als derjenige zu nennen, welcher sich von solchen vorgefaßten Meinungen ganz frei zu machen wußte. Rückhaltlos bekennt er seine Dankesschuld an die englischen Naturforscher.
Im Winter 1895/96 hielt ich eine Vorlesung über »Psychologie und Logik der Forschung«, in welcher ich den Versuch machte, die Psychologie der Forschung nach Möglichkeit auf autochthone Gedanken der Naturwissenschaft zurückzuführen. Die vorliegenden Blätter enthalten im wesentlichen eine Auswahl des dort behandelten Stoffes in freier Bearbeitung. Ich hoffe hiermit jüngeren Fachgenossen, insbesondere Physikern, manche Anregung zu weiteren Gedanken zu bringen, und dieselben zugleich auf von ihnen wenig kultivierte Nachbargebiete hinzuweisen, deren Beachtung doch jedem Forscher über das eigene Denken reiche Aufklärung bietet.
Die Durchführung wird natürlich mit mancherlei Mängeln behaftet sein. Obgleich ich mich nämlich stets für die Nachbargebiete meines Spezialfaches und auch für Philosophie lebhaft interessierte, so konnte ich selbstverständlich manche dieser Gebiete, und so besonders das letztgenannte, doch nur als Sonntagsjäger durchstreifen. Wenn ich hierbei das Glück hatte, mit meinem naturwissenschaftlichen Standpunkt namhaften Philosophen, wie Avenarius, Schuppe, Ziehen u. a., deren jüngeren Genossen Cornelius, Petzoldt, v. Schubert-Soldern u. a., auch einzelnen hervorragenden Naturforschern recht nahe zu kommen, so mußte ich mich hiermit von andern bedeutenden Philosophen, wie es die Natur der gegenwärtigen Philosophie notwendig mit sich bringt, wieder sehr entfernen.2 Ich muß mit Schuppe sagen: Das Land des Transscendenten ist mir verschlossen. Und wenn ich noch das offene Bekenntnis hinzufüge, daß dessen Bewohner meine Wißbegierde gar nicht zu reizen vermögen, so kann man die weite Kluft ermessen, welche zwischen vielen Philosophen und mir besteht. Ich habe schon deshalb ausdrücklich erklärt, daß ich gar kein Philosoph, sondern nur Naturforscher bin. Wenn man mich trotzdem zuweilen, und in etwas lauter Weise, zu den ersteren gezählt hat, so bin ich hierfür nicht verantwortlich. Selbstverständlich will ich aber auch kein Naturforscher sein, der sich blind der Führung eines einzelnen Philosophen anvertraut, so wie dies etwa ein Molièrescher Arzt von seinem Patienten erwartet und fordert.
Die Arbeit, welche ich im Interesse der naturwissenschaftlichen Methodologie und Erkenntnispsychologie auszuführen versucht habe, besteht in folgendem. Zunächst habe ich getrachtet, nicht etwa eine neue Philosophie in die Naturwissenschaft einzuführen, sondern eine alte abgestandene aus derselben zu entfernen, ein Bestreben, das übrigens auch von manchen Naturforschern recht übelgenommen wird. Unter den vielen Philosophemen, die im Laufe der Zeit aufgetreten sind, befinden sich nämlich manche, welche die Philosophen selbst als Irrtümer erkannt oder doch so durchsichtig dargelegt haben, daß sie von jedem Unbefangenen leicht als solche erkannt werden konnten. Diese haben sich in der Naturwissenschaft, wo sie einer weniger aufmerksamen Kritik begegneten, länger lebend gehalten, so wie eine wehrlose Tierspecies auf einer abgelegenen Insel von Feinden verschont bleibt. Solche Philosopheme, welche in der Naturwissenschaft nicht nur nutzlos sind, sondern schädliche müßige Pseudoprobleme erzeugen, haben wohl nichts Besseres verdient, als beseitigt zu werden. Habe ich damit etwas Gutes getan, so ist dies eigentlich das Verdienst der Philosophen. Sollten sie dieses von sich weisen, so wird die künftige Generation vielleicht gegen sie gerechter sein, als sie selbst es sein wollten. Ferner habe ich im Verlauf von mehr als 40 Jahren, als von keinem System befangener naiver Beobachter, im Laboratorium und Lehrsaal Gelegenheit gehabt, die Wege zu erschauen, auf welchen die Erkenntnis fortschreitet. Ich habe versucht, dieselben in verschiedenen Schriften darzulegen. Aber auch, was ich da erblickt habe, ist nicht mein ausschließliches Eigentum. Andere aufmerksame Forscher haben oft dasselbe oder sehr Naheliegendes wahrgenommen. Wäre die Aufmerksamkeit der Naturforscher nicht so sehr von den sich drängenden Einzelaufgaben der Forschung in Anspruch genommen gewesen, so daß manche methodologische Funde wieder in Vergessenheit geraten konnten, so müßte, was ich an Erkenntnispsychologie zu bieten vermag, seit langer Zeit schon in gesichertem Besitz der Naturforscher sich befinden. Eben darum glaube ich, daß meine Arbeit nicht verloren sein wird. Vielleicht erkennen sogar die Philosophen einmal in meinem Unternehmen eine philosophische Läuterung der naturwissenschaftlichen Methodologie und kommen ihrerseits einen Schritt entgegen. Wenn dies aber auch nicht geschieht, hoffe ich doch den Naturforschern genützt zu haben.
Herr Dr. W. Pauli, Privatdocent für interne Medizin, hatte die besondere Freundlichkeit, eine Korrektur zu lesen, wofür ich ihm hiermit meinen herzlichen Dank ausspreche.
Wien, im Mai 1905.
D. V.
Vorwort zur zweiten Auflage
Der Text der zweiten Auflage unterscheidet sich nur unwesentlich von jenem der ersten. Zu eingreifender Umarbeitung fehlte sowohl die Zeit als der Anlaß. Manche kritische Bemerkungen wurden mir auch zu spät bekannt, um dieselben noch berücksichtigen zu können.
Verweisungen auf Schriften verwandten Inhalts, welche gleichzeitig mit oder unmittelbar nach der ersten Auflage dieses Buches erschienen sind, habe ich in Form von Anmerkungen hinzugefügt. Eine nähere Verwandtschaft meiner Grundansichten zu jenen Jerusalems offenbart sich durch dessen Buch »Der kritische Idealismus und die reine Logik« (1905); dieselbe ist wohl enger, als wir beide, auf verschiedenem spezialwissenschaftlichen Boden stehend, vorher annehmen konnten; sie dürfte auf die gemeinsame Anregung durch die Biologie, insbesondere durch die Entwicklungslehre zurückzuführen sein. Manche Berührungspunkte und reiche Anregung fand ich auch in Stöhrs origineller Arbeit »Leitfaden der Logik in psychologisierender Darstellung« (1905). Sehr erfreut war ich durch Duhems Werk »La théorie physique, son objet et sa structure« (1906). So weit gehende Übereinstimmung hoffte ich bei Physikern noch nicht zu finden. Duhem weist jede metaphysische Auffassung physikalischer Fragen ab; er sieht in der begrifflich-ökonomischen Fixierung des Tatsächlichen das Ziel der Physik; er hält die historisch-genetische Darstellung der Theorien für die einzig richtige und didaktisch zweckmäßige. Das sind Ansichten, die ich in Bezug auf Physik seit reichlich drei Decennien vertrete. Die Übereinstimmung ist mir um so wertvoller, als Duhem ganz unabhängig zu denselben Ergebnissen gelangt ist. Während ich aber, wenigstens in dem vorliegenden Buch, hauptsächlich die Verwandtschaft des vulgären und des wissenschaftlichen Denkens hervorhebe, beleuchtet Duhem besonders die Unterschiede des vulgären und des kritisch-physikalischen Beobachtens und Denkens, so daß ich sein Buch meinen Lesern als ergänzende und aufklärende Lektüre wärmstens empfehlen möchte. In dem Folgenden werde ich oft auf Duhems Äußerungen zu verweisen und nur selten, in untergeordneten Punkten, eine Meinungsdifferenz zu bemerken haben.
Herr Dr. James Moser, Privatdocent an der hiesigen Universität, hatte die besondere Freundlichkeit, eine Korrektur zu lesen, wofür ich ihm auch hier herzlich danke.
Wien, im April 1906.
D. V.
In Ausführung einer letzten Anordnung des am 19. Februar 1916 verschiedenen Autors wurde diese dritte Ausgabe nur nach den schriftlichen Vermerken im Handexemplare korrigiert, ergänzt und mit einem Anhang versehen, der auch eine Zusammenstellung der Zitate in alter und neuer Auflage enthält.
Haar bei München, März 1917.
L. M.
1. Eine systematische Darstellung, welcher ich in allem Wesentlichen zustimmen kann, in welcher auch strittige psychologische Fragen, deren Entscheidung für die Erkenntnistheorie nicht dringend und nicht unbedingt nötig ist, sehr geschickt ausgeschaltet sind, gibt Prof. Dr. H. Kleinpeter (Die Erkenntnistheorie der Gegenwart. Leipzig, J. A. Barth, 1905).
2. In je einem Kapitel der »Mechanik« und der »Analyse« habe ich die mir bekannt gewordenen Einwendungen gegen meine Ansichten beantwortet. Hier muß ich nur einige Bemerkungen über Hönigswalds »Zur Kritik der Machschen Philosophie« (Berlin 1903) einfügen. Es gibt vor allem keine Machsche Philosophie, sondern höchstens eine naturwissenschaftliche Methodologie und Erkenntnispsychologie, und beide sind, wie alle naturwissenschaftlichen Theorien vorläufige, unvollkommene Versuche. Für eine Philosophie, die man mit Hilfe fremder Zutaten aus diesen konstruieren kann, bin ich nicht verantwortlich. Daß meine Ansichten mit den Kantschen Ergebnissen nicht stimmen können, mußte, bei der Verschiedenheit der Ansätze, die sogar einen gemeinsamen Boden für die Diskussion ausschließen (vgl. Kleinpeters »Erkenntnistheorie« und auch die vorliegende Schrift), für jeden Kantianer und auch für mich von vornherein feststehen. Ist denn aber die Kantsche Philosophie die alleinige unfehlbare Philosophie, daß es ihr zusteht, die Spezialwissenschaften zu warnen, daß sie ja nicht auf eigenem Gebiet, auf eigenen Wegen zu leisten versuchen, was sie selbst vor mehr als hundert Jahren denselben zwar versprochen, aber nicht geleistet hat? Ohne also im mindesten an der guten redlichen Absicht von Hönigswald zu zweifeln, glaube ich doch, daß eine Auseinandersetzung etwa mit den »Empiriokritikern« oder mit den »Immanenten«, mit welchen er doch noch mehr Berührungspunkte finden konnte, für ihn und andere bessere Früchte getragen hätte. Sind die Philosophen einmal untereinander einig, so wird die Verständigung mit den Naturforschern nicht mehr so schwer fallen.
Philosophisches und naturwissenschaftliches Denken
1. Unter einfachen, beständigen, günstigen Verhältnissen lebende niedere Tiere passen sich durch die angeborenen Reflexe den augenblicklichen Umständen an. Dies genügt gewöhnlich zur Erhaltung des Individuums und der Art durch eine angemessene Zeit. Verwickelteren und weniger beständigen Verhältnissen kann ein Tier nur widerstehen, wenn es sich einer räumlich und zeitlich ausgedehnteren Mannigfaltigkeit der Umgebung anzupassen vermag. Es ist hierzu eine räumliche und zeitliche Fernsichtigkeit nötig, welcher zunächst durch vollkommenere Sinnesorgane, und bei weiterer Steigerung der Anforderungen durch Entwicklung des Vorstellungslebens entsprochen wird. In der Tat hat ein mit Erinnerungausgestattetes Lebewesen eine ausgedehntere räumliche und zeitliche Umgebung im psychischen Gesichtsfeld, als es durch seine Sinne zu erreichen vermag. Es nimmt sozusagen auch die Teile der Umgebung wahr, die an die unmittelbar sichtbare grenzen, sieht Beute oder Feinde herankommen, welche noch kein Sinnesorgan anmeldet. Was dem primitiven Menscheneinen quantitativen Vorteil über seine tierischen Genossen verbürgt, ist wohl nur die Stärke seiner individuellen Erinnerung, die allmählich durch die mitgeteilte Erinnerung der Vorfahren und des Stammes unterstützt wird. Auch der Fortschritt der Kultur überhaupt ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, daß zusehends größere räumliche und zeitliche Gebiete in den Bereich der Obsorge des Menschen gezogen werden. Mit der teilweisen Entlastung des Lebens, welche bei steigender Kultur zunächst durch die Teilung der Arbeit, die Entwicklung der Gewerbe u.s.w. eintritt, gewinnt das auf ein engeres Tatsachengebiet gerichtete Vorstellungsleben des einzelnen an Kraft, ohne daß jenes des gesamten Volkes an Umfang verliert. Das so erstarkte Denken kann nun selbst allmählich zu einem Beruf werden. Das wissenschaftliche Denken geht aus dem volkstümlichen Denken hervor. So schließt das wissenschaftliche Denken die kontinuierliche biologische Entwicklungsreihe, welche mit den ersten einfachen Lebensäußerungen beginnt.
2. Das Ziel des vulgären Vorstellungslebens ist die gedankliche Ergänzung, Vervollständigung einer teilweise beobachteten Tatsache. Der Jäger stellt sich die Lebensweise eines eben erspähten Beutetiers vor, um danach sein eigenes Verhalten zweckentsprechend zu wählen. Der Landwirt denkt an den passenden Nährboden, die richtige Aussaat, die Zeit der Fruchtreife einer Pflanze, die er zu kultivieren gedenkt. Diesen Zug der gedanklichen Ergänzung einer Tatsache aus einem gegebenen Teil hat das wissenschaftliche Denken mit dem vulgären gemein. Auch Galilei will nichts anderes, als den ganzen Verlauf der Bewegung sich vergegenwärtigen, wenn die anfängliche Geschwindigkeit und Richtung eines geworfenen Steines gegeben ist. Allein durch einen andern Zug unterscheidet sich das wissenschaftliche Denken vom vulgären oft sehr bedeutend. Das vulgäre Denken, wenigstens in seinen Anfängen, dient praktischen Zwecken, zunächst der Befriedigung leiblicher Bedürfnisse. Das erstarkte wissenschaftliche Denken schafft sich seine eigenen Ziele, sucht sich selbst zu befriedigen, jede intellektuelle Unbehaglichkeit zu beseitigen. Im Dienste praktischer Zwecke gewachsen, wird es sein eigener Herr. Das vulgäre Denken dient nicht reinen Erkenntniszwecken, und leidet deshalb an mancherlei Mängeln, welche auch dem von diesem abstammenden wissenschaftlichen Denken anfänglich anhaften. Von diesen befreit sich letzteres nur sehr allmählich. Jeder Rückblick auf eine vorausgehende Periode lehrt, daß wissenschaftliches Denken in seinem Fortschritt in einer unausgesetzten Korrektur des vulgären Denkens besteht. Mit dem Wachsen der Kultur äußert aber das wissenschaftliche Denken seine Rückwirkung auch auf jenes Denken, welches praktischen Zwecken dient. Mehr und mehr wird das vulgäre durch das vom wissenschaftlichen durchdrungene technische Denken eingeschränkt und vertreten.
3. Die Abbildung der Tatsachen in Gedanken, oder die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen, ermöglicht dem Denken, nur teilweise beobachtete Tatsachen gedanklich zu ergänzen, soweit die Ergänzung durch den beobachteten Teil bestimmt ist. Die Bestimmung besteht in der Abhängigkeit der Merkmale der Tatsachen voneinander, auf welche somit das Denken auszugehen hat. Da nun das vulgäre und auch das beginnende wissenschaftliche Denken sich mit einer recht rohen Anpassung der Gedanken an die Tatsachen begnügen muß, so stimmen auch die den Tatsachen angepaßten Gedanken untereinander nicht vollständig überein. Anpassung der Gedanken aneinander ist also die weitere Aufgabe, welche das Denken zu seiner vollen Befriedigung lösen muß. Dies letztere Streben, welches die logische Läuterung des Denkens bedingt, aber weit über dieses Ziel hinausragt, kennzeichnet vorzugsweise die Wissenschaft im Gegensatz zum vulgären Denken. Letzteres genügt sich, wenn es nur ungefähr der Verwirklichung praktischer Zwecke dient.
4. Das wissenschaftliche Denken tritt uns in zwei anscheinend recht verschiedenen Typen entgegen: dem Denken des Philosophen und dem Denken des Spezialforschers. Der erstere sucht eine möglichst vollständige, weltumfassende Orientierung über die Gesamtheit der Tatsachen, wobei er nicht umhin kann, seinen Bau auf Grund fachwissenschaftlicher Anleihen auszuführen. Dem anderen ist es zunächst um Orientierung und Übersicht in einem kleineren Tatsachengebiet zu tun. Da aber die Tatsachen immer etwas willkürlich und gewaltsam, mit Rücksicht auf den ins Auge gefaßten augenblicklichen intellektuellen Zweck, gegeneinander abgegrenzt werden, so verschieben sich diese Grenzen beim Fortschritt des forschenden Denkens immer weiter und weiter. Der Spezialforscher kommt schließlich auch zur Einsicht, daß die Ergebnisse aller übrigen Spezialforscher zur Orientierung in seinem Gebiet berücksichtigt werden müssen. So strebt also auch die Gesamtheit der Spezialforscher ersichtlich nach einer Weltorientierung durch Zusammenschluß der Spezialgebiete. Bei der Unvollkommenheit des Erreichbaren führt dieses Streben zu offenen oder mehr oder minder verdeckten Anleihen beim philosophischen Denken. Das Endziel aller Forschung ist also dasselbe. Es zeigt sich dies auch darin, daß die größten Philosophen, wie Plato, Aristoteles, Descartes, Leibniz u. a. zugleich auch der Spezialforschung neue Wege eröffnet und anderseits Forscher wie Galilei, Newton und Darwinu. a., ohne Philosophen zu heißen, doch das philosophische Denken mächtig gefördert haben.
Es ist allerdings richtig: Was der Philosoph für einen möglichen Anfang hält, winkt dem Naturforscher erst als das sehr ferne Ende seiner Arbeit. Allein diese Meinungsverschiedenheit soll die Forscher nicht hindern, und hindert sie tatsächlich auch nicht, voneinander zu lernen. Durch die zahlreichen Versuche, die allgemeinsten Züge großer Gebiete zusammenzufassen, hat sich die Philosophie in dieser Richtung reichliche Erfahrung erworben; sie hat nach und nach sogar teilweise die Fehler erkannt und vermeiden gelernt, in die sie selbst verfallen ist und in die der philosophisch nicht geschulte Naturforscher seinerseits noch heute fast gewiß verfällt. Aber auch positive wertvolle Gedanken, wie z.B. die verschiedenen Erhaltungsideen, hat das philosophische Denken der Naturforschung geliefert. Der Philosoph entnimmt wieder der Spezialforschung solidere Grundlagen, als sie das vulgäre Denken ihm zu bieten vermag. Die Naturwissenschaft ist ihm einerseits ein Beispiel eines vorsichtigen, festen und erfolgreichen wissenschaftlichen Baues, während er anderseits aus der allzugroßen Einseitigkeit des Naturforschers nützliche Lehren zieht. In der Tat hat auch jeder Philosoph seine Privat-Naturwissenschaft und jeder Naturforscher seine Privat-Philosophie. Nur sind diese Privat-Wissenschaften meist etwas rückständiger Art. In den seltensten Fällen kann der Naturforscher die Naturwissenschaft des Philosophen, wo sich dieselbe gelegentlich äußert, für voll nehmen. Die meisten Naturforscher hingegen pflegen heute als Philosophen einen 150 Jahre alten Materialismus, dessen Unzulänglichkeit allerdings nicht nur die Fachphilosophen, sondern alle dem philosophischen Denken nicht zu fern Stehenden, längst durchschaut haben. Nur wenige Philosophen nehmen heute an der naturwissenschaftlichen Arbeit teil, und nur ausnahmsweise widmet der Naturforscher eigene Denkarbeit philosophischen Fragen. Dies ist aber zur Verständigung durchaus notwendig, denn bloße Lektüre kann hier dem einen wie dem andern nicht helfen.
Überblicken wir die Jahrtausende alten Wege, welche Philosophen und Naturforscher gewandelt sind, so finden wir dieselben teilweise wohl gebahnt. An manchen Stellen scheinen sie aber durch sehr natürliche, instinktive, philosophische und naturwissenschaftliche Vorurteile verlegt, welche als Schutt älterer Versuche, mißlungener Arbeit, zurückgeblieben sind. Es möchte sich empfehlen, daß von Zeit zu Zeit diese Schutthalden weggeräumt oder umgangen werden.
5. Nicht nur die Menschheit, sondern auch jeder einzelne findet beim Erwachen zu vollem Bewußtsein eine fertige Weltansicht in sich vor, zu deren Bildung er nichts absichtlich beigetragen hat. Diese nimmt er als ein Geschenk der Natur und Kultur hin. Hier muß jeder beginnen. Kein Denker kann mehr tun, als von dieser Ansicht ausgehen, dieselbe weiter entwickeln und korrigieren, die Erfahrungen der Vorfahren benützen, die Fehler derselben nach seiner besten Einsicht vermeiden, kurz seinen Orientierungsweg selbständig und mit Umsicht noch einmal gehen. Worin besteht nun diese Weltansicht? Ich finde mich im Raum umgeben von verschiedenen in demselben beweglichen Körpern. Diese Körper sind teils »leblos«, teils Pflanzen, Tiere und Menschen. Mein im Raume ebenfalls beweglicher Leib ist für mich ebenso ein sichtbares, tastbares, überhaupt sinnliches Objekt, welches einen Teil des sinnlichen Raumfeldes einnimmt, neben und außer den übrigen Körpern sich befindet, wie diese selbst. Mein Leib unterscheidet sich von den Leibern der übrigen Menschen nebst individuellen Merkmalen dadurch, daß sich bei Berührung desselben eigentümliche Empfindungen einstellen, die ich bei Berührung anderer Leiber nicht beobachte. Derselbe ist ferner meinem Auge nicht so vollständig sichtbar, wie der Leib anderer Menschen. Ich kann meinen Kopf, wenigstens unmittelbar, nur zum kleinsten Teil sehen. Überhaupt erscheint mein Leib unter einer Perspektive, die von jener aller übrigen Leiber ganz verschieden ist. Denselben optischen Standpunkt kann ich andern Leibern gegenüber nicht einnehmen. Analoges gilt in Bezug auf den Tastsinn, aber auch in Bezug auf die übrigen Sinne. Auch meine Stimme höre ich z.B. ganz anders, als die Stimme der andern Menschen.3 Ich finde ferner Erinnerungen, Hoffnungen, Befürchtungen, Triebe, Wünsche, Willen u.s.w. vor, an deren Entwicklung ich ebenso unschuldig bin, wie an dem Vorhandensein der Körper in der Umgebung. An diesen Willen knüpfen sich aber Bewegungen des einen bestimmten Leibes, der sich dadurch und durch das Vorausgehende als mein Leib kennzeichnet. – Bei Beobachtung des Verhaltens der übrigen Menschenleiber zwingt mich nebst dem praktischen Bedürfnis eine starke Analogie, der ich nicht widerstehen kann, auch gegen meine Absicht, Erinnerungen, Hoffnungen, Befürchtungen, Triebe, Wünsche, Willen, ähnlich den mit meinem Leib zusammenhängenden, auch an die andern Menschen- und Tierleiber gebunden zu denken. Das Verhalten anderer Menschen nötigt mich ferner anzunehmen, daß mein Leib und die übrigen Körper für sie ebenso unmittelbar vorhanden sind, wie für mich ihre Leiber und die übrigen Körper, daß dagegen meineErinnerungen, Wünsche u.s.w. für sie ebenso nur als Ergebnis eines unwiderstehlichen Analogieschlusses bestehen, wie für mich ihre Erinnerungen, Wünsche u.s.w. Die Gesamtheit des für alle im Raume unmittelbar Vorhandenen mag als das Physische, dagegen das nur einemunmittelbar Gegebene, allen anderen aber nur durch Analogie Erschließbare vorläufig als das Psychische bezeichnet werden. Die Gesamtheit des nur einem unmittelbar Gegebenen wollen wir auch dessen (engeres) Ich nennen. Man beachte des Descartes Gegenüberstellung: »Materie, Geist-Ausdehnung, Denken«. Hierin liegt die natürliche Begründung des Dualismus, der übrigens noch alle möglichen Übergänge vom bloßen Materialismus zum reinen Spiritualismus darstellen kann, je nach der Wertschätzung des Physischen oder Psychischen, nach der Auffassung des einen als des Fundamentalen, des andern als des Ableitbaren. Die Auffassung des im Dualismus ausgesprochenen Gegensatzes kann sich aber auch zu solcher Schärfe steigern, daß an einen Zusammenhang des Physischen und Psychischen – entgegen der natürlichen Ansicht – gar nicht mehr gedacht werden kann, woraus die wunderlichen monströsen Theorien des »Occasionalismus« und der »prästabilierten Harmonie« hervorgehen.4
6. Die Befunde im Raume, in meiner Umgebung, hängen voneinander ab. Eine Magnetnadel gerät in Bewegung, sobald ein anderer Magnet genügend angenähert wird. Ein Körper erwärmt sich am Feuer, kühlt aber ab bei Berührung mit einem Eisstück. Ein Blatt Papier im dunklen Raum wird durch die Flamme einer Lampe sichtbar. Das Verhalten anderer Menschen nötigt mich zu der Annahme, daß darin ihre Befunde den meinigen gleichen. Die Kenntnis der Abhängigkeit der Befunde, der Erlebnisse voneinander ist für uns von dem größten Interesse, sowohl praktisch zur Befriedigung der Bedürfnisse, als auch theoretisch zur gedanklichen Ergänzung eines unvollständigen Befundes. Bei Beachtung der gegenseitigen Abhängigkeit des Verhaltens der Körper voneinander kann ich die Leiber der Menschen und Tiere wie leblose Körper ansehen, indem ich von allem durch Analogie Erschlossenen abstrahiere. Dagegen bemerke ich wieder, daß mein Leib auf diesen Befund immer einen wesentlichen Einfluß übt. Auf ein weißes Papier kann ein Körper einen Schatten werfen; ich kann aber einen diesem Schatten ähnlichen Fleck auf diesem Papier sehen, wenn ich unmittelbar zuvor einen recht hellen Körper angeblickt habe. Durch passende Stellung meiner Augen kann ich einen Körper doppelt, oder zwei sehr ähnliche Körper dreifach sehen. Körper, welche mechanisch bewegt sind, kann ich, wenn ich mich zuvor rasch gedreht habe, ruhig sehen, oder umgekehrt ruhige bewegt. Bei Schluß meiner Augen verschwindet überhaupt mein optischer Befund. Analoge haptische oder Wärmebefunde u.s.w. lassen sich durch entsprechende Beeinflussung meines Leibes ebenfalls herbeiführen. Wenn aber mein Nachbar die betreffenden Versuche an seinem Leibe vornimmt, so ändert dies an meinem Befund nichts, wiewohl ich durch Mitteilung erfahre und schon nach der Analogie annehmen muß, daß seine Befunde in entsprechender Weise modifiziert werden.
Die Bestandteile meines Befundes im Raume hängen also nicht nur im allgemeinen voneinander ab, sondern insbesondere auch von den Befunden an meinem Leib, und dies gilt mutatis mutandis von den Befunden eines jeden. Wer nun auf die letztere Abhängigkeit aller unserer Befunde von unserem Leib einen übertriebenen Wert legt, und darüber alle anderen Abhängigkeiten unterschätzt, der gelangt leicht dazu, alle Befunde als ein bloßes Produkt unseres Leibes anzusehen, alles für »subjektiv« zu halten. Wir haben aber die räumliche Umgrenzung U unseres Leibes immer vor Augen und sehen, daß die Befunde außerhalb U ebensowohl voneinander, als auch von den Befunden innerhalb U abhängen. Die Erforschung der außerhalb U liegenden Abhängigkeiten ist allerdings viel einfacher und weiter fortgeschritten, als jene der U überschreitenden Abhängigkeiten. Schließlich werden wir aber doch erwarten dürfen, daß letztere Abhängigkeiten doch von derselben Art sind wie erstere, wie wir aus der fortschreitenden Untersuchung fremder, außerhalb unserer U – Grenze gelegener Tier- und Menschenleiber mit zusehends wachsender Sicherheit entnehmen. Die entwickelte, mehr und mehr auf Physik sich stützende Physiologie kann auch die subjektiven Bedingungen eines Befundes klarlegen. Ein naiver Subjektivismus, der die abweichenden Befunde derselben Person unter wechselnden Umständen und jene verschiedener Personen als verschiedene Fälle von Schein auffaßte und einer vermeintlichen sich gleichbleibenden Wirklichkeit entgegenstellte, ist jetzt nicht mehr zulässig. Denn nur auf die volle Kenntnis sämtlicher Bedingungen eines Befundes kommt es uns an; nur diese hat für uns praktisches oder theoretisches Interesse.
7. Meine sämtlichen physischen Befunde kann ich in derzeit nicht weiter zerlegbare Elementeauflösen: Farben, Töne, Drücke, Wärmen, Düfte, Räume, Zeiten u.s.w. Diese Elemente5 zeigen sich sowohl von außerhalb U, als von innerhalb U liegenden Umständen abhängig. Insofern und nur insofern letzteres der Fall ist, nennen wir diese Elemente auch Empfindungen. Da mir die Empfindungen der Nachbarn ebensowenig unmittelbar gegeben sind, als ihnen die meinigen, so bin ich berechtigt dieselben Elemente, in welche ich das Physische aufgelöst habe, auch als Elemente des Psychischen anzusehen. Das Physische und das Psychische enthält also gemeinsame Elemente, steht also keineswegs in dem gemeinhin angenommenen schroffen Gegensatze. Dies wird noch klarer, wenn sich zeigen läßt, daß Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühle, Willen, Begriffe sich aus zurückgelassenen Spuren von Empfindungen aufbauen, mit letzteren also keineswegs unvergleichbar sind. Wenn ich nun die Gesamtheit meines Psychischen – die Empfindungen eingerechnet – mein Ich im weitesten Sinne nenne (im Gegensatz zu dem engeren Ich, S. 6), so kann ich ja in diesem Sinne sagen, daß mein Ich die Welt eingeschlossen (als Empfindung und Vorstellung) enthalte. Es ist aber nicht außer acht zu lassen, daß diese Auffassung andere gleichberechtigte nicht ausschließt. Diese solipsistische Position bringt die Welt scheinbar als Selbständiges zum Verschwinden, indem sie den Gegensatz zwischen derselben und dem Ich verwischt. Die Grenze, welche wir U genannt haben, bleibt aber dennoch bestehen; dieselbe geht nunmehr nicht um das engere Ich, sondern mitten durch das erweiterte Ich, mitten durch das »Bewußtsein«. Ohne Beachtung dieser Grenze und ohne Rücksicht auf die Analogie unseres Ich mit dem fremden Ich, hätten wir die solipsistische Position gar nicht gewinnen können. Wer also sagt, daß die Grenzen des Ich für die Erkenntnis unüberschreitbarseien, meint das erweiterte Ich, welches die Anerkennung der Welt und der fremden Ich schon enthält. Auch die Beschränkung auf den »theoretischen« Solipsismus6 des Forschers macht die Sache nicht erträglicher. Es gibt keinen isolierten Forscher. Jeder hat auch praktische Ziele, jeder lernt auch von andern, und arbeitet auch zur Orientierung anderer.
8. Bei Konstatierung unserer physischen Befunde unterliegen wir mancherlei Irrtümern oder »Täuschungen«. Ein schief ins Wasser getauchter gerader Stab wird geknickt gesehen, und der Unerfahrene könnte meinen, daß er auch haptisch sich als geknickt erweisen werde. Das Luftbild eines Hohlspiegels halten wir für greifbar. Einem grell beleuchteten Gegenstand schreiben wir weiße Körperfarbe zu und sind erstaunt, denselben bei mäßiger Beleuchtung schwarz zu finden. Die Form eines Baumstamms im Dunkeln bringt uns die Gestalt eines Menschen in Erinnerung, und wir meinen diesen vor uns zu haben. Alle solche »Täuschungen« beruhen darauf, daß wir die Umstände, unter weichen ein Befund gemacht wird, nicht kennen, oder nicht beachten, oder andere als die bestehenden voraussetzen. Unsere Phantasie ergänzt auch teilweise Befunde in der ihr geläufigsten Weise und fälscht sie zuweilen eben dadurch. Was also im vulgären Denken zur Entgegenstellung von Schein und Wirklichkeit, von Erscheinung und Ding führt, ist die Verwechslung von Befunden unter den verschiedensten Umständen mit Befunden unter ganz bestimmten Umständen. Sobald einmal durch das ungenaue vulgäre Denken der Gegensatz von Erscheinung und Ding sich herausgebildet hat, dringt die betreffende Auffassung auch in das philosophische Denken ein, welche dieselbe schwer genug los wird. Das monströse, unerkennbare »Ding an sich«, welches hinter den Erscheinungen steht, ist der unverkennbare Zwillingsbruder des vulgären Dinges, welcher den Rest seiner Bedeutung verloren hat!7 Nachdem durch Verkennen der Grenze U der ganze Inhalt des Ich zum Schein gestempelt ist, was soll uns da noch ein unerkennbares Etwas außerhalb der vom Ich niemals überschreitbaren Grenzen? Bedeutet es etwas anderes als einen Rückfall in das vulgäre Denken, das hinter der »trügerischen« Erscheinung, wenigstens doch immer noch einen soliden Kern zu finden weiß?
Wenn wir die Elemente: rot, grün, warm, kalt u.s.w., wie sie alle heißen mögen, betrachten, welche in ihrer Abhängigkeit von außerhalb U gelegenen Befunden physische, in ihrer Abhängigkeit von Befunden innerhalb U aber psychische Elemente, gewiß aber in beiderlei Sinn unmittelbar gegeben und identisch sind, so hat bei dieser einfachen Sachlage die Frage nach Schein und Wirklichkeit ihren Sinn verloren. Wir haben hier die Elemente der realen Welt und die Elemente des Ich zugleich vor uns. Was uns allein noch weiter interessieren kann, ist die funktionale Abhängigkeit (im mathematischen Sinne) dieser Elemente voneinander. Man mag diesen Zusammenhang der Elemente immerhin ein Ding nennen. Derselbe ist aber kein unerkennbares Ding. Mit jeder neuen Beobachtung, mit jedem naturwissenschaftlichen Satz schreitet die Erkenntnis dieses Dinges vor. Wenn wir das (engere) Ich unbefangen betrachten, so zeigt sich dieses ebenfalls als ein funktionaler Zusammenhang der Elemente. Nur die Form dieses Zusammenhanges ist hier eine etwas anders geartete, als wir sie im »physischen« Gebiet anzutreffen gewöhnt sind. Man denke an das verschiedene Verhalten der »Vorstellungen« gegenüber jenem der Elemente des ersteren Gebietes, an die associative Verknüpfung der letzteren u.s.w. Ein unbekanntes, unerkennbares Etwas hinter diesem Getriebe haben wir nicht nötig, und dasselbe hilft uns auch nicht im mindesten zu besserem Verständnis. Ein fast noch Unerforschtes steht allerdings hinter dem Ich; es ist unser Leib. Aber mit jeder neuen physiologischen und psychologischen Beobachtung wird uns das Ich besser bekannt. Die introspektive und experimentelle Psychologie, die Hirnanatomie und Psychopathologie, welchen wir schon so wertvolle Aufklärungen verdanken, arbeiten hier der Physik (im weitesten Sinne) kräftig entgegen, um sich mit dieser zu mehr eindringender Weltkenntnis zu ergänzen. Wir können erwarten, daß alle vernünftigen Fragen sich nach und nach der Beantwortbarkeit nähern werden.8
9. Wenn man die Abhängigkeit der wechselnden Vorstellungen voneinander untersucht, so tut man das in der Hoffnung, die psychischen Vorgänge, seine eigenen Erlebnisse und Handlungen zu begreifen. Wer aber zum Schluß seiner Untersuchung im Hintergrunde doch wieder ein beobachtendes und handelndes Subjekt braucht, der bemerkt nicht, daß er sich die ganze Mühe der Untersuchung hätte ersparen können, denn er ist beim Ausgangspunkt derselben wieder angelangt. Die ganze Situation erinnert lebhaft an die Geschichte von dem Landwirt, der sich die Dampfmaschinen einer Fabrik erklären ließ, um schließlich nach den Pferden zu fragen, durch welche die Maschinen getrieben würden. Das war ja das Hauptverdienst Herbarts, daß er das Getriebe der Vorstellungen an sichuntersuchte. Allerdings verdarb er sich die ganze Psychologie wieder durch seine Voraussetzung der Einfachheit der Seele. In neuester Zeit erst fängt man an, sich mit einer »Psychologie ohne Seele« zu befreunden.
10. Das Vordringen der Analyse unserer Erlebnisse bis zu den »Elementen«, über die wir vorläufig nicht hinaus können9, hat hauptsächlich den Vorteil die beiden Probleme des »unergründlichen« Dinges und des ebenso »unerforschlichen« Ich auf ihre einfachste durchsichtigste Form zu bringen und dieselben eben dadurch als Scheinprobleme leicht erkennbar zu machen. Indem das, was zu erforschen überhaupt keinen Sinn hat, ausgeschieden wird, tritt das wirklich durch die Spezialwissenschaften Erforschbare um so deutlicher hervor: die mannigfaltige, allseitige Abhängigkeit der Elemente voneinander. Gruppen solcher Elemente können immerhin als Dinge (als Körper) bezeichnet werden. Es ergibt sich aber, daß ein isoliertesDing genau genommen nicht existiert. Nur die vorzugsweise Berücksichtigung auffallender, stärkerer Abhängigkeiten und die Nichtbeachtung weniger merklicher, schwächerer Abhängigkeiten erlaubt uns bei einer ersten vorläufigen Untersuchung die Fiktion isolierter Dinge. Auf demselben graduellen Unterschiede der Abhängigkeiten beruht auch der Gegensatz der Welt und des Ich. Ein isoliertes Ich gibt es ebensowenig, als ein isoliertes Ding. Ding und Ich sind provisorische Fiktionen gleicher Art.
11. Unsere Betrachtung bietet dem Philosophen sehr wenig oder nichts. Sie ist nicht bestimmt ein oder 7 oder 9 Welträtsel zu lösen. Sie führt nur zur Beseitigung falscher, den Naturforscher störender Probleme und überläßt der positiven Forschung das Weitere. Wir bieten zunächst nur ein negatives Regulativ für die naturwissenschaftliche Forschung, um welches der Philosoph gar nicht nötig hat sich zu kümmern, namentlich nicht derjenige, welcher schon sichere Grundlagen einer Weltanschauung kennt, oder doch zu kennen glaubt. Will also diese Darlegung zunächst vom naturwissenschaftlichen Standpunkt beurteilt werden, so kann damit doch nicht gemeint sein, daß der Philosoph nicht Kritik an derselben üben, sie nicht nach seinen Bedürfnissen modifizieren oder nicht ganz verwerfen soll. Für den Naturforscher ist es jedoch eine ganz sekundäre Angelegenheit, ob seine Vorstellungen in irgend ein philosophisches System passen oder nicht, wenn er sich derselben nur mit Vorteil als Ausgangspunkt der Forschung bedienen kann. Die Denk- und Arbeitsweise des Naturforschers ist nämlich von jener des Philosophen sehr verschieden. Da er nicht in der glücklichen Lage ist, unerschütterliche Prinzipien zu besitzen, hat er sich gewöhnt, auch seine sichersten, bestbegründeten Ansichten und Grundsätze als provisorisch und durch neue Erfahrungen modifizierbar zu betrachten. In der Tat sind die größten Fortschritte und Entdeckungen nur durch dieses Verhalten ermöglicht worden.
12. Auch dem Naturforscher kann unsere Überlegung nur ein Ideal weisen, dessen annähernde allmähliche Verwirklichung der Forschung der Zukunft vorbehalten bleibt. Die Ermittlung der direkten Abhängigkeit der Elemente voneinander ist eine Aufgabe von solcher Komplikation, daß sie nicht auf einmal, sondern nur schrittweise gelöst werden kann. Es war viel leichter erst ungefähr und in rohen Umrissen die Abhängigkeit ganzer Komplexe von Elementen (von Körpern) voneinander zu ermitteln, wobei es sehr vom Zufall, vom praktischen Bedürfnis, von früheren Ermittlungen abhing, welche Elemente als die wichtigeren erschienen, auf welche die Aufmerksamkeit hingelenkt wurde, welche hingegen unbeachtet blieben. Der einzelne Forscher steht immer mitten in der Entwicklung, muß an die unvollkommenen von den Vorgängern erworbenen Kenntnisse anknüpfen, und kann dieselben nur seinem Ideal entsprechend vervollständigen und korrigieren. Indem er die Hilfe und die Fingerzeige, welche in diesen Vorarbeiten enthalten sind, dankbar für seine eigenen Unternehmungen verwendet, fügt er oft unvermerkt auch Irrtümer der Vorgänger und Zeitgenossen den eigenen hinzu. Die Rückkehr auf den vollkommen naiven Standpunkt, wenn sie auch möglich wäre, würde für jenen, der sich von Ansichten der Zeitgenossen ganz frei machen könnte, neben dem Vorteil der Voraussetzungslosigkeit auch deren Nachteil bedingen: die Verwirrung durch die Komplikation der Aufgabe und die Unmöglichkeit, eine Untersuchung zu beginnen. Wenn wir also heute scheinbar auf einen primitiven Standpunkt zurückkehren, um die Untersuchung von neuem auf besseren Wegen zu führen, so ist dies eine künstliche Naivität, welche die auf einem langen Kulturwege gewonnenen Vorteile nicht aufgibt, sondern im Gegenteil Einsichten verwendet, die eine recht hohe Stufe des physikalischen, physiologischen und psychologischen Denkens voraussetzen. Nur auf einer solchen ist die Auflösung in die »Elemente« denkbar. Es handelt sich um Rückkehr zu den Ausgangspunkten der Forschung mit der vertieften und reicheren Einsicht, welche eben die vorausgehende Forschung gezeitigt hat. Eine gewisse psychische Entwicklungsstufe muß erreicht sein, bevor die wissenschaftliche Betrachtung beginnen kann. Keine Wissenschaft kann aber die vulgären Begriffe in ihrer Verschwommenheit verwenden; sie muß auf deren Anfänge, auf deren Ursprung zurückgehen, um sie bestimmter, reiner zu gestalten. Sollte dies nur der Psychologie und der Erkenntnislehre verwehrt sein?
13. Wenn eine Mannigfaltigkeit vielfach voneinander abhängiger Elemente zu untersuchen ist, so steht uns zur Ermittlung der Abhängigkeiten nur eine Methode zur Verfügung: die Methode der Variation. Es bleibt uns nichts übrig, als die Veränderung eines jeden Elementes zu beobachten, welche an die Veränderung jedes anderen gebunden ist, wobei es einen geringen Unterschied macht, ob die letztere »von selbst« eintritt oder durch unsern »Willen« herbeigeführt wird. Die Abhängigkeiten werden durch »Beobachtung« und »Experiment« ermittelt. Selbst wenn die Elemente nur paarweise voneinander abhängig, von den übrigen aber unabhängig wären, würde eine systematische Erforschung dieser Abhängigkeiten schon eine recht mühsame Aufgabe sein. Eine mathematische Überlegung lehrt aber, daß bei Abhängigkeiten in Kombinationen zu 3, zu 4 u.s.w. Elementen die Schwierigkeit der planmäßigen Untersuchung sich sehr rasch zur praktischen Unerschöpflichkeit steigert. Jede vorläufige Außerachtlassung weniger auffallender Abhängigkeiten, jede Vorwegnahme der auffallendsten Zusammenhänge muß hiernach als eine wesentliche Erleichterung empfunden werden. Beide Erleichterungen sind unter dem Einfluß des praktischen Bedürfnisses, der Not und der psychischen Organisation zunächst instinktiv gefunden und nachher von den Naturforschern bewußt, geschickt und methodisch benützt worden. Ohne diese Erleichterungen, welche man immerhin als Unvollkommenheiten ansehen mag, hätte die Wissenschaft überhaupt nicht wachsen und entstehen können. Die Naturforschung hat Ähnlichkeit mit der Entwirrung kompliziert verschlungener Fäden, wobei der glückliche Zufall fast ebenso wichtig ist, als Geschicklichkeit und scharfe Beobachtung. Die Arbeit des Forschers ist ebenso aufregend, wie für den Jäger die Verfolgung eines wenig bekannten Wildes unter störenden Umständen.
Wenn man die Abhängigkeit irgend welcher Elemente untersuchen will, so tut man gut, Elemente, deren Einfluß unzweifelhaft ist, aber bei der Untersuchung störend empfunden wird, möglichst konstant zu halten. Darin besteht die erste und wichtigste Erleichterung der Forschung. Die Erkenntnis der Doppelabhängigkeit eines jeden Elementes von Elementen außerhalb U, und von Elementen innerhalb U, führt nun dazu, zunächst die Wechselbeziehung der Elemente außerhalb U zu untersuchen, und jene innerhalb U konstant, d.h. das beobachtende Subjekt unter möglichst gleichen Umständen zu belassen. Indem die Abhängigkeit des Leuchtens der Körper, oder ihrer Temperaturen, oder ihrer Bewegungen voneinander unter möglichst gleichen Umständen desselben, oder auch verschiedener an der Beobachtung teilnehmender Subjekte untersucht wird, befreien wir die Kenntnis des physikalischen Gebietes nach Möglichkeit von dem Einfluß unseres individuellen Leibes. Die Ergänzung hierzu bildet die Erforschung der U überschreitenden und innerhalb fliegenden physiologischen und psychologischen Abhängigkeiten, welche aber nun durch die vorweggenommenen physikalischen Forschungen schon wesentlich erleichtert ist. Auch diese Teilung der Untersuchung hat sich instinktiv ergeben, und es handelt sich nur darum, dieselbe mit dem Bewußtsein ihres Vorteils methodisch festzuhalten. Für analoge Teilungen kleinerer Untersuchungsgebiete liefert die Naturforschung zahlreiche Beispiele.
14. Nach diesen einleitenden Bemerkungen wollen wir die Leitmotive der Naturforschung näher in Augenschein nehmen. Hierbei machen wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen uns überhaupt vor verfrühtem Philosophieren und Systematisieren hüten. Wir wollen als aufmerksame Spaziergänger, das Gebiet der Naturforschung durchstreifend, das Verhalten des Naturforschers in seinen einzelnen Zügen beobachten. Wir fragen: Durch welche Mittel ist die Naturerkenntnis bisher tatsächlich gewachsen, und wie hat sie Aussicht, noch fernerhin zu gedeihen? Das Verhalten des Forschers hat sich in der praktischen Tätigkeit, im volkstümlichen Denken instinktiv entwickelt, und ist von diesem nur auf das wissenschaftliche Gebiet übertragen und zuletzt zu bewußter Methodik entwickelt worden. Wir werden zu unserer Befriedigung nicht nötig haben, über das empirisch Gegebene hinauszugehen. Wenn wir die Züge in dem Verhalten des Forschers auf tatsächlich beobachtbare Züge unseres physischen und psychischen Lebens zurückführen können, welche sich auch im praktischen Leben, im Handeln und Denken der Völker wiederfinden, wenn wir nachweisen können, daß dieses Verhalten wirklich praktische und intellektuelle Vorteile herbeiführt, so wird uns dies genügen. Eine allgemeine Betrachtung unseres physischen und psychischen Lebens wird hierfür die natürliche Grundlage bilden.
3.An guten Phonographen erkennt man die Klangfarbe der Stimme der Freunde, die eigene Stimme hat aber einen fremden Klang, da die Kopfresonanz fehlt.
4.Euler hat in seinem 83. Brief an eine deutsche Prinzessin dargelegt, wie lächerlich und aller täglichen Erfahrung zuwider es ist, zwischen dem eigenen Leib und der eigenen Psyche keine engere Beziehung anzunehmen, als zwischen irgend einem Leib und irgend einer Psyche. Vgl. Mechanik. 7. Aufl. 1912. S. 431.
5. Vgl. Analyse d. Empfindungen. 4. Aufl. 1903. – Ich möchte hier auch auf die sehr interessanten Ausführungen von R. v. Sterneck hinweisen, obwohl ich in manchen Punkten anderer Meinung bin. (v. Sterneck, Über die Elemente des Bewußtseins. Ber. d. Wiener philosophischen Gesellschaft. 1903.)
6. Vgl. J. Petzoldt, Solipsismus auf praktischem Gebiet. Vierteljahrsschrift f. wissensch. Philosophie. XXV. 3. S. 339. – Schuppe, Der Solipsismus. Zeitschr. für immanente Philosophie. B. III S. 327.
7. Vgl. die vortrefflichen polemischen Ausführungen Schuppes gegen Ueberweg (Brasch, Welt- und Lebensanschauung F. Ueberwegs. Leipzig 1889).
8. Die Ausführungen in 5-8 schienen vereinzelten Lesern von den in »Analyse der Empfindungen« gegebenen abzuweichen. Das ist jedoch nicht der Fall. Ich habe, ohne an dem Wesen der Sache etwas zu andern, mit dieser Form nur der Scheu der Naturforscher vor allem, was an Psychomonismus zu streifen scheint, Rechnung tragen wollen. Für mich ist es übrigens ganz ohne Belang, mit welchem Namen man meinen Standpunkt bezeichnet.
9. Die Zerlegung in die hier als Elemente bezeichneten Bestandteile ist auf dem vollkommen naiven Standpunkt des primitiven Menschen kaum denkbar. Derselbe faßt, wie das Tier, wahrscheinlich die Körper der Umgebung als Ganzes auf, ohne die Beiträge, welche die einzelnen Sinne liefern, die ihm aber nur zusammen gegeben sind, zu trennen. Noch weniger wird er Farbe und Gestalt zu scheiden, oder die Mischfarbe in ihre Bestandteile zu zerlegen vermögen. Das alles ist schon Ergebnis einfacher wissenschaftlicher Erfahrungen und Überlegungen. Die Zerlegung der Geräusche in einfache Tonempfindungen, der Tastempfindungen in mehrere Teilempfindungen, der Lichtempfindungen in die Grundfarbenempfindungen u.s.w. gehört ja sogar der neueren Wissenschaft an. Daß hier die Grenze der Analyse erreicht sei, und daß diese durch kein Mittel der Physiologie weiter getrieben werden könnte, werden wir nicht glauben. Unsere Elemente sind also vorläufige, so wie es jene der Alchimie waren, und die jetzt geltenden der Chemie auch sind. – Wenn für unsere Zwecke, zur Ausschaltung philosophischer Scheinprobleme, die Reduktion auf die besagten Elemente auch der beste Weg schien, so folgt daraus noch nicht, daß jede wissenschaftliche Untersuchung bei diesen Elementen beginnen muß. Was für den Psychologen der einfachste und natürlichste Anfang ist, muß ein solcher durchaus nicht für den Physiker oder Chemiker sein, der ganz andere Probleme vor sich hat, oder dem dieselben Fragen ganze andereSeiten darbieten. Aber eins ist zu beachten. Während es keiner Schwierigkeit unterliegt, jedes physische Erlebnis aus Empfindungen, also psychischen Elementen aufzubauen, ist keine Möglichkeit abzusehen, wie man aus den in der heutigen Physik gebräuchlichen Elementen: Massen und Bewegungen (in ihrer für diese Spezialwissenschaft allein dienlichen Starrheit) irgend ein psychisches Erlebnis darstellen könnte. Wenn Dubois letzteres richtig erkannte, so bestand sein Fehler doch darin, daß er an den umgekehrten Weg gar nicht dachte, und die Reduktion beider Gebiete aufeinander darum überhaupt für unmöglich hielt. Man bedenke, daß nichts Gegenstand der Erfahrung oder einer Wissenschaft ist, was nicht irgendwie Bewußtseinsinhalt werden kann. Die klare Erkenntnis dieses Sachverhalts befähigt uns, je nach dem Bedürfnis und dem Ziel der Untersuchung, bald den psychologischen, bald den physikalischen Standpunkt als Ausgangspunkt zu wählen. So wird auch der das Opfer eines sonderbaren aber weit verbreiteten System-Aberglaubens, welcher meint, weil er das eigene Ich als Medium aller Erkenntnis erkannt hat, den Analogieschluß auf die fremden Ich nicht mehr machen zu dürfen. Dient doch dieselbe Analogie auch zur Ergründung des eigenen Ich. Ich freue mich hier noch auf M. Verworn (Naturwissenschaft und Weltanschauung 1904) hinweisen zu können, welcher wieder sehr verwandte Ansichten vertritt. Man vergleiche insbesondere die Anmerkung S. 45. V.'s Ausdruck »Psychomonismus« scheint mir jetzt allerdings weniger sachgemäß, als es in einer älteren, idealistischen Jugendphase meines Denkens der Fall gewesen wäre. H. Höffding (Moderne Philosophen, 1905, S. 121) referiert die mündliche Äußerung von R. Avenarius: »Ich kenne weder Physisches noch Psychisches, sondern nur ein Drittes.« Diese Worte würde ich sofort unterschreiben, wenn ich nicht fürchten müßte, daß man unter diesem Dritten ein unbekanntes Dritte, etwa ein Ding an sich oder eine andere metaphysische Teufelei versteht. Für mich ist das Physische und Psychische dem Wesen nach identisch, unmittelbar bekannt und gegeben, nur der Betrachtung nach verschieden. Diese Betrachtung, und demnach die Unterscheidung beider, kann überhaupt erst bei höherer psychischer Entwicklung und reicherer Erfahrung eintreten. Vorher ist das Physische und das Psychische ununterscheidbar. Für mich ist jede wissenschaftliche Arbeit verloren, die nicht das unmittelbar Gegebene festhält, und die, statt die Beziehungen der Merkmale des Gegebenen zu ermitteln, irgendwo im Leeren fischt. Sind diese Beziehungen ermittelt, so kann man sich noch allerlei Gedanken über dieselben machen. Mit diesen beschäftige ich mich aber nicht. Meine Aufgabe ist keine philosophische, sondern eine rein methodologische. Man soll auch nicht denken, daß ich die vulgären auf guter empirischer Grundlage instinktiv entwickelten Begriffe: Subjekt, Objekt, Empfindung u.s.w., angreifen oder gar abschaffen will. Mit diesem praktisch zureichenden Nebel ist aber methodologisch nichts anzufangen; da muß vielmehr untersucht werden, welche funktionalen Abhängigkeiten der Merkmale des Gegebenen voneinander zu diesen Begriffen gedrängt haben, wie es hier geschehen ist. Kein schon erworbenes Wissen soll weggeworfen, sondern erhalten und kritisch verwertet werden. In unserer Zeit finden sich wieder Naturforscher, welche nicht ganz in der Spezialforschung aufgehen, sondern nach allgemeineren Gesichtspunkten suchen. Höffding nennt sie, um sie zweckentsprechend von den eigentlichen Philosophen zu scheiden, »philosophierende Naturforscher«. Wenn ich zunächst zwei derselben, Ostwald und Haeckel, nenne, so steht vor allem deren hervorragende fachliche Bedeutung ganz außer Frage. In Bezug auf die allgemeine Orientierung muß ich die beiden Genannten als Strebensgenossen ansehen und hochschätzen, wenn ich ihnen auch nicht in allen Punkten zustimmen kann. In Ostwald verehre ich außerdem einen mächtigen und erfolgreichen Streiter gegen die Erstarrung der Methode, in Haeckel einen aufrechten, unbestechlichen Kämpfer für Aufklärung und Denkfreiheit. Wenn ich nun mit einem Wort sagen soll, nach welcher Richtung ich von diesen beiden Forschern mich am meisten entferne, so ist es dies: Mir erscheint die psychologische Beobachtung als eine ebenso wichtige und fundamentale Erkenntnisquelle, wie die physikalische Beobachtung. Von der Gesamtforschung der Zukunft wird wohl gelten, was Hering einmal (Zur Lehre vom Lichtsinn, Wien 1878, S. 106) so treffend von der Physiologie gesagt hat, sie wird einem von zwei Seiten her (von der physischen und psychischen) zugleich durchgeführten Tunnelbau gleichen. Wie sich Hering auch sonst stellen mag, in diesem Punkte stimme ich ihm vollkommen bei. Das Streben, zwischen diesen beiden scheinbar so differenten Gebieten eine Brücke und eine homogene Auffassung beider zu finden, liegt in der ökonomischen Konstitution des Menschengeistes. Ich möchte auch nicht bezweifeln, daß bei zweckmäßiger Umformung der Begriffe dieses Ziel sowohl von der physischen wie von der psychischen Seite her zu erreichen ist, und nur dem unerreichbar scheint, der seit seiner Jugendzeit in starre instinktive oder konventionelle Begriffe eingeschnürt bleibt. Wenn ich mich nicht täusche, so äußert sich auch in der eigentlich philosophischen Literatur, die mir ferner liegt, das Streben nach dem bezeichneten Ziel. Betrachte ich z.B. das Buch von G. Heymans(Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung, 1905), so werden die meisten Naturforscher gegen dessen einfache und klare Ausführungen ebensowenig einzuwenden haben, wie gegen dessen schließlich erreichten Standpunkt, den »kritischen Psychomonismus«; nur daß vielleicht stark materialistische Denker sich noch vor dem Namen scheuen. Allerdings muß man fragen, wenn nach Heymans die Methode der Metaphysik ganz dieselbe ist, wie jene der Naturwissenschaft, nur auf ein weiteres Gebiet übertragen, wozu dann der Name, der seit Kant einen so fatalen Klang hat, und dem der Zusatz »auf Grundlage der Erfahrung« zu widersprechen scheint? Endlich wäre zu erwägen, daß die Naturwissenschaft seit Newton gelernt hat, Hypothesen, Einschaltungen von x und y zwischen das bekannte Gegebene, nach ihrem wahren, geringen Wert einzuschätzen. Nicht die vorläufige Arbeitshypothese, sondern die Methode der analytischen Untersuchung ist es, was die Naturwissenschaft wesentlich fördert. – Wenn es nun einerseits sehr erfreulich und ermutigend ist, daß wir alle fast in derselben Richtung suchen, so können doch anderseits die zurückbleibenden Differenzen jeden von uns warnen, das Gesuchte nicht etwa für ein schon Gefundenes oder gar für eine allein seligmachende Lehre zu halten.
Eine psycho-physiologische Betrachtung
1. Die Erfahrung wächst durch fortschreitende Anpassung der Gedanken an die Tatsachen. Durch Anpassung der Gedanken aneinander entsteht das übersichtlich geordnete, vereinfachte, widerspruchlose Gedankensystem, welches uns als Ideal der Wissenschaft vorschwebt. Meine Gedanken sind unmittelbar nur mirzugänglich, wie die meines Nachbars nur ihm direkt bekannt sind. Dieselben gehören dem psychischen Gebiet an. Erst durch deren Zusammenhang mit Physischem: Geberden, Mienen, Worten, Taten, kann ich auf Grund meiner Physisches und Psychisches umfassenden Erfahrung einen mehr oder weniger sicheren Analogieschluß auf die Gedanken des Nachbars wagen. Anderseits lehrt mich dieselbe Erfahrung auch meine Gedanken, mein Psychisches, als abhängig von der physischen Umgebung mit Einschluß meines Leibes und des Verhaltens meiner Nachbarn erkennen. Die Betrachtung des Psychischen durch »Introspektion« ist nicht erschöpfend; sie muß mit der Untersuchung des Physischen Hand in Hand gehen.
2. Wie Mannigfaltiges finde ich »in mir« vor, z.B. auf einem Gang zur Vorlesung! Meine Beine bewegen sich, ein Schritt löst den andern aus, ohne daß ich etwas Besonderes dazu tue, außer wenn es etwa ein Hindernis zu umgehen gilt. Ich komme an den Anlagen des Stadtparks vorbei, erblicke und erkenne das Rathaus, das mich an gotische und maurische Bauten erinnert, ebenso wie an den mittelalterlichen Geist, der in dessen Räumen herrscht. In der Hoffnung auf kulturwürdigere Zustände will ich mir eben die Zukunft ausphantasieren, als beim Überschreiten der Straße ein dahersausender Radfahrer mich streift und meinen unwillkürlichen Seitensprung auslöst. Ein leiser Groll gegen diese rücksichtslosen Geschwindigkeitsidealisten tritt an die Stelle meiner Zukunftsphantasien. Der Anblick der Rampe des Universitätsgebäudes bringt mir nun mein Ziel, die Aufgabe der nächsten Stunde, nochmals in Erinnerung und beschleunigt meine Schritte.
3. Lösen wir dieses psychische Erlebnis in seine Bestandteile auf. Da finden wir zunächst diejenigen, welche in ihrer Abhängigkeit von unserm Leib: Offensein der Augen, Richtung der Augenachsen, normaler Beschaffenheit und Erregung der Netzhaut u.s.w. »Empfindungen« heißen, in ihrer Abhängigkeit von anderem Physischem: Anwesenheit der Sonne, greifbarer Körpern u.s.w. Merkmale, »Eigenschaften« des Physischen sind. Ich meine das Grün des Stadtparks, das Grau und die Formen des Rathauses, den Widerstand des Bodens, auf welchen ich trete, die streifende Berührung des Radfahrers u.s.w. Bleiben wir für die psychologische Analyse bei dem Ausdruck Empfindung. Gegenüber den Empfindungen, wie Heiß, Kalt, Hell, Dunkel, einer lebhaften Farbe, Ammoniakgeruch, Rosenduft u.s.w. verhalten wir uns in der Regel nicht indifferent. Sie sind uns angenehm oder unangenehm, d.h. unser Leib reagiert gegen dieselben mit mehr oder weniger intensiven Annäherungs- oder Entfernungsbewegungen, welche selbst wieder der Introspektion als Komplexe von Empfindungen sich darstellen. Im Beginn des psychischen Lebens lassen nur die Empfindungen deutliche, starke Erinnerungen zurück, an welche eine starke Reaktion geknüpft war. Mittelbar können aber auch andere Empfindungen im »Gedächtnis« bleiben. Der an sich recht gleichgültige Anblick der Flasche, welche Ammoniak enthielt, ruft die Erinnerung des Geruches hervor und hört dadurch auf, indifferent zu sein. Das ganze vorausgehende Empfindungsleben, soweit es in der Erinnerung aufbewahrt ist, wirkt nun bei jedem neuen Empfindungserlebnis mit. Das Rathaus, an dem ich vorbeigehe, wäre für mich nur eine räumliche Anordnung von farbigen Flecken, wenn ich nicht schon viele Gebäude gesehen, deren Gänge durchschritten, deren Treppen erstiegen hätte. Erinnerungen an mannigfaltige Empfindungen verweben sich hier mit der optischen Empfindung zu einem viel reicher ausgestatteten Komplex, der Wahrnehmung, von welcher wir die bloße augenblickliche Empfindung nur mit Mühe trennen. Wenn mehreren Personen dasselbe optische Gesichtsfeld geboten wird, so wird die »Aufmerksamkeit« einer jeden in einer besonderen Richtung erregt, d.h. das psychische Leben derselben durch individuelle starke Erinnerungen in besondere Bewegung gesetzt. Ein älterer Herr, Ingenieur, macht in Begleitung eines 18jährigen Sohnes und eines 5jährigen Knaben einen Spaziergang durch eine Wiener Straße. Ihre Augen haben dieselben Bilder aufgenommen. Der Ingenieur hat aber fast nur die Straßenbahn, der Jüngling besonders die hübschen Mädchen und der Knabe vielleicht nur die Spielzeuge in den Auslagen der Mechaniker beachtet. Angeborene und erworbene organische Umstände spielen hier mit. Die Erinnerungsspuren älterer Empfindungserlebnisse, welche das psychische Schicksal neu eintretender Empfindungskomplexe wesentlich mitbestimmen, sich mit letzteren unvermerkt verweben und, an das Empfindungserlebnis anknüpfend, dieses weiterspinnend sich anschließen, wollen wir Vorstellungen nennen. Dieselben unterscheiden sich von den Empfindungen nur durch ihre geringere Kraft und durch ihre größere Flüchtigkeit und Veränderlichkeit, sowie durch die Art der Verknüpfung miteinander (Association). Eine neue Art von Elementen stellen sie den Empfindungen gegenüber nicht vor; sie scheinen vielmehr von derselben Natur zu sein wie diese.10
4. Neue Elemente scheinen auf den ersten Blick die Gefühle, Affekte, Stimmungen: Liebe, Haß, Zorn, Furcht, Niedergeschlagenheit, Trauer, Fröhlichkeit u.s.w. darzubieten. Betrachten wir aber diese Zustände genauer, so finden wir weniger analysierte Empfindungen, die mit weniger bestimmten, diffusen, unscharf lokalisierten Raumelementen innerhalb U verbunden sind, und die eine gewisse, aus der Erfahrung bekannte Reaktionsstimmung unseres Leibes von bestimmter Richtungkennzeichnen, welche bei genügender Stärke wirklich in Angriffs- oder Fluchtbewegungen ausbricht. Der Umstand, daß diese Zustände für die Gesamtheit ein viel geringeres Interesse haben, als für den einzelnen, und daß selbst für diesen deren Beobachtung viel schwieriger ist, weil die Elemente des Leibes nicht so offen für die Untersuchung daliegen, wie die allgemein zugänglichen äußeren Objekte und die Sinnesorgane, bedingt eine geringere Kenntnis, eine schwierigere Beschreibung und eine unvollkommene Nomenklatur derselben. Gefühle können sowohl mit Vorstellungen als auch mit (außerhalb U lokalisierten) Empfindungen verknüpft sein. Bricht eine Reaktionsstimmung in eine durch einen Empfindungskomplex bestimmte bewußte Angriffs- oder Abwehrbewegung von voraus bekanntem Ziel aus, so sprechen wir von einem Willensakt. Wenn ich von einem Gang zur Vorlesung spreche, wenn man mir den Besuch eines fremden Gelehrten ankündigt, wenn ein Mann als gerecht bezeichnet wird, so vermag ich die gesperrt ausgesetzten Worte zwar nicht als einen bestimmten Komplex von Empfindungen oder Vorstellungen zu deuten; dieselben haben aber durch ihren vielfachen mannigfaltigen Gebrauch doch die Eigenschaft gewonnen, die betreffenden Komplexe, welche sie bezeichnen können, so zu umschreiben und zu umgrenzen, daß jedenfalls mein Verhalten, meine Reaktionsweise gegenüber diesen Komplexen hierdurch bestimmt ist. Worte, welche gar keine Komplexe von sinnlichen Erlebnissen bezeichnen könnten, wären eben unverständlich, ohne Bedeutung. Auch wenn ich die Worte: Rot, Grün, Rose gebrauche, hat die deckende Vorstellung schon einen beträchtlichen Spielraum. Derselbe erweitert sich in den oben angeführten Beispielen, noch mehr aber im wissenschaftlichen begrifflichen Denken, indem zugleich die Schärfe der Umgrenzung, welche unsere Reaktionsweise gegenüber den betreffenden Komplexen bestimmt, zunimmt. Der Übergang von den bestimmtesten sinnlichen Vorstellungen durch das vulgäre Denken bis zu dem abstraktesten wissenschaftlichen Denken ist ein ganz kontinuierlicher. Auch diese Entwicklung, welche durch den Gebrauch der Sprache ermöglicht ist, vollzieht sich zunächst ganz instinktiv, und ihr Ergebnis findet erst in der wissenschaftlichen Begriffsdefinition und der terminologischen Bezeichnung bewußte methodische Anwendung. Über die Kontinuität zwischen Individualvorstellung und Begriff und über die Empfindungen als Grundelemente alles psychischen Lebens kann uns der scheinbar weite Abstand von konkreter sinnlicher Vorstellung und Begriff nicht täuschen.
Es gibt also kein isoliertes Fühlen, Wollen und Denken. Das Empfinden, welches zugleich physisch und psychisch ist, bildet die Grundlage alles psychischen Lebens. Die Empfindungen sind stets auch mehr oder weniger aktiv, indem sie bei den niederen Tieren unmittelbar, bei den höheren auf einem Umwege durch das Großhirn die verschiedensten Reaktionen des Leibes auslösen.11 Die bloße Introspektion ohne stete Rücksicht auf den Leib und demnach auf das gesamte Physische, von dem der Leib einen unabtrennbaren Teil ausmacht, vermag keine zureichende Psychologie zu begründen. Betrachten wir also einmal das organische, insbesondere des tierische Leben als Ganzes, bald mehr die physische, bald mehr die psychische Seite beachtend. Wählen wir auch solche Beispiele, in welchen dieses Leben sich in besonders einfachen Formen offenbart.
5. Der Falter, der auf prächtigen Schwingen von Blume zu Blume schwebt, die Biene, welche den eifrig gesammelten Honig der heimatlichen Vorratskammer zuführt, der bunte erzglänzende Sandläufer, der klug der haschenden Hand entwischt, bietet uns ein wohlvertrautes Bild überlegten, bedächtigen Handelns. Wir fühlen uns diesen kleinen Wesen verwandt. Sehen wir aber den Falter wiederholt sich versengend immer wieder in die Flamme fliegen, beobachten wir, wie die Biene am halb offenen Fenster ratlos summend stets gegen das undurchdringliche Glas anstürmt, sehen wir deren verzweifelte Verlegenheit bei geringer Verschiebung des Fluglochs, jagen wir als harmlose Spaziergänger durch unsern vorauseilenden Schatten den Sandläufer, ihn immer wieder aufscheuchend, kilometerweit auf unserm Wege vor uns her, während er doch so leicht ausweichen könnte, so wird es uns verständlich, wie Descartes darauf verfallen konnte, die Tiere als Maschinen, als eine Art wunderbarer oder unheimlicher Automaten anzusehen. Die treffende burschikose ironische Bemerkung der jungfräulichen Königin Christine, daß die Fortpflanzung der Uhren doch etwas Unerhörtes sei, war übrigens wohl geeignet, den Philosophen auf die Mängel seiner Auffassung hinzuweisen und ihn zur Vorsicht zu mahnen.
Betrachten wir nun aber genauer die beiden gegensätzlichen Züge des tierischen Lebens, welche uns so widersprechend anmuten, so finden wir sie beide deutlich in unserer eigenen Natur ausgeprägt. Die Pupillen unserer Augen verengern sich maschinenmäßig bei hellerer Beleuchtung und erweitern sich ebenso regelmäßig entsprechend den Graden der Dunkelheit, ohne unser Wissen und Wollen, ganz so wie die Funktionen der Verdauung, der Ernährung und des Wachstums ohne unser bewußtes Tun sich vollziehen. Unser Arm hingegen, der sich streckt und die Lade des Tisches öffnet, wenn wir uns des darin liegenden Maßstabes erinnern, dessen wir augenblicklich bedürfen, scheint ganz ohne äußern Anstoß nur unserem wohl erwogenen Befehlzu gehorchen. Doch zieht sich die zufällig gebrannte Hand, der an der Sohle gekitzelte Fuß auch ohne Absicht und Überlegung, auch beim schlafenden und sogar beim apoplektisch gelähmten Menschen zurück. In der Bewegung der Augenlider, die sich bei plötzlicher Annäherung eines Gegenstandes unwillkürlich schließen, die aber auch willkürlich geschlossen und geöffnet werden, sowie in unzähligen andern Bewegungen, z.B. jenen des Atmens und Gehens, wechseln und mischen sich unausgesetzt beide Charakterzüge.
6. Die genaue Selbstbeobachtung der Vorgänge, die wir Erwägung, Entschluß, Willen nennen, lehrt uns einen einfachen Tatbestand kennen. An ein sinnliches Erlebnis, z.B. die Begegnung eines Freundes, der uns einlädt, ihn zu besuchen, ihn in seine Wohnung zu begleiten, knüpfen sich mannigfaltige Erinnerungen. Diese Erinnerungen werden nacheinander lebendig, wechseln und verdrängen sich gegenseitig. In der Erinnerung vernehmen wir die geistvolle Unterhaltung des Freundes, sehen wir sein Klavier in seinem Zimmer stehen, hören wir sein vorzügliches Spiel; jetzt fällt uns aber ein, daß heute Dienstag ist und daß ein zänkischer Herr an diesem Tage unsern Freund zu besuchen pflegt; wir lehnen die Begleitung dankend ab und entfernen uns. Wie auch unsere Entscheidung ausfallen mag, in den einfachsten wie in den verwickeltsten Fällen beeinflussen die zur Wirkung gelangenden Erinnerungen unsere Bewegungen gerade so bestimmt, lösen gerade dieselben Annäherungs- oder Entfernungsbewegungen aus, wie die betreffenden sinnlichen Erlebnisse, deren Spuren sie sind. Wir sind nicht Herren darüber, welche Erinnerungen uns auftauchen und welche den Sieg davon tragen.12 In unsern »Willkürhandlungen« sind wir nicht minder Automaten als die einfachsten Organismen. Doch ist von diesen Automaten ein Teil des Mechanismus, der durch das Leben selbst fortdauernd kleine Veränderungen erfährt, nur für uns selbst sichtbar, bleibt dem fremden Beobachter verborgen, und die feineren Züge desselben können selbst unserer eigenen gespanntesten Aufmerksamkeit entgehen. So ist es also ein viel größerer, viel weniger durchsichtiger und übersichtlicher Ausschnitt des Weltgeschehens, ein räumlich und zeitlich viel weiter reichender Weltzusammenhang, der in unsern Willkürhandlungen zu Tage tritt, und deshalberscheinen dieselben unberechenbar. Die Organe der niederen Tiere reagieren in verhältnismäßig regelmäßiger und einfacher Weise auf die Reize, die offen vor uns liegen. Alle maßgebenden Umstände scheinen fast auf einen Raum- und Zeitpunkt zusammengedrängt. Der Eindruck des Automatischen tritt hier besonders leicht hervor. Doch lehrt die feinere Beobachtung auch hier individuelle, teils angeborene, teils erworbene Unterschiede kennen. Große Verschiedenheit zeigt ja das Gedächtnis der Tiere je nach Genus und Spezies, kleinere auch nach dem Individuum. Von dem Hunde des Odysseus, der verendend und schon unfähig sich zu erheben, den nach 20 Jahren wiederkehrenden Herrn noch erkennt und wedelnd begrüßt, bis zur Taube, deren Gedächtnis für eine Wohltat kaum einen Tag vorhält und zur Biene, welche den Ort, der Futter bot, eben noch wiederfindet – welch ein Abstand! Ob wohl bei den niedersten Organismen das Gedächtnis gänzlich fehlt?
Daß wir Menschen uns für etwas so ganz anderes zu halten geneigt sind, als die einfachst organisierten Tiere, liegt bloß an der Verwicklung und Mannigfaltigkeit der Äußerungen unseres psychischen Lebens im Gegensatz zu denen jener Tiere. Die Fliege, deren Bewegungen durch Licht, Schatten, Geruch u.s.w. unmittelbar bestimmt und geleitet zu sein scheinen, setzt sich zehnmal verjagt immer wieder auf dieselbe Stelle des Gesichtes. Sie kann nicht nachgeben, bis sie erschlagen am Boden liegt. Der arme Hausierer, der in der Sorge um den Pfennig, welcher das Leben des Tages sichern soll, den behaglich hindämmernden Bourgeois wiederholt in seiner Ruhe stört, bis er mit einem kräftigen Fluch abgewiesen ist, hat sich nicht minder als Automat verhalten, wie der letztere; nur sind beide etwas weniger einfache Automaten.
7. Das fest Bestimmte, Regelmäßige, Automatische ist der Grundzug des tierischen und menschlichen Verhaltens, der uns nur in beiden Fällen in so verschiedenen Graden der Entwicklung und Komplikation entgegentritt, daß wir glauben können, zwei ganz verschiedene Grundmotive wahrzunehmen. Für das Verständnis unserer eigenen Natur ist es nun von der größten Wichtigkeit, den Zug von Bestimmtheit