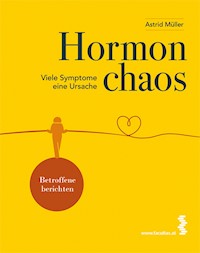Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 360° medien mettmann
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Unglücklich und ausgebrannt von ihrem Job, bricht die Berlinerin Astrid Müller aus dem Alltag aus und macht sich auf den Weg nach Südostasien. Sie beginnt ihre Reise mit einem Meditations-Marathon in einem buddhistischen Kloster und erkundet dann die Länder Thailand, Laos und Kambodscha. Aus dem Inhalt: Die Autorin ist Anfang vierzig und schon viel zu lange Single. Die Suche nach Sinn und innerer Einkehr lockt sie in die Ferne. Sie zieht in ein Kloster und erlebt mit „Vipassana, Kunst des Lebens“ zehn Tage Meditation nonstop. Danach geht die Reise weiter: In Thailand kommt sie einem Mystiker auf die Spur, in Laos verläuft sie sich im Präsidentenpalast und im bettelarmen Kambodscha entgeht sie nur knapp einem Auffahrunfall mit einem Elefanten. Ihr lang ersehntes Rendezvous mit einem amerikanischen Filmstar nimmt am Ende der Reise eine vollkommen unerwartete Wendung und stellt sie auf die Probe … Astrid zeichnet mit ihren Beschreibungen ein eindrucksvolles Bild der Länder und Menschen, gibt ihre persönlichen Einsichten preis. Das Wiedersehen mit ihrem Star, Mister X, zeigt ihr, dass die Dinge oft ganz anders sind, als sie erscheinen. Das ist die Botschaft des Buddhismus und auch die gelebte Geschichte der abenteuerlustigen Großstädterin. Erleuchtung für Zweifler: Die Einladung steht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Henning, meinen geliebten Vater.
Bildnachweis:
Die Bilder des Textteils: Astrid Müller
Coverfoto: Astrid Müller
Karte: © Jens Mattausch
Kartenicon: © Stepmap GmbH, Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2017 traveldiary Verlag
www.reiseliteratur-verlag.de
www.traveldiary.de
Der Inhalt wurde sorgfältig recherchiert, ist jedoch teilweise derSubjektivität unterworfen und bleibt ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Bei Interesse an Zusatzinformationen, Lesungen o.ä. nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
traveldiary Verlag, Mady Host und Cornelia Reinhold GbR
Brauereistraße 4, 39104 Magdeburg
Umschlagentwurf und Layout: Jürgen Bold, Jens Freyler
Hintergrundfoto: © Carola Vahldiek / Fotolia
Satz: traveldiary Verlag, Mady Host und Cornelia Reinhold GbR
Druck: "Standartu Spaustuve" www.standart.lt, Tel. 37052167527
ISBN 978-3-942617-15-4
eISBN 978-3-942617-26-0
Astrid Müller
Erleuchtung für Zweifler
Eine spirituelle Reise nach Thailand, Laos und Kambodscha
Inhalt
Einführung
1. KapitelReisebeginn − hochprozentig und heiß
2. KapitelEs wird ernst - es geht ins Kloster
3. KapitelVon Frostbeulen und Bettwanzen
4. KapitelTag 2 im Kloster: Am Set mit Mr. X
5. KapitelTag 3 im Kloster: Das letzte große Spiel und Elefantenfüße
6. KapitelTag 4 im Kloster: Wie Niederdrückler Kaffee stehlen
7. KapitelTag 5 im Kloster: Der Wintergoldsänger
8. KapitelTag 6 im Kloster: Wer schön ist und ängstlich
9. KapitelTag 7 im Kloster: Die Giraffin und der Schmerz
10. KapitelTag 8 im Kloster: Nur Wäscheduft ist schöner
11. KapitelTag 9 im Kloster: Ich kann ewig sitzen
12. KapitelTag 10 im Kloster: Nobles Schwätzen
13. KapitelGeworfen in den Linksverkehr
14. KapitelGute Nachrichten im lauten Laos
15. KapitelKein Starbucks, aber gute Geschäfte
16. KapitelDas Opium Kambodschas – Lächeln für Fortgeschritte
17. KapitelGelbe Karte für Rot
18. KapitelJoshua und die Weißkopfseeadler
19. KapitelWiedersehen ohne Begegnung - der König der Straße
20. KapitelBack to life, back to reality
21. KapitelRückreise mit Hindernissen
Epilog
Dank
Karte
Über die Reisende ... Astrid Müller
Einführung
An diesem frühen Novembermorgen ist der Moskau Airport fast menschenleer. Verwaiste Stühle und Tische stehen vor den Restaurants, die Türen der Geschäfte sind noch geschlossen. Klimaanlagen summen leise, keine Stimmen sind zu hören. Kaum ein Mensch streift durch die endlosen Gänge und Hallen. An diesem Ort der Massen wäre die unwirkliche Stille beunruhigend, ginge mein Flug nachmittags nicht weiter nach Bangkok. Ich bin in Hochstimmung, meine lang ersehnte spirituelle Reise hat begonnen. In ein thailändisches Kloster wird sie mich führen und durch die Buddha-Länder Laos und Kambodscha. Im Handgepäck ist jener Mann, der jüngst ganz überraschend die Bühne meines Lebens betreten hat.
Ziellos schlendere ich durch den verlassenen Flughafen, nehme nur am Rande die BBC-News wahr, die tonlos auf großen Flatscreens laufen. Die Gedanken spazieren zurück zu den mühsamen vergangenen Wochen und Monaten. Ich sitze fest auf einem Job. Anfangs erschien er so verheißungsvoll, doch er entpuppte sich rasch als energiefressender Alptraum. Zahllose Stunden Lebenszeit verschlingen die täglichen Fahrten von Berlin nach Brandenburg und die allabendliche Suche nach einer neuen Arbeit. Unmerklich kreuze ich die Vierzig, finde mich über all die Zeit nachsinnend wieder, die mich meine folgenreiche Anstellung inzwischen kostet. Traurig und wütend macht mich diese verzwickte Lebenslage. Und eine große Sehnsucht wächst in mir. Eine Sehnsucht nach Momenten des Glücks und nach Sinn. Sah ich mich bislang halbwegs überzeugt, mit meinem Sein und meinem Handeln einen angemessenen Platz in meiner Umwelt einzunehmen, regieren nun die Zweifel. Gefangen im Hamsterrad ringe ich um persönliche Selbstdefinition in meiner Arbeit, suche nach einer sinnvollen Beschäftigung, jener vermeintlichen Absicherung vor Unbill im Wohlstandsleben.
Mit Erschrecken nehme ich Veränderungen an mir wahr. Meine Empathie und mein Wohlwollen für andere schwinden dahin. Das will ich nicht, und es macht mir Angst. So unabänderlich meine Lebensumstände erscheinen − vielleicht kann ich mich ändern? Meine Haltung zum Leben? Ich muss es versuchen, denn so kann es nicht bleiben, auf keinen Fall will ich weiter verhärten. Deshalb meditiere ich nun. Ein bisschen kann ich es schon und übe während unvermeidlicher S-Bahnfahrten zur Arbeit, in sinnlosen Meetings im Betrieb, oder hier im Flughafen. Äußerlich bleibt alles wie es ist, doch jetzt beobachte ich meine Gedanken aus einer neuen Perspektive. Die vergeudet geglaubte Lebenszeit füllt sich nun mit Sinn. Und auf dieser außergewöhnlichen Reise darf es sehr viel mehr sein. In Thailand werde ich in die Meditation eintauchen. Sehr tief, vielleicht sogar in Abgründe. Extreme haben mich schon immer gelockt. Womöglich falle ich auseinander, in Einzelteile, muss mich danach neu zusammensetzen, Stück für Stück. Das Bild weckt die Vorstellung von Neuerung, vom Phönix aus der Asche. Und wenn das zu hoch gegriffen ist, eröffnet sich hoffentlich eine neue Sicht auf das Dilemma meines Lebens und bereitet den Weg für einen Wandel.
Es brummt und am Ende des Ganges tauchen zwei Gestalten auf. Blau uniformierte Putzfrauen rangieren eine elektrische Wischmaschine über den makellosen Granitboden des Flughafens. Mühelos steuern sie das große Gerät in langen Bahnen und schnattern aufgeregt miteinander. Der Boden glänzt, als wäre er gerade erst verlegt worden. Alles hier ist neu. Selbst die Toiletten des Flughafens wirken vollkommen unberührt. Es scheint kaum vorstellbar, dass hier je ein Mensch seine Notdurft verrichten wird.
Eine einzelne Reisende verlässt die Toiletten in dem Moment, da ich eintrete. Im Spiegel schaut mir das Alter − und der Stress der letzten Zeit − mitten ins Gesicht. Heute Morgen betrachte ich meine müden Züge mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wenige Tage vor Reisebeginn schlagen die Wogen des Lebens nochmal hoch. Ich werde gekündigt – die Belegschaft auch, der Betrieb wird zum Jahresende abgewickelt. Die Kollegen stornieren gebuchte Flüge und Urlaubsreisen, ich fliege trotzdem. Jetzt erst recht. Es ist unwahrscheinlich, bis 1. Januar noch einen neuen Job zu finden. Die Arbeitslosigkeit danach ist mir wohl so sicher wie mein reservierter Platz im Vipassana-Kloster in Thailand. Ein Lächeln huscht mir über die Lippen. Die Freiheit winkt und in wenigen Wochen wird die Plackerei ein Ende haben.
Dabei gibt es Dinge, die so unabänderlich scheinen, als würden sie die Ewigkeit repräsentieren. In meiner Jugend war das die Ära Helmut Kohl. Er ging, nach sechzehn Jahren. Jetzt erreicht mich die Nachricht des Tages, die immerzu von den großen Bildschirmen flimmert: Aung San Suu Kyi ist frei! Die burmesische Oppositionspolitikerin wurde nach fünfzehn Jahren von der herrschenden Militärjunta Myanmars aus dem Hausarrest entlassen. Die Menschen des gebeutelten Landes triumphieren über das Militär. Immer wieder sehe ich die Wiederholung der Nachricht und werde ganz warm im Herzen. Das ist ein angemessener Auftakt für diese Asienreise, die mit einem Meditationsseminar der Extreme beginnen wird. Zehn Tage lang vom frühen Morgen bis weit nach Sonnenuntergang werde ich meditieren − bei radikalem Kommunikationsverbot − so ich es schaffe, das durchzuhalten. Ich habe keinen Schimmer, was da auf mich zukommt, ob mein Körper dieser Herausforderung gewachsen sein wird und mein Geist. Wird mein Rücken diese Aufrichtung dulden, die Knie solche Zwangshaltungen tolerieren? Wird aus meinem Herzen alle Trauer hervorlockt, die ich je empfunden habe? Oder werde ich an der Ernsthaftigkeit meines eigenen Handelns zweifeln, das Ganze gar für einen Witz halten, der agitiertes Kichern provoziert? Oder bricht eine ungeahnte Wut sich Bahn, die sich in den letzten Jahren unmerklich in mir aufgebaut hat? Ich weiß es nicht. Noch nicht.
Die Stille des Flughafens ist wie ein Vorgeschmack auf das Schweigen im Kloster. Sie macht mich schläfrig. Ohne Eile streune ich zu meinem Gate, strecke mich aus auf einer Bank in der noch leeren Wartehalle. Bevor die Müdigkeit mich übermannt, sind die letzten Gedanken dem Mann gewidmet, der seit einigen Wochen meinen schnöden Alltag verzaubert. Er bringt die schon vergessen geglaubte Sinnlichkeit in mein von Existenzängsten und Sinnfragen gebeuteltes Leben zurück. Mein Herz macht einen Satz, wenn ich einen Artikel über ihn lese oder plötzlich in der Stadt sein Gesicht auf Kinoplakaten entdecke. Und am Ende dieser Reise werde ich ihn zu einem tropisch-romantischen Rendezvous wiedersehen.
Wie aus weiter Ferne träufeln Stimmen in mein Ohr. Der Flughafen erwacht zum Leben. Erste Aufrufe von Abflügen erfüllen das Gate und Gemurmel wird laut. Ratternde Rollläden fahren hoch, die Restaurants und Geschäfte öffnen ihre Türen. Es ist früher Nachmittag geworden und um mich herum finden sich Reisende ein. Wolken süßen Parfums schweben durch die Luft. Verschlafen reibe ich mir die Augen, recke und strecke die steifen Glieder. Viele durstige Menschen versammeln sich am Gate. Vielleicht ist bei der russischen Airline Aeroflot Alkohol an Bord nicht gestattet? Noch am Boden kippen Frauen und Männer Beinhartes in sich hinein, als gäbe es kein Morgen. Schnell ist es mit der Ruhe vorbei, ihre Stimmen erheben sich, werden laut und schrill. Die unschuldigen Toiletten empfangen die ersten torkelnden Gestalten. Nach der Abfertigung des Fluges werden die Putzfrauen eine Menge zu tun haben. Fasziniert schaue ich dem Treiben der Russen zu bis der Aufruf des Fluges erfolgt. Eine alkoholisierte Woge Mensch setzt sich in Bewegung, schwappt auf die Gangway und treibt mich mit sich ins Flugzeug.
1. KapitelReisebeginn − hochprozentig und heiß
Die Begrüßung der Flugbegleiterinnen an Bord ist kühl. Kein Lächeln entgleitet ihnen, ihre Gesichter sind verriegelt. Es gibt schönere Beschäftigungen, als ein ganzes Flugzeug Volltrunkener den langen Weg bis Bangkok zu verpflegen. Doch Buddha prüft uns alle, auch mich. Eingezwängt zwischen zwei komatös benebelte Männer kauere ich mich in den Sitz. Mit verschwitzten Händen fuchteln die beiden übergewichtigen Herren in der Luft herum, scheitern lange beim Schließen ihrer Sicherheitsgurte. Eine Stewardess langt zu, hilft mit steinerner Miene nach. Die Maschine stinkt erbärmlich. Den kollektiven Entgiftungsbemühungen der Passagiere vermag die Klimaanlage an Bord nur wenig entgegen zu setzen. Aufgeheizte Gemüter verlangen lautstark nach Service, die Unterhaltungen werden gebrüllt. Erstmals kann ich während eines Fluges nicht lesen. Auch meditieren ist undenkbar. Ich schließe die Augen und lasse mich einhüllen von Lärm und Gestank.
Die Geräuschkulisse beschwört lebhafte Bilder meines ersten Arbeitstages im Brandenburger Großraumbüro herauf. Er liegt inzwischen gut zweieinhalb Jahre zurück, doch die Erinnerung ist so deutlich, als wäre es gestern gewesen. Der Betrieb, ein Callcenter, hatte erst vor wenigen Wochen im obersten Geschoß eines schicken Neubaus seine Arbeit aufgenommen und war noch im Aufbau begriffen. Die ersten Kolleginnen telefonierten schon. Es waren Krankenschwestern, die kranke Menschen medizinisch beraten haben. Für die alten Gewohnheiten der kranken Menschen und die Anregung von neuen Impulsen sollte ich ins Spiel kommen und mein Beratungsfeld die Gesundheitsförderung mit Verhaltensänderung sein. Das hilft besonders, wenn man chronisch krank ist.
Das Callcenter überraschte mit seiner Geräumigkeit und stilvollen Einrichtung. In allen Arbeitsbereichen waren die Wände pastellgelb getüncht und harmonierten mit beruhigendem Blau am Boden. Üppige Grünpflanzen erfreuten sich an den großzügigen Fenstern, die viel Tageslicht spendeten. Es fiel von allen Seiten ein – wie auch der Lärm. Es war laut, sehr laut sogar. Lediglich von dünnen Pinnwänden getrennt, sprachen die Kolleginnen gegeneinander an. Binnen weniger Wochen sollten hundertdreißig Kolleginnen die Beratung aufnehmen und ohne Lärmschutz würden sie ihr eigenes Wort wohl kaum noch verstehen.
‚Jeder, der sich in diesem Krach auf eine Beratung zu konzentrieren versucht, wird selbst erkranken!‘, dachte ich bei meinem ersten Rundgang durch das Callcenter. Dann streckte sich mir eine große Hand entgegen und ein hemdsärmeliger Mitarbeiter hieß mich mit festen Griff willkommen. Die Worte des Mannes erschlossen sich mir nur zum Teil und das war weniger dem enormen Geräuschpegel hier geschuldet. Ich bin wirklich nicht schwer von Begriff, aber ich musste drei Mal hinhören und hegte den leisen Verdacht, dem Haushandwerker vorgestellt zu werden. Doch die Dinge sind häufig anders als sie scheinen. Der wenig wortgewandte Altenpfleger war mein Chef.
An diesem ersten Arbeitstag kamen bereits Zweifel auf, ob ich mich in diesem Betrieb würde verorten können. Am Ende der ersten Woche fühlte ich mich schon fehlplatziert und irgendwie verloren. Doch das Schlimmste kam noch: Die Aufgabe, wofür ich hier laut Arbeitsvertrag antrat, gab es nicht. Stattdessen sollte ich Klinken putzen und im Minutentakt Menschen anrufen, um sie zu überreden, sich beraten zu lassen. Ich war fassungslos. Acht Stunden am Tag sprach ich eine kleine Handvoll Worte in einer Endlosschleife, wieder und wieder. Als Gesundheitswissenschaftlerin und Sozialarbeiterin helfe und berate ich gerne − allerdings Menschen, die aus freien Stücken zu mir kommen. Ich wollte nichts verkaufen, oder irgendwem etwas andrehen. Die Anstellung von Callcenter-Agenten wäre für das Unternehmen sicher billiger gewesen und auch professioneller als meine ungelenken Mitwirkungsversuche.
Im Betrieb hatte das Chaos Methode. Eine staatliche geprüfte Hauswirtschafterin wurde die rechte Hand des Geschäftsführers und zu seiner Assistentin gekürt. Vor lauter kreativer Eingebungen und Freude beim Einrichten des Callcenters ging ihr der Lärmschutz durch die Lappen − wie auch das Ablegen der Teilnahmeerklärungen von etwa vierzehntausend Kunden. Da es in dem Laden sonst niemanden gab, der die Ablage machte, sortierte ich schließlich auch noch die Teilnahmeerklärungen, was für mich mindestens so geistlos war, wie die Klinkenputzerei. Erstmals erfuhr ich am eigenen Leib, was es heißt, geistig unterfordert zu sein. Zuerst war ich fassungslos und verzweifelt. Knapp vier Wochen brauchte es, die Unabänderlichkeiten im Betrieb zu begreifen, dann begann ich, mich wieder zu bewerben.
Eine Pflegefachkraft nach der anderen wurde meine Chefin. Irgendwann waren wir bei Nummer sechs angelangt, und ich war nicht mehr offen für neue Persönlichkeiten. Es gab keine Personalabteilung, aber ohnmächtige Führungskräfte, die nach Großgutsherrenart regierten, und es bis heute tun. Von Anfang an fiel mir der Austausch schwer. Eigentlich ist er unmöglich, denn keine der Chefinnen ist von meinem Fach oder hat den Erfahrungshintergrund, den ich mitbringe. Das Management beschließt irgendwann, sich selbst eine Gehaltserhöhung zu gönnen – die Kollegen an der Basis gehen leer aus. Der Betrieb ist miserabel geführt und bleibt es, auch wenn der Geschäftsführer ausgetauscht wird – kluge Köpfe begegnen mir kaum. Inzwischen berate ich immer häufiger ratsuchende Kollegen, denn viele von ihnen sind krank, sehr krank sogar.
An Bord ist es still geworden. Beharrlich schwebt der Akoholnebel über allen Reisenden. Doch die Durstigen schlafen endlich. Eine Berührung reißt mich aus den Gedanken. Im ersten Moment denke ich, es ist die Hand von meinem Prominenten. Mr. X hat schöne Hände mit langen feinen Gliedern. Jetzt wünsche ich mir, diese Hände würden mich zärtlich berühren. Doch an meinem Ellenbogen rüttelt eine ungeduldige Pranke. Der Dicke rechts am Fenster muss aufs Klo. Es scheint dringend zu sein. Er haucht mir die Nachricht so russisch ins Gesicht, dass es mir den Atem verschlägt. Der Sitznachbar links am Gang schläft. Mein vorsichtiges Antippen soll verhindern, dass er aufschreckt, gefährlich mit den Armen rudert und dabei unkontrollierte Schläge verteilt. Doch das geht dem Dicken rechts zu langsam. Rigoros langt er über mich hinweg, wälzt seine mächtige Wampe auf mich und versucht den Schlafenden wachzurütteln. Ich möchte aber keinen Russen auf meinem Schoß haben! Es bleibt nur, ihn lautstark und handgreiflich wieder zurückzudrängen.
Aber wer pinkeln muss, muss pinkeln. Ich klettere über den Linken am Gang hinweg. Es ist fraglich, welche Reflexe des Dicken noch funktionstüchtig sind, wie lange die Blase noch ihren Job macht, noch machen kann. Der Dicke von rechts kneift den Linken jetzt ganz ungeniert − ohne Erfolg: Er schlummert selig weiter.
Dann versucht der Dicke ebenfalls über die Armlehnen zu steigen. Doch er ist viel zu schwergewichtig und zu betrunken. Ich springe zur Seite und es kommt, was kommen muss: Der Mann verheddert sich mit einem Fuß und fällt der Länge nach vornüber. Schwer stürzt er, schlägt mit dem Kopf auf und sinkt stöhnend zu Boden. Aus einer kleinen Wunde am Kopf sickert ein Faden Blut. Offenbar ist auch die Kontrolle über die Blase futsch. Schnell breitet sich ein großer dunkler Fleck auf seiner Jeans aus.
Die ernsten Flugbegleiterinnen sind in der Bordküche zu finden. Sie handeln wortlos und rasch, pressen Verbandmull auf die Wunde. Mit erstaunlicher Leichtigkeit zerren sie das Schwergewicht auf seine Beine und bugsieren den Mann routiniert zu den Toiletten. Wenig später rüsselt der dicke Unglücksrabe in einer blauen Jogginghose auf seinem Fensterplatz. Bangkok ist noch dreieinhalb Flugstunden weit in der Ferne.
Meine Gedanken wandern zurück nach Brandenburg. Der tägliche Weg in den Betrieb ist zwanzig Kilometer lang und verschlingt jede Woche fünfzehn Stunden − unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel. Das sind mindestens drei Stunden Lebenszeit pro Tag. Fliegen die jahrelangen Verfehlungen der Berliner S-Bahn auf, ihre Züge zu warten − so jüngst geschehen – verbringe ich sogar vier Stunden im Schienenersatzverkehr. Oder mehr. Mich treibt die leidige Pendelei auf das Fahrrad, mit dem ich in Berlin immer unterwegs bin.
Tatsächlich sind die Radtouren die schönsten Momente des Tages. In der ausdauernden Bewegung werde ich weich und vermag den Frust loszuwerden, der sich täglich neu formiert. Dabei bin ich weite Strecken in der Natur, treffe neben Füchsen, Kaninchen und Rehen sogar auf Uhus – ein großes Geschenk für eine Berlinerin, die im Zentrum lebt. Der Weg führt von Charlottenburg in der westlichen Innenstadt entlang an vielen bunten Schrebergärten und den alten Backsteinbauten von Siemens in Spandau, immer weiter Richtung Norden. Über die hölzerne Havelbrücke, wo morgens regelmäßig Kormorane ihre Flügel spreizen, um sich nach dem Frühstückstauchgang zu trocknen. Die schönsten Teile der Strecke jedoch liegen im Spandauer Forst, einem Waldstück am Stadtrand Berlins. Besonders im Morgengrauen duftet es dort herrlich frisch. Der Wald lässt meine großstädtischen Ohren unbekannten Vogelstimmen lauschen und mich nochmal tief durchatmen, bevor ich wieder ins Tollhaus muss.
Eines Morgens steht mitten auf dem Waldweg eine Bache – eine leibhaftige Wildsau. Mein Fahrrad kommt keine drei Meter vor ihr mit einer abrupten Vollbremsung zum Stehen. Ich halte den Atem an. Das imposante Tier wedelt mit seinem borstigen Schwänzchen und nimmt meine Witterung auf. Aus der Deckung des Unterholzes heraus lösen sich elf Frischlinge, die um die Bache herumwuseln. Langsam und nichtsahnend kommen die Kleinen auf mich zu. Das zwischen mich und die Meute gebrachte Fahrrad ist ein lächerlicher Schutz. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen und ein Mobiltelefon besitze ich nicht. Die Straße im Wald ist früh im Morgengrauen kaum befahren. Doch bevor die Frischlinge bei mir angelangt sind, macht die Bache eine resolute Bewegung mit ihrem großen Körper. Sie treibt ihre Jungen weg von mir, weg von der Gefahr und zurück in den Wald. Zögernd folgt sie ihnen, dreht sich immer wieder um. Gebannt warte ich, dann ist auch sie im Unterholz verschwunden. Einige Minuten stehe ich reglos da und warte, bis mein Puls sich normalisiert, dann steige ich auf und fahre weiter.
Bislang dachte ich, die neue Arbeit gefährde meine geistige Gesundheit. Offenbar steht auch meine körperliche Unversehrtheit auf dem Spiel. Ich brauche ein Mobiltelefon. So bei einem Zusammenstoß mit wilden Tieren die Zeit bliebe, könnte ich Hilfe rufen. Beinahe zehn Jahre widerstehe ich nun dem Handy-Trend. Dass meine gesamte Mitwelt bereits ein Handy zu besitzen scheint, macht mich ja eher skeptisch. Es war bedeutend ruhiger und die Menschen aufmerksamer, als noch nicht unaufhörlich in Mobiltelefone gequasselt und getippt wurde.
Es widerstrebt mir, stets erreichbar zu sein. Bis heute, da die mobilfunklose Ära zu Ende geht und ich abends das Handy einer Freundin borge. Doch es bleiben Zweifel. In meiner mädchenhaften Wunschvorstellung sollte es eine romantische Liebe sein, für die ich irgendwann ein Mobiltelefon anschaffe. Ein Mann, dessen Nachrichten mir den Tag versüßen, mit dem ich stets in Verbindung sein möchte. Keine mich zu Notrufen nötigenden wilden Schweine. Doch ich bin vernünftig: Safety first – auch während der Asienreise ist das Handy im Handgepäck – für den Notfall. Jetzt ist es sogar mein eigenes.
Am Suvarnabhumi-Airport in Bangkok lasse ich die Erinnerungen an Deutschland hinter mir und komme an. Und da ist es, das Glücksgefühl in meinem Bauch, das mich bei jeder Reise überkommt. Ich kann es kaum erwarten, den ersten Fuß in die große heiße Stadt zu setzen. Im Flughafen ist es noch kühl und geschäftig, wie in einem unterirdischen Ameisenhaufen. Meine sturztrunkenen Mitreisenden und ihr unverwechselbarer Geruch verflüchtigen sich rasch, mischen sich mit Menschen aus aller Herren Länder, die in Richtung der Einreiseschalter strömen. In endlosen Schlangen kommen sie vorerst zum Stehen. Nur wenige Schalter sind von Thaibeamten besetzt und geöffnet. Etwa achtzig Reisende harren vor mir in der Schlange. An jeden einzelnen wird die Aufforderung gehen, direkt in die kleine Kamera zu schauen, die ein Foto für das Visum macht.
Eine Gruppe betagter Engländerinnen in bunten Sommerkleidern wartet vor mir. Ich lausche der Melodie ihres unverwechselbar britischen Dialektes. Die Ladies sind ohne männliche Begleitung unterwegs und beglückwünschen sich dafür. Mit ihren großen Strohhüten auf den Köpfen und um die Hälse baumelnden Sonnenbrillen sind sie bestens gerüstet für die Tropensonne – und für das Warten in Schlangen. Die breiten Krempen der Hüte sorgen dort für gebührenden Abstand, wo Ungeduldige zu dicht aufrücken oder ausscheren. Es sei denn, man steht hinter Passagieren aus Moskau, wie es bei den Ladies scheinbar der Fall ist. Der dicke Unglücksrabe aus dem Flugzeug ist mir unbemerkt zuvorgekommen. Kein bisschen nüchterner schwankt er vor den Engländerinnen. Er trägt noch immer die provisorische Jogginghose von Aeroflot. Die Ladies halten Sicherheitsabstand. Eine drückt sich ein Taschentuch vor die Nase und wendet sich ab. „Bloody hell, this is disgusting!“ Ja, es ist wirklich widerlich. Nach gut neun Stunden Flugzeit wird der Mann kaum angenehmere Düfte ausströmen als an Bord. Vielleicht musste er sich zwischenzeitlich auch übergeben oder hat er gerade ausgelassen gerülpst, wie auch im Flugzeug so oft?
Eine weitere Begegnung mit dem Dicken ist im Kloster eher unwahrscheinlich. Dort herrscht stricktes Alkoholverbot. Jetzt muss der Dicke wieder aufs Klo und hier hat er Platz. Er bricht aus der Warteschlange aus und torkelt in Richtung Toiletten. Es kommt zu Kollisionen, denn sein Weg kreuzt mehrmals die benachbarten Warteschlangen. Allerlei internationale Worte des Unmuts löst er damit aus und verursacht bei Vollkontakten kleine Massenfluchten. Das letzte, was ich von ihm sehe, ist die blaue Jogginghose, dann ist er verschwunden.
Suvarnabhumi Airport, Bangkok
Bangkok
Die Warterei ist eine wunderbare Gelegenheit, um das Meditieren zu üben. Erste Bekanntschaft damit habe ich in einem buddhistischen Zentrum der Tibeter gemacht. In einem alten roten Backsteinhaus, kaum zehn Minuten von meinem Berliner Zuhause entfernt, tauchte ich in die Stille ein. Nach einem Arbeitstag im Getöse waren die Abende dort pure Entspannung. Anfangs saß ich nur da und schnupperte den Duft der Räucherstäbchen, blinzelte dem großen goldenen Buddha zu und atmete tief. Es dauerte ein wenig, bis die Konzentration auf die Anleitung zur Meditation gelang. Nach einigen Wochen sickerten die Worte immer tiefer ein und langsam lernte ich zu meditieren. Bis heute empfinde ich Freude, sobald ich das alte rote Backsteinhaus betrete. Im kalten Winter empfängt die große Meditationshalle mich mit molliger Wärme. Klettert das Thermometer im Berliner Sommer auf über fünfunddreißig Grad, bleibt es dort dennoch kühl. Ganz anders als hier in Thailand.
Bangkok ist heiß und laut wie immer. Es ist gleichgültig, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man ankommt – die Stadt ist immer wach, ihr feuchtwarmer Atem steht niemals still. Nachts wird das Brummen der zahllosen Mopeds, Klimaanlagen und Autos nur etwas leiser und schwillt lange vor Sonnenaufgang bereits wieder an. Es ist Nachmittag, und ich versuche unversehrt die Straßenseite zu wechseln. Müde von der Reise stehe ich am Straßenrand. Die tropische Sonne schwebt grell am Himmel. Der rasante Linksverkehr Bangkoks ist herausfordernd und verlangt nach jenem Koordinationsvermögen, mit dem andere gesegnet sind. Eine wie ich kann in der Hauptstadt Thailands leicht unter die Räder geraten. Dann endlich, nach einigen Adrenalinschüben, wird ein Plätzchen im Gehirn frei und lässt mich die neuen Verkehrsregeln begreifen: Den Kopf in die ungewohnte Richtung rechts drehen und augenblicklich dem Impuls Losgehen folgen. Denn bliebe ich stehen, führe kein Fahrzeug langsamer. Tue ich bei einer Lücke in der Blechschlange jedoch so, als hätte ich keines gesehen und marschiere los, lassen mich die motorisierten Bangkokians großzügig queren, wenn auch mit Hup-Konzerten.
Auch auf den Fußwegen – so überhaupt vorhanden – muss auf jeden Schritt achtgegeben werden. Große tiefe Löcher lauern in Gehwegplatten sowie Müll und Bordsteine von extremer Höhe. Letztere verhindern das Fahren von Mopeds auf Bürgersteigen, lassen Fußgänger jedoch oft ins Stolpern geraten. Hier in der Hauptstadt Thailands spüre ich, wie ich mit dem Leben davonkomme, sei es nur auf dem kurzen Weg zum Bahnhof.
Mein erstes Ziel ist die Hua Lamphong Central Trainstation, ein alter Bahnhof, der im Zentrum Bangkoks liegt. Wie Bienen schwärmen die Thais dort umher. Sie eilen vom Gleis in die große Wartehalle, schleppen große Pakete mit sich und viele Kinder – manche einen Karton mit lebenden Hühnern. Am Schalter lausche ich den fremden Worten und beobachte das emsige Treiben. Morgen schon soll es in Richtung Kloster gehen, mit einer alten koksbetriebenen Zuckelbahn in die Provinz Isaan im Nordosten des Landes. Es braucht eine kleine Diskussion, bis der freundliche Mann in Uniform meinem Wunsch entspricht. Eine weiße alleinreisende Frau ist hier in Thailand etwas Exotisches: Sie braucht doch Aircondition und einen weichen Sitz, besser noch eine Liege, weil die Fahrt so lang ist. Die Fürsorglichkeit des Beamten rührt mich. Er möchte mir ein 1. Klasse-Ticket verkaufen. Der Mann weiß nicht, dass ich zahllose Stunden in der Berliner S-Bahn abgesessen habe. Mir erscheint eine Tagesreise frei von Sitzkomfort und kalter Kunstluft wie Luxus. Sie bedeutet für mich unverfälschtes Erleben. Bestimmt lächle ich zurück und der Mann überreicht mir die 3. Klasse-Fahrkarte.
Hua Lamphong Trainstation
Beschwingt schlendere ich durch die mir noch vage bekannte Gegend rund um den alten Bahnhof. Die Metropole Bangkok wird bei jedem Besuch vertrauter und bleibt doch beharrlich fremd. Entweder lauert der Gestank von kompostierendem Abfall an der nächsten Ecke oder der köstliche Duft einer mobilen Straßenküche oder beides. Die Abgase der endlosen Blechlawinen schweben über der Stadt. Am Ende einer Gasse trotzt ein kleiner Stand mit frisch gepressten Fruchtsäften der gnadenlosen Sonne. Mit großem Durst steuere ich darauf zu. Zwei junge Straßenhunde tollen hechelnd umher. Sie haben offenbar verlässliche Futterstellen und sichere Schlafplätze, sehen noch unbeschadet aus. Eine Katze beobachtet das bunte Treiben aus einem sicheren Hauseingang im Schatten. Frische Mangos, Ananas, Papayas und Zitrusfrüchte schmücken die kleine Saftbar. Ein alter Mann deutet zahnlos lächelnd auf seine Schätze. Heute soll es für mich Orangensaft sein. Der landestypische Orangensaft wird in Thailand gesalzen. Erst ganz hinten auf der Zunge wird dieser scheinbare Widerspruch merkbar und möchte dann an Deutlichkeit nicht mehr nachlassen. Bei jedem weiteren Schluck drängt er sich mehr auf und breitet sich aus, wie so vieles im Leben.
Die Schritte werden größer, ich laufe schneller. Es ist kurz vor Sonnenuntergang und die Plagegeister Thailands, die Moskitos, sind da. Wie eine Heimsuchung fallen sie in den Stunden der Dämmerung über alles her, was Nahrung verspricht – so auch über meine nackten Arme und Beine. Freundliche alte Menschen sitzen in den Gassen vor ihren Häusern. Sie lächeln mich an und wollen helfen. Einfach so. Denken, die blasse Fremde hat sich verirrt. Im Grunde stimmt das ja, bin ich doch hierhergekommen, suche in Thailand nach etwas, was ich in Deutschland verloren glaube und bislang nicht wieder finden konnte. Doch heute Abend möchte ich nur umherstreunen, bis es Zeit zum Schlafen wird. Die Alten sprechen kein Englisch und ich kein Thai. Unser Lächeln reicht für einige stille Dialoge auf dem Rückweg zum Guesthouse. In einer Straßenküche schlürfe ich eine Suppe. Dann falle ich ins Bett.
Die zehn Stunden Schlaf in der letzten Nacht sind rekordverdächtig. Ich habe tief geschlafen und fühle mich erfrischt. Der Tag kann kommen – ich bin bereit für das Kloster. Um 8 Uhr früh zuckelt die alte Koksbahn gemütlich ihre vierhundertfünfzig Kilometer gen Norden. In allen Waggons der 3. Klasse sind die Deckenventilatoren im Eimer. Es ist bereits so warm, als hätte jemand einen Fön eingeschaltet. Einige Fensterklappen lassen sich noch öffnen, verschaffen jedoch kaum Luftzug. Mit kleinen bunten Fächern bewedeln Frauen und Männer ihre Kinder und sich selbst. Die Fahrt wird rußig. Zahllose kleine Kokspartikel flirren durch die Luft, kleben auf der schweißnassen Haut, nisten sich im Gewebe der Kleidung ein.
Draußen zieht Bangkok vorbei, das reiche und das arme. Fast direkt an die Gleise drängen sich Wellblechhütten und andere armselige Behausungen, bunte Wäschestücke wehen im Wind, während kleine Kinder im Dreck spielen. Dann wieder die Moderne: Schicke Autos auf glatten Straßen, postmoderne Architektur. Immer wieder Müll und kleine Straßenküchen. Auf jedem Kilometer weht ein anderer Geruch hinein.
Hinter den Außenbezirken der Metropole breitet sich grüne Sumpflandschaft aus. Erste Reisfelder werden sichtbar. Nah bei den Gleisen waten Störche und weiße Reiher im Lotus und Schilf umher. Sie wissen, dass der Zug nicht ausschert, heben erst ab, wenn er fast neben ihnen fährt.
Bei jedem Halt schwärmen Obstverkäuferinnen von beiden Seiten der Waggons hinein und bieten Mango, Papaya und Ananas als Fingerfood feil. Ich kaufe einige Früchte und würze sie mit süßem Chilisalz. Diese Nahrung hält wach und vital in den Tropen, verschafft dem Körper die Mineralien und Nährstoffe, die er so rasch bei anhaltendem Schwitzen verliert. Bis mittags gegen 13 Uhr ist die Hitze im Zug betäubend. Sie vernebelt mein Gehirn. Unablässig läuft der Schweiß von der Stirn in die Augen und den Nacken hinab, sorgt für ein permanentes Gekribbel auf der Haut. Mein als Fächer genutztes Meditations-Buch habe ich bereits durchgeschwitzt – es zerfällt in seine Einzelteile. Das mechanische Klappern und Ruckeln ist derart einschläfernd, dass nur Dösen und Schlafen bleibt.
Ob es im Kloster Deckenventilatoren gibt, die die Hitze des Mittags mildern? Es werden ähnliche Temperaturen herrschen wie hier. Was, wenn ich im Kloster auch einfach wegnicke und umkippe? Auch gibt es im Schneidersitz keine Rückenlehne, wie im Zug. Dafür bleibt dann mein nassgeschwitztes Kreuz nicht daran kleben, wie an diesem beinharten Sitz, überlege ich trotzig.
Ich mache mir Sorgen. Habe plötzlich Angst, es nicht zu schaffen. Noch bevor es überhaupt angefangen hat, sehe ich mein Vorhaben bereits im Geiste scheitern. Wegen Hitze, Jetlag und Erschöpfung. Da sind sie also, die ersten Zweifel. Sie schleichen sich an, versuchen meine Freude auf das Vorhaben zu verdrängen und übernehmen das Regiment. Dabei kann ich noch nicht wissen, wie es werden wird. Ich muss es erleben, denn die Situation liegt noch in der Zukunft. Und genau das möchte Vipassana ja vermitteln: Die Erfahrung am eigenen Leib und am eigenen Geist. Heute ist heute und Kloster ist morgen! Ich schicke die bösen Vorahnungen zurück in die Wüste, schließe erneut die Augen und schlafe wieder. Offenbar ist es den Zweifeln auch zu warm. Sie bleiben vorerst auf Abstand.
Am späten Nachmittag wird es endlich kühler. Vermutlich nur ein oder zwei Grad, doch die fühlen sich an wie zehn. Bangkok liegt weit hinter uns. Die Koksbahn zuckelt durch den Nordosten Thailands und ist fast leer. Die wenigen Menschen, die zusteigen, sind ärmlich gekleidet und haben eine dunkle Hautfarbe. Sie mustern mich neugierig. Irgendwann bin ich die einzige Weiße im Zug.
Rund elf Stunden Fahrt sind vergangen. Aus dem Spiegel des Hotelzimmers starrt mir ein Geist entgegen. Mein Gesicht ist vollkommen schwarz, die hellblonden Haare zu stumpfem Grau-Schwarz mutiert. Surreal tritt das Blau und Weiß meiner Augen hervor, die rosa Bluse ist bleifarben. Ich dusche lange, schrubbe den hartnäckigen Ruß von meiner Haut und versuche vergeblich, die verkoksten Kleidungsstücke zu waschen. Mittlerweile erkenne ich die Vorteile eines 1. Klasse-Tickets.
Es geht auf 23 Uhr zu, als ich hungrig in die Innenstadt wandere. Nach dem endlosen Sitzen ist der Bewegungsdrang da, auch wenn es bereits viel zu spät ist, um als Frau die unbekannte Stadt zu erkunden. Es ist der letzte Abend, an dem ich laufen kann, laufen darf – die letzte Nacht, bevor es ins Kloster geht. Die Straßen Khon Kaens sind spärlich beleuchtet und der Verkehr gefährlich. Niemand ist bereit, vom Gas zu gehen, wie in Bangkok, wo man Reisende meist mit Fassung und viel Geduld passieren lässt. Um ein Haar werde ich beim Überqueren der Straße angefahren. Der Schreck ist groß, mein Herz rast. Und da ist es wieder, das Gefühl der eigenen Verwundbarkeit. Trotz Müdigkeit muss ich achtsamer sein, wenn ich nicht unter die Räder kommen will.
Die Straßenküchen sind bereits geschlossen, doch auf einem großen Platz in der Nähe findet Open-Air-Kino statt. Buddha ist mit mir, es läuft ein Musical oder Musikfilm, die Töne klingen indisch und sind ohrenbetäubend laut. Die aufgestellten Verstärker hätten gut und gerne die Berliner Loveparade beschallen können. Es ist tatsächlich ein indischer Streifen aus der Traumfabrik Bollywood. Auf der Leinwand wird gerade getanzt. Die Frauen tragen farbenfrohe Saris und sind atemberaubend schön. Vater und Sohn fechten einen Streit aus und bringen die rauschende Choreografie zu einem vorzeitigen Ende. Die Frauen beginnen bitterlich zu weinen. Sie versuchen, die sich nunmehr an den Kragen gehenden Männer zu trennen. Der Film hat keine Untertitel. Gebannt sitzen die Thais im Schneidersitz auf dem Boden und folgen dem Treiben auf Hindi.
Ich stehe einfach da und lasse die Szene einsinken. Im anhaltenden Getöse merke ich plötzlich, wieviel Aufmerksamkeit ich hier errege. Viele Augenpaare von Zuschauern sind auf mich gerichtet, ohne ein Lächeln. Keine einzige weibliche Thai ist hier anwesend – geschweige denn eine Weiße. Das Kino ist ein Männerhappening und meine Anwesenheit nicht erwünscht. Für einen kurzen Moment kriecht nackte Angst in mir hoch. Ich wende mich ab, trolle mich zurück ins Hotel und gehe hungrig schlafen.
Am Morgen beginnt die Suche nach der Busstation. Ein Mini-Van wird mich dort auflesen und die verbleibenden dreißig Kilometer in das Kloster Dhamma Suvanna fahren. Im Hotel spricht niemand Englisch und einen Stadtplan scheint es nicht zu geben. So suche ich auf der Straße nach Tuk-Tuk-Fahrern, jenen Akrobaten, die sich, motorisiert auf drei Rädern, allen Herausforderungen im asiatischen Straßenverkehr stellen. Sie kennen sich aus, haben auf jede unverstandene Frage eine Antwort. Binnen weniger Minuten sehe ich mich umringt von zahlreichen Fahrern. Die Männer verstehen das Wort „Bus“ und zeigen in alle Himmelsrichtungen. Ich habe ein Luxus-Problem und erfreue mich vieler verschiedener Wegbeschreibungen. Keiner versteht mich, ebenso wenig, wie ich die Männer verstehe.
Eigentlich wird das Reisen in einem solchen Moment besonders interessant: Ich bin angewiesen auf die Mitmenschlichkeit und Intuition meines Gegenübers, gezwungen, zu vertrauen, ja mich anzuvertrauen, weil mir eine eigene Einschätzung der Lage – der örtlichen Lage der Busstation – nicht möglich ist. Doch das fällt mir schwer in Gegenwart so vieler Männer, die sich beinahe überschlagen, um bei mir das Rennen zu machen. Und weil einige bereits nach dem Rucksack auf meinem Rücken und dem Handgepäck greifen. Und vermutlich gleich nach mir. Wie sehr ich diese körperlichen Übergriffe hasse. Ich zerre mein Gepäck zurück zu mir und fletsche im Geiste bereits die Zähne, bin nur noch Angehörige einer Industrienation, nur noch Weiße und will den gewohnten Radius wahren. Und bleibe dennoch höflich. Der Grad des freundlichen Umgangs ist erstaunlich schmal hier für eine Frau: Wie breit darf ein Lächeln gelächelt werden?
Immer mehr Männer kommen heran und beraten lautstark über das Fahrziel. Plötzlich drängt ein Beschlipster durch das Männermeer. Er spricht feinstes US-amerikanisches Englisch und entschuldigt sich galant für den Mangel nötiger Sprachkenntnis seiner Landsleute. Als wäre nicht ich diejenige, die hier versäumt hat, sich mit der Landessprache zu rüsten. Der Mann verkündet, er werde an einem Bildungskongress teilnehmen, der heute im Hotel stattfindet. Das mag ich mindestens genauso wenig: von gut situierten Männern gerettet werden. Dennoch lasse ich mir eine Zeichnung von ihm machen. Beschriftet in Thai kann ich sie den Fahrern zeigen. Die Busstation ist natürlich jedem Fahrer ein Begriff, alle lachen nun, fragen den feinen Herrn nach meinem Reiseziel. Mein Wunsch, hier zu meditieren, lässt sie staunen: Mit einem Wai, jenem respekterweisenden Nicken, für das hier die Handflächen vor dem Herzen aneinander gelegt werden und der Kopf sich neigt, danken sie mir diese Antwort.
Es ist noch Zeit bis zur Abfahrt und so streune ich von der Busstation zum nahegelegenen Einkaufszentrum. Die letzten Stunden vor der Klosterstille werden gefüllt mit Kitsch und Krach. Grelles Neonlicht schreit mich an, blendet mich fast mehr als die tropische Sonne draußen. Der Rucksack bleibt in der Obhut der schönen jungen Thai-Frauen am Informationsschalter. Sie sehen aus wie Models und tragen Make-up auf einem ohnehin makellosen Teint. Sofort werde ich mir meiner inzwischen zu Beulen ausgewachsenen Insektenstiche der ersten Reisenacht gewahr. Dabei ist für Dünnhäuter jeder Abdeckungsversuch sinnlos. Auch bin ich auf dem Weg in die Reizlosigkeit für die nächsten zehn Tage. Und Mr. X, mein Promi, weilt gerade in Europa, also tausende Kilometer weit weg. Nur ich muss mein ungeschminktes und verbeultes Gesicht im Spiegel ertragen, so es im Kloster überhaupt welche gibt.
Der Krach treibt mich in das Untergeschoß der Shoppingmall, doch leiser ist es hier unten keineswegs. Thais haben in ihren Ohren augenscheinlich keine Abstufung für Dezibel. Sie sind schmerzfrei, was Lärm betrifft. Eine ganze Hand voll Lärmquellen können gleichzeitig tröten und flöten, kreischen und quietschen – weder Alte noch Kinder, Frauen oder Männer zeigen kleinste Anzeichen von Überlärmung. Ein Fernseher in Bangkok kann ein ganzes Dorf beschallen. Auf den Inseln oder in der Provinz ist es genauso. Nur wir Gestressten aus dem Westen leiden – die Thais aber lieben es laut. Auch die kleinen Damenboutiquen hier unten werden mit Musik beschallt – jede einzelne mit einer anderen. Wenigstens entkomme ich dem Geballer der Gameboys im Erdgeschoß, an denen die Kinder der shoppenden Mütter sitzen. Ich lächle in mich hinein, tanke den Krach, wohlwissend, dass mich in wenigen Stunden die absolute Stille im Kloster erwartet.
Thailands Mode für Frauen erinnert an die Mädchenkleidung in heimatlichen Kinderabteilungen. Der wunderbare Kitsch, den es hier für Frauen gibt, lullt mich ein. Meine Hände greifen hinein, fassen alles an, saugen auf, ganz in Erwartung des vollständigen Entzugs vertrauter Sinneseindrücke. Vor den herrlichen Rüschen, Herzchen und zahllosen Volants, die die Garderobe der Thailänderinnen zieren, bin ich anatomisch wegen westeuropäischer Grobschlächtigkeit geschützt. Was in den USA die Konfektionsgröße XXS hat, lautet hier XXL. Das ist beruhigend. Kein Shoppen, nur Schauen. Dann ein schwacher Moment: Smaragdgrüne Flip-Flops mit Blüten aus glitzernden Glasperlen und Garn bestickt, in meiner Schuhgröße, die man sonst in Thailand vergeblich sucht – Hilfe! Das Garn ist gewachst und die Blümchen lassen sich herrlich modellieren wie eine Skulptur. Ganz sicher werde ich nie wieder die Möglichkeit haben, solche Latschen zu ergattern, außer im Hier und Jetzt, in Khon Kaen, in Thailand. Keine dreißig Minuten bevor es in den Totalentzug, in die Isolation geht, gebe ich mich hin und kaufe.
Eine junge Verkäuferin spricht mich an. Sie versucht es ehrgeizig, bemüht sich um Englisch und mischt es mit Thai. Ganz und gar schief stehen ihre Zähne in dem hübschen Gesicht. Sie weiß es und hält immer wieder die Hand vor ihren Mund. Es ist gerade diese Unvollkommenheit, die sie zur Schönheit kürt. Ich lächle nur. Ein ums andere Mal wandert ihr Blick von meinen Augen zu meinem Haar. Nach vier Haarwäschen ist es wieder hellblond. Sie zeigt darauf und kichert verschmitzt, wird immer aufgeregter. Das macht mich neugierig, doch ihre Worte bleiben noch immer unverstanden. Schüchtern holt sie schließlich ein abgegriffenes Büchlein unter dem Ladentisch hervor. Es ist vollkommen zerlesen. Auf dem Cover ist Jesus Christus abgebildet, in einem weiß wallenden Gewand und mit langem gelbem Haar. Seine Augen leuchten hellblau. Stolz berichtet die junge Frau, sie sei 2010 zu den Zeugen Jehovas konvertiert. In mir vermutet sie eine nahe Verwandte. „Sister!“ – „Sister!!!“ Mit einem strahlenden Lächeln werde ich für die Schwester von Jesus Christus gehalten. Es ist es kaum auszuhalten, wie ehrfürchtig sie mich ansieht. Ich bin wohl die erste blonde Europäerin, die die junge Frau zu Gesicht bekommt. Ich versuche ihr zu erklären, aus welchem Grund ich hier bin. Das ist schwer. Doch das Wort Buddha versteht sie. Wir lachen beide. Ich sehe sie denken, ihre Zweifel an meinen Worten. „You Buddha? No, you Sister Jesus!“ Mit verklärtem Blick verabschiedet sie mich, als wäre ich ein Wunder. Wie gerne möchte ich es zerstören. Ich sehe Religion kritisch und eine religiöse Autorität möchte ich noch weniger sein.
Auf den Stufen vor der Shoppingmall gönne ich mir noch einen letzten leiblichen Genuss, bevor der Speiseplan des Klosters das Regiment übernimmt: Limetten-Hühnchen mit Koriander und Chili. Es wird einfaches vegetarisches Essen geben und mir bereitet das bei der Anmeldung genannte Wort „basic“ irgendwie Unbehagen. Um mich herum futtern Thais und mustern neugierig das, was ich esse. Dann stehen Männer wie Frauen auf und bringen mir dunkelroten Sticky Rice – süßen Klebereis und verschiedene Gemüse, Fisch, gesalzenen Orangensaft und Servietten. Sie lächeln und nicken, schenken mir ihre Gastfreundschaft. Mir wird ganz warm ums Herz. Kleine Kinder zeigen mir, wie mit den Händen der Reis in das Curry gedippt und zum Mund geführt wird. Sie lachen, weil ich mir ständig etwas aus den Fingern flutscht. Schließlich bringt ein kleiner alter Mann mir eine Plastikgabel. Wir schmatzen und lächeln, doch geben darf ich keinen einzigen Baht-Schein, die Thai-Währung, für das köstliche Essen. Man scheucht mich resolut zurück in den Schatten. Den Mund halten soll ich und aufessen. So leicht geht Teilen hier in Thailand. Mit vollem Bauch und schwerem Rucksack auf dem Rücken danke ich den freundlichen Menschen mit einem Wai und wanke zur Busstation.
2. KapitelEs wird ernst - es geht ins Kloster
Vier ältere Thai-Ladies begrüßen mich an der Busstation mit einem Wai. „Sind Sie Astrid Müller?“ − Wie können Sie wissen, dass ich es bin? „How did you know, I am Astrid?“ Verwundert setze ich mich zu den Frauen. In der Wartehalle befinden sich noch andere weiße Reisende und meine Anmeldung für das Seminar enthielt kein Foto „I thought you searching for something, while carry heavy. This is looked German!“ Wie eine Suchende sehe ich aus und ich trage schwer, das sehe deutsch aus. Selbst hier in der thailändischen Provinz bin ich als Deutsche erkennbar. Vorbei der Traum, in Thailand, wo so viele meiner Landsleute unterwegs sind, unerkannt als Skandinavierin oder Amerikanerin unterzutauchen. Wie gerne hätte ich meine Herkunft für wenige Wochen abgestreift, doch offenbar brauche ich nicht einmal zu sprechen. Man muss mich nur sehen. Shalini ist eine der Dhamma-Helferinnen und wird während des Kurses für mein und das Wohl der anderen Teilnehmer sorgen. Sie lächelt mich aufmunternd an. Ihre Worte wollen verdaut werden.
Nach und nach treffen andere Teilnehmer ein, weitere Verrückte, die, wie ich, freiwillig in den Knast auf Innenschau gehen. Neugierig mustere ich sie – noch darf ich das ja. Eine schwarze Üppige drängelt vorbei, um ihre Ankunft zu melden. Resolut, sauberstes Weststaaten-Englisch. Die Wimpern von einer ungeschminkten Pracht, die jede Bollywood-Schönheit in den Wahnsinn treiben könnte und das krause Haar zu einem Knoten aufgesteckt. Ihr Rucksack wirkt federleicht und beneidenswert austariert. Ganz sicher bringt er satte acht Kilogramm weniger auf die Waage als meiner. Freundlich lächelnd erwidert sie meinen Gruß.
Das Paar, das nun erscheint, begrüßt alle mit Handschlag. Die junge asiatische Frau zappelt wie verrückt. In dem Moment, da sie mir ihren Namen nennt, habe ich ihn aufgrund ihrer Hippeligkeit, die so präsent ist, schon wieder vergessen. Ihr Gesicht wird im Gedächtnis bleiben. Ihr Partner, ein sommersprossiges Schwergewicht mit rotem Haar und braunen Augen, wirkt abwesend und scheint zu grübeln. Er ist ein Farbtupfer unter den dunklen Haarschöpfen hier. Dann erscheint ein Paradiesvogel. Eine junge Thai kommt mit wiegenden Hüften heran. Ihr Chiffonkleid in grellem Pink flattert im warmen Wind. Die Schuhe, Sonnenbrille und Handtasche kontrastieren in Rot. Bis Shalini sie anspricht, ist sie für mich ein Filmstar oder eine Schönheitskönigin, die sich auf der Durchreise verirrt hat. Aber nein, sie ist eine von uns und will ins Kloster. Kein bisschen wankt sie auf ihren schwindelerregend hohen Stiletto-Pumps. Mit einem flüchtigen Gruß nickt sie über die Köpfe der Wartenden hinweg und führt eine dünne lange Zigarette zu ihren pink geglossten Lippen.
Noch hält die Neugier meine Zweifel in Schach. Ich möchte so viele andere Teilnehmer wie möglich sehen und wahrnehmen, mit allen Sinnen erfahren, bis es losgeht. Die nächste weiße Frau kommt heran. Sie hat traurige Augen und hält den Kopf gesenkt. Sie ist schmal wie eine Thai, doch mindestens einsachtzig groß – mit Beinen bis zum Hals. Sie nickt uns zu, als gelte bereits das Gebot zu schweigen. Irgendwann merke ich, dass auch ich zu sprechen aufgehört habe. Zunicke, mit oder ohne Wai, immer noch lächelnd, noch immer starrend, aber bereits still. Noch eine Weiße erscheint, brünett und mit einer Nase, die sie deutlich erhoben über der Mittellinie ihres Gesichtes trägt, darunter rubinrote Lippen. Sie schafft es, das Lächeln von Shalini und den Thais unerwidert zu lassen, schreitet stumm vorüber, als sei sie gut vorbereitet auf das, was uns erwartet. Zum Schluss wartet ein großer blonder Mann auf, der auch schon schweigt. Er und ich bleiben die einzigen Helläugigen. Die spät eintreffenden Thai-Ladies sind im fortgeschrittenen Alter. Sie nicken allen zu und schnattern aufgeregt in der mir fremden Melodie ihrer Sprache, machen die Sprachlosigkeit von uns wett. Ob sie einander kennen, vielleicht aus früheren Kursen? Viel gäbe ich darum, ihre Worte zu verstehen.
Im Kleinbus bricht hektische Aktivität aus. Jeder Mann und jede Frau kramt im Gepäck, um Literatur hervorzuholen. Vipassana-Meditationsbücher, wo ich hinblicke. Versuchen sie sich, auf diesen letzten dreißig Kilometern, während der vielleicht noch zwanzig verbleibenden Minuten die Fähigkeit anzulesen, über den eigenen Gedanken zu schweben? Und dabei elf Stunden pro Tag in Verrenkung an einem Platz zu sitzen? Ich kann jetzt nicht lesen, denke an Mr. X, wünsche ihn hierher zu mir und gleich wieder weg, meine Entschlusskraft ist zu leicht zu beeinflussen.
Nach kurzer Fahrt hält der Bus vor einem kleinen Tor. Das Kloster Dhamma Suvanna liegt fern ab der langen Freundschaftsstraße, die Bangkok mit Laos, dem Land der Langsamkeit auf der anderen Seite des Mekongs, verbindet. Die Landschaft ist flach, viel Gras und einige Bäume sind zu sehen. Die schlichten Gebäude erinnern an ein Kinderferiendorf aus meiner Jugendzeit. In der Ferne knattern Motoren auf den Reisfeldern und einige Vögel zwitschern, dazwischen bellen Hunde, heiß und kräftig fegt der Wind durch die Bäume, wirbelt totes Laub und Staub auf. Das Klostergelände ist offen, Zäune sind keine zu sehen, lediglich die kleine Einfahrt ist links und rechts mit niedrigen Mauern eingefasst. Wer wieder weg muss kann raus. Doch vorerst wollen wir allein hinein.
Das Einchecken dauert lang. Die Üppige hat es selbst hier eilig und drängelt sich vor. Etwa fünf Jahre hat es gebraucht, mich in Berlin nachträglich mit solchen Ellenbogen auszurüsten. Mitunter fällt es heute schwer, sie wieder abzulegen. Auch deshalb bin ich hier. Doch in diesem Moment möchte ich jede meiner Bewegungen lieber einfrieren, nur, um da nicht hinein zu müssen. Mein Fracksausen ist jetzt arg, nun regieren alle Zweifel.
Mein Herz schlägt bis zum Hals, als ich an der Reihe bin. Bei meiner Selbstauskunft soll ich mögliche geistige Krankheiten ausschließen. Diese würden die Teilnahme unmöglich machen. Mechanisch akzeptiere ich die Regeln für die kommenden zehn Tage und erkläre mich mit allem einverstanden, bescheinige den vollen Besitz meiner geistigen Kräfte. Dabei sind diese Angaben sehr relativ. Was bedeutet eigentlich geistige Gesundheit oder besser geistige Unversehrtheit? Was ist Vipassana nicht mehr zuträglich? Schizophrenie, Depression, Psychose oder Neurose? Die Selbstauskunft reicht. Wer hier Geheimnisse einschleppt, tut sich selbst keinen Gefallen. Es geht gleich zur Sache. Von Null auf Hundert, elf Stunden pro Tag. Es wird kein Picknick werden.
Die Regeln fordern auch die Abgabe aller künstlichen Stimuli. Damit sind Stoffe gemeint, die das „neuronale Geschwätz“ im menschlichen Hirn – so nennt es Yongey Mingyur Rinpoche, der junge Shooting-Star am tibetischen Meisterhimmel – chemisch anregen, lahmlegen oder umlenken. Neuronales Geschwätz meint die Korrespondenz der Hirnzellen, die etwa Gedanken und Emotionen erzeugt, Erinnerungen schafft und Sinneswahrnehmung verarbeitet. Wie alte Freunde schwätzen diese Zellen, so der Jungmeister, und zwar in immer gleichen Botschaften. Läuft dies mit unerwünschtem Ausgang, greift man im Westen nicht selten zu Antidepressiva, Sedativa, Aufputschern und anderem. Das Bild von den quasselnden Hirnzellen gefällt mir.
Bereitwillig lege ich meine gesamte Reiseapotheke hin. Um sie gleich wieder einzupacken. Meine Angaben reichen. Wir alle mussten vorab schriftlich darlegen, welche Schwächen und Disbalancen uns plagen und mit welchen Drogen wir ihnen begegnen. Nur das absolut Notwendigste ist erlaubt. Stoffe wie Nikotin oder Notbremsen in Form von Haschisch oder Alkohol sind tabu. Mich plagen andere Geister: Die Aussicht auf Yoga-Entzug und Insektengifte zum Beispiel. Die Adrenalin-Spritze ist erlaubt, wie auch das Kortison – für so eine wie mich, die schwer allergisch ist. Auch religiöse Mitbringsel werden eingezogen. Heilige und Götterschmuck sollen draußen bleiben, die würden hier im Kloster nicht helfen, denn der Mensch soll sich auf Eigenverantwortung besinnen. Und weil ein betörender Duft den Geist zu verwirren vermag, wird sogar parfumfreies Deodorant empfohlen. Was ich an kommunikativen Ablenkern abzugeben habe, passt jedoch in keinen Umschlag. Buchstaben und Klänge machen acht Bücher plus Reiseführer, Notizbuch, MP3-Player und Handy. Zum Schluss meine Identität: Alle Reisedokumente, Ticket, Kreditkarte und Bargeld – schweren Herzens. „Better save than sorry.“ Eine Dhamma-Helferin liest meine Gedanken. Sie strahlt. Ich will hier weg, schon jetzt – jetzt noch!
Haus C ist eine Baracke, und hier werden wir Frauen residieren. Noch kann ich das passende Wort für unsere Behausung nicht finden. Hundertzwanzig mal zweihundert Zentimeter Raum gibt es hier pro Frau. Es sind Kabinchen, ja, das Wort scheint zu passen. H&M und C&A sind großzügiger mit uns, wenn wir uns entblößen und in neue Hüllen werfen. Das Mobiliar besteht aus einer etwa fünfzig Zentimeter breiten Spanplatte als Pritsche, darauf eine Schaummatte – vermutlich über Jahre mit jenem halben Liter Schweiß durchtränkt, den jeder Mensch pro Nacht verstoffwechselt. Sie ist so dünn, dass sie gar nicht erst da zu liegen bräuchte. Das kleine Kopfkissen ist aufgebläht und von einer Härte, die die Sitzbeine zum Meditieren einlädt. Ruht der Kopf darauf, wird es sicher beim Einrenken verdrehter Nackenwirbel helfen können.
Wären fünf Kilogramm mehr auf meinen Hüften und vollführte ich eine Drehung um meine eigene Achse, sie räumten das Bett ab. Sperrholzwände trennen die Kabinen und das ist geschönt, ja gehübscht. Sie reichen knapp hundertfünfundachtzig Zentimeter in die Höhe – wie Toiletten auf einem Campingplatz. Ein kleines Birnchen an der Wand ist die einzige Möglichkeit, dass mir ein Licht aufgeht, und mein Moskitonetz Halt findet. Keine Tür. Ein Vorhang, der sich nicht festzurren lässt, ja, vor meinem Palast nur noch an drei Ösen hängt. ‚Irgendwie wird es gehen und gelingen!’, sage ich immer wieder still, wie ein Mantra. Ich könnte heulen! Dann werden eben alle Frauen Zeuginnen meiner Flatulenzen und ich von ihren. Was mir augenblicklich mehr Sorgen macht, ist die Aussicht darauf, kein Yoga praktizieren zu dürfen.
Sofort beginne ich mit dem Umbau. Möglichst geräuschlos wandert die Pritsche auf Wäschestücken, um als meine künftige Schlafstatt auf der anderen Seite der Kabine zum Stehen zu kommen. Ein Brett auf Beinen und eine Kleiderstange sind und bleiben beharrlich im Weg, egal wohin ich sie zerre und staple. In diesem Stübchen wird mir kein Mero-Asana, der Hund, der nach unten schaut oder das Shathuranga gelingen – verdammt! Keine Krieger und Giraffen. Jene köstlichen Dehnübungen, jene Figuren und Tiere, mit denen ich Leben nachtanken kann. Es nützt nichts. Dabei ist Yoga so heilsam, pegelt aus oder ein. Kann glätten, was sich verworfen hat. Nicht hier. Auch wenn sich meine Glieder noch so sehr im vollen Ausmaß erfahren werden wollen nach meditativen Zwangshaltungen.
Und noch etwas anderes muss ich fahren lassen. Aller Ansprachen beraubt sah ich mich hier im verbalen Dialog mit mir selbst. Abends, allein. Wenn ich meine Stimme höre, bin ich. Doch noch. Noch immer. Vorbei der Traum von heimlichen Selbstgesprächen in späten Stunden, in denen die Stille unerträglich werden kann.
Wie mag es Mr. X in diesem Moment ergangen sein? Er saß auch in einem Vipassana-Seminar und bewohnte einen kleinen Raum in einem burmesischen Kloster. Mit eigenem Klo und einer richtigen Tür. Mr. X ist zwanzig Jahre älter als ich und hier zahlen sich die Jahre aus: Die Älteren bekommen eine eigene schlichte Zelle. Aus Respekt vor jenen anderen Bedürfnissen, die das Alter mit sich bringt. Sein Hintern wird wohl viel weniger auf Grundeis gegangen sein als meiner jetzt. Wer Klostererfahrung hat, weiß in etwa, was kommt. Ich weiß gar nichts, ahne aber vieles.
Zum Beispiel, dass hier auch für persönliche Rituale zur Nacht kein Platz ist. Das ist clever, schafft den Boden für die Abschaffung des Egos. So will es Buddha. Alle sind hier gleich. Ob Schlaflose, Nasenbohrerin, Vielfurzende oder Schnarchfrau. Letztere ist beängstigend. So auch die Träumerin. Sie neigt dazu im Schlaf zu plappern. Ohrstöpsel habe ich dabei, für den Notfall. Doch mit den Dingern verliere ich mein inneres Gleichgewicht, sie sind zu nah am Hirn, fühlen sich an wie Eindringlinge. Mit ihnen im Kopf ist an Schlaf nicht zu denken. Kein Ort des Rückzugs bleibt. Selbst der lächerliche Fetzen Stoff, der vor den Kabinen hängt, reicht nicht bis zum Boden. Ein alternativer Versuch. Ich wuchte die schmierige Schaummatte von der Pritsche und klettere hinauf. Stemme mich auf allen Vieren vom Vierfüßler in Mero-Asana. Sprich, kopfüber und Hintern in die Höhe. Beinahe wischt meine Hüfte die Glühbirne von der Wand. Ist es Zeit aufzugeben? Noch nicht ganz: Die Waschräume, ein letzter Hoffnungsschimmer, ein Funke – der sofort verglimmt. Plastikkammern, im Grundriss noch kleiner und mit noch mehr Luft ober- und unterhalb der Trennwände. Und mit vielen Spinnweben und anderen Mitbewohnern, die zur Gattung der Insekten zählen. Jetzt gebe ich auf.
Während ich räume, beginnen die Frauen aus C zu putzen. Stimmt irgendetwas mit mir nicht? Es fehlt wohl ein weibliches Gen. Betrete ich einen Raum, wie meinen kleinen Palast hier, fange ich an umzubauen. Die anderen Frauen kehren und wischen, um ihr Revier in Beschlag zu nehmen. Ich wünsche mir eine Bohrmaschine, die könnte jetzt helfen. Wenn der Garderobenständer seitlich an der Wand hinge – mit zwei kleinen Schrauben kein Problem – das Brett samt Gestell darunter stünde, dann, ja dann. Wie auch immer. Der Palastboden ist tatsächlich nicht sehr sauber. Und dort gehen Scharen von Ameisen spazieren. Ihr Gift ist unfreundlich und kann mich, die Empfindliche, schnell in Bedrängnis bringen. Draußen an der Barackenwand hängen Besen und Schaufel. Auch eine große Mülltonne steht dort. Ich deportiere die Ameisen, bereits in diesem Moment ahnend, das Gebot Tiermorde zu unterlassen, keine zehn Tage einhalten zu können.
Seit Beginn des Abendessens schweigen wir und meiden die Blicke der anderen. Für die nächsten zehn Tage und Nächte gilt die „Noble Silence“. In der Mitte der Baracke, des Lunchrooms, steht eine Tafel, auf der die Töpfe und Schalen mit warmem Essen warten. Und alles andere. Das Essen ist mehr als das gefürchtete „basic“: Sojageschnetzeltes in Curry, Reis, Kürbis-Kokos-Suppe, Früchte und alles, was frau zum Nachwürzen braucht. Ab morgen wird es um 17 Uhr lediglich eine letzte Teepause geben, mit Obst, Kräckern und Toast. Sogar Fruchtsaftsirup gibt es.
Rund um die Fensterfronten stehen schmale Tische, unsere Plätze sind namentlich festgelegt. Auf jedem Platz liegt ein roter Stoffbeutel – mit kleinen Ameisen übersät – der das Gedeck enthält: Ein Blechteller, eine kleine Plastikschüssel, ein Keramikbecher – welche Freude – und Campingbesteck. Die Fenster, aus denen wir blicken dürfen, weisen auf Bäume und Wiesen. Die Orte der Männer sind nicht zu sehen. Draußen lehnen zwei klapprige Spültische und drei verschiedene Mülleimer für Essenreste und Verpackungen. Im Dhamma Suvanna wird der Müll getrennt. Ich schöpfe wieder Hoffnung. Das alles ist mehr, als ich befürchtet habe. Vielleicht geht es ja doch.
Vier Plätze neben mir schmatzt genüsslich eine alte Nonne. Mit kahl rasiertem Schädel und im weißen Gewand sitzt sie da, aufrecht wie eine Kerze. Renitent bleibt sie auch nach der für die Mahlzeit vorgesehene Zeit sitzen. Sie lässt sich alle Zeit der Welt, um langsam zu kauen. Von draußen beobachte ich die Nonne fasziniert und spüle mein Geschirr. Jeder Naturheilkundler würde sie beklatschen, so vorbildlich speichelt sie einen Bissen nach dem anderen ein. Wie Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Zen-Mönch. Bei jeder Kieferbewegung den Fokus der Gedanken auf die Nahrung haltend, an ihre Entstehung, den Wuchs der Pflanze denkend, in Dankbarkeit und Achtsamkeit für das Geschenk der Frucht. Das tut sie, ich kann es sehen. Schon fast erleuchtet ist sie. Ganz langsam tupft sie schließlich ihren Mund mit einer Serviette ab. Dann der krönende Abschluss: Sie rülpst beherzt. Sehr laut sogar. Das hat Stil. Alles achtsam, alles langsam und bewusst.
Ganz anders die Frau, die im Lunchroom immer zu meiner Linken sitzen wird. Es ist die Wippende, jene junge Asiatin, die mir beim Treffpunkt die Hand schüttelte. Sie zappelt noch immer. Und schafft es, während des Essens sämtliche Gliedmaßen in Bewegung zu halten. Ich wünsche mir augenblicklich, dass sie in der Meditationshalle ganz weit von mir entfernt sitzt. Und gebe ihr einen Namen: Die Hampelfrau.
Rechts von mir die schwarze Üppige. Es scheint ihr nicht zu schmecken, sie lässt das Gros auf ihrem Teller liegen, nachdem sie es aufmerksam gemustert hat mit ihren schönen dunklen Augen. Hinter ihr die Schönheitskönigin – jetzt in rosé mit gelb und mit dezentem Make-up. Ihre Lippen tragen zarten Lipgloss in apricot. Wie ein Fotomodell sitzt sie mit einer Vierteldrehung in den Raum gerichtet und wird uns andere an jedem neuen Tag gnadenlos anstarren. Ganz so, als hätte es die gegenteilige Regel nie gegeben. Scheinbar hat hier jede ihre Strategie zu trotzen. Die einen offen, die anderen heimlich, wie ich, die alles beobachtet.
Die Dhamma-Helferinnen führen nun ein in das, was kommt. Im Lunchroom hängen Schilder. Sie enthalten die nötigen Informationen des Tagesablaufs samt aller Regeln. Ein Vipassana-Tag beginnt zu einer Zeit, da sich nachtaktive Katzen endlich schlafen legen: Morgens um 4 Uhr wird der Gong ertönen. Die erste Meditation beginnt – gewaschen oder ungewaschen – um 4:30 Uhr. Um 6:30 Uhr dann ist Frühstück bis 7:30 Uhr, 30 Minuten Pause folgen.
Ich höre nicht mehr zu. In meinem Kopf kommt es zu einer finalen Kontroverse: Was tue ich hier eigentlich? Warum nehme ich freiwillig diese Marter auf mich? Zehn kostbare Lebens- und Urlaubstage darauf verwenden, meinem Ego bei seinen Endlosschleifen zuzusehen, meine Knie und Hüften in die vorzeitige Coxarthrose treiben und vor Hitze taumeln? Weil ich es wissen will! Weil ich Blut geleckt habe, bei den Tibetern in Berlin. Weil es schon angefangen hat. Und weil ein Tag mit Meditation anders beginnt als ohne, genauso, wie jeder Tag, der mit Hatha-Yoga beginnt. Und weil ich hoffe, dass ich in den kommenden einhundertzehn Stunden Meditation zu Regionen in meinem Bewusstsein vordringen werde, die mich wieder in Kontakt mit mir bringen, mich wieder sensibilisieren, für mich und für andere. Und, dass dieses Vordringen unvergesslich bleiben und mich in meinem weiteren Leben begleiten wird. Ob wir alles verstanden hätten, werden wir gefragt. Ich nicke alles ab, ich bleibe. Ja, ich werde es tun.
Der Gong ertönt für die erste Meditation in der Dhammahall, einer schmucklosen Meditationshalle. Die Schuhe bleiben draußen. Meine sind mit Abstand die größten. Ein kleines Treppchen führt etwa fünf Stufen hinauf. Wie bei allen anderen Gebäuden will die Erhöhung vor Schlagregen während des Monsuns schützen und das Eindringen kriechender Tiere verhindern. Hier vor allem Schlangen. Wir Frauen betreten die Halle von rechts und sitzen auf dieser Seite, die Männer links. Devotionalien sind nirgends zu sehen. Am Boden sind Meditationskissen und Matten verteilt. Auf jedem Kissen liegt ein kleines Zettelchen mit einem Namen. Ich meine Glück zu haben, sitze weit hinten, in der vorletzten Reihe, wäre schnell draußen, wenn ich wollte. Als bräuchte ich Fluchtwege. Wir Ausländerinnen sind alle beisammen. Ganz vorn sitzen die älteren Thai-Ladies. Es sind zehn Frauen, die ich auf mindestens sechzig Jahre schätze oder älter. Werde ich das noch schaffen, wenn ich zwanzig Jahre älter bin? Etwa fünfundzwanzig Frauen sitzen hier beisammen. Unerlaubt nach links schielend zähle ich zehn Männer. Hinter uns die Dhamma-HelferInnen. Es sind sechs.
Ganz vorne ist ein kleines Plateau, auf dem nun ein alter Mann Platz nimmt. Es ist Mr. Amnatat Apichatvallop, ein vom Meister S.N. Goenka ausgebildeter Lehrer, ein „Assistant-Teacher“. Er verströmt jenen Gleichmut, jene friedliche Ruhe langjährig Meditationserfahrener, die Zweifler wie mich magisch anzieht. In ihrer Gegenwart darf ich sein. Gibt es kein Wägen und Wiegen, kein richtig oder falsch. Wird der Atem automatisch tiefer, sinken die Schultern, die sich nicht mehr zu schützen brauchen, vor Gedankenmannschaften, die den Nacken belagern, sich dort dick gemacht haben.