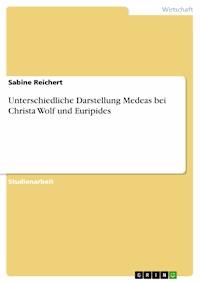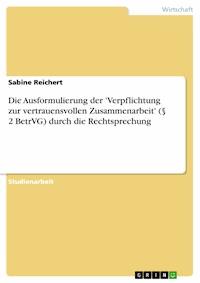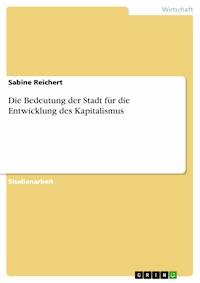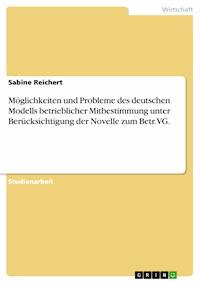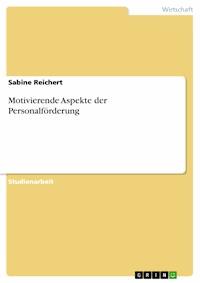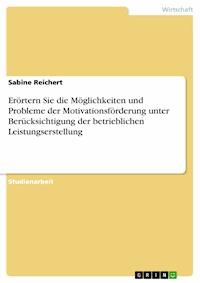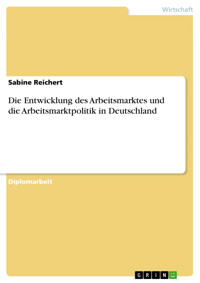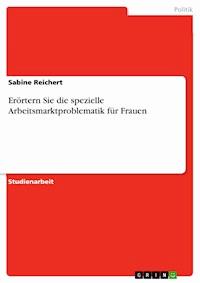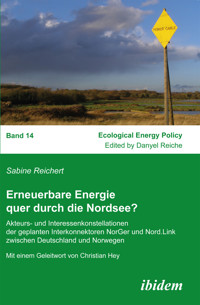
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ecological Energy Policy (EEP)
- Sprache: Deutsch
Der europäische Stromnetzausbau ist ein Schlüsselthema für das Gelingen der Energiewende. Seit dem Jahr 2006 sind Stromkabelverbindungen zwischen Deutschland und Norwegen geplant, die angesichts der zum Teil volatilen Stromproduktion regenerativer Energien kurzfristig auftretende Über- oder Unterangebote abfedern und so den Ausbau der Erneuerbaren unterstützen sollen. Bisher konnte jedoch noch keines der Übertragungskabel realisiert werden. Sabine Reichert untersucht in diesem Kontext die handlungsleitenden Bedingungen der in den Prozess involvierten Akteure, die sich bislang restriktiv auf die Umsetzung der Projekte ausgewirkt haben. Dazu wertet sie aktuelles, bisher nicht öffentlich zugängliches Datenmaterial aus. Auf dieser Grundlage nimmt Reichert die Leserinnen und Leser wortgewandt und mitunter detektivisch-spannend mit auf die Spur von deutschen wie norwegischen Protagonisten, die mit Rechtsunsicherheit, unklaren Zuständigkeiten und Finanzierungsproblemen konfrontiert waren und sind. Ihre Studie bietet aufschlussreiche Einsichten in die Schwierigkeiten, die eine europäische Ausbauplanung der Stromübertragungsnetze aufwerfen, und zeigt konstruktiv Möglichkeiten zu deren Überwindung auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Ecological Energy Policy (EEP) – Series Foreword
How can we initiate an ecological transformation process in the energy industry,a development toward increased use of renewable energies, more efficiencywhere the burning of fossil resources is still necessary, and the fasterreduction of the gross energy consumption?As evident as the necessity for changes of that kind may appear, it has onlyrecently been brought to the attention of a broader international audience:The consequences of global warming, external costs, the finiteness of fossilresources, and the regional conglomeration of fossil sources bear problemsfor mankind on a scale that seemed utterly unthinkable before.
So the goal of the new seriesEcological Energy Policy (EEP)is not about the– now widely accepted – necessity for a change, a transformation process,but it aims to discuss how such an alteration can beimplementedin real-lifeeconomy and society.
Crucial for the papers to be published within EEP are the answers to questionssuch as:
- Which political, economical, technical, and cognitiverestrictionsopposechange, by which factors(success conditions)can those restrictions beovercome?
- Whichactorscan support change, whichconstellations of actorsare necessaryto induce alterations?
- Whichregulating patternis in favor of the implementation of a transformationprocess? How do the differentinstrumentshave to be formed, what isa reasonable policy mix to achieve the effects intended?
The new series EEP presents an attractive platform for the publication ofmonographs, anthologies, conference volumes, and studies.
The first volumes of the series are studies of outstanding quality which representresearch that was conducted under the series' editor's supervision at theOtto Suhr Institute for political science and in the master course EnvironmentalManagement at the Freie Universität Berlin.
May the series EEP contribute to a better understanding of the possibilitiesand constraints of the implementation of an ecological transformation processwithin the energy industry.
Prof. Dr. Danyel Reiche
The series' editor, Prof. Dr. Danyel Reiche, is Assistant Professor for Comparative Politics
at the American University of Beirut (AUB), Lebanon.
Geleitwort
Die Energiewende ist die Domäne der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaftler. Diese identifizieren Technologien, berechnen Kosten, entwickeln Zukunftsszenarien und debattieren Marktdesign und Förderinstrumente. Politikwissenschaftlich ist das Thema bisher Neuland. Noch existieren viel zu wenig empirisch fundierte, politikwissenschaftliche
Analysen zur Energiewende. Diese aber könnten einen Beitrag zum tieferen Verständnis der anstehenden großen Transformation leisten. Das Handlungsfeld ist alles andere als einfach. Die Prozesse sind erratisch und führen oft zu unerwarteten und paradoxen Ergebnissen. Neue Allianzen und Konflikte entstehen aus der Systementscheidung für die erneuerbaren Energien. Es findet eine gesellschaftliche, wissenschaftliche undökonomische Mobilisierung sondergleichen statt. Aus der systematischen Aufarbeitung dieser Prozesse, von Erfolgen und Misserfolgen, lassen sich wichtige Lektionen für die Zukunft ziehen. Die vorliegende Studie ist ein wertvoller Beitrag zur politikwissenschaftlichen Aufklärungüber die Energiewende.
Sabine Reichert hat sich für ihre Arbeit einen strategisch wichtiges Thema ausgesucht. Wenn es gelingt, die großen kostengünstigen Speicherpotentiale Norwegens mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu verkoppeln, dann wird eine wertvolle Ressource für die Energiewende gehoben. Versorgungssicherheit undLastausgleich können so selbst bei sehr hohen Anteilen wetterabhängiger, zum Teil stark schwankender erneuerbaren Energien zu unschlagbar niedrigen Kosten gesichert werden, weist der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Sondergutachten zu einer 100% erneuerbaren Stromversorgung nach.
Das Projekt Norwegens, als„grüne Batterie“Europas ist aber von Insidern der Energiedebatte immer wieder belächelt oder als unrealistisch verworfen worden. Der Weg dorthin ist in der Tat steinig. Nicht jeder Versuch gelingt. Es gibt erhebliche politische Widerstände und zahlreiche regulative undökonomische Hemmnisse. Und dennoch wird nun mit Nord.Link ein erster Schritt getan.
Es ist das Verdienst der Autorin, die unterschiedlichen Interessen norwegischer und deutscher Akteure detailgenau und kenntnisreich rekonstruiert, die kritischen Phasender Entscheidungsfindung nachgezeichnet und die Erfolgsbedingungen identifiziert zu haben. Sie hatte dabei Einsicht in regierungsinterne Dokumente und Protokolle, die so zeitnah selten zur Verfügung stehen. Der empirische Teil ihrer Arbeit ist daher besonders erhellend.
Letztlich hat die Bundesregierung die Bedeutung dieses Projektes begriffen und unkonventionelle Mittel mobilisiert, um es zum Erfolg zu führen. Zugleich konnten diejenigen norwegischen Akteure, die zunächst skeptisch waren, gewonnen werden. Diese Erfolgsstory zeigt: Man sollte gute Ideen nicht zu schnell aufgeben, aber auchihre Handlungsbedingungen realistisch einschätzen.
In diesem Sinne hat Frau Reichert einen ermutigenden Beitrag zur Debatte um die Energiewende geleistet.
Dr. Christian Hey
Generalsekretär des Sachverständigenrates für Umweltfragen
Danksagung
Ich danke allen, die mich beiderPlanung und Erstellung der vorliegenden Studie unterstützt haben.
Ganz besonders aberbin ichPD Dr. Lutz Mez und Dr. Matthias Adolfvom Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlinfür ihren Rat und ihre Hilfezu Dank verpflichtet.Dasselbe gilt für den Herausgeber dieser Schriftenreihe, Prof.Dr. Danyel Reiche der American University of Beirut.
Weiterhinmöchte ichDr. Dörte Ohlhorst, Matthias Corbach,EvaMaria Miller,Max Reichert,Sabrina Roy, Wiebke MünchbergerundFrank Rexhausenpersönlich danken,die mirin den verschiedenen Stadien des Entstehungsprozesses dieses Bandesjederzeitund ausdauerndmit wertvollen Hinweisen zur Seite standen.Auch meinen Interviewpartnerinnen und -partnernund dem Referat KI III 3„Wasserkraft, Windenergie und Netzintegration der Erneuerbaren Energien“ des Bundesumweltministeriumsgebührt Dankfür diezum Teilintensiveund engagierteZusammenarbeit.
Schließlich möchte ich mich bei meinen Elterndafürbedanken, dass sie mir imLaufe desletzten Jahrestrotzäußerstwidriger Umständevor allem mentalden Rücken freigehaltenhaben.Nicht zuletztdanke ichmeinem Lebensgefährtenfür seineRuhesowiedie Freiräumeund Ideen,die er mir gibt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AEEAgentur für Erneuerbare Energien
AEUVVertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AFCAdvocacy Coalition Framework
AGArbeitsgemeinschaft
ALAbteilungsleiter
AKWAtomkraftwerk
AWZAusschließliche Wirtschaftszone
BDEWBundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
BDIBundesverband der deutschen Industrie
BfNBundesamt für Naturschutz
BIBürgerinitiative
BMFBBundesministerium für Bildung und Forschung
BMUBundesministerium für Umwelt, Naturschutz undReaktorsicherheit
BMVBSBundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BMWiBundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BNatSchGBundesnaturschutzgesetz
BNetzABundesnetzagentur
BRDBundesrepublik Deutschland
BSHBundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
BWEBundesverband Windenergie
CCSCarbon Capture and Storage
CO2Kohlenstoffdioxid
denaDeutsche Energie-Agentur
DG EnergyDirectorate-General for Energy
DUHDeutsche Umwelthilfe
EWREuropäischer Wirtschaftsraum
EEGGesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien;Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGLElektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
EnLAGEnergieleitungsausbaugesetz
EnWGEnergiewirtschaftsgesetz
EUEuropäische Union
EVUEnergieversorgungsunternehmen
FAZFrankfurter Allgemeine Zeitung
FNFForum for natur og frisluftsliv
GWGigawatt
HGÜHochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung
H&HHochstätter und Husen
IWESFraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik
KfWKreditanstalt für Wiederaufbau
KraftNAVKraftwerksnetzzugangsverordnung
kVKilovolt
KWhKilowattstunde
LBEGLandesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Niedersachsen)
LOLandesorganisasjon i Norge
MdBMitglied des Bundestags
MELVMinisterium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (Niedersachsen)
Mio.Million
MLURMinisterium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Schleswig-Holstein)
Mrd.Milliarde
MWMegawatt
NABEGNetzausbaubeschleunigungsgesetz
NGONon-Governmental Organization; Nicht-Regierungsorganisation
NIMBYNot inmy Backyard
NVENorwegian Water Resources and Energy Directorate
OEDÖl- und Energieministerium Norwegens
OWPOffshore-Windpark
PSWPumpspeicherwerk
PVPhotovoltaik
RLReferatsleiter
SRUSachverständigenrat für Umweltfragen
TWhTerrawattstunde
UALUnterabteilungsleiter
UBAUmweltbundesamt
UIGUmweltinformationsgesetz
ÜNBÜbertragungsnetzbetreiber
VDIVerein Deutscher Ingenieure
VIKVerband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft
ZfKZeitung für Kommunale Wirtschaft
Kurzfassung
Bisher war Elektrizitätsversorgung imHinblick auf Kraftwerksparks und Netzinfrastruktur stark auf die Bedürfnisse einzelner Nationalstaaten ausgelegt. Doch gerade dieseSysteme befinden sich aufgrund der Liberalisierung der Strommärkte und Verpflichtungen im Klimaschutzin Europain starkem Wandel. Auch Deutschland und Norwegen müssen daher neue Wege gehen. Dazu sind seit 2006zweiInterkonnektorenzwischen den beiden Ländern geplant,diediezum Teilvolatile Stromproduktion der erneuerbaren Energien abfedernund wirtschaftlich nutzbar machensollen. Die Umsetzung der beiden Projekte NorGer und Nord.Link kommt allerdings nur schleppend voran, was seitensinvolvierter Akteure maßgeblich regulatorischen SchwierigkeitenundProblemen bei der Kapitalbeschaffung zugeschriebenwird.
DievorliegendeStudiegeht der Frage nach,durch welche Akteurskoalitionen und HintergrundbedingungenPlanung und BauderSeekabelauf deutscher Seite bisher verzögert wurden. Mit Hilfe des‚Advocacy Coalition Framework‘nach Paul SabatierwurdedieEinordnung der Akteurein Koalitionenanhandihrerhandlungsleitenden Orientierungenund Strategienim politikwissenschaftlich bisher kaum erforschten Feld vorgenommen.DieUntersuchungwurdedurch die Annahmen des ‚Multi-Level-Governance-Ansatzes‘ ergänzt, daerSchwierigkeiten und Chancen, die das Regieren in Mehrebenensystemen mit sich bringt,erfassenkann.Die Analysestütztsich vor allem auf diequalitativeAuswertung prozessgenerierter Daten und teilstandardisierter Leitfadeninterviewsmit involvierten Akteuren.
Aufdieser Grundlagewerden drei Hypothesen aufgestellt: Die Realisierung der Seekabel NorGer und Nord.Link scheiterte bisher anmangelhaften Absprachen der zuständigen Regulierungsbehörden,fehlenderPlanungssicherheit aufgrund unterschiedlicherjuristischer und ökonomischer Maßgaben im Mehrebenensystemder Europäischen Union sowieunzureichenderKapitalausstattung des Netzbetreibers TenneT.
DieUntersuchungzeigtsoallgemeine,institutionell bedingte Problemeder transeuropäischen Netzausbauplanung im Zusammenhang mit der deutschen und europäischen Energiepolitikstrategieauf. Gleichzeitig verweist sie auf Schwierigkeiten im institutionellen Gefügeder deutschen Energiepolitik und bietet Lösungen an.
Abstract
Until recently, power supply was strongly oriented toward the needs of single nation-states in terms of power plant fleets and grid infrastructure. But it is precisely those systems that are currently undergoing sustained change in Europe due to the liberalization of electricity markets and climate change commitments. Among those countries forced to explore new paths are Germany and Norway. To that end, since 2006, two new interconnectors between the two countries are in the planning stages, installations meant to absorb the occasionally volatile production of electricity provided by renewable energies, and to make that energy economically usable. However, the realization of the projects, NorGer and Nord.Link, is making but sluggish progress, a fact that the actors involved ascribe largely to regulatory difficulties and problems with the procurement of funds.
The present study explores the question of what coalitions of actors and what background conditions have hitherto delayed planning and construction of the undersea cables on the German side. With the aid of the "Advocacy Coalition Framework" developed by Paul Sabatier, a classification of actors according to the goals and strategies guiding their respective actions was undertaken in a field which is as of yet relatively unexplored from a political science perspective. The investigation was complemented by leveraging the assumptions of the "Multi-level Government Approach", as it allows a comprehensive assessment of the difficulties as well as the opportunities that governing onmultiple levels brings with it.
Based on this evaluation, three hypotheses are then proposed: Therealizationof the undersea cables has, up until now, failed for lack of coordination among the relevant regulation authorities, for lack of confidence in planning due to a multitude of legal and economic frameworks within the multi-level system of the European Union, and because of insufficient financial endowment on the part of the grid operator, TenneT.
Close examination thus reveals general, institutional problems of trans-European grid extension planning in the context of German and European strategic energy policy. At the same time, it points to difficulties in the institutional structure of German energy policymaking and offers solutions to them.
1Einleitung
Bisher waren leitungsgebundene Elektrizitätsversorgungssysteme inHinblick auf den Kraftwerkspark und die Stromnetzinfrastruktur starkdurch dieAbschottungder einzelnen nationalstaatlichen Märktegekennzeichnet. Dementsprechend existieren nur wenige Leitungsverbindungen zwischen einzelnen EU-Ländern (vgl.Azau 2010, 32). Gleichzeitig stieg unter anderem aufgrund internationaler Verpflichtungen im Klimaschutzund sich stetig verknappenden fossilen Energieträgernder Druck auf die Regierungen der EU-Staaten,ihreEnergieversorgungssysteme auf kohlenstoffarme Erzeugungskapazitäten umzustellen. Auch die schrittweisestattfindendeLiberalisierung der Strommärkte und diedamit einhergehendeEinbindung des deutschen Stromnetzes in das europäische Verbundnetz erfordern politische, ökonomische und technische Anpassungsmaßnahmen seitens der Gesetzgeber beziehungsweise der Netzbetreiber (vgl.Casey 2012).
DieRegierung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) strebt einen 60-prozentigen Anteil erneuerbarer Energien im Bruttoendenergieverbrauch bis 2050 an (vgl.BMU &BMWi 2011).Dies soll zu großen Teilen durch den Ausbau von Offshore-Windenergie erfolgen (vgl.Bundesregierung 2002).Durch den wachsendenAnteil vonStrom ausWindenergie und Photovoltaik(PV)an der Stromerzeugungfluktuiert diese tages- und jahreszeitlichzunehmend.So entsteht das Risiko,dass in manchen SituationendieStromproduktion nicht mit den Lastanforderungen der Verbraucher in Einklang gebracht werden kann(vgl.DB Research 2012, 3).Dies liegt vor allem an zwei Aspekten:Bei einerin näherer Zukunftnoch relativ großen installierten konventionellen Kraftwerkskapazitätmitteilweise unflexiblen Betriebsmöglichkeiten – insbesonderevonAtom- und Braunkohlekraftwerken –müssenzum Lastausgleichhäufigerneuerbare Erzeugungsanlagen heruntergeregelt werden.Langfristigkannesbeistark abnehmendem konventionellem Kraftwerkspark und gleichzeitigem AusbauvonWindenergie und PVzu einemÜber- oder Unterangebot von Strom aufgrund der angesprochenen fluktuierendenErzeugungkommen(vgl.AEE 2011, 5).Teilweise wird demmit Instrumenten des Lastmanagements zu begegnen sein[1].Trotzdem werdender Ausbau von StromspeicherkapazitätenundKuppelstellenmit demeuropäischenAuslandvon erheblicherBedeutungfür die Durchführbarkeit der Energiestrategiesein(vgl.SRU 2011, 162–166). Aufgrund regional sehr unterschiedlich starkerEinspeisung von regenerativ erzeugtem Strom sowie dessen Verbrauch ist ferner ein Ausbau der Netzinfrastruktur auf allen Ebenen[2]entscheidend(vgl.BDEW 2010, 7).
Norwegen hingegen decktseinen Bedarf an elektrischer Energie zu 99% aus Wasserkraft, obwohl es über ergiebige Erdöl- und Erdgasvorkommen verfügt (vgl.Deutsch-Norwegische Handelskammer &BMWi 2010, 1). Allerdingswar esin den letzten Jahrenin niederschlagsarmen MonatenaufteureStromimporte aus dem Ausland angewiesen (vgl.Brammert-Schröder 2011). Um dennochdiehoch gesteckten Klimaschutzziele[3]zu erreichenund Versorgungssicherheitder Bevölkerungzugewährleisten, plant der staatliche Netzbetreiber Statnett fünf neueInterkonnektoren(vgl.Larsen 13.01.2012).
Zur Optimierung der Netzstabilitätkönnte mittelsHochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ)[4]in Zeiten von Erzeugungsspitzen beziehungsweise Nachfrageengpässen ein Lastausgleichzwischen Deutschland und Norwegenerfolgen. Dies sollnach Aussage der InvestorenzustabilerenStrompreisen aufden betroffenenMarkt führen(vgl. u.a.Hochstätter 25.01.2010)[5]. Außerdem wären weniger Abregelungen von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen notwendig[6]. Dadurch würden die norwegischen Wasserkraftwerke weniger Strom produzieren undihreReservoirs kämensoals Speicher zum Einsatz (vgl.Brammert-Schröder 2011).
1.1Problemstellung
Die praktische Umsetzung des Seekabelbaus zwischen Deutschland und Norwegengehtzögerlichvoran, obwohl sich derzeit zwei Projekte,NorGer und Nord.Link[7],mit jeweils 1,4GW Übertragungsleistung[8]in der Planungsphase befinden (vgl.Prognos AG & Statnett 17.02.2012; Tippelt 31.03.2011). Dabei unterscheiden sich beide Projektelediglich aufgrundihrer Trassenführung undder ursprünglich geplantenwirtschaftlichenBetriebsweise voneinander.
NorGer war alsprivatwirtschaftlichfinanziertes,dereguliertes Handelskabelgeplant, das einerentsprechendenGenehmigung vonSeitenderzuständigen Regulierungsbehörden in Deutschland und Norwegen sowie einer Stellungnahmeder EU-Kommissionbedurfte. Nachdem dienorwegische SeitedieErlöse des Kabels aus dem Engpassmanagement[9]nicht freigestellthatte, stiegen die privaten Anteilseigner[10]aus dem Projekt aus(vgl.EGL 26.08.2011).Dieablehnende Haltung der norwegischen Regulatorenhingauch mit der in Norwegenherrschenden Doktrin zusammen, dasssichUnternehmen und Infrastruktur im Energiebereich mehrheitlich in öffentlicher Handbefinden müssen.Mittlerweile sind die Anträgeauf Deregulationfür NorGerzurückgezogen und der norwegischen Netzbetreiber Statnett ist alleiniger InvestorderNorGerKS(vgl. Statnett 11.07.2011).Dieser Regelungspflichtunterliegt das Kabel Nord.Link hingegen nicht, daesvon Anfang anreguliert betrieben werden sollte(vgl.Bündner 11.04.2011).
Im November 2011meldete sich TenneT, derÜbertragungsnetzbetreiber, der die beiden Seekabel[11]an seinNetz anbinden muss, mit einem ‚Brandbrief‘beideutschen Behörden: Der Bau von Anschlüssenvon Offshore-Windparks (OWP) und Interkonnektorensei „in der bisherigen Form[…]nicht länger möglich“,da esfinanzielleund logistische Schwierigkeiten gebe(TenneT 07.11.2011).Seitdem berät die Bundesregierung darüber, wie der Konzern dabei unterstützt werden kann, seinen Aufgaben dennochnachzukommen (vgl.Stratmann 13.08.2012).Dies sind zweiderKonfliktpunkte,die laut verschiedenerim Feld aktiverAkteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und PolitikrelevanteRestriktionen darstellen.Sie werden im Rahmen dieserUntersuchunganalysiert und durch mögliche weitere ergänzt.
1.2Stand der Forschung
Das Projekt einer Kabelverbindung zwischen der BRD und Norwegenist nicht neu (vgl.Econ Pöyry & Thema Consulting Group 2010). Trotzdemexistiert kaumpolitikwissenschaftliche Fachliteratur zu dem Thema:In den einschlägigen internationalenZeitschriften fand sich kein Artikel, der sich explizit mit den geplanten Kabeln oderähnlichen Projektenbeschäftigt[12]. Auch in der deutschsprachigen Fachliteraturgab esnur wenige Artikel, die zumeist auf ökonomische, juristische oder planerische Fragen abzielten[13]. Keiner jedoch hatte reinpolitikwissenschaftlichenCharakter(vgl. Linnemann & Moser 2011, Brammert-Schröder 2011, Wiedemann 2010b).
Seit 2001 entstandenaufnorwegischer Seite einige Studien zum Thema Interkonnektoren.Dabei stechendie Paper „Norway and the North Sea Grid“der ‚Smart Energy for Europe Platform’(SEFEP2009),„Renewable Energy Policy Making in the EU – What has been the Role of Norwegian Stakeholders?”vonRuud & Knudsen(2009)der‚SINTEF Energy Research’sowiedie Studie„Challenges for the Nordic Power Market – How to handle the Renewable Electricity Surplus“vonEcon Pöyry & Thema Consulting Group (2010)hervor.Siebeschäftigen sich mit den Schlüsselakteuren der norwegischen Energielandschaft und deren Positionen bezüglich eines Netzausbaus in der Nordsee. Die Studie„Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany”vonLindberg(2012)der norwegischen Klimaschutzorganisation‚ZERO‘widmet sich als einzigedenMöglichkeiten und Restriktionen eines Seekabelbaus auf norwegischer und deutscher Seite.Ansonsten fanden sichDatenzumeist inprozessgeneriertenDaten wieZeitungsartikeln, Gesetzes- und Vertragstexten, Verwaltungsakten, Protokollen, Gutachten und Presseerklärungen.
1.3Fragestellung
Die vorliegendeStudiewird folgende Forschungsfrage beantworten:
WelcheAkteureund/ oder Rahmenbedingungenverhinderten bisher den Bau der Seekabel NorGer und Nord.Link zwischen Deutschland und Norwegen?
Dabeiwerdenvor allemdiehandlungsleitenden Orientierungen und erfolgreichen Strategien der politischen Einflussnahme seitensmöglicher Advocacy-Koalitioneninihrem sozio-politischen Kontextanalysiert. Um die zentrale Forschungsfrage beantworten zu können, wird das Vorhaben daher von folgenden Unterfragen geleitet:
·Mit welchenInstrumentenversuchten Akteure oder Koalitionen ihre Interessenim Felddurchzusetzen?Wessen Vorgehensweiseführte wie zum Erfolg?
·Hatten sich im Rahmen des politischen Prozesses Interessenkoalitionen herauskristallisiert und welche waren dies gegebenenfalls?
·Durch welchesozio-politischenRahmenbedingungen wurde der politische Prozess beeinflusst?
1.4Ziel der Forschung
Zielsetzung des Forschungsvorhabens ist es, die relevanten Akteure,möglicheKoalitionen, gemeinsame‚Belief Systems‘undInstrumente, die sie zur Durchsetzung ihrer Interessen einsetzten,innerhalb des Feldes abzubilden.Dabeidientdas Forschungsvorhaben ausdrücklich nicht dazu, die Annahmen, dieder‚Advocacy Coalition Framework‘(ACF),macht,empirisch zu testen. Esbenutztvielmehr einzelneseinerHypothesen, um den komplexen und bisher nicht politikwissenschaftlich erschlossenen Forschungsgegenstand im Hinblick auf seine Restriktionen zu ordnen und darzustellen.Sokann diedargelegteForschungslücke geschlossen werden.
Aufgrund der Komplexitätdes Falles ist esnicht möglich, beide beteiligten Länder abschließendzu untersuchen, da dazu jedes in seiner Lage im Mehrebenensystem der Europäischen Union– seinen politischen, rechtlichen, geografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen –in Gänze dargestellt werden müsste. Daher konzentriert sich das Forschungsvorhaben darauf, die Akteurskoalitionenauf deutscher Seitein ihrer Einbettung im Mehrebenensystem und ihrem sozio-politischen Umfeld in der BRD mit Hilfe des‚ACF‘nach Sabatierund des‚Multi-Level-Governance-Ansatzes‘zu analysieren.Die Untersuchungwird sichauf den Zeitraum von2006 bis Sommer 2012beschränken, da in diesen Jahren die konkrete Planung für die Vorhaben NorGer und Nord.Link fällt.Wieinerwähnt, liegt bereits Literatur zu den Interessenskonstellationen auf norwegischer Seite vor. Diese wird gleichfalls ausgewertet.
1.5Thesen
Ausgehend von demvorgetragenenForschungsstand wurden dreiHypotheseninBezug auf die Fragestellungformuliert: Die Realisierung der Seekabel NorGer und Nord.Link scheiterte bisher
·an mangelhaften Absprachen der zuständigen Regulierungsbehörden Bundesnetzagentur und dem norwegischenMinisterium für Öl und Energie,
·an mangelnder Planungssicherheit aufgrund unterschiedlicherjuristischer und ökonomischer Maßgaben im Mehrebenensystemder EU,
·anmangelhafterKapitalausstattung des Netzbetreibers TenneT.
1.6Aufbau derStudie
Dasfolgende Kapitel beginnt damit,die theoretischenund methodischenGrundlagen in Bezug auf den sozio-politischen Kontextdes Forschungsgegenstandesvorzustellen. Dabei werdender‚ACF‘von Sabatier als Analyserahmen beschriebenunddie Annahmen des‚Multi-Level-Governance-Ansatzes‘sowiedie methodische Vorgehensweiseder Fallstudiebeschrieben.
Im darauffolgenden dritten Kapitel werden relevante sozio-ökonomische, politische und regulatorische Kontextbedingungen in Deutschland, Norwegen und der EU aufgezeigt. Auch die beiden Kabelprojekte NorGer und Nord.Link werden beschrieben.
Das anschließende Analysekapitelgliedertsich invierBereiche, in denendieEntwicklungen im Fall derSeekabelprojektechronologisch dargestellt werden. Daran anschließend werdenAdvocacy-Koalitionen, der Zugang zu Entscheidungsprozessen sowie die Konfliktfähigkeit einzelner Akteure analysiert.
Im Fazit werden die Ergebnisse der Analyse abschließend zusammengefasst. Darauf folgend werden die eingangs aufgestellten Thesen überprüft und die Fragestellung beantwortet, indem die entscheidendenRestriktionen in Hinblick auf den Fall erläutert werden. Zum Schluss werden Probleme der Forschung sowiemögliche politische Handlungsalternativen aufgezeigt und eineeigene Bewertunghinsichtlich der geleistetenUntersuchungabgegeben.
2Theoretische und methodische Vorgehensweise
Zielsetzung des Forschungsvorhabens ist es, die dominanten Akteure, ihre‚Advocacy-Koalitionen‘, gemeinsame‚Belief Systems‘,Strategien und Mittelinnerhalbihres sozio-politischenUmfeldes abzubilden, um deren Anteil an derlangsamenUmsetzung der geplanten HGÜ-Kabelverbindungen darzustellen.Dabei wird eine Kombinationaus den klassischen Ansätzen der Policy-Analyse, dem aus den Internationalen Beziehungen stammenden‚Multi-Level-Governance-Ansatz‘und der aus der Geschichtswissenschaft entlehnten‚Pfadabhängigkeit‘verwendet.Diese Vorgehensweise bringt in Bezug auf den zu untersuchenden Fall mehrere Vorteile mit sich: Zum einen hilft der‚Advocacy Coalition Framework‘, die Verhaltensmuster und Absichten verschiedener Akteure und die sie beeinflussenden Rahmenbedingungen zu erfassen. Die Einordnung von Handlungsmöglichkeiten und deren Einschränkungen im Mehrebenensystem der Europäischen Union kann mit Hilfe des‚Multi-Level-Governance-Ansatzes‘vollzogen werden.‚Pfadabhängigkeiten‘hingegen können als Rahmenbedingungen gesehen werden, dieAkteurenHandlungsalternativenals realisierbar erscheinen lassenund andere unterdrücken.Durch eineKombinationaus verschiedenen Ansätzenkann derForschungsgegenstand inseiner Komplexitätdaher präziser erfasst und analysiert werden.
2.1Analyserahmen
Mit einer Policy-Analyse können spezielle politische Entscheidungen als Fallstudienbetrachtet werden,sie versuchtaber immer, auch eine Systematisierung desForschungsgegenstandesinHinblick auf den größeren politischen Kontext zu erreichen (vgl.Windhoff-Héritier 1987, 8). Das Grundmodell derprozessorientiertenPolicy-Analyse stellt dabei der so genannte‚Policy-Zyklus‘dar. Er geht davon aus, dass der politische Prozess grob in dieaufeinander folgendenPhasen (1) Problemwahrnehmung und -definition, (2)Agenda-Setting, (3) Politikformulierung, (4) Politikimplementation,(5)Evaluation,(6) Politik-Terminierungodergegebenenfalls Neuformulierungaufteilbar ist(vgl.ebd., 65;Schubert 1991, 69–77).Die Idee und die Aushandlungsprozesse um die Seekabel NorGer und Nord.Link setzen inder erstenPhasedesZyklusan,weildie Problemwahrnehmung auf die Tatsache der fluktuierenden Einspeisungder derzeit dominanten erneuerbaren Energieträger Wind und PV undderdamit einhergehenden potentiellen Instabilität des Stromnetzeszielt[14].Da nach IWES(2011, 10f.)weder ein idealer Netzausbau noch ein konsequentes Lastmanagement den kompletten Lastausgleich leisten können, muss letztlich versucht werden, dieoptimaleKombinationverschiedener Maßnahmen zu finden (vgl.Manzke 2012, 21).Während des Agenda-Settings bildete sich als eine mögliche Lösung die Verbindung des deutschen mit demnorwegischenStromversorgungssystemsheraus.
DasPhasenmodellkanndieFragestellung dervorliegenden Forschungsarbeitnicht hinreichendbeantworten.