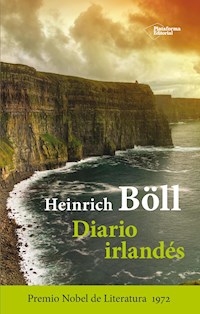9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Als Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, wurde er als einer der bedeutendsten Romanciers seiner Zeit gewürdigt. Mindestens ebenso groß ist sein Rang als Meister der kurzen Form. Dieser Band präsentiert Bölls Erzählungen aus vier Jahrzehnten! Es beginnt im Jahr 1937 mit der Erzählung »Jugend« und endet 1982 mit der Humoreske »In welcher Sprache heißt man Schneckenröder?«: Heinrich Böll hat seine literarische Laufbahn mit Kurzgeschichten eröffnet, und er ist diesem Genre Zeit seines Lebens treu geblieben. Der Erfolg der frühen Erzählungen aus den Jahren nach dem Krieg setzte sich in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren fort, in denen Böll die kurze literarische Form zur Vollendung führte. Der von Jochen Schubert herausgegebene Band bietet eine umfassende Auswahl aus dem erzählerischen Werk Heinrich Bölls und folgt dabei mehreren Gesichtspunkten: Neben den bekanntesten Erzählungen stehen solche, die aufgrund ihres Themas und ihrer Erzählweise repräsentativ sind, und andere, die bisher noch gar nicht oder nur an schwer zugänglichen Orten veröffentlicht wurden. Die insgesamt 75 Erzählungen dokumentieren auf anschauliche Weise das Schaffen Bölls in diesem Genre, bieten eine Fülle von Lesestoff und dazu unter dem Titel »Gibt es eine deutsche Story?« einen nicht mehr zugänglichen Essay Bölls aus dem Jahre 1953. Der Band wird ergänzt durch ein editorisches Nachwort des Herausgebers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Ähnliche
Heinrich Böll
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Heinrich Böll
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Heinrich Böll
Heinrich Böll, geboren am 21. Dezember 1917 in Köln, gestorben am 16. Juli 1985 in Kreuzau (Kreis Düren).
Heinrich Böllwar Sohn eines Tischlers und Holzbildhauers, in dessen Hause in Köln ab 1933 Zusammenkünfte verbotener katholischer Jugendverbände stattfanden. Nach einem gerade begonnenen Studium der Germanistik und klassischen Philosophie wurde Böll 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Er desertierte 1944 und kehrte 1945 aus der Kriegsgefangenschaft nach Köln zurück, wo er sein Studium wieder aufnahm und in der Schreinerei seines Bruders arbeitete. Ab 1947 publizierte er in Zeitschriften und wurde 1951 für die Satire Die schwarzen Schafe mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet.
Fortan war er als freier Schriftsteller tätig. Außerdem übersetzte er, gemeinsam mit seiner Frau Annemarie, englische und amerikanische Literatur (u. a. George Bernard Shaw und Jerome D. Salinger).
Als Publizist und Autor führte Heinrich Böll Klage gegen das Grauen des Krieges und seiner Folgen, polemisierte er gegen die Restauration der Nachkriegszeit und wandte er sich gegen den Klerikalismus der katholischen Kirche, aus der er 1976 austrat.
In den 60er und 70er Jahren unterstützte er die Außerparlamentarische Opposition. 1983 protestierte er gegen die atomare »Nachrüstung«. Insbesondere engagierte sich Böll für verfolgte Schriftsteller im Ostblock (Reisen in die UdSSR und CSSR). Der 1974 aus der UdSSR deportierte Alexander Solschenizyn war zunächst Bölls Gast. Ab 1976 gab er, gemeinsam mit Günter Grass und Carola Stern, die Zeitschrift L 76. Demokratie und Sozialismus heraus. Der Verband deutscher Schriftsteller wurde 1969 von ihm mitbegründet, und er war Präsident des Internationalen PEN-Clubs (1971-74).
Böll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so den Georg-Büchner-Preis (1967), den Literatur-Nobelpreis (1972) und die Carl-von-Ossietzky-Medaille (1974).
Jochen Schubert, geboren 1957 in Dortmund, studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Seit 1995 ist er Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist Mitherausgeber der Kölner Ausgabe. der Heinrich-Böll-Werkausgabe, die seit 2002 in 27 Bänden bei Kiepenheuer & Witsch erscheint.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, wurde er als einer der bedeutendsten Romanciers seiner Zeit gewürdigt. Mindestens ebenso groß ist sein Rang als Meister der kurzen Form. Dieser Band präsentiert Bölls Erzählungen aus vier Jahrzehnten!
Es beginnt im Jahr 1937 mit der Erzählung »Jugend« und endet 1982 mit der Humoreske »In welcher Sprache heißt man Schneckenröder?«: Heinrich Böll hat seine literarische Laufbahn mit Kurzgeschichten eröffnet, und er ist diesem Genre Zeit seines Lebens treu geblieben. Der Erfolg der frühen Erzählungen aus den Jahren nach dem Krieg setzte sich in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren fort, in denen Böll die kurze literarische Form zur Vollendung führte.
Der von Jochen Schubert herausgegebene Band bietet eine umfassende Auswahl aus dem erzählerischen Werk Heinrich Bölls und folgt dabei mehreren Gesichtspunkten: Neben den bekanntesten Erzählungen stehen solche, die aufgrund ihres Themas und ihrer Erzählweise repräsentativ sind, und andere, die bisher noch gar nicht oder nur an schwer zugänglichen Orten veröffentlicht wurden.
Die insgesamt 75 Erzählungen dokumentieren auf anschauliche Weise das Schaffen Bölls in diesem Genre, bieten eine Fülle von Lesestoff und dazu unter dem Titel »Gibt es eine deutsche Story?« einen nicht mehr zugänglichen Essay Bölls aus dem Jahre 1953. Der Band wird ergänzt durch ein editorisches Nachwort des Herausgebers.
Inhaltsverzeichnis
Jugend
Die Schwester
1. Gericht
Der Dieb
Aus der »Vorzeit«
Im Käfig
In guter Hut …
Todesursache: Hakennase
Die Botschaft
Der Angriff
Die Ratte
Kumpel mit dem langen Haar
Mit diesen Händen
Denkmal für den unbekannten Soldaten, der tot vor einem Bahnhof lag
Lohengrins Tod
Der Mann mit den Messern
Wir Besenbinder
Wiedersehen in der Allee
An der Grenze
Seltsame Reise
Der Unsichtbare
So ein Rummel!
Einsamkeit im Herbst
Abschied
Der unbekannte Soldat
Mein teures Bein
Auch Kinder sind Zivilisten
Die Toten parieren nicht mehr
An der Brücke
Damals in Odessa
Mein trauriges Gesicht
Geschäft ist Geschäft
Über die Brücke
Die Essenholer
Steh auf, steh doch auf
Wanderer, kommst du nach Spa…
Beziehungen
Das Abenteuer
Die schwarzen Schafe
Der Geschmack des Brotes
Besichtigung
Die Suche nach dem Leser
Die Postkarte
Nicht nur zur Weihnachtszeit
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
Ich bin kein Kommunist
Abenteuer eines Brotbeutels
Bekenntnis eines Hundefängers
Der Tod der Elsa Baskoleit
Die Waage der Baleks
Unberechenbare Gäste
Hier ist Tibten
So ward Abend und Morgen
Schicksal einer henkellosen Tasse
Der Lacher
Daniel, der Gerechte
Doktor Murkes gesammeltes Schweigen
Es wird etwas geschehen
Wie in schlechten Romanen
Hauptstädtisches Journal
Der Wegwerfer
Monolog eines Kellners
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Die Kirche im Dorf
Epilog zu Stifters »Nachsommer«
»Höflichkeit bei verschiedenen unvermeidlichen Gesetzesübertretungen«
Du fährst zu oft nach Heidelberg
Geständnis eines Flugzeugentführers
Rendezvous mit Margret oder: Happy-End
Nostalgie oder Fettflecken
In welcher Sprache heißt man Schneckenröder?
Gibt es die Deutsche Story?
Heinrich Böll: Poetik des »Augen-Blicks«
Jugend
1937
In der dunklen Webergasse der alten Stadt Köln, im Hofe des alten baufälligen Hauses, betrieb der alte Meister Bolanders sein Handwerk als Schreiner. Mit zwei alten Gesellen, die nicht lange nach Lohn frugen, wenn der Meister samstags mit einem hoffnungslosen Gesicht von seinen Gängen zurückkam, hatte er genügend Arbeit, und es hätte es wohl auch allen dreien zum Leben dienen können, wenn nicht ein geheimes Untier allen Verdienst aufgefressen hätte, und dieses Ungeheuer, das unsichtbar, aber unersättlich und unerbittlich an der Schwelle des alten Hauses lag, hieß Unkosten. Die Inflation hatte das kleine Barvermögen des Meisters, das nur dazu dagewesen war, im Falle der Not für Wochen und Monate als Lohn für die Gesellen zu dienen, aufgeschluckt, und die folgenden Jahre, da die Nachwehen des schrecklichsten aller Kriege wie graue Ungeheuer aus dem Boden aufwuchsen, da hatte der Meister in sonderbarer kindlicher Weise sein heiteres und üppiges Leben weitergeführt, hatte Arbeit auch um billige Preise angenommen, um nur die Gesellen nicht entlassen zu müssen, und es hatten sich, ohne daß der ahnungslose Meister etwas wußte, Schulden angehäuft, die unmerklich ins Schreckliche wuchsen. Und eines Tages hatte es Zahlungsbefehle und Pfändungen geregnet; was der Meister noch an Wertgegenständen besaß, wurde gepfändet und verkauft, die Außenstände wurden mit Beschlag belegt, und sein kleines freundliches Wohnhaus vor der Stadt geriet unter den Hammer. Wenn auch dadurch die größten Schulden bezahlt wurden, so blieben doch noch eine Menge kleinerer Beträge zwischen hundert und tausend Mark, deren Gläubiger sich auf den letzten Rest von Habseligkeiten warfen, das kleine Haus mit der Werkstatt in der Webergasse, die wenigen Möbel, die gerettet worden waren; und um den Verkauf dieser Dinge zu verhüten, mußte man wöchentlich den Gerichtsvollziehern oder den Gläubigern kleine Beträge in den Rachen schmeißen; und das war mit Schreibgebühren und Unkosten sonderbar selbstverständlicher Art verbunden, die den ganzen kleinen Verdienst auffraßen, wie wenn er nichts wäre. So kam das kleine Häuschen auch noch in Zwangsverwaltung, dadurch wurden automatisch die Zinsen erhöht, und der Meister mußte für seine eigene Wohnung und Werkstatt Miete bezahlen; und wenn die Krämer und Bäcker, die man notgedrungen anpumpen mußte, ihre Beträge einklagten wie die anderen, die Holzhändler und Eisenhändler, dann wuchs die Summe erst einmal von selbst um viele Mark, und im Verlaufe des langsamen Abtragens entstanden Unkosten, die das Geld schluckten, als wenn es Zunder wäre. Der Meister sah dieses schreckliche Spiel, daß sein mühsam verdientes Geld in den Dreck fiel, daß es nicht einmal dazu diente, seine Schulden zu vermindern, und da kam ihm ein Gedanke, den er erst lange verwarf, aber dann eines Tages in Wirklichkeit umsetzte. Er ging zu allen seinen Gläubigern und erklärte ihnen, daß er Bankerott machen müßte, wenn sie sich nicht verpflichteten, ihn einige Jahre mit Pfändungen und andren Dingen, die ihm Unkosten verursachten, zu verschonen, damit er erst einmal ein wenig zu Atem käme; er wolle die Schulden später bezahlen. Und da die Gläubiger zwar zum großen Teil damit einverstanden waren, die Gerichtsvollzieher und Winkeladvokaten aber davon abrieten, da sie sich fürchteten, solch ein fettes Schaf aus der Hürde zu lassen, so erklärte der Meister Bolanders eines Tages, nachdem er Haus und Möbel seiner Frau überschrieben und eine ziemlich große Barsumme, die er heimlich beiseite geschafft hatte, seinen beiden Gesellen für rückständigen Lohn ausgehändigt hatte, seinen Bankerott. Er verlor dadurch seinen letzten Kredit und mußte jeden Nagel und jedes Stück Holz, das er brauchte, vorher bar bezahlen, aber er sah doch, daß er wieder Löhne zahlen und leben konnte, wenn auch sehr wenig verdient war, so daß er sich sehr einschränken mußte. Aber war es auch noch so kümmerlich und mußte man oft in die Pfandhäuser und zu habgierigen Pfandleihern laufen, die Blutzinsen nahmen, man hatte doch wieder ein wenig Freude an der Arbeit. In dieser Luft von Armut und Aufregung wuchs der jüngste Sohn des Meisters unter den Augen der gütigen Frau Mutter auf. Die Erinnerung an das freundliche Haus vor der Stadt war schnell weggewischt, aber sonderbarerweise liebte er dieses graue dunkle Haus in der alten Gasse mehr als das neumodische feine Ding mit dem Garten voll Blumen und der grünen Wiese. Schon als er noch kaum gehen konnte, lungerte er tagelang in der Werkstatt umher und freute sich an den fliegenden Spänen, die man zu langen Locken ziehen konnte, und nahm den sonderbaren Duft des Leims in sich auf, und schon früh gesellte er sich zu den Jungen der Gasse, mit denen er die wildesten Spiele und Streiche verübte.
Vom Krieg wußte er fast kaum etwas; die Mutter erzählte ihm oft, wie sehr sie gehungert hätten und wie er die schlechten trockenen Zwiebacke, die sie in Wasser habe aufweichen müssen, in großen Mengen ruhig verzehrt habe. Er wußte nichts mehr davon, denn er war erst spät im Jahre 17, das das schrecklichste Hungerjahr war, wie die Mutter sagte, geboren, er wußte nichts von der Angst um die beiden Brüder, die siebzehn- und achtzehnjährig im Feuer gewesen waren, und um die Schwestern, die in den Lazaretten an der Westfront ihre schwachen Kräfte in den Dienst der Kranken gestellt hatten. Er sah die Brüder lange Jahre nicht, bis in das Jahr 1923, wo sie müde und in sonderbarer Stumpfheit aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Wie zwei fremde, feindliche Männer hatte er sie eines Tages in der Küche hockend gefunden, bleich und schmal, mit glimmenden Augen, und dann waren sie schnell verschwunden, und er hörte von der Mutter, daß sie heimlich nachts über den Rhein gegangen seien, da die Besatzung hinter ihnen hergewesen sei. Von den Schwestern kam wohl manchmal ein Brief, aus dem fernen Osten, wo Magdalena, die jüngere, an einen Siedler verheiratet war, und aus dem Süden von Theresia, die mit ihrem Gatten, dem Maler Johannes, Hunger litt. Von diesen beiden Frauen wußte Paul fast noch weniger, und er konnte sich nur schwer daran gewöhnen, von ihnen als seinen Schwestern zu denken. Sie hatten beide kurz nach der Revolution, als er noch kaum ein Jahr alt war, geheiratet und hatten bisher, da das Reisegeld für beide unerschwinglich war, nicht mehr ihr Elternhaus besucht, obwohl ihnen als Rheinländerinnen in der Fremde fast das Herz brach.
Wie ein einziges Kind wuchs Paul auf, und irgendwo in seinem Inneren hockte eine leise Hoffnung, daß er alle seine ihm so fremden Geschwister eines Tages wiedersehen werde. Eben als er in die Schule kam, fing zu Hause das hoffnungslose Elend an. Er nahm teil an allen Freuden und Leiden eines Gassenjungen und lernte jeden Winkel der alten Stadt kennen bei den zahlreichen Streifzügen; in seinem Wesen machte sich immer mehr eine sonderbare Traurigkeit bemerkbar, die ihn oft wie einen Zerstreuten erscheinen ließ; so machte er alle tollen Streiche mit, gleichsam wie im Unterbewußtsein, ohne eine gewisse Unnahbarkeit auf seinen Zügen zu verlieren. In der Schule gehörte er zu den allerfaulsten und zu den allerklügsten, die den Lehrern so viel Qual verursachen wie tausend andere Schüler; sie hätten ihn gern sitzenlassen, jedes Jahr, aber bei entscheidenden Prüfungen und Visitationen zeigte er sich von einer so glänzenden Seite, daß sie ihn wohl oder übel mitnehmen mußten in die nächste Klasse.
Als er nach dem vierten Schuljahr mit dem Zeugnis nach Hause kam, das als besonderen Vermerk das schreckliche Todesurteil trug: Ihm mangelt auch der geringste Ehrgeiz, der das Tier vom Menschen unterscheidet, eröffnete ihm sein Vater, daß er ihn auf dem Gymnasium angemeldet habe; er habe ein Stipendium, das sogar die Bücher umfasse, und er wolle das ausnützen, beharrte der Vater hartnäckig, als der Junge unter Weinen und Fluchen sich sträubte wie ein Tier, das eingekerkert werden soll. Er wollte seine Kameraden aus der Gasse nicht vermissen, und wenn man ihm das Doktordiplom auf den Tisch gelegt hätte; er biß sich mehrere Tage mit dem Vater herum und zeigte sogar gegen die Mutter, der er nie zuwider gewesen war, eine gewisse Mißstimmung, da sie nicht auf seiner Seite schien. Er wurde besiegt, und er schleppte sich, hoffnungsloser als je irgendein Sextaner, zu Beginn des neuen Schuljahres mit seinen Büchern in den nüchternen alten Kasten, der aus der klassizistischen preußischen Zeit stammte.
Mit seinen neuen Kameraden sprach er kein Wort, nicht einmal das Notwendigste; er raste gleich, wenn die Glocke den Schluß ankündigte, aus der Schule heraus in einem durch, ohne anzuhalten, bis nach Hause, wo er schnell und hastig das Essen hinunterschlang, um in die Gasse zu kommen. Später, als er merkte, wie die Mutter unter dem Zorn des Vaters litt, setzte er sich nach dem Essen eine halbe Stunde hin, um in rasendem Tempo seine Schularbeiten zu improvisieren, die er dann dem Vater in der Werkstatt unter die Nase hielt. Die Lehrer machten ihm wohl oft Vorwürfe seines befremdlichen Verhaltens seinen Mitschülern gegenüber wegen, aber er hatte eine so schneidende Art, sie zu fragen, ob es zu den Pflichten eines Gymnasiasten gehöre, Freundschaft mit Leuten zu halten, die er verabscheue, daß sie ihn bald als einen hoffnungslosen Fall aufgaben und sich fleißig bemühten, ihn zu Fall zu bringen, was er aber durch dieselbe Taktik, die er auf der Vorschule sich angeeignet, verhinderte, nur seiner Mutter wegen, sonst wäre er froh gewesen, von der Schule zu fliegen. Seinen Mitschülern war er so fremd, daß er manche von ihnen nicht wiedererkannte, wenn er ihnen manchmal in der Stadt begegnete.
Eines Tages jedoch kam er auf eine sonderbare Weise einem seiner neuen Kameraden näher; bei Gelegenheit einer Schlacht, die zwischen den Jungen der Webergasse und denen der benachbarten Gerbergasse ausgetragen wurde und bei der Paul mit der ihm eigenen fast teilnahmslosen wilden Düsternis focht, gewahrte er in der Reihe seiner Gegner den Melchior von Frankmann, einen Mitschüler aus der Sexta, der ebenso wie er in stolzer Angeschlossenheit unter den schwatzhaften Bürgersöhnen des Gymnasiums pflichtgemäß bis zwölf Uhr mittags seine Zeit absaß. Nach dem Getümmel der Schlacht, als der Waffenstillstand verkündet wurde, näherten sich die beiden Jungen und gaben sich treuherzig die Hand, ohne zu verhehlen, daß sie sich freuten, einander bekannt zu werden. In den folgenden Tagen wurden sie zu Freunden; Melchior wohnte mit seiner Mutter, einer verwitweten Adeligen, deren Mann als Student im Krieg gefallen war und die eine kleine Rente bezog und freies Studium ihres Sohnes zugesichert hatte, auf zwei kleinen Stübchen der Gerbergasse, die in der Stadt wegen einiger Bordelle verrufen war.
Die beiden setzten sich zusammen zu ihren Schularbeiten hin, die sie beide, wie sie oft gegeneinander betonten, nur machten, um ihren Eltern keine Sorgen zu bereiten. In der Folge fanden sie aber – und sie machten wiederum daraus keinen Hehl – Gefallen an den fremden Sprachen, und sie trieben darum fleißig, zu eigenem Vergnügen, das Erlernen derselben, so daß sie wunderbar darin vorankamen, ohne freilich in der Schule irgendeinen Nutzen daraus zu finden, außer wenn es irgendein fremdes, gänzlich neues Stück zu übersetzen galt, und sie waren in gleicher Weise imstande, Advokaten- oder Historikerlatein und -griechisch zu übersetzen wie die Sprache der Dichter. An den Naturwissenschaften fanden sie wenig Gefallen, und sie kümmerten sich, da ja auch die von Pflanzen und Tieren leere Stadt keinerlei Anregung gab, recht wenig darum; nur wenn es hieß, ein bevorstehendes Sitzenbleiben zu verhüten, machten sie sich einige Tage über die Bücher.
Die beiden schäbig gekleideten Freunde schlossen sich, als ihre Kameraden von der Gasse die Lehrlings- und Arbeiterkleider anzogen und nur noch an wenigen Abenden Zeit fanden, die alte Freundschaft zu befestigen, noch fester zusammen. Melchior ging in dem Schreinerhaus ein und aus und half sehr oft, wenn es an Geld mangelte, einen notwendigen Hilfsarbeiter zu entlöhnen, zusammen mit Paul den beiden alten Gesellen, die erst mit stummem Mißtrauen und später mit stummem Wohlwollen die Arbeit dieser schwachen Schreiber betrachteten. Paul fand sich natürlich oft in der bescheidenen Behausung seines Freundes und ließ sich von der musikkundigen gütigen Mutter Melchiors in die Kunst des Geigespielens einführen, da diese die Begabung, die sie bei ihrem Sohne vermißte, zu ihrer Freude bei dessen Freund vorfand. Melchior dagegen, dem es an einer Beschäftigung für die langen Nachmittage mangelte, trat eines Abends, nachdem er lange mit seinem Freund sich besprochen und beiden Müttern, in die kleine Stube des Meisters Bolanders, die zugleich Wohnzimmer und Kontor war. Er grüßte ein wenig schüchtern, und als dann der harte Blick des Meisters, der ihm unbequeme Schreibarbeiten erledigte, sich auf ihn richtete, wollte ihm erst der Mut sinken, aber er zwang sich und sprach schnell: »Ich möchte Lehrling bei Ihnen werden, nachmittags!« Der Meister nahm seine Brille ab und lächelte. »Hast du Freude daran?« fragte er.– »Ja!« Der Meister spielte mit seiner Brille und sagte: »Du weißt, daß ich nicht Alleinherrscher bin; ich muß meine beiden Gesellen fragen, komm«, und ging ohne weiteres zur Tür. Melchior, der eine ehrfürchtige Angst vor den beiden alten tüchtigen Männern hatte, die still und einfach die schönsten Dinge unter ihren Händen entstehen ließen, sank auf dem kurzen Weg zur Werkstatt wieder aller Mut, und als sie endlich vor den beiden grauen Alten standen, wagte er nicht mehr, die Augen zu heben. Er hörte, wie der Meister ohne lange Überleitung gleich fragte: »Er will Lehrling bei uns werden, nachmittags, hat er Geschick, ihr kennt ihn doch?« Bei Melchior siegte nun doch die Neugier, und er hob die Augen. Die beiden Alten blickten ihn ohne Strenge an, und der eine sagte: »Gute Idee von dem Jungen«, und der eine nickte nur und murmelte kaum hörbar: »Kann er machen.«
Melchior mußte einen regelrechten Lehrvertrag unterzeichnen und von seiner Mutter genehmigen lassen, daß er fünf Jahre alle Nachmittage vier Stunden zu arbeiten habe, mit angemessener Entlöhnung, und daß er nach Ablauf dieser Frist in der Werkstatt des Schreinermeisters Markus Bolanders sein Gesellenstück anzufertigen habe.
Paul erlitt bei seinem Geigenspiel alle Qualen des Anfängers, der sich verzweifelt auf die schönsten Melodien stürzt, ohne die notwendige Technik zu beherrschen, und wäre bei der sehr gütigen Leitung der guten Frau von Frankmann wohl gescheitert, wenn er nicht selbst ein halbes Jahr jeden Nachmittag immer wieder die Griffe geübt hätte, mit verbissenem Gesicht, und sich die stümperischen Spielereien versagt hätte. Nach dieser Zeit hatte er dann auch so viel gespart, daß der Vater die Summe nach oben ergänzen konnte, damit die Geige, die bisher nur entliehen war, endgültig in Pauls Besitz überging. Melchior, der weniger heftig, mehr ausdauernd war, machte unterdes, nachdem die anfängliche Fremdheit mit dem Material und der Umgebung überwunden, so gute Fortschritte, daß selbst die alten Graubärte, die als alte Meister schon viel Geschicklichkeit gesehen, manchmal bewundernd mit dem Kopf nickten.
Waren die beiden in allen Dingen von unübertrefflicher Leidenschaft, so der eine dem Geigenspiel, der andere dem Handwerk, und beide ihrer Verachtung ihrer schleimredenden, säuberlichen Mitschüler ergeben, so waren sie von entschiedener Gleichgültigkeit, die aus einem Schwanken zwischen Verachtung und Hingabe entstanden war, dem Christentum gegenüber. Sie gingen sonntäglich früh zur Kirche, hatten ihre Erstkommunion in der üblichen Weise hinter sich gebracht und sprachen mit ihren Eltern wenig darüber, so daß diese glaubten, in diesem Punkt sei die Angelegenheit ihrer Söhne in Ordnung. Jedenfalls war ihre Haltung sehr entschieden, und sie drohte, unter dem Einfluß des Religionslehrers aus dem Gymnasium, immer mehr in Verachtung umzuschlagen. Während die naturwissenschaftlichen Lehrer die beiden mit einer kalten Verachtung behandelten und die Sprachlehrer teils mit gütiger Nachsicht und mit lächelnder Güte, so war zwischen ihnen und dem Religionslehrer eine Luft des schlimmsten Hasses. Es kam wohl daher, daß der alte Priester, der beim Generalvikariat entschieden in Ansehen stand, mehr eine seicht bürgerliche Soziologie verzapfte als Christentum und daß er auch den älteren Jungen nie mehr von der Bibel zu lesen gab als einen schleimig übersetzten, mit entsetzlichen Bildern versehenen Auszug aus der Heiligen Schrift, es kam wohl daher, daß eine unerträgliche Atmosphäre zwischen ihm und diesen beiden Proleten herrschte. Die beiden gingen nun in ihrer Verachtung nicht soweit, den Religionslehrer mit dem Christentum schlechthin zu identifizieren, aber er war ihnen ein, wenn auch etwas krummer, Spiegel dieser Religion, der ihre Vaterstadt nun schon fast zweitausend Jahre anhing. Mit anderen Priestern waren sie nie in Berührung gekommen, bis eines Tages, in den Osterferien von Untertertia nach Obertertia, am Palmsonntag nach der frühen Messe, ein junger Kaplan auf sie zukam und sie einlud, ihm für eine kurze Stunde auf seine Wohnung zu folgen. Sie verständigten sich mit einem kurzen Blick und folgten dann dem Kaplan, der schon voranging. Er führte sie in ein kleines bescheiden eingerichtetes Kabinett, worin nur ein schlichter Schreibtisch und einige Bücherregale standen, und forderte sie kurz auf, sich zu setzen. Der Kaplan, dessen bäuerliches Gesicht etwas bleich war, faltete unruhig die Hände und sah die beiden prüfend an. »Ich will euch nicht verhehlen«, sagte er schnell, »daß ich durch einige eurer Mitschüler, die bei uns im Verein sind, auf euch aufmerksam geworden bin. Ich wollte euch nur fragen, warum ihr euch so ganz von unserer Pfarrgemeinschaft fernhaltet.«
Melchior sagte kurz: »Aus dem einfachen Grunde, weil wir arm sind und arm bleiben und deshalb nicht in diesen abscheulichen Verein passen und gehören.«
»Es sind sehr viele Arme in unserem… und wenn ihr nun selbst einmal reich…«
»Wir werden nie reich; wenn man einmal arm gewesen ist und einmal gesehen hat, wieviel Elend es gibt, dann kann man nur reich werden, wenn man ein Verbrecher ist… das haben wir vorläufig noch nicht vor… und zudem kennen wir dieses kriecherische Streberpack, das zwar arm ist, aber nach Reichtum lechzt, das in Ihrer Pfarrgemeinschaft ist.« Paul hieb die Sätze wie eine Anklage hin.
Der Kaplan erbleichte. »Das ist entsetzlich… habt ihr die Bibel gelesen?«
Die beiden lachten: »Verlag ›Ars sacra‹…«
Der Kaplan erhob sich, zitternd am ganzen Leib, bleich wie der Tod. Er kramte hastig aus seiner Schublade zwei schmale braune Bändchen heraus und trat auf die beiden zu und gab jedem eins in die Hand. »Ihr werdet das Neue Testament lesen… um Gottes willen… es ist das Wort Gottes… Christi… und ihr werdet mir versprechen, mich danach noch einmal zu besuchen?« Die beiden Jungen, in Verlegenheit und Betroffenheit, nickten stumm und verließen das Zimmer.
Irgend etwas zwang die beiden, gleich nach dem schmalen Frühstück dieses kleine Buch aufzuschlagen. Paul saß in dem kleinen Stübchen und Melchior in der Küche neben seiner Mutter, die Kartoffeln schälte. Unmittelbar sprach das Wort zu ihnen, und es packte sie mit Gewalt und schmetterte sie in die Abgründe der Reue und der Hoffnung. Sie saßen beide, räumlich voneinander getrennt, und nahmen die ungeheure Glut des Wortes auf und die schreckliche Milde. Es erging der Ruf an sie, und sie folgten ihm…
Paul zündete sich eine Zigarette an und blickte lächelnd auf seinen Freund, der vor einer dampfenden Tasse Kaffee saß, noch bekleidet mit der blauen, leinenen Schreinerschürze, an der die Späne hingen. Mit den langen schmalen Fingern griff er in die Seitentasche seines grauen Rockes und zog einige Blätter sehr zerknitterten Papiers hervor, die er langsam entfaltete; sein langes schmales Gesicht rötete sich ein wenig, und er sah den geduldig wartenden Freund noch einmal lange an, indem er den Blick dieser ruhigen grauen Augen in dem gesunden jungen Gesicht sorgfältig prüfte. »Ich habe heute nacht eine kleine Geschichte geschrieben, ich will sie dir vorlesen.« Seine dunkle Stimme hob sich gegen Ende wie zu einer Frage, und da kein Widerspruch erfolgte, begann er zu lesen.
»Caius Decimus Moguntiacus, seines Zeichens Besitzer einer florierenden Fabrik für Gipsbüsten lebender und gestorbener Caesaren und Götzen aller Nationen, rheinischer Abstammung und römischer Bürger, betrat eines Morgens um die Iden des Juli des Jahres 134 nach Christus, auf dem Gesicht die Zeichen wachsenden Mißmutes, sein Büro in der guten Stadt Köln, wo er in der Vorstadt eine nette neumodische Villa besaß. Die Büromädchen, die Laufjungen und die Zeichner zitterten bereits vor dem schrecklichen Zorn des Chefs, der wie alle Chefs im Privatleben ganz nett sein sollte, aber das Gesicht des mit einem Bauch und einer Glatze versehenen fünfzigjährigen Caius erhellte sich gleich, als er in den Liegestühlen des Empfangssalons seinen alten Geschäftsfreund Pompeius gewahrte, der in Rom eine Niederlassung der Firma leitete und alljährlich einmal an den schönen Rhein kam.
›Edler Pompeius, wie geht’s, wie steht’s?‹ Mit diesen holdseligen Worten begrüßte Caius seinen ebenfalls dickwanstigen Freund und führte ihn in sein Privatkontor. Pompeius räkelte sich nach der Art eines gewiegten Faulenzers auf die rote Ottomane und nahm erst einen Schluck schweren Cypernweines, ehe er überhaupt sein Karpfenmaul öffnete. Dann sagte er mit einer dünnen Stimme, die den Dickwanst als einen Kastraten erscheinen ließ: ›So du mein leibliches Wohl meinest, geht’s mir gut… so du aber meine Geschäftsaussichten, unsere vielmehr… oh böse böse Zukunft…‹, und er verzog seine Fratze zu einer Grimasse schlechter Laune. Caius lachte laut auf, daß sein Bauch wackelte, und rieb sich vor Vergnügen seine schlaffen Wangen. ›Immer Pessimist… guter Pompeius… immer Pessimist… gut haben wir verkauft in diesem Jahr… keine Restbestände in den Lagern… sogar die paar Büsten des scheußlichen Nero hast du noch an einige ältere Jungfern, die nicht mehr recht sehen konnten, verkauft und die alten verstaubten Reliefs des Trajan, hahaha, und dennoch – Pessimist… Pessimist…‹ Pompeius fuhr, etwas pikiert, über sein riesiges schlappes Maul und sagte in milder Strenge: ›Ich sprach von der Zukunft, o Caius, nicht von der Vergangenheit, vom abgeschlossenen Geschäftsjahr… du weißt, daß diese verfluchte Sekte der Christus-Leute sich immer mehr ausbreitet, zumal bei den Proleten, die nun einmal für jede sozial gefärbte Lehre zu haben sind (in politisch eingeweihten römischen Kreisen spricht man von einer neuen Spartakusbewegung)… nun, und du weißt auch, daß die unteren Schichten unsere Hauptabnehmer sind für den mistigen Tand deiner Fabrik… und ich sage dir, es macht sich schon bemerkbar, daß der Sinn der Leute sich geändert hat. Schon im verflossenen Geschäftsjahr‹ (seine Stimme überschlug sich, man hörte draußen die Büromädchen lachen) ›konnte ich nur mit Mühe in Rom die Hälfte der bisher verkauften Büsten und Reliefs absetzen, die anderen habe ich den Händlern, die nach Smyrna und Alexandrien zogen, verkauft, weit unter Preis.‹ Er kreuzte die Arme über der Brust und lauerte mit der Genugtuung eines vollkommen gesättigten Schweines auf seinen Geschäftsfreund, der in ernstes Nachdenken versunken war, wobei der Schweiß in Strömen über das bleiche Gebirge seines fetten Gesichts rann. Einige Minuten vergingen in Ruhe, dann klatschte sich der fette Caius auf die Stirn, daß sein Fleisch bis an die Schenkel erzitterte. ›Heureka!‹ brüllte er, ›heureka, wie simpel, wie einfach… heureka!‹, und er lachte eine Minute still den erstaunten Pompeius an, wobei seine Augen verschwanden, so daß der dicke römische Wanst sich in einen Mehlsack verwandelte, der in Bewegung geraten ist. Als er ausgelacht hatte, wischte er ruhig den Schweiß ab und sagte nüchtern: ›Furchtbar simple Sache das… wir machen einfach Gipszeug, das diesen Christen in den Kram paßt. Bilder von diesem Christus, der alle Menschen befreit hat, hahaha…‹ Pompeius vergaß vor Staunen die ganze Würde eines römischen Bürgers, er schlug sich auf die Knie und brüllte: ›Du bist ein Genie… du bist ein Genie!‹ Aber Caius’ Laune hatte sich wieder verschlechtert, er murmelte mißmutig: ›Eine Schwierigkeit ist da allerdings… alle unsere Büsten sind nach dem Original gezeichnet oder nach Originalbüsten modelliert; die Originale werden sorgfältig in unserem Archiv bewahrt; gibt’s ein Bild von diesem Christus?‹ – ›Nein! … er war ein Jude, der gekreuzigt wurde… so an die dreißig Jahre alt.‹ Caius überlegte wiederum wenige Minuten, dann sprach er lächelnd: ›Wir machen Miniaturkreuze mit Miniatur-Gipsfiguren eines gekreuzigten Juden. Die Kreuze werden aus Holz gemacht, und einen Juden von dreißig Jahren haben wir auch, meinen Sklaven Cantus, einen semitischen Syrer… wir werden ihn ans Kreuz heften und von unseren Zeichnern ein streng realistisches Bild von einem dreißigjährigen gekreuzigten Juden anfertigen lassen.‹ Ohne lange die Antwort des Pompeius abzuwarten, zog er an einer Schelle, und als ein junges Mädchen ehrfürchtig in der Tür erschien, sagte er kurz: ›Lasse nach meiner Privatwohnung schicken, der Sklave Cantus soll sofort hierherkommen.‹
Eine halbe Stunde später zimmerten drei riesige Sklaven des Caius, die sonst in der Fabrik den Gips anmengten, auf dem Hofe der Fabrik ein großes Kreuz aus roh behauenen Balken. Caius, Pompeius, einige Zeichner und der Sklave Cantus standen dabei. Cantus, der erst vor wenigen Monaten aus Afrika hierhergekommen war, war Christ. Er war ein einfacher und gebildeter Arbeiter, der den Garten des Caius in Ordnung hielt, ein stiller Mann, der nichts verstand und nichts besaß als Glaube, Hoffnung und Liebe. Er hatte mehrmals schon in seiner sanften Weise Einspruch erhoben gegen diesen schrecklichen Spott, den man hier treiben wollte, aber Caius hatte ihn mit seinen fetten Händen ins Gesicht geschlagen, daß Blut aus seinem Munde floß, und Pompeius hatte ihn mit seinem Gürtel über den Rücken geschlagen, so daß sein dünnes Gewand von Blut klebte. Als sie das Kreuz gezimmert hatten und ihn ergreifen wollten, da trat er nochmals vor seinen Herrn hin und sagte leise: ›Ich bin ein Christ… tut es nicht.‹ Alle lachten laut auf: ›Oho, ein Christ!‹ Und Caius gab den Sklaven einen Wink, daß sie ihn lassen sollten, und er kniff das eine Auge gegen die Umstehenden zu, so daß Cantus es nicht sehen konnte, und sagte milde: ›Gut… vielleicht laß ich dich leben, aber erzähle uns doch mal, wie sie euren Christus gekreuzigt haben.‹ Cantus stand still und beugte den Kopf, und sein Schweigen griff sogar diesen feisten Hunden ans Herz, und der Caius, um seine Gewissensbisse auszulöschen, brüllte mit einer schrecklichen Stimme: ›Rede, jüdischer Hund!‹ Das Brüllen löste den Schrecken der Umstehenden, und sie brachen in ein lautes Lachen aus, als sie den jämmerlichen, blutverschmierten Juden besahen. Cantus sprach leise, ohne den Kopf zu heben: ›Sie nagelten ihn ans Kreuz… und sie zerschlugen den beiden Mitgekreuzigten die Knochen, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon tot war, öffneten sie nur mit einem Speer seine Seite, und es floß Blut und Wasser heraus.‹ Caius gab den Sklaven einen Wink, wie ihn nur Herren zu geben verstehen, und sie packten ihn lachend und schlugen ihn ans Kreuz. Der Jude Cantus gab keinen Laut von sich. Es herrschte Schweigen in der Runde, man hörte nur das schwache Geräusch der Stifte, die über das Papier der Zeichner fuhren. Und plötzlich packte der Pompeius einen Hammer und schlug dem gekreuzigten Juden die Seite ein, daß Blut und Knochenteile hervorspritzten, und er schrie: ›Wir sind Realisten!‹ Der Jude Cantus aber schrie schrecklich und gab seinen Geist auf.«
Paul zerriß das Papier in tausend Stücke und stützte seinen Kopf in die Hände. Melchior schien wie ein Schlafender, er hatte sich zurückgelehnt, die Augen geschlossen. Es war Totenstille in dem dunklen Zimmer, und plötzlich schlugen beide die Hände vors Gesicht und brachen in Weinen aus.
Je älter sie wurden, je mehr ihnen die großen Realitäten des Lebens aufgingen, um so schrecklicher wurde ihnen die Schule; jahrelang mit dem schlimmsten abgestandenen Schleim der Führer des Geistes genährt zu werden, das ist selbst für Jungen aus der Webergasse eine große Probe der Geduld, jahrelang wehrlos den lauen schmutzigen Zaster des Religionslehrers zu verdauen, das ist selbst für junge Christen eine Prüfung über die Kraft. »Es ist«, sagte der Lehrer der christlichen Religion römisch-katholischer Prägung, »es ist gerade heute, in einer Zeit, die nach Sozialismus riecht, nach Kommunismus, notwendig, die materielle Seite der Stellung des Priesters in der Welt einmal klarzustellen. Abgesehen davon, daß ein Priester einem Laien schier unvorstellbare Summen notwendig hat, die unzähligen Bettler zu befriedigen, die zunehmen wie eine Plage, abgesehen davon gebührt einem Priester ein monatliches Einkommen, wie es der weltliche Akademiker mit gleicher Ausbildungsdauer bezieht, auf daß er standesgemäß lebe.«
»Es hat indessen«, sagte der Biologielehrer, »diese fabelhafte Entwicklung der Hygiene einen Nachteil, nämlich den, daß durch ihre nützliche Anwendung manche Individuen, die an sich nicht lebens- und erwerbsfähig wären und durch die natürliche Auslese ausgemerzt würden, daß solcherlei Individuen, die den Taschen der begüterten Mitbürger zur Last fallen, dennoch am Leben erhalten werden; es ist notwendig, daß wir uns dies merken, in einer Zeit, die wieder einer humanen Verweichlichung zugänglich ist.«
Wenn die beiden Jungen dennoch aushielten in dem Kasten, so geschah es der Sprachen wegen, in einer Weise gelehrt, die ihnen das Wort nicht überdrüssig und verhaßt, sondern liebenswert machte. Aber es war ihnen doch die Schule eine Last, die wie ein unaustilgbarer dumpfer schwerer Klotz in der Brust lag; und die Zukunft, die Unbekannte, war ihnen beiden, die sie nicht dazu neigten, den Horizont als einen rosigen Streifen zu sehen, eine dunkle grau-schwarze Wolke, in die man hineintauchen würde, notwendig und vor Schrecken zitternd. Die Erkenntnis, daß die Stadt eine Insel der Armut war, darin wie blutige Flecken am Gewand Kains die scheußlichen Paläste der Reichen lagen und die scheußlich bettelnden, Reklame machenden Schaukästen reicher Händler, eine Insel der Armut, umgeben von dem vor Elend brüllenden Ring der Vorstädte mit ihren Mietskasernen und Kinos, die in einem Nebel der Verzweiflung untertauchten, die Erkenntnis dieser Realität war unauslöschlich in ihnen verschlossen, und sie brannte sich ein für immer, an Spaziergängen durch die dunklen Gassen und an Abenden in kleinen ärmlichen oder fürchterlich grell aufgeputzten Cafés. Hatten sie in früheren Tagen zu langen Reden Neigung gehabt, so wurden sie nun immer schweigsamer, und die Siebzehnjährigen waren wahre Meister des Schweigens. Untragbar wäre diese Erkenntnis gewesen, hätte nicht die Gewißheit der Erlösung daneben geruht, die einen Glanz auf alle Armut und alles Elend warf; einen Glanz auf alle, die der wunderbare Strahl der Seligpreisungen traf.
An einem dunklen Dezembertag, eine Woche vor Weihnachten, trafen sie sich eines Abends in einem kleinen erbärmlichen Café der Altstadt, wo sich nur Huren, die eine Ruhepause einlegten zwischen den schrecklichen Alltag ihrer Erniedrigung und ihre Dornenkrönung, die sich müde und teilnahmslos an die kleinen marmornen Tische setzten, ohne die fürchterliche gespielte Begierde auf ihren armen Gesichtern, abgesunkene Künstler und andere gescheiterte Existenzen trafen. Melchior hatte am Nachmittag, zusammen mit seinem Lehrmeister und den beiden Gesellen, in einem märchenhaft reichen Palast eines Industriekaisers eine wunderbare Wandvertäfelung angebracht und hatte von dieser Arbeit eine schreckliche Müdigkeit des Leibes und ein noch schlimmeres Entsetzen des Geistes aus der furchtbaren Atmosphäre des Reichtums mit nach Hause getragen. Er saß in sich zusammengesunken an einem der Tische und trank seinen Kaffee und rauchte wie abwesend seine Pfeife, die in dieser Luft von Verlorenheit etwas Bäuerliches und Gediegenes hatte. Er wartete, ohne irgendeiner Zeit bewußt zu sein. Und es schienen ihm daher, als Paul mit seiner Geige eintrat und sich müde und traurig neben ihn setzte, Stunden vergangen zu sein, aber ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, daß er erst eine Viertelstunde wartete. Sie begrüßten sich stumm und herzlich, und Paul bestellte bei dem schmierigen Mädchen, das, so jung sie noch war, eine schreckliche lächelnde zerfallene Schönheit hatte. Die Haare waren noch glänzend und blond, nicht künstlich, der Leib noch straff und ohne Spuren schrecklicher Nächte, aber in dem geschminkten Gesicht der kaum Sechzehnjährigen, um den grellroten Mund waren fürchterliche Linien von Zynismus und Verfall, und die Augen waren von glimmender schamloser Unzucht erfüllt.
Die beiden saßen stumm und tranken. Paul, der in irgendeiner mondänen Bude zum Fünf-Uhr-Tee gespielt hatte und zu dem Verdienst noch einen Vorschuß bitter erkämpft hatte, da morgen ein Wechsel seines Vaters fällig war, war ebensowenig zum Sprechen geneigt wie Melchior. Sie starrten in die dumpfe Luft des Cafés, und obwohl ihre Augen auf irgend etwas gerichtet schienen, waren sie doch ins Leere gerichtet. Paul richtete sich einmal auf und sagte leise: »Man kann den Glauben und die Liebe nicht so leicht verlieren wie die Hoffnung, sie droht immer zuerst in dem schrecklichen Brand ausgelöscht zu werden, ihr Schein verschwindet in der entsetzlichen Glut der Verzweiflung…« Und es verging wieder eine Weile in dumpfem Schweigen, da hob Melchior sein Gesicht, furchtbar bleich, und er flüsterte: »Ich habe eine schreckliche Ahnung… hier… hier…« Er deutete auf seine Brust, und seine Augen flackerten. Wie Tote erhoben sie sich, zahlten und gingen auf die dunkle Gasse hinaus, die von grauem Nebel eingesponnen war. An einer Ecke reichten sie sich wortlos die Hand zum Abschied.
Am anderen Abend saßen sie zusammen in Melchiors Wohnung, in der Küche. Sie waren allein. Paul stand mit der Geige unterm Kinn mitten im Zimmer. Sein Gesicht zeigte zum ersten Mal, seit Melchior ihn kannte, etwas wie Heiterkeit, sein Gesicht, bleich, von braunen Haaren umrahmt, das oft schrecklich alt und manchmal sonderbar kindlich wie das eines Zwölfjährigen aussah, fast niemals sein wirkliches Alter, siebzehn Jahre, zeigte, lag in einem sonderbaren Glanz, er lächelte und spielte. Eine unsagbar zarte Sonate Mozarts ging von den Saiten in dem Raum, und mit einer unwiderstehlichen Gewalt schien sie die Wände wegzudrängen und die schwere dunstige Winterluft aufzulösen, und es schien irgendwo jemand aufzuspielen mit süßen Tönen, die von Tränen zitterten, in einer heiteren Ebene, an deren Horizont sich traurige Wolken schwach zusammendrängten. Ein dumpfes Geräusch zerbrach den Zauber; Paul setzte ab, und Melchior ging zur Tür; er öffnete sie, und das spärliche Licht der Küchenlampe fiel auf die Gestalt eines jungen Mädchens, das im Flur stand. Ihre keusche mädchenhafte Fülle wurde von einem schlichten grauen Kleid geborgen. Ihre braunen Haare waren zu einem einfachen schweren Knoten zusammengebunden; ihr Gesicht, schmal und bräunlich, blieb dunkel, obwohl das Licht voll darauf fiel, es schien eine unauslöschliche Trauer darauf eingebrannt, die kein Licht erhellen konnte. Ihre Augen, die sonderbar groß wirkten in dem schmalen Gesicht, hatten einen weichen Glanz. Sie war sehr erschrocken und wandte sich gleich zitternd um und wollte die Treppe hinabsteigen. Melchior rief leise ihren Namen: »Fräulein Sebald…«
Sie wandte sich um und sagte leise: »Ihre Mutter ist nicht da? … verzeihen Sie…« und ging schnell lautlos die Treppe hinab.
Ohne Paul anzublicken, der noch immer mit der Geige in der Hand mitten in der Küche stand, ging Melchior auf seinen Platz zurück und stützte den Kopf in beide Hände. Ein dunkles Schweigen. Und wie wenn er den Blick seines Freundes gesehen hätte, der ihn starr und fragend ansah, sagte Melchior langsam und leise: »Sie ist die Tochter der Dirne Käthe, die unter uns wohnt… ich habe sie noch nie… so… ganz gesehen.« Paul nickte gedankenlos. Ohne sich anzublicken, verharrten sie beide in gleicher Stellung und in gleichem Schweigen. Erst als Paul der Bogen aus der Rechten glitt, zuckten sie beide zusammen und schrien leise auf. Paul raffte den Bogen auf und packte hastig seine Geige ein. Er trat vor Melchior hin und reichte ihm die Hand. Sie blickten sich an, und beide erröteten und senkten den Blick. Zu gleicher Zeit sagten sie beide leise: »Auf Wiedersehen!«
Wie wenn sie sich verabredet hätten, trafen sie sich am folgenden Morgen in jenem dunklen, einsamen Café. Paul bemerkte bei seinem Eintritt staunend, daß Melchior einen Tornister neben sich auf der Erde liegen hatte. Sie gaben sich die Hand. Paul wartete, etwas schüchtern, was in seiner düsteren Trauer sonderbar wirkte, auf die ersten Worte des Freundes, der mit wilder Entschlossenheit wartete, bis Paul Kaffee bestellt und erhalten hatte. Das Café war trotz der frühen Stunde schon überfüllt wegen des Marktes, der in der Nähe auf einem kleinen Platz in der Altstadt abgehalten wurde. Ein schrecklicher Lärm füllte die dreckige Bude; um so furchtbarer wirkte auf Paul, der in marternden Ängsten und Zweifeln die Nacht durchwacht hatte, die Ruhe des Freundes, der düster irgendwo ins Leere starrte. Melchiors schönes offenes Gesicht, das sonst immer einen jugendlichen Schimmer von Röte zeigte, war bleich, und die dunklen Ringe unter seinen Augen zeigten an, daß auch er die Nacht nicht geschlafen hatte. Er begann so plötzlich, ohne seine Haltung zu ändern, zu sprechen, daß Paul, der erregt auf seine Worte gewartet hatte, erschreckt zusammenfuhr. Melchior lächelte freundlich. »Dieses Mädchen«, sagte er deutlich und fest, »Susanne liebt mich nicht, und da sie dich liebt, habe ich in dieser Stadt nichts mehr zu suchen. Ich bin für möglichst gerade Dinge, wenn sie auch hart scheinen. Alles, was ich außer diesem Mädchen noch liebe, lasse ich zurück… ich habe, da ich selbst mich nicht zu entscheiden wagte, mit unserem Freund, dem Kaplan, gesprochen, heute morgen, nachdem ich mir Gewißheit geholt habe bei… Susanne. Lieber Paul, du wirst so freundlich sein, die Sache mit der Schule zu regeln; meine Mutter hat mir ihren Segen gegeben, und nun werde ich zu deinem Vater gehen, der mir Empfehlungen schreiben lassen soll, für Handwerksmeister in den Städten des Südens.« Er erhob sich; Paul, mit zitternden Armen, ohne ein Wort zu sagen, zog ihn wieder auf den Stuhl herab. Schweigend blickten sie sich lange an und schwiegen. Dann erhoben sie sich gemeinsam; Melchior bezahlte. Schnell, ohne Hast, liefen sie auf Pauls Wohnung zu. In der Tür blieb Melchior stehen. »Geh«, sagte er leise, »ich glaube, sie wartet auf dich. Vielleicht komme ich auch mal nach Frankreich und besuche das Grab meines Vaters.«
Paul lehnte wie gebrochen an der Wand und konnte nicht sprechen. Melchior wurde weiß wie Kalk, er wankte und hielt sich krampfhaft fest am Türgriff, dann ging eine rote glühende Welle über sein Gesicht, er umarmte seinen Freund schweigend und lief in den Flur. Paul stand noch lange unbeweglich in der Tür. Er starrte auf den Fleck, wo Melchior gestanden hatte… und versank in ein unbestimmtes Nachdenken; erst als er drinnen Tritte hörte, lief er schnell hinweg. Lange irrte er durch die winkligen Gassen, schwitzend und manchmal von einem kalten Schauder ergriffen; mehrere Male wollte er in ein Café eintreten, aber er besann sich immer wieder, daß er kein Geld bei sich hatte… wie ein Schlafwandler schwankte er hin und her, und er geriet oft gegen eine Mauer und erwachte von harten, schmerzhaften Schlägen. Endlich wandte er sich schnell um und lenkte seine Schritte auf das dunkle kleine Haus in der Gerbergasse. Er tastete sich die Treppe hinauf und klopfte wie im Traum an die Tür, die gänzlich im Schatten lag. Er hörte leise Schritte, und die Tür tat sich auf wie ein schwarzes Loch; in dem dunklen schwarzen Rahmen war wie ein lichter Fleck das graue Kleid Susannes. Paul trat unsicher darauf zu und drückte die Tür hinter sich zu. Er sah das Mädchen nicht, er konnte nur ihre stille Gegenwart fühlen; in dem Dunkel des kleinen Flures hörte er ein leises Weinen. Er streckte seine Rechte aus und fühlte eine kleine warme Hand, die in seiner verschwand. »Ich kann kein Licht machen«, sagte die schwache Stimme, die ihm gestern schon Tränen in die Augen getrieben hatte, »es ist abgesperrt worden, und meine Mutter ist seit vorgestern… verreist.« Paul öffnete die Tür und zog sie langsam hinaus. Das schwache, ärmliche Licht des Flures schien wie unermeßlicher silberner Schimmer, der auf die kleine wunderschöne Gestalt fiel. Sie lächelte und ging langsam vor ihm die Treppe hinab, und da sie wankte, faßte er sie und beugte seinen Kopf über ihre Schulter. »Ich habe Hunger, seit meine Mutter weg ist«, flüsterte sie. Paul zog sie sanft die Treppe hinauf und stieß die Tür auf. »Warte«, sagte er leise, »ich hole dich gleich wieder ab.« Sie trat gehorsam in den dunklen kleinen Flur und wandte sich noch einmal um. »Bring deine Geige mit«, sagte sie, und da er in sonderbarer Erregung und Angst sie anblickte, mit einer wilden Trauer auf seinem bleichen Gesicht, beugte sie sich zu ihm hin und sagte: »Ich liebe dich«, und ein wilder Strom von Tränen lief über ihr Gesicht. Paul nahm sie in seine Arme und küßte sie; sie lächelte und trat ins Dunkel des Flures; Paul raste die Treppe hinab; er eilte, ohne auf irgend etwas zu achten, nach Hause und lief an der Küche vorbei in sein kleines Schlafzimmer hinauf.
Er nahm schnell seinen Geigenkasten aus dem Kleiderschrank und ging dann zaghaft und leise die Treppe hinunter; vor der Küche zauderte er einen Augenblick, dann trat er schnell ein. Seine Mutter stand, in Dampf gehüllt, an dem kleinen Ofen. Sie kam, bevor er etwas sagte, auf ihn zu und umarmte ihn schweigend. Die kleine dicke Frau, die alle Register des Elends hatte spielen hören, zitterte vor Tränen. »Ich weiß alles, Junge«, sagte sie, »sage nichts.« Und sie ließ ihn los und schob ihn sanft zur Tür. Paul wandte sich und sah sie an. »Ach«, sagte sie mit leisem Lachen und nahm aus ihrer blauen Schürze die lederne Geldbörse. »Nimm es, es ist nicht viel… Vater ist nicht hier… er ist…« Sie stockte. Paul steckte die Geldbörse blindlings in irgendeine Tasche und lief hinaus. Auf dem kurzen Weg zurück, den er in aller Eile hinter sich brachte, ballte sich eine undurchdringliche Trauer in ihm zusammen, Angst und Ahnung. In dem schwach erhellten Hausflur blieb er kurz stehen und betete leise mit Tränen in den Augen, er formte keine Worte, eine unausdrückbare heiße Bitte stieg empor. Susanne erwartete ihn an der Tür; sie hatte einen leichten schwarzen Mantel und ein kleines dunkles Hütchen angezogen. Sie nahm schweigend Pauls Arm und ging mit ihm langsam die Treppe hinab.
Paul führte sie in ein kleines verstecktes Restaurant mitten in der Stadt und ließ eine kleine abgesonderte Stube herrichten. Er aß erst mit ihr, um ihr Gesellschaft zu leisten, da er selbst keinen Hunger spürte, aber über dem Essen kam ein gewaltiger Appetit über ihn, er aß freudig mit und trank Wein, und sie forderten sich gegenseitig lachend zum Essen auf und tranken auf ihr Wohl. Der ungewohnte Wein stieg ihnen beiden zu Kopf; das stille schöne Mädchen glühte, und die dunkle Trauer ihres Gesichts schien verschwunden, und Paul griff lebhaft zu seiner Geige, als der Kellner den Tisch abgeräumt hatte.
Er spielte jene Sonate von Mozart, bei der sie ihn gestern überrascht hatte, und er goß alle Seligkeit und alle Düsternis in die Töne, und er geriet beim Spiel in eine Ekstase; er sah nur die wunderschöne Erscheinung seiner Liebsten und hörte nur, wie wenn sie von einer fremden Hand gespielt seien, die Klänge, die er in leidenschaftlicher Glut aus den Saiten zauberte. Die Heiterkeit verließ schnell das Gesicht des Mädchens, sie gehörte auf dieses Feld der Trauer; wie ein kurzer Lichtstrahl hatte sie einen Augenblick den Acker der Tränen, dieses dunkle, schmale Gesicht, besucht, und sie huschten wieder fort. Das Mädchen saß lautlos da, in seiner märchenhaften düsteren Schönheit, und Paul wurde von ihrem Weinen, von diesem schwachen winzigen Geräusch ihres Leidens, aus dem Meer der Musik gerissen; er legte seine Geige beiseite und setzte sich neben Susanne. Er umarmte sie leidenschaftlich und küßte das tränenüberströmte Gesicht dieser weinenden Dirnentochter. Sie saßen wenige Minuten, als sich die Tür öffnete und die Gestalt eines riesigen bärenhaften Mannes erschien, der offenbar von der Musik angelockt schien. Hinter ihm drängten sich vier oder fünf andere Gestalten. Paul stand mit flammendem Gesicht und wies dem dicken Riesen die Tür; auf dessen Gesicht malte sich eine sonderbare Schüchternheit, er wollte sich mit einer unklar gemurmelten Entschuldigung zurückziehen, aber da drängte sich einer aus der hinteren Gruppe vor, und Paul sah, wie Susanne erbleichte, als sie ihn sah. Ein greisenhafter schmaler Fünfzigjähriger, dessen Gesicht alle Spuren der Hölle zeigte. Er stellte sich lachend in die Tür, wobei er die Zähne fletschte, und sagte mit einer scheußlich schleimigen Stimme: »Ah… Demoiselle Sebald… die allzu spröde Tochter der großzügigsten aller Mütter… habe die Ehre…« Seine Anhänger brachen in ein lautes Gelächter aus. Paul packte in blinder Wut die Weinflasche und schleuderte sie nach dem Kopf des schändlichen Lüstlings. Ein fürchterliches Gepolter und ein höhnisches Lachen zeigte ihm an, daß er sein Ziel verfehlt hatte, und er stürzte sich blitzschnell zur Tür, preßte sie zu und drehte den Schlüssel um. Draußen wurde es unheimlich still; dann hörten sie die Bande nach oben gehen. Susanne schien vor Angst zu sterben; sie hatte sich in die entfernteste Ecke des Zimmers zurückgezogen, weinte und zitterte wie ein vor Furcht sterbendes Kind an der Wand, ihr Gesicht hatte alle Farbe verloren, ihre Haare klebten von Schweiß, in ihren großen braunen Augen schien sich für immer ein unsagbares Entsetzen festgesetzt zu haben. Sie wollte erst in schrecklicher Angst auch Paul abwehren, der sich, halb tot vor Schrecken, ihr näherte, aber als sie ihn erkannte, stürzte sie mit einem schrecklichen Schluchzen auf ihn zu und klammerte sich an ihn. Paul legte sein glühendes Gesicht an das ihre. Ihre Tränen netzten seine Brust, und er wußte nichts zu tun, als in ungeschickter, verzweifelter Hilflosigkeit ihr Haar zu streicheln und ihre schmale zuckende Schulter. Langsam beruhigte sich das Mädchen, das die erste sorglose Minute seines Lebens schrecklich büßte. Sie weinte lautlos, und ihr keuscher junger Leib brach immer wieder unter dem Schluchzen. Sie klammerte sich immer fester an Paul und lehnte ihr in Tränen schwimmendes Gesicht gegen das seine, und als er in ihre Augen blickte, kam ein unsagbares Mitleid wie eine schwere, undurchdringliche Wolke auf ihn herab. Er schloß ihres Mundes rote Wunde mit seinen Lippen…
Aus einem seligen und von Trauer umdüsterten Traum weckte sie das Geräusch der knarrend aufspringenden Tür. Sie wandten sich um und erstarrten. In der Tür stand der Greis, höhnisch grinsend, eine Pistole in der Hand, hinter ihm, stumm, einige weitere Fratzen, die vor Gier verzerrt waren. Der Greis öffnete den Mund, Paul hielt Susannes Hand fest in der seinen und ließ den schauderhaften Lusthund aussprechen. Er dachte nur daran, Zeit zu gewinnen. »Sie sind ein vernünftiger Mensch«, sagte der Alte, »wir wollen alles vergessen von eben, wir wollen Ihnen freien Abzug gewähren… geben Sie uns das Mädchen… es ist keine strafende oder rächende Geste«, er grinste unheimlich, »ich bin von der Literatur. Sie verzeihen meine Umschweife… es geht uns nur darum, dieses süße kleine Ding zu bekommen… entweder sterben Sie beide oder… keiner von Ihnen… Wir werden Ihnen dann die junge Dame morgen früh mit… nun ja zuschicken… Wählen Sie!« Paul hatte kaum auf ihn gehört. Er packte in dem Augenblick, als sein Gegner noch einmal zum Sprechen ansetzte, Susanne mit einem schnellen Ruck um den Leib und rannte wie ein Wahnsinniger auf die Mauer von Männern, wobei er ein unheimliches, tierisches Gebrüll ausstieß, den fürchterlichen Ausfluß seiner Verzweiflung. Die Schüsse knallten los, und Arme klammerten sich um ihn, er spürte einen stechenden Schmerz an der Seite und unter dem Herzen und hörte, wie Susanne laut aufschrie, und seine Hände klebten von ihrem Blut… aber er bahnte sich den Weg und raste den dunklen, langen Flur entlang, durch die Gaststube auf die Straße. Die Straße war leer; er lief, da er nicht mehr sich halten konnte, in den nächsten Hausflur hinein und legte Susanne sanft nieder. Sie hatte an der Stirn und unter dem Herzen eine Wunde, und er sah, daß sie bewußtlos war; er legte sich neben sie auf die kalten Fliesen und küßte in wilder Leidenschaft ihr blutüberströmtes bleiches Gesicht, in das die klebrigen braunen Haare hineinhingen. Das Gesicht war vollkommen unkenntlich, nur die zarte Brücke ihrer Brauen ragte noch rein und unberührt auf der bleichen Stirn. Er richtete sich röchelnd auf und versuchte aufzustehen, und da ihm die Kraft versagte, faltete er die Hände und beugte sich über seine Liebste, und er sank in sich zusammen. Noch einmal, nach wenigen Minuten, erwachte er und erwachte auch der körperliche Schmerz, er fühlte nach seinen Wunden und schrie laut auf, und dieses Schreien saugte seine letzten Kräfte auf, er knickte um, und sein bleiches Gesicht tauchte in eine Blutlache, die aus der Seite seiner Liebsten floß…
Melchior, den, da er seine Anschrift nicht angegeben hatte, keine der blutigen Nachrichten aus seiner Vaterstadt erreicht hatte, wanderte wenige Tage später aus der großen Ebene auf die Stadt. Ein unstillbares Heimweh hatte ihn getrieben, und er hatte sich umgewandt und war zurückgeschritten. Als er von Ferne am rötlichen Himmel die dunkle Silhouette der Stadt schimmern sah, in feinen Dunst gehüllt, um die sich der Rhein wie ein glühendes, blutiges Band schlang, beschleunigte er seine Schritte, und er eilte über die nebligen Uferwiesen auf die schwarze Brücke zu, die ihn über den dunklen Abgrund des Stromes führte und ihn in die Stadt lenkte. Er lief und lief, eine ungewisse Angst im Herzen, und spürte nicht die Last seines Tornisters, er durchschritt eilig die Gassen, die schon abendlich dunkel waren, und trat zuerst in das Haus seines Meisters und öffnete die Tür zur Stube; er sah die beiden Bahren, seine Mutter, die Dirne Käthe und die beiden alten Eltern, die ihren letzten Sohn verloren hatten, und er fiel mit einem Schrei zu Boden, und es bahnte sich ein Strom von Tränen aus seinen Augen über die Dielen…
Die Schwester
1938
»Er hat wieder seinen Koller!«
Wie ein Murmeln ging es durch die Gruppe von sieben Frauen, die in wollüstiger, ängstlicher Neugierde vor der Tür zum Atelier des Malers Pendercast standen. Die Gevatterin Achlotzki, die den bevorzugten Posten einer Spionin am Schlüsselloch innehatte, gab, indem sie sich manchmal kurz umwandte und hastig murmelte, Bericht von den Geschehnissen hinter der Tür und deutete den horchenden Weibern die sonderbaren Geräusche, die aus dem Atelier drangen.
»Nun zerhackt er die Keilrahmen… er lacht… er schneidet die Bilder kaputt… er weint…«
Ihre Stimme, die wie ein feistes Röcheln klang, schien von einer unglaublichen Befriedigung erfüllt; es machte ihr Vergnügen, der Gevatterin Achlotzki!
»Nun zerreißt er die Skizzenblätter… Mein Gott, was geschieht denn da!« Sie verstummte und drückte ihre Augen fest ans Schlüsselloch. Die andren Gevatterinnen vibrierten vor Ungeduld und hätten am liebsten, von einem bohrenden Neid zerfressen, die Gevatterin Achlotzki vom Schlüsselloch weggerissen. Diese richtete sich plötzlich hoch und sah die andren erst lang streng an, ehe sie ihre Botschaft verkündete, und mit einem heimlichen Bedauern, daß die Lust, den anderen die Botschaft vorzuenthalten, nun zu Ende sei, sagte sie ernst: »Er ist hingefallen!« Sie drängten sich nun einzeln zum Schlüsselloch, und als sie wieder zusammenstanden, sagte die Frau Sonderberg: »Wir müssen den Pfaffen holen… er ging immer in die Kirche.«
»Und den Schlosser!« sagte Frau Barndes.
»Man könnte…« Die schüchterne, ängstliche Frau Sermer wollte auch etwas sagen, aber die dicke, hochmütige Achlotzki schnitt ihr das Wort ab und fragte streng: »Was könnte man?«
»Den Arzt holen…«, sagte leise Frau Sermer.
»Ein sehr einfacher Tatbestand, Herr Pfarrer… Schwäche… Ohnmachtsanfall… kleiner Tobsuchtsanfall… vor Hunger… Überführung ins Krankenhaus, an sich das beste, ausgeschlossen, da… na…« Dr. Barendorf putzte eifrig seine Brille, und der feuchte Zigarrenstummel quappte zwischen seinen Lippen.
»Glauben Sie, daß er sterben wird?« Der Pfarrer, gleich vom Altar weggerufen ohne Frühstück, hatte die Mißmutsfalten noch nicht alle aus seinem feinen Ästhetengesicht austilgen können. Er fühlte eine unangenehme Leere … in seinem Magen und hatte das »fürchterlich peinliche Gefühl, daß die Hausordnung gestört sei«.
»Nein«, erwiderte Dr. Barendorf, »sterben wird er gerade nicht, aber ich möchte Ihnen anempfehlen, dem jungen Mann gutes Essen und eine geduldige Pflegerin zu besorgen… In einer Kasse ist er nicht… Auf Wiedersehen!« Er lief schnell die Treppe hinab und ließ den Pfarrer erstaunt zurück. Der Pfarrer musterte mit einem schnellen Blick die Frauen, die ihm Bahn machten, und trat ins Atelier ein. Zu seinem Erstaunen fand er den Maler an einem Tisch sitzend, vor einem kleinen Ölbild. Der Pfarrer trat näher, und als er nach einem kurzen Blick festgestellt hatte, daß das Bild schlecht war, wurde seine Laune noch übler. Er mußte sich zwingen, möglichst freundlich zu sagen: »Wie geht’s? Wie steht’s? Ich sehe: Sie sitzen schon wieder.«
Der Maler schien den heiteren Anwurf überhört zu haben; er rührte sich nicht; mit seinen vor Fieber glänzenden Augen blickte er unverwandt auf das kleine Bild, das einen Knabenkopf darstellte, bleich, mit düsteren Augen auf die ferne Silhouette einer Stadt starrend. Das ausgezehrte Gesicht des Malers, von den wilden schwarzen Haaren umgeben, rührte in dem Pfarrer etwas wie Mitleid, und in dem Glauben, der Maler könne vielleicht seine Frage überhört haben, sagte er nochmals: »Wie geht’s? Wie steht’s? Ich sehe: Sie sitzen schon wieder.« Der Maler rührte sich nicht; es kam dem Pfarrer der schreckliche Gedanke, er könne mit einem Wahnsinnigen allein sein. Dieser unerhörte Trümmerhaufen zerstörter Bilder und mitten darin dieser krankhaft ruhige Mensch, der nicht einmal der Höflichkeit halber antwortete. Vielleicht war das ein schrecklicher Streich des zynischen, antiklerikalen Dr. Barendorf! Dem Pfarrer brach der kalte Schweiß aus. Er trat etwas zurück und studierte in ängstlicher Sorgfalt den Blick des stummen Malers, und es kam ihm ein absurder Gedanke, den er später beim Konveniat als »furchtbar lächerlich« bezeichnete. Er dachte: »Wie gut, daß wir psychologisch auch ein wenig geschult worden sind!« Er konnte in dem Blick nichts psychisch Krankes entdecken, und so begann er nochmals: »Warum antworten Sie nicht? Sind Sie…« Er verstummte; der Maler öffnete den Mund und wollte zu einem Brüllen ansetzen, aber er war zu schwach dazu und sagte leise, mit einem drohenden Zorn in der Stimme: »Sind Sie wahnsinnig? Wie geht’s? Wie steht’s? Gut Wetter heute, Monsieur le curé. Sie sind doch sicher westlich orientiert?« Der Pfarrer lief auf ihn zu und blieb händeringend vor ihm stehen: »Um Gottes willen, wenn Sie das gekränkt hat, verzeihen Sie… Sie sind krank, empfindlich…« Der Maler machte eine fürchterlich wegwerfende Geste und bot dem Pfarrer einen Stuhl an. »Verzeihen Sie«, sagte er, »ich bin wirklich etwas gereizt.« Der Pfarrer schob eifrig seinen Stuhl näher und legte seinen runden schwarzen Hut auf den Tisch neben das Bild. Seine gute Laune war im Nu wieder da, er hatte alles Störende vergessen, das aufgeschobene Frühstück, die beleidigend unsachliche Äußerung des Malers und den kalten Zynismus des Dr. Barendorf, er war gut gelaunt, denn es eröffnete sich ihm die Aussicht auf eine fabelhafte Diskussion.
Er legte sanft die Hand auf die Schulter des Malers, der die Augen geschlossen und den Kopf in die Rechte gestützt hatte. »Ich weiß, ich weiß«, sagte er leise, »es ist fürchterlich. Aber die Idee, die Idee erfordert Opfer. Als Künstler stehen Sie dem Absoluten doch näher als andere, die Hunger leiden… ach, was ist der Hunger gegen ein wunderschönes Bild!« Der Maler öffnete die Augen und deutete auf den Trümmerhaufen zerrissener Bilder. »Ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur… Herr Pfarrer, da liegen zehn Bilder, vielleicht wunderschöne… es fand sich niemand, der mir ein Mittagessen dafür gegeben hätte… und ich hätte sie schon für ein Frühstück und zwei Zigaretten angegeben. Sehen Sie«, er lächelte in einer Weise, die dem Pfarrer das Herz durchbohrte, »mein Magen ist kein Idealist.« Der Pfarrer zuckte entsetzt zusammen, dann sagte er streng und ernst: »Das sind Platitüden eines Verzweifelten!« Mit einem schwachen Griff packte ihn der Maler an der Soutane und knirschte mit den Zähnen: »Kaufen Sie mir ein Bild ab«, er deutete auf einen Stoß unzerstörter Bilder, »oder scheren Sie sich fort!« Der Pfarrer packte schnell seinen Hut und stand auf; er sah auf den Maler herab, der müde und schlapp seine Arme hängen ließ, und sagte streng: »Sie gehören zu den Leuten, die die Kunst in Verruf bringen. Dennoch: Ich bin gern bereit, beim Verlag ›Ars sacra‹, dessen…« Mit einem Satz war er an der Tür. Dem Maler schien der Zorn Kraft zu geben. Er sprang auf den Pfarrer zu und brüllte: »Verlag ›Ars sacra‹, das fehlte noch…« Aber der Pfarrer war schon zur Tür hinaus, und der Maler setzte sich müde wieder an seinen Tisch und nahm das kleine Bild in die Hand.
Noch zitternd und bebend hatte der Pfarrer endlich sein Frühstück eingenommen. Er blickte auf die Uhr. »Halb