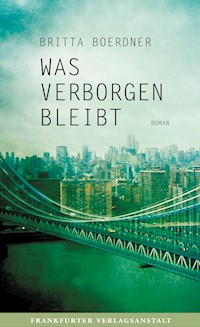Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das einfühlsame Porträt einer Frau im freien Fall, ein Blick in die Abgründe der modernen Arbeits- und Lebenswelt. Ein heißer Sommermorgen in der ›hellen Stadt‹, dem neuen Viertel am Rand der Metropole. Unter dem Weiß der Wolken bilden die Neubauten eine leblose Formation, in Beton gegossene Sehnsucht nach Übersicht und Unverbindlichkeit. Alles ist ruhig, bis eine Voicemail die Stille des Apartments unterbricht: »Ich war seine Freundin. Ich kenne die E-Mails. Rufen Sie zurück, es ist wichtig.« Die kühle Stimme holt das Geschehene zurück: Sie, mit Mitte vierzig fünfzehn Jahre älter als er, ein externer Consultant, hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Affäre ohne Verpflichtungen, ohne Konsequenzen bleiben sollte. Alles Private hatte sie zugunsten der Karriere aufgeschoben. Was dann geschah, war nicht vorherzusehen. Britta Boerdners Sprache ist von müheloser, minimalistischer Eleganz, ihre Kunst ist das lautlose Durchbrechen von Oberflächen. In Es geht um eine Frau blickt sie hinter die Fassaden einer Welt, in der Selbstoptimierung und Gewinnmaximie- rung regieren. Sie zeigt ihre Protagonistin ungeschminkt, in all ihrer Härte und Zartheit, Angreifbarkeit und Aggressivität, im Kampf mit den An- und Überforderungen des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das einfühlsame Porträt einer Frau im freien Fall, ein Blick in die Abgründe der modernen Arbeits- und Lebenswelt.
Ein heißer Sommermorgen in der ›hellen Stadt‹, dem neuen Viertel am Rand der Metropole. Unter dem Weiß der Wolken bilden die Neubauten eine leblose Formation, in Beton gegossene Sehnsucht nach Übersicht und Unverbindlichkeit. Alles ist ruhig, bis eine Voicemail die Stille des Apartments unterbricht: »Ich war seine Freundin. Ich kenne die E-Mails. Rufen Sie zurück, es ist wichtig.«
Die kühle Stimme holt das Geschehene zurück: Sie, mit Mitte vierzig fünfzehn Jahre älter als er, ein externer Consultant, hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Affäre ohne Verpflichtungen, ohne Konsequenzen bleiben sollte. Alles Private hatte sie zugunsten der Karriere aufgeschoben. Was dann geschah, war nicht vorherzusehen.
Britta Boerdners Sprache ist von müheloser, minimalistischer Eleganz, ihre Kunst ist das lautlose Durchbrechen von Oberflächen. In Es geht um eine Frau blickt sie hinter die Fassaden einer Welt, in der Selbstoptimierung und Gewinnmaximierung regieren. Sie zeigt ihre Protagonistin ungeschminkt, in all ihrer Härte und Zartheit, Angreifbarkeit und Aggressivität, im Kampf mit den An- und Überforderungen des Lebens.
Inhalt
Prolog
1 | Schließen Menschen, die …
2 | Mein Spaziergang nach …
3 | Es hatte nicht genügt, dass …
4 | Und, was machts du …
5 | Nach meiner Flucht …
6 | Die beiden, die wir waren …
7 | Schon Wochen vor meinem Umzug …
8 | Die Sandsteinfassade …
9 | Natürlich kommt es vor …
10 | Ich kann dir nicht antworten …
11 | Die Sache mit dem Café …
12 | Für den Abend war ein Unwetter …
13 | An jenem Freitagmorgen …
14 | Wie auch an den Tagen davor …
15 | Während der morgendlichen U-Bahn-Fahrt …
16 | Als ich aufstand …
17 | Rasch hob ich …
18 | Ich gehe davon aus …
19 | Am 20. November …
20 | Ich würde Jana nicht …
21 | Das Geräusch hätte …
22 | Ich versuchte, den Abstand …
23 | Es war halb zwölf in der Nacht …
24 | Als ich zurück zu den Fahrstühlen …
25 | Perschke gehörte zu denjenigen …
26 | Ich wäre gerne …
27 | Wenn ich wollte, konnte ich …
28 | Als ich an jenem Novemberfreitag …
29 | In der forensischen Medizin …
30 | Am Montag nach dem Sprung …
31 | Das alles könnte ich …
32 | Perschke hatte es im November …
33 | Frauen beobachten Frauen …
34 | Nach M.s Tod fing ich …
35 | Ein schwerer Einbruch …
36 | Monica Vitti in L’Eclisse …
37 | An einem Freitag bin ich …
38 | Wenn ich versuche, eine Geschichte …
39 | Erst als ich das Hotel verließ …
40 | Sie vermute, ihre Nachrichten …
41 | Am Morgen nach Janas E-Mail …
42 | Kanntest auch du diese Zustände …
43 | An jenem 20. November …
44 | Wie so oft handelte ich …
45 | Als M. mir öffnete …
46 | Hätte uns jemand von außen …
47 | Ein Taxi brachte mich …
48 | Alles geschieht nur noch außen …
49 | In der Nacht fand …
* | Sonntagfrüh und ich stehe …
Prolog
An jenem Freitagmorgen des vergangenen Jahres ging ich als Kriegerin aus dem Haus. Alles war wie immer, ich duschte, trocknete mich ab, nahm die Kleidung vom Bügel, die ich am Abend zuvor ausgesucht hatte, zog mich an und überflog meine E-Mails. Wie jeden Morgen hatte ich das Gefühl, die Zeit liefe mir davon. Aus dem Badezimmerspiegel sah mir eine Fremde entgegen, ich beugte mich nach vorne, schloss und öffnete die Augen, trug den Lidschatten, den Eyeliner auf. Eine mechanische Bewegung führte zur nächsten. Während ich mich auf den Tag einstellte, der vor mir lag, erschöpfte mich jeder Handgriff. Ich ahnte noch nicht, was sich am Nachmittag ereignen würde, ich wusste nur, dass ich meine Schwäche spätestens dann überwinden müsste, wenn ich das Firmengebäude beträte.
Immer wieder versuche ich, diejenige zu verstehen, die ich war, versuche, den Schock zu mindern, indem ich mir die Geschehnisse in einem weiten Bogen erzähle. Die Vergangenheit zeigt sich nur in Momentaufnahmen, der Zugriff auf vollständige Abläufe, Tage, Wochen bleibt verwehrt, sobald sie passé sind. Jeder Blick auf die erinnerten Sequenzen dient der Erklärung dazu, wer man war, wer man ist, die Räume zwischen den Gedächtnisbildern können nur vermutet werden. Ich kann sie nur durch eine nachträgliche Erzählung füllen, der ich selbst nicht traue, auch, weil seit den Ereignissen bereits ein dreiviertel Jahr vergangen ist. So seltsam es klingt, es hilft mir, wenn ich mir Jana als Gegenüber vorstelle. Eine Wand, auf die ich blicke, ein verschlossener Mund, ein Körper, der meinem nicht gleicht. Hilft, den Hergang zu ordnen. Was aber würde ich ihr wirklich sagen können? Kaum etwas von allem. So gut wie nichts. Sie hat kein Recht darauf. Diese Geschichte schwebt wie eine der Wolken zwischen Tag und Nacht.
1
Schließen Menschen, die ihre Wohnung verlassen, um sich irgendwo in die Tiefe zu stürzen, zuvor noch die Tür hinter sich ab? Greifen die gewohnten Mechanismen, wenn man sich dazu entschieden hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, denkt man an die Schuhe, die man trägt, an die Kleidung, daran, wie man aufgefunden wird?
Ich zog meine Sneakers an und wünschte mir, ich hätte die Mailbox nicht sofort abgehört. Es war zu spät, die Stimme war in meinem Wohnzimmer zu hören gewesen, ich hatte den Lautsprecher meines Smartphones eingeschaltet.
Ich zögerte, in den Hausflur zu treten. Zum ersten Mal, seit ich drei Wochen zuvor eingezogen war, tippte ich auf den Monitor der Videosprechanlage. Die Überwachungskamera zeigte die Natursteinplatten von der Haustür bis zum Gehweg, der Asphalt der Straße war im Sonnenlicht kaum zu erkennen. Alles schien makellos, nichts regte sich. Vielleicht war das Display noch mit Folie überzogen, das Bild, das ich darauf sah, ein Beispiel für beispiellose Ruhe; als ich mit dem Fingernagel am Rand des Bildschirms entlangfuhr, um den Überzug zu lösen, kam ein Schemen ins Bild. Eine Taube. Tippelte auf dem Gehweg nach rechts und links, lief auf die Haustür zu. Sie hinkte. Am unteren Rand des Monitors blieb sie stehen. Ich wartete darauf, dass sie sich wieder bewegte, hoffte, sie würde nicht ausgerechnet jetzt vor Überhitzung sterben und mit zur Seite gedrehtem Kopf und halboffenem Auge vor mir liegen, wenn ich nach unten käme. Sie bewegte den Kopf, als würgte oder versuchte sie, ihren Abflug durch Lockern der Schultermuskulatur vorzubereiten. Erst nachdem sie aufgeflogen und aus dem Sichtbereich der Kamera verschwunden war (ohne Ton eine Bewegung wie in Zeitlupe), wagte ich mich hinunter.
Warme Luft drängte mir entgegen, als ich die Haustür öffnete. Niemand war auf der Straße zu sehen. Es war kurz nach neun Uhr, ein Montagmorgen, an dem die Kinder in der Kita und der Schule waren und die Erwachsenen in ihren Homeoffices, in ihren Büros in der Innenstadt oder in einem Gewerbegebiet arbeiteten. Ich ging entlang der vertrockneten Grünfläche in Richtung der Allee, die zur Innenstadt führte. Junge Purpureschen standen eingelassen in Erdquadrate, in Plastiksäcken, die ihrer Bewässerung dienten. Vorne an der Allee waren die Fassaden der Geschäftshäuser mit cremefarbenen Steinquadern verkleidet, hinter den Glasfronten sah ich Sitzgruppen in den zweigeschossigen Eingangshallen stehen. Lieferwagen parkten in Zufahrten. Zwischen den ersten und zweiten Häuserreihen schimmerten die Gehwege, durch den Sprühnebel eines kleinen Springbrunnens hindurch wirkte die Abfahrt zu einer der Tiefgaragen im Gegenlicht weichgezeichnet. Trotz der Sonnenbrille tränten meine Augen. Hoch über mir ragten zwei Sonnenschirme aus den eingelassenen Balkonen. Hinter den Neubauten waren die Dächer und Brandmauern des alten Arbeiterviertels zu sehen, aus den neuen Häusern würde man darauf herabblicken können. Ich nahm mir vor, am Abend die DVD mit Mon Oncle von Tati in meinen Umzugskisten zu suchen. Meine Fotos, die ich seit dem ersten Tag im Viertel machte, könnte ich damit abgleichen, eine ironische Auseinandersetzung mit meiner neuen Umgebung würde es werden. Vielleicht sollte ich eine großformatige Collage daraus basteln. Ein entspannter Abend, an dessen Ende ich die Sprachnachricht löschen würde.
Wie an jedem Tag in den vergangenen drei Wochen war ich, obwohl ich nichts zu tun hatte, gegen viertel nach sieben aufgestanden und nach dem Duschen mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon getreten. Bereits jetzt nannte man den Sommer den heißesten, so, wie man schon viele Sommer zuvor als die heißesten bezeichnet hatte, und wie zur Bestätigung zeigte das Thermometer, das ich während des Umzugs im Keller meiner alten Wohnung gefunden und an der Wand meines neuen Balkons aufgehängt hatte, neunundzwanzig Grad im Schatten. Auf der Straße unter meinem Balkon fuhren vereinzelt Firmenwagen vorüber, die üblichen Marken in gedeckten Farben. Geräuschlos bewegten sie sich hin zur Allee, die sie zur Innenstadt oder zur Autobahn führte. Auch der anthrazitfarbene BMW des Nachbarn rollte aus der Tiefgarage. Auf der Fahrerseite glitt die getönte Scheibe nach unten, eine Hemdmanschette leuchtete auf. Schwarze Hose, weißes Hemd und ein Kinn im Anschnitt, das war alles, was ich sah. Heavy-Metal-Musik setzte ein, viel zu laut für diese Uhrzeit, und wurde sofort leiser gedreht. Der Wagen blieb weiter vorne an der menschenleeren Kreuzung an einer roten Ampel stehen. Als es Grün wurde, bog er auf die Allee ein, die zur Innenstadt führte.
Das Gesicht dieses Nachbarn hatte ich erst einmal kurz gesehen, als er wenige Tage nach meinem Einzug abends im Businessanzug auf seinem Balkon stand und telefonierte. Ich wollte grüßen, nicht mehr als ein unverfängliches Kopfnicken sollte es werden, doch als ahnte er meine Aufmerksamkeit, machte er auf dem Absatz kehrt und ging mit der Körperhaltung desjenigen, der Anweisungen gibt – zu jedem seiner drei, vier Schritte bekräftigend nickend – zurück in seine Wohnung. Ich konnte mir vorstellen, welche Begriffe fielen, open issues, die zu klären wären, dieses und jenes sei zu challengen (gleich morgen!). Bis hin zum Esstisch mit Frau und Kind würde er in diesem Takt gehen und dabei in sein Handy sprechen. Den Rücken würde er den beiden zukehren, so lange, bis sein Gespräch beendet war, nicht etwa aus Rücksicht wendete er sich ab, sondern um zu zeigen, dass ein geschäftliches Telefonat stets wichtiger ist als alles andere. Einige Tage danach hörte ich spät am Abend ein Kind weinen, das Schluchzen drang aus den geöffneten Balkontüren dieses Paares hinaus auf die Straße. In diesem Moment hatte ich auch zum ersten Mal die Lieblingsmusik des Nachbarn gehört, ein Heavy-Metal-Getöse, das für vier oder fünf Sekunden in höchster Lautstärke losbrach, aufgedreht aus dem Nichts und ebenso plötzlich wieder abgestellt, ein Schock nicht nur für mich. Das Kind war still.
Ich legte eine Hand auf das Balkongeländer. Seit einigen Tagen meinte ich, manchmal ein Vibrieren im Haus zu spüren, kaum wahrnehmbar, ein leichtes Zittern, das nie lange anhielt. Wahrscheinlich kam es aus den Tiefgaragen, die unter den Häusern lagen, von ihren Toren, die auf- und abglitten. Es konnte auch eine Täuschung sein, ganz so, wie ich auch die Treppe, die vor dem Nachbarhaus schwebte, im ersten Moment als etwas empfand, das ich mir einbildete. Die Wolken blendeten mit ihrem Weiß, ich kniff die Augen zusammen. Eine Wendeltreppe war es, aus Beton gegossen, blass hing sie an Ketten unter dem Kran, der schon seit Wochen dort stand. Sie pendelte ein wenig über dem Asphalt, wurde höher gezogen, blieb stehen und drehte sich langsam um ihre Achse. Zwei Häuser weiter hob ein Kran eine weitere Treppe von der Ladefläche eines Tiefladers. Unverputzte Ziegelsteine, bodentiefe Fensteröffnungen, dahinter die noch nackten Innenräume, ich hätte die Raumaufteilungen aufmalen können. Ein anderer Bauherr, andere Investoren, doch die Architektur unterschied sich nur wenig von der des Hauses, in das ich gezogen war. Neben diesen Rohbauten war das Viertel noch Bauwüste, in der tagein, tagaus schwere Maschinen die Schutthügel plan schoben und an anderer Stelle wieder aufwarfen.
In den Maklerbroschüren hatte ich gelesen, dass die Fläche zwischen meiner und den Häuserensembles auf der gegenüberliegenden Seite acht Hektar betrug, so groß wie acht Standardfußballplätze. Europagarten wurde die Anlage genannt, aber die Bepflanzung und die niedrigen ornamentalen Sichtbetonmauern, die eine moderne Version der Broderien früherer Gartenkunst darstellen sollten, überzeugten mich nicht von den Ideen der Landschaftsplaner. Die Ziergräser standen zu weit auseinander, um an ihre flächendeckende Zukunft glauben zu lassen, und einer der beiden Wege, die quer über die Fläche führten, verlief in einem solch unnatürlichen Bogen, dass ich, als ich einmal früh am Morgen auf ihm entlangjoggte, das Gefühl hatte, mir würde etwas aufgezwungen. In der Mitte kehrte ich um und sprintete den Weg zurück. Metallzäune verhinderten eine Abkürzung, niemand durfte den spärlichen Rasen betreten. Er wuchs nicht richtig, verbrannte unter der Sonne; der Mutterboden sei der falsche, oder falsch angelegt, zu sehr verdichtet, noch könne der Park nicht eröffnet werden, hatte ich gelesen.
Vor einiger Zeit hatten große Teile des Quartiers nur als Renderings auf den Webseiten der Immobilienbüros existiert; als moderne Stadt neben der eigentlichen Stadt war es geplant, im vorderen Teil mit Luxuswohntürmen, darin Penthouses mit übereinander gestaffelten Dachterrassen. In eine bislang unerreichte Wohlfühlatmosphäre tauche man hier ein, und zwar premium, hatte der Makler gesagt, und ein Speichelrest war an seiner Unterlippe kleben geblieben. Das Terrain war als ein völlig neues Erholungssystem geplant, eines, das man auch nach Jahren noch großzügig nennen sollte, eines, das in seiner Künstlichkeit der allgemeinen Sehnsucht nach Übersicht und Unverbindlichkeit entgegenkam, vermutete ich. Es war ein Mangel, den ich nicht benennen konnte, eine Einfallslosigkeit, die alles durchdrang, und doch empfand ich die Abwesenheit, die ich in allem sah, als wohltuend.
Eine erste Wolke Zementstaub war von den Baustellen über die Straße gezogen, ich hatte mich gerade auf das Dröhnen der Betonmischmaschinen eingestellt, als ich meinte, mein Handy klingeln zu hören. Sechs, sieben Schritte hinter mir lag es halb unter einem Kissen auf der Ecke der Wohnzimmercouch. Ich drehte mich danach um, doch da war nichts. Das Klingeln musste von einem anderen Balkon, aus einer anderen Wohnung gekommen sein. Unwahrscheinlich auch, dass es mir galt, ich hatte seit meinem Umzug mit niemandem gesprochen und niemand hatte mich angerufen. Auch in den Wochen davor hatte ich nur mit dem Makler und der Umzugsfirma telefoniert. Erst später sah ich, dass dieser erste Anruf um acht Uhr elf erfolgt war. Mittlerweile bezeichne ich diese Uhrzeit, diesen Tag als einen der Wendepunkte in meinem Leben, und mehr als einmal habe ich mir seither gewünscht, meine Telefonnummer gewechselt zu haben.
Ich holte mir einen zweiten Kaffee. Wenn ich sage, ich hatte in diesem Moment eine Vorahnung, dann trifft es das nicht ganz. Eine nervöse Spannung war in mir aufgestiegen, mir war nicht wohl in meiner Haut, der Raum hinter mir – meine Küche ging über in das Wohnzimmer – schien plötzlich erweitert und so, als bewegte sich darin etwas, wenn ich nicht hinsah. Ich schrieb es meiner Übermüdung zu. Mit dem falschen Bein aufgestanden, eine Überblendung der Zustände, sagte ich mir. Seit Tagen schlief ich nicht gut. Es war kurz vor der Sommersonnenwende, und wenn mir tagsüber die südliche Sonne zu schaffen machte, war es in der Nacht ein beinahe nördliches Firmament, das mich nicht zur Ruhe kommen ließ. Die Abenddämmerung hielt bis nach halb zehn Uhr an, die Morgendämmerung zog gegen halb fünf Uhr auf; samtig, würde man gegen Mitternacht auf einer Restaurantterrasse im Urlaub sagen, zur Mondsichel am dunkelblauen Himmel zeigen und sich zuprosten. Doch das hier war kein Urlaub, es war eine Außenstelle der Vernunft, eine Flucht aufs offene Feld, und trotzdem – das stellte ich seit meinem Einzug täglich fest – verhalfen mir das Licht und die neue Umgebung zu einer Ruhe, wie ich sie seit Jahren nicht gefunden hatte. Es störte mich nicht, dass das Neubaugebiet als geschichts- und ausdruckslos galt, ich wusste nicht einmal, wie lange ich hier wohnen würde. So lange, bis alles gut ist, dieser Gedanke war mir durch den Kopf gegangen, als ich mich für die Wohnung entschied. Nach allem, was im Herbst geschehen war, hatte mich nichts davon abhalten können, frei zu wählen, und so hatte ich mich für das Entfernteste, mir am wenigsten Bekannte entschieden. Träumten wir nicht alle einmal, wenn wir in den früheren, guten Zeiten aus dem Kino kamen, von dieser südlichen Villa oder einem Pariser Stadthaus, von den kühlen Innenräumen, den Bücherregalen, der Veranda oder dem Balkon mit dem Tisch und den Weingläsern darauf, den Kieseln auf der Zufahrt, dem begrünten Innenhof, von einer Brise am Abend; sind nicht solche Filmbilder in unserem Gedächtnis abgelegt als Inbegriff eines Lebens, das uns Üppigkeit und eine zukünftige Liebe verspricht? Der Teil des Viertels, in dem ich in erster Reihe zu der Grünanlage wohnte, glich für mich einer Nachahmung dieser Vorstellungen, war ein auf Fassadenelemente und Minigärten begrenztes Sammelsurium aller möglichen Ideen eines gediegenen Lebensstils. Tünche, die Weltläufigkeit vermitteln sollte. So sah ich es. Von Anfang an aber hatte ich mein Quartier auch als neutrales Gebiet empfunden, eine Art Blaupause, mich selbst ein unbeschriebenes Blatt, bereit für eine neue Kontur. Die Innenstadt mit ihrem Verkehrslärm gehörte zu einer anderen Welt, meine neue Adresse war nur der Datenbank des Einwohnermeldeamts bekannt. Meine Wohnung entlastete mich durch ihren gehobenen Standard. Für eine Weile sollte es nur angenehme Dinge geben; fotografieren, schlafen, Filme anschauen. Wer in dieser Übersichtlichkeit angekommen ist, muss sich sicher fühlen, war mein erster Gedanke bei der Besichtigung. Bereits mit dem allmorgendlichen Aufstehen konnte ich der Helligkeit nicht widerstehen, die von der Anlage ausging. Mehr noch als die Hausfassaden reflektierten die Wolken das Licht, täglich schwebten diese Kumuli über dem Gelände, organische Gegenstücke zu den eckigen Apartmenthäusern und zur gleichen Zeit abgewandt von allem, was unter ihnen liegt. Oft erschienen sie mir als Zeichen dafür, dass hier die Zeit wohltuend langsamer vergeht als in meinem bisherigen Leben; dann wieder empfand ich sie als einen Verweis darauf, was es heißt, wirklich eigenständig zu sein. Seit meinem Einzug habe ich zu jeder Tageszeit Fotos gemacht, darauf sieht man diese Wolken, die größer wirken als die Häuser darunter. Wenn sie auftauchen, stehen sie bis zum Nachmittag beinahe unverändert, erst dann schweben sie in die Ferne, um dort am Abend einen Rahmen für die Sonnenuntergänge zu bilden. Zirruswolken, die in der Innenstadt oft als Fetzen hinter den Hochhäusern vorbeiziehen, habe ich hier noch nie gesehen. Verwischtes, in Auflösung Befindliches hat in diesem Viertel keine Chance.
Um kurz vor halb neun war die Wendeltreppe in das Treppenhaus des Rohbaus geschwenkt worden. Der Tieflader, der sie angeliefert hatte, machte gerade noch rechtzeitig Platz, um den Bus vorbeizulassen, der zur Stadt fuhr. Seine Seitenscheiben reflektierten die Sonne, das Streiflicht ließ die Pflanzen im Vorgarten aufleuchten. Die ganze Zeit hindurch spürte ich eine Art nervöser Angespanntheit. Nach meinem Morgenkaffee würde ich die Jalousien vor meiner Fensterfront herunterlassen und mich vielleicht noch einmal hinlegen. Ich war gerade in Versuchung, mich wieder so lange mit dem Wort Rechenschaft zu beschäftigen, mit dem Gedanken, niemandem mehr Rechenschaft ablegen zu müssen, bis das Wort selbst einen fremden Klang annehmen und seine Bedeutung verlieren würde, da stoppten auf der Baustelle die Maschinen. In der Stille riefen sich die Arbeiter etwas zu, das ich nicht verstand, die Stimmung war wie immer schlecht. Hammerschläge setzten ein, wieder wirbelte Zementstaub auf, mit toxischen Bestandteilen wahrscheinlich, die sich auch ohne Wind verbreiten würden. Als ich hineinging und die Balkontür hinter mir zuzog, hörte ich das Klingeln wieder. Ich nahm es nur wahr, weil es als Kontrapunkt zu den Hammerschlägen der Bauarbeiter erklang. Irgendwann in den letzten Tagen musste ich das Handy auf laut gestellt haben, vielleicht durch eine Beunruhigung darüber, sein Läuten lange nicht mehr gehört zu haben. Mit dem Ton des alten Festnetzklingelsounds, den ich eingestellt hatte, verfestigten sich die Ränder der Wolken. Im Winter, wenn ich um diese Uhrzeit bereits im Office war, hätte ich mich nicht darüber gewundert, frühmorgens angerufen zu werden. Doch schon vor meiner Umzugsplanung hatte ich sämtliche Kontakte auf das Notwendigste beschränkt. Ich melde mich, sobald ich aus dem Gröbsten raus bin, nein, keine Sorge, es geht mir gut, ein bisschen ausspannen, Neuorientierung, vielleicht eine kleine Reise, Italien oder Griechenland, und danach in aller Ruhe einen neuen Job suchen, ich lasse von mir hören, nachdem sich alles wieder eingespielt hat, und dann unternehmen wir etwas, sagte oder schrieb ich. Manchmal wunderte ich mich darüber, wie schnell es ging, nicht mehr angerufen zu werden und keine Nachrichten mehr zu bekommen, aber ich nahm es hin.
Mit dem vierten Klingeln stand ich vor meiner Couch, Nummer unbekannt, las ich, Grund genug, das Gespräch nicht anzunehmen. Im fünften Ton brach der Anruf ab. Das Display leuchtete auf und zeigte zwei verpasste Anrufe an. Für einen Moment hatte ich den Impuls, einfach wegzugehen, auch hier wegzugehen, die beiden Meldungen und der Nachhall des Klingeltons durften in meiner Wohnung nicht sein, und als sich das Display wieder verdunkelte, hatte ich erst recht das Gefühl, etwas könnte Einzug gehalten haben, das nicht hierhergehörte.
Noch während ich das Telefon wieder auf lautlos stellte, leuchtete eine weitere Meldung auf. Eine Voicemail war eingegangen.
Ich war seine Freundin, sagte die Stimme. Kühl klang sie. Das Mikro des Telefons war nahe an den Mund gehalten worden.
Ich kenne die E-Mails. Rufen Sie mich zurück. Es ist wichtig.
2
Mein Spaziergang nach dem Abhören der Mailbox erleichterte mich nicht. Keiner der vier Sätze, die ich gehört hatte, war eine Verwechslung gewesen. Ich war gemeint. Zwischen den Schulterblättern rann mir der Schweiß hinab.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite klebte eine Folie auf der Glasfront eines Maklerbüros, auf ihr wurden die Eigentumswohnungen und deren Ausstattung aufgeführt. Die Schrift war über die halbe Breite des Erdgeschosses aufgedruckt, Worte wie individuell, riesig, anspruchsvoll, luxuriös waren kursiv gestellt. Daneben zog sich bis zum zweiten Stockwerk ein Foto hinauf, das den Oberkörper und das Gesicht einer jungen Frau mit aufgetürmten Haaren und Perlenkette zeigte, ein Audrey-Hepburn-Imitat, offenbar der Prototyp der Bewohnerin dieser Wohnungen. Im Glas der Eingangsfront sah ich mich selbst in meinem ärmellosen schwarzen Kleid, meinen weißen Sneakers und der übergroßen Sonnenbrille, auch ich hatte die Haare hochgesteckt. Ich nahm mein Handy aus der Tasche, um mein Spiegelbild zu fotografieren, aber sobald ich auf das Display sah, vergaß ich die Idee. Ich ermahnte mich. Diese Frau konnte mir nichts anhängen, es hatte im Winter keinen Grund zur Flucht gegeben, ich war nur meiner Erschöpfung entkommen. Es gab E-Mails, aber erst gegen Ende, und nur von M. geschrieben. So gut wie nichts war mir aus ihnen in Erinnerung, weil ich sie nur überflogen und als die Anklagen eines Menschen abgetan hatte, der sich nicht damit abfinden wollte, verlassen worden zu sein. Ich hatte ihm nicht geantwortet, konnte ihm keine Erklärung liefern, die mich nicht selbst entblößte. Hätte ich die Mails aufheben sollen, würde es mir jetzt helfen, sie sorgfältig zu lesen? Stelle niemals eine Frage, deren Beantwortung du nicht erträgst, so sagt man doch.
Auf dem Gebäude gegenüber stützte die folierte Kosmopolitin ihr Kinn auf der Glasfront des zweiten Stocks in die Hand, dabei sah sie mich von oben herab aus grün eingefärbten Katzenaugen an. Die Frau mit Sonnenbrille darunter, die im schwarzen Sommerkleid die Straße überquerte und auf die gläserne Eingangstür des Maklerbüros zukam, das war ich. Ich, die auf mich zuging, mich in der einzigen Front spiegelte, die nicht beklebt war. Die Frau, die jetzt mitten auf der Fahrbahn im Sonnenlicht stehenblieb, weil sie dachte, im Foyer des Maklerbüros einen Körper auf dem Boden liegen zu sehen, war ich. Ich nannte mich verrückt, ich musste mich beruhigen. Dieser Zustand gehörte nicht hierher, die ganze Aktion mit dem Umzug war ja zur Heilung ausgelegt und nicht als Aggregatveränderung gedacht. Er gehörte in den Herbst und den Winter und in die beiden Jahre davor, als das Arbeitspensum so straff war, dass ich oft vergaß zu atmen. Bei dem Versuch, gleichmäßig Luft zu holen, sah ich meiner Hand zu, die immer noch das Handy hielt, sah, wie sie zitterte, gleich würde sie es fallenlassen. In kleinen Schritten ging ich auf mein Spiegelbild zu. Als ich vor dem Gebäude stand, merkte ich, ich hatte mich geirrt. Was wie ein menschlicher Körper auf dem Steinboden des Eingangsbereichs ausgesehen hatte, waren nebeneinanderliegende Pakete, eine Anlieferung, die sich im Hintergrund in der verchromten Fahrstuhltür spiegelte. Kein Mensch war in dieser Eingangshalle zu sehen. Wie seltsam, es war doch ein Wochentag, wahrscheinlich waren die Immobilienleute hier mittlerweile nur nach Voranmeldung zu sprechen, vielleicht musste man klingeln wie in feinen Restaurants, was weiß ich schon, sagte ich mir und wünschte mich zurück in das Dämmerlicht meiner Wohnung. Schlafen wollte ich und aufwachen wie neugeboren, und gleichzeitig kam mir an diesem Morgen in meiner neuen Umgebung zum ersten Mal der Gedanke: Ich bin nicht fähig, den Bildern zu entrinnen. Ich kann keine andere Geschichte von mir erzählen.
Die Frau im schwarzen Kleid ging an den Fenstern des Maklerbüros vorüber, zwei Schritte lang war ihr Oberkörper noch zu sehen, dann verschwand auch er, wurde abgelöst von übereinandergestapelten Paletten. Eine Brache neben dem Gebäude, Kieshaufen, Zichorie, dazwischen ein Stück Bauzaun halb auf einem Erdhügel, einer seiner Betonfüße trotz des Stahldrahts schief zur Seite geneigt. Totholz, eine Hecke, Brombeeren, ineinander verwachsen. Ein verwaistes Stück Land, das bald weichen musste, die Abraumcontainer waren aufgestellt.
Ein warnender Unterton war in der Stimme gewesen, diese Frau hatte bei dem Es ist wichtig das Mikro ihres Headsets noch dichter an den Mund gehalten. Erst kauen, dann schlucken, dann verdauen, war das Motto gewesen, wenn ich in meiner Abteilung unangenehme Wahrheiten zu verkünden hatte. Jetzt traf es mich selbst. Ich drehte mich um, sah in der Ferne die Hochhäuser des Bankenviertels in der Innenstadt aufragen und verfluchte zum ersten Mal, meine Telefonnummer nicht geändert zu haben.
Jana. Jetzt fiel es mir ein. Jana war der Name seiner Freundin, M. hatte ihn nur zwei- oder dreimal erwähnt. Meine ehrgeizige Freundin nannte er sie, Meine ehrgeizige Freundin hat mir schon wieder die Hölle heiß gemacht, sagte er manchmal. Ansätze von Beschwerden waren es, die er nicht ausführte, weil ich nur widerwillig nachfragte.
Mir fiel ein, dass diese Jana, wie auch er, als Consultant für eine große Unternehmensberatung arbeitete. Gut ausgesucht war dieser Name, er konnte in vielen Sprachen ausgesprochen werden, klang weiblich, war leicht zu merken. Wahrscheinlich hatten sich die Eltern gewünscht, dass dieses Mädchen einmal Karriere machen sollte. Wie lange waren die beiden zusammen gewesen? Ich erinnerte mich nicht daran, ob er darüber gesprochen hatte. Ich mochte es nicht, wenn er von seinem Leben mit Jana erzählte. Von Anfang an wollte ich keinen Zweifel daran lassen, dass ich keine Beichtmutter war, keine Helferin, Problemlöserin nur im Projekt, nicht aber im Leben.
3
Es hatte nicht genügt, dass ich M.s E-Mails nicht beantwortet und gelöscht hatte, natürlich hatte es das nicht. Es gab diese Mails und es gibt sie noch, war mir nach Janas erster Sprachnachricht klargeworden. Ganz offensichtlich hatte sich Jana Zugriff auf M.s Rechner verschafft, nur so konnte sie die Vorwürfe gelesen haben, die M. an mich richtete. Und in seinen Kontakten hatte sie meine Telefonnummer gefunden. Hatte sie erst jetzt den Mut, mich anzurufen, oder brauchte sie nach M.s Tod eine gewisse Zeit, bis sie sich seine Unterlagen ansehen konnte? Brauchte sie, ähnlich wie ich, Monate, in denen sie aus ihren Vermutungen darüber, was M. im vergangenen Sommer und Herbst umtrieb, etwas für sich zurechtlegen konnte?
Auf dem Nachhauseweg von meinem Spaziergang empfand ich die Stimme auf meiner Mailbox als geradezu herrisch. Und wenn diese Jana, wie auch immer, vielleicht sogar M.s Handy entsperren konnte, dann hatte sie auch unsere Messages gelesen. Bis auf M.s letzte E-Mails gab es zwischen ihm und mir nur diese kurzen Nachrichten, in ihnen ging es ausschließlich um unsere Verabredungen.
Darf ich dich heute Abend zu einem Sundowner einladen? lautete im vergangenen August seine erste WhatsApp-Nachricht. Ein wenig abgedroschen zwar, wie ich fand, aber wie sollen Mann und Frau zusammenkommen, wenn nicht einer den Anfang macht. Ich gestand mir ein, dass ich mich über die Nachricht freute. Niemals hätte ich diesen Schritt gewagt, don’t fuck the company, ich war vorsichtig. Ich, die immer weiterstrebte, aus jeder Beziehung nach fünf, sechs Jahren ausgebrochen war, weil ich das Gefühl hatte, auf der Stelle zu treten, war der Meinung, dass etwas Besseres, das Beste überhaupt erst noch käme, dann nämlich, wenn ich selbst dort angekommen war, wo ich hinwollte. In einer Zukunft, die alle Überstunden, alle schlaflosen Nächte belohnte. Etwas Künftiges, eine Führungsposition, finanzielle Sorglosigkeit, die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich wollte; schemenhaft zogen Stuckdecken an mir vorüber, eine Bibliothek, ein Blick über das Meer in die Weite, wo weiße Segelboote kreuzten. Du wirst es erreichen, sagte ich mir in den Monaten, in denen ich allein lebte. Aus diesen Monaten waren zuletzt drei Jahre geworden. Ich, die ich siebenmal in den letzten fünfundzwanzig Jahren die Wohnung gewechselt hatte, das machte einen Schnitt von 3,57 Jahren pro Adresse, las diese erste Nachricht von M. und wusste nicht, was ich antworten wollte. Dann ließ ich mich darauf ein. Gerne, schrieb ich zurück.
Was machst du morgen? Machen wir was zusammen? So und ähnlich klangen seine Nachrichten in den nächsten Wochen. Der Ton irritierte mich, ich fand ihn kindlich, dann wieder ärgerte ich mich darüber, dass M. die Dinge nicht beim Namen nannte. Du bist kein Junge mehr, der sein Verlangen durch Coolness überspielen will, hätte ich ihm am liebsten gesagt. Bald hatte ich den Verdacht, dass er mir vermitteln wollte, es sei ihm im Grunde einerlei; unsere Treffen hatten für ihn keine größere Bedeutung als etwas zusammen machen, so, wie man ein Eis isst, ins Kino geht oder noch auf ein Bier, eine Zerstreuung für den Augenblick, am nächsten Tag bereits so gut wie vergessen und dennoch wiederholbar. Vielleicht waren die belanglosen Sätze ein Kniff von ihm, eine Antwort auf meine eigene Knappheit. Denn ich hielt meine Antworten ebenfalls so kurz wie möglich. 20 Uhr?, oder: Donnerstag um neun? Ein lächerliches Benehmen, wie ich jetzt finde. Uns auf diese Weise die Beiläufigkeit unserer Beziehung zu demonstrieren, war jedoch auch ein Band zwischen uns, eine bedrückende Art, Unabhängigkeit zu zeigen, einen Ausweg offenzulassen, der leicht zu nehmen wäre. Nichts anderes als Feigheit, Unverbindlichkeit als Stärke deklariert, das weiß ich jetzt. Was mich wirklich verblüfft ist, wie sehr ich noch vor Monaten davon überzeugt war, das Richtige zu tun.
Im Unternehmen war ich M.s Vorgesetzte und er mein extern zugekaufter Project Manager, der die Fäden zusammenhielt, nachhakte, auf Deadlines pochte, die Budgetplanung führte. Er war Anfang dreißig, fünfzehn Jahre jünger als ich, hatte ich in seinem Kurzprofil gelesen. Mit dem Gang eines Sportlers kam er mir an einem Montagmorgen zu dem vereinbarten Vorstellungsgespräch entgegen, Schritte, die lässig wirkten, die Fußspitzen leicht nach innen gedreht. Hätte er keinen Anzug angehabt, er hätte ein Handballer sein können, der zum Training ging. Sein Jackett war von der gleichen sandigen Farbe wie seine kurzen Haare. Als er mir gegenüberstand, schien es ihn nicht zu stören, dass der Riemen seines Rucksacks eine Schulter nach unten gezogen und den Stoff zerknittert hatte. Bei der Begrüßung lächelte er nicht. Schweigsam war er, das stellte ich am gleichen Tag bei einem Kennenlern-Lunch im Unternehmensrestaurant fest. Mit einem Seitenblick ins Ungefähre erwähnte er Wien, wo er noch kurz zuvor ein Wochenende verbracht und während seines Musikstudiums zwei Jahre gelebt hatte. Musik, eine brotlose Kunst, sagte er und lächelte schließlich doch. Das gab den Ausschlag, ihn für meine offene Projektstelle anzufordern, das, seine bisherigen Projekterfahrungen, und dass ich mir während unseres Gesprächs wünschte, ich könnte ihn sehen, wie er durch Wien lief.