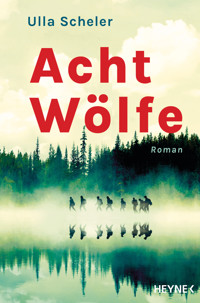11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wie es sich anfühlte, ihn zu sehen? Als hätte ich einen Monat lang durch einen Strohhalm geatmet.
Ben ist seit Ewigkeiten Hannas bester Freund. Er ist anders. Wild, tollkühn, ein Graffiti-Künstler, ein Geschichtenerzähler. Und keiner versteht Hanna so wie er. Nach dem Abi packen die beiden Bens klappriges Auto voll und fahren zum Meer. An einen verwunschenen Strand, um den sich eine düstere Legende rankt. Sie erzählen sich Geschichten. Bauen Lagerfeuer. Kommen einander dort nahe wie nie zuvor. Und Hanna hofft, endlich hinter das Geheimnis zu kommen, das Ben oft so unberechenbar und verzweifelt werden lässt. Doch dann passiert etwas Schreckliches …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Ähnliche
Zum Buch
Hanna und Ben sind wie Wasser und Feuer: Hanna beobachtet, überlegt – und entscheidet sich meistens für die Vernunft. Außer wenn Ben an ihrer Seite ist, Ben, der Wilde, Impulsive, der immer tut, was ihm gerade durch den Kopf schießt. Zum Beispiel die Wand des Schulgebäudes zu Hannas Geburtstag mit einer riesigen Torte zu besprayen. Oder mit Hanna nach dem Abi einfach loszufahren, an einen einsamen Strand, mit nichts als einem Zelt und ein paar Lebensmitteln im Gepäck. Aber hinter seiner Fassade ist Ben zerbrochen – ein Schicksalsschlag hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Das zeigt sich auch in seiner Beziehung zu Hanna: Sie sind sich so nahe, dass es manchmal schon wehtut, und kommen doch nicht zusammen.
Doch dann taucht ein seltsames Mädchen an ihrem Strand auf. Sie erzählt die Legende, dass jedes Jahr während einer Sturmnacht ein junger Mann an diesem Strand ertrinkt. Und tatsächlich häufen sich plötzlich die Anzeichen, dass Ben in großer Gefahr ist …
Zur Autorin
Ulla Scheler wurde 1994 in Coburg geboren. Bücher liebt sie schon seit ihrer Kindheit. Nach dem Abitur arbeitete sie in einem Krankenhaus, beim Fernsehen und in einem marokkanischen Hotel. Bis sie dann endlich ihren Debütroman Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen fertig schrieb, der schon seit drei Jahren darauf wartete, veröffentlicht zu werden. Die Autorin lebt in München und studiert Psychologie.
Ulla Scheler
ES IST GEFÄHRLICH,
BEI STURM
ZU SCHWIMMEN
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2016 by Ulla Scheler
Copyright © 2016 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler in München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs
von © shutterstock/Boyan Dimitrov
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-17736-2V001
www.heyne-fliegt.de
Für meine Familie
TEIL 1
EINS
Zu meinem achtzehnten Geburtstag schenkte mir mein bester Freund Ben eine Sachbeschädigung. Natürlich hätte Ben nie daran gedacht, mir ein normales Geschenk zu machen, aber damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet.
Alle haben gefühlt, dass Ben anders war, auch wenn es keiner in Worte fasste. Die Jungs im Schwimmteam der Schule, die Freundinnen der Jungs im Schwimmteam, die Sport-Referendarin, die das Team trainieren sollte und die er auf dem glitschigen Weg zwischen Duschen und Umkleide geküsst hat.
Er wirkte nicht wie ein Zwölftklässler. Dazu war er in den Schultern zu breit, und sein Gesicht unter den dunklen Haaren war zu scharf geschnitten. Die anderen Jungs wichen zur Seite, wenn er von der Raucherecke kam. Er war der einzige Schüler, der auf dem Lehrerparkplatz sein Auto abstellte. Und er hielt den Schulrekord im Schwimmen und den meisten Verweisen.
Alle haben gespürt, dass Ben anders war, und alle haben hingesehen, bis man Ben nicht mehr sehen konnte, weil er zwischen seinen Geschichten verschwand wie ein Lesezeichen.
Es war der Sommer nach unserem Abitur. Der achte Sommer, seit wir uns kennengelernt hatten. Der dritte Sommer, seit Bens Vater sich umgebracht hatte.
Ich sage Sommer, weil das unsere wichtigste Jahreszeit war. Im Winter dagegen verkrochen wir uns nur in den Bibliotheken und lasen Märchen aus aller Welt, aus Uganda und Norwegen, aus dem Silmarillion und dem Decamerone.
Es waren die Grenzen der Welt, vor denen wir uns im Winter versteckten. Die Welt sagte: »Du kannst nicht nach draußen«, und wenn man hinausstapfte, um ihr das Gegenteil zu beweisen, legte sie ihre Hände um einen, bis man seine Haut nicht mehr spüren konnte. Trotzdem mochte ich unsere Winter – wie durch den Schnee alles langsamer und leiser wurde. Ich war dann gerne allein in der Bibliothek, weil ich dort meine Gedanken besser hören konnte, wenn Schritte und Wörter von Teppichboden und Regalen gedämpft waren. Aber ich war auch gerne mit Ben dort, weil er kopfüber in ein Buch eintauchen konnte, um erst wieder an die Oberfläche zu kommen, wenn es draußen schon dunkel war. Er saß dann auf einem Stuhl in der Ecke und bewegte sich kaum, nur seine Finger blätterten die Seiten um. Ihm zuzuschauen glättete jedes Mal meine inneren Wellen. Ich glaube, nicht viele Leute kannten diese Seite an ihm.
Der Sommer war anders. Die Welt war weit. Wir glaubten, uns ein Stück Anders-Sein erschleichen zu können. Ein Stück Nicht-Langeweile. Ein Stück Besonderheit. Wie das eine Mal, als wir uns abends im Freibad einschließen ließen und das Spritzen unserer Doppel-Arschbombe in der Leere so gewaltig klang wie noch nie. Oder als wir einen ganzen Tag lang statt zu sprechen Sätze aus einem Buch vorlasen, das der andere ausgesucht hatte. Wir machten die Leute um uns herum wahnsinnig, aber wir fühlten uns golden.
Der Sommer nach unserem Abitur war der heißeste Sommer meines Lebens. Das ist nicht nur mein Gefühl – ich habe es nachgeprüft: Es stimmt. Wenn man die Tür öffnete, sperrte das Wetter das Maul auf, schluckte einen und spuckte einen schweißbedeckt wieder aus.
Es war ein heißer Sommer, und er trocknete uns aus.
Die Flammen warfen Funken in den Himmel. Es waren wesentlich mehr Hefte und Ordner geworden, als Melissas kleiner Kugelgrill verkraften konnte, deshalb hatten die Jungs mit Steinen eine Feuerstelle im Garten gebaut. Dafür hatten die Unterlagen wieder nicht gereicht, und wir mussten mit Holzscheiten nachlegen. Dann war das Feuer hüfthoch geworden, und inzwischen versengte es einem die Gesichtshälfte, die man ihm zuwendete. Ich stocherte mit dem Feuerhaken zwischen Karo-Papier mit skizzierten Graphen und endlosen Vokabellisten herum. Ab und zu wirbelte ein Papierfetzen in die Luft, bevor das Feuer ihn wieder einatmete.
»Hey, Hanna.« Tobias tippte mir mit seinem Beck’s ans Knie. »Kommt Ben noch?«
Keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte.
»Echt mal«, sagte Kai und zog den Eimer, auf dem er hockte, näher ans Feuer. »Den hat man schon ewig nicht mehr gesehen.«
Sie wussten nicht, dass er weg war. Dass ich ihn seit über einem Monat nicht gesprochen hatte. Dass ich keine Ahnung hatte, wo er war. Aber wie sollten sie das ahnen? In der achten Klasse hatte uns jemand den Spitznamen »Benna« verpasst, und wenn ich ehrlich war, traf uns das ziemlich gut. Wir hatten einige Fächer getrennt, Ben hatte Schwimm-, ich hatte Lauftraining, aber meistens reichte es, einen von uns zu suchen, wenn man beide finden wollte.
Ich überlegte, ob ich ihnen sagen sollte, dass er weg war. Aber wozu? Sie würden es nicht merkwürdig finden. Sie würden nur denken, er würde sonst was machen. Eine abartig geniale Abi-Feier planen. Beach-Volleyballerinnen auf Malta vögeln. Durch die Arktis schwimmen.
Sie liebten seine idiotischen Einfälle. Sie hingen an seinen Lippen, wenn er Geschichten erzählte. Sie konnten nicht aufhören hinzuschauen, aber sie sahen die Kratzer nicht.
Tränen traten mir in die Augen, und ich fixierte den hellsten Punkt der Flamme, damit sie nicht über meine Wangen rollten. Ich würde ihnen nicht von unserem Streit erzählen.
»Der Sack hat sich schon ewig nicht mehr blicken lassen«, sagte Tobias.
Ganz offensichtlich. Als würden sie so was sagen, wenn er da wäre.
»Aber ist auch schön, dich mal wieder zu sehen«, sagte Kai und stupste mich mit dem Ellenbogen an. »Seit du uns an Tobses Geburtstag beim Schafkopfen abgezogen hast, haben wir uns nicht mehr gesehen. Was gibt’s Neues?«
Spielten sie darauf an, dass ich mit Fabian Schluss gemacht hatte? So leicht würde ich es ihnen auf jeden Fall nicht machen.
Ich beugte mich nach vorne, sodass sie näher heranrutschen mussten, um zu hören, was ich sagte. Zwei Paar große, neugierige Augen. »Also, brandneue Information.« Ich machte eine bedeutsame Pause. »Ich habe mein Abi.« Ich sagte es völlig trocken, ohne das Gesicht zu verziehen.
Die zwei sahen enttäuscht aus, fingen sich aber relativ schnell wieder.
»Krasser Scheiß«, sagte Kai.
»In echt«, sagte Tobias. »Hätte ich nicht von dir gedacht.«
Man musste ihnen Plus-Punkte dafür geben, wie schnell sie darauf einstiegen. Trotzdem ließ Kai nicht locker: »Und was hat Fabian dazu gesagt?«
»›Krasser Scheiß‹«, sagte ich.
Tobias legte mir eine Hand auf die Schulter. Seine Augen waren schon ein bisschen glasig. »Hanna, Karten auf den Tisch: Hast du ihn abgesägt?«
Ich nickte und zuckte die Schultern. Ich wollte das Thema nicht vertiefen.
»Hast du echt? Geil.« Die beiden klatschten ab.
Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Ist nur, dass es uns gewurmt hat, dass einer aus dem Nachbarkaff das feuerfesteste Mädchen der Stadt abbekommen hat«, erklärte Kai und zwinkerte.
Damit spielte er auf einen Insider an: Wir waren mal Laborpartner in Chemie gewesen, und ich hatte ihm am Bunsenbrenner mehrmals die Augenbrauen gerettet. Das war ein witziges Schuljahr gewesen, vor allem weil wir in der Mittagspause immer um einen Muffin vom Hausmeister gekartet hatten, den meistens der schweigsame Underdog gewonnen hatte. Will heißen: ich.
»Wo bist du ab Herbst noch mal?«, fragte Tobias.
»Ich ziehe nach Regensburg und mache ein freiwilliges kulturelles Jahr am Theater.«
Sie nickten. Ihre Pläne kannte ich schon: Sie wollten beide Maschinenbau studieren, wo immer sie mit ihrem Abi-Schnitt genommen wurden. Das dazu passende Karohemd hatten sie auch schon an.
»Wir sollten die Menschen jetzt schon vor dir warnen«, sagte Tobias. »Du wirst sie so hart abziehen. Nein, im Ernst: Das wird bestimmt Bombe.«
Kai nickte und nahm einen Schluck. Sein Gesicht hatte einen feierlichen Ausdruck. Für eine halbe Sekunde. Dann fokussierten seine Augen etwas bei der Terrassentür.
»Schau mal da«, sagte Kai und schlug Tobias fast die Bierdose aus der Hand.
Ich schaute auf.
Melissa umarmte jemanden. Blond, Lip-Gloss, pinker H&M-Cardigan – ein insgesamt pinkes Mädchen. Melissa hatte nicht nur unsere Jahrgangsstufe eingeladen, sondern auch Leute aus ihrem Tanzverein. Sie hatte mir schon vor Monaten bei unserem Samstagsbrunch davon erzählt, dass sie diese Party schmeißen wollte, und jeden darauf folgenden Samstag war die Gästeliste länger geworden.
Kai und Tobias folgten dem pinken Mädchen mit Blicken zum Feuer. Sie setzte sich gegenüber von uns. Neben ihr war ein Hocker frei – sofort warfen sich Kai und Tobias einen Blick zu.
»Also, Hanna«, sagte Kai und stand auf.
»Gut, dass Meister Reißer nicht da ist«, sagte Tobias und stand noch schneller auf.
Sie schlenderten auf die andere Seite des Feuers, gerade so schnell, dass es nicht auffiel.
Ich beobachtete, wie sie sich vorstellten und unauffällig um den Sitzplatz rangelten. Es endete damit, dass sie beide mit einer halben Pobacke auf dem Hocker saßen.
Kein neues Phänomen – die beiden mussten alles angraben, was rasierte Beine hatte.
Mich ließen sie meistens in Ruhe. Vermutlich gehörten sie zu denen, die vermuteten, dass zwischen Ben und mir etwas lief (was nicht der Fall war).
»Hanna! Kannst du mal bitte …«
Ich nahm Melissa einen Stapel schmutziger Teller ab, die sie auf einer Hand balancierte, und trug sie in die Küche. Den gemütlichen, kleinen Raum kannte ich gut. Auf der Eckbank hatte ich einen festen Sitzplatz, und jeden Samstagmorgen kam ich mit frischen Brötchen vorbei, um mit Melissa zu frühstücken und zu quatschen.
Melissa kam gleich hinter mir durch die Tür und wuchtete einen zweiten Stapel Teller auf die Anrichte.
»Erinnere mich nächstes Mal daran, dass es Arbeit ist, vierzig Leute dazuhaben«, sagte sie und trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch. Ihr Pony klebte an der Stirn.
»Quatsch«, sagte ich. »Du liebst es. Also hol gleich noch die leeren Gläser, während ich mit dem Spülen anfange.«
Melissa lächelte mich dankbar an und lief wieder nach draußen. Ich musste daran denken, wie sie mir vor ein paar Monaten gesagt hatte, dass es ein Geschenk war, jemanden wie mich zu haben, jemanden, der so genau hinsah und so viel sehen konnte. Genau wie es ein Geschenk war, dass ich beim Gedanken an diesen Satz jedes Mal lächeln musste. Ich ließ Wasser einlaufen und tauchte die Teller in den Schaumberg. Das leise Klappern der Teller und der feste Schaum auf den Handrücken gefielen mir. Es war nett, nicht denken oder reden oder schauen zu müssen. Ich spülte die zwei Stapel weg. Wollte Melissa nicht noch mehr Geschirr bringen?
Ich trocknete mir die Hände und ging zur Terrassentür. Dort blieb ich stehen. Eine Stimme hielt mich fest.
Bens Stimme. Seine Schokoladenstimme, mit der er sonst mir leise vorlas.
Da saß er. Am Feuer, gegenüber von dem pinken Mädchen, auf meinem Platz. Er fixierte sie mit seinem aufmerksamen Blick.
Ich fing an zu zittern.
»Noch eine Geschichte?«, fragte Ben. Ich konnte hören, wie er lächelte.
Das Mädchen nickte und schaute weg. Ich wusste genau, wie es war, wenn Ben einen anblickte: Man fühlte sich gesehen. Wenn man ihn so gut kannte wie ich, konnte man auch zurückschauen. Hatte sie ihn wirklich nach einer weiteren Geschichte gefragt? Gott, Melissa sollte ihr schon mal einen Vorrat an Taschentüchern mitgeben. Man schnitt sich leicht an Bens schimmernden Kanten.
»Also gut, wenn du willst«, sagte Ben. »Das ist die Geschichte von einem Jungen und seiner besten Freundin und wie sie den Wind reiten.«
Mein Herz schlug schneller. Erzählte er jetzt unsere Geschichte, um ein Mädchen aufzureißen? Ich fühlte mich aufgeregt und zerfetzt zugleich. Es war eine der wenigen wahren Geschichten, die Ben erzählte, und seine beste.
Er rutschte ein bisschen näher zum Feuer, vielleicht wegen der Dramatik, vielleicht weil er wusste, wie seine dunklen Haare im Licht glänzten, und begann zu erzählen.
Ich wollte wütend bleiben, aber ich driftete ab in den Sog seiner Stimme. Es reichte schon, ihm beim Erzählen zuzusehen. Die Linienführung seiner Gesten, wie er sich leicht nach vorne beugte, die Flammen, die sich in seinen Pupillen spiegelten.
Das Mädchen übernachtete zum ersten Mal bei ihrem besten Freund. Sie waren zehn Jahre alt und kannten sich seit zwei Wochen. Natürlich war es nicht geplant gewesen, dass sie im Gewächshaus übernachteten – hätte es jemand gewusst, hätte es auf jeden Fall Ärger gegeben. Aber es gab ein Gewitter, wunderschön und furchteinflößend, und sie wollten es sehen. Sie hatten ihre Decken genommen und sich unter einem Regenschirm durch den Garten geschlichen. Die Liegestühle standen schon im Gewächshaus, der Gärtner stellte sie bei Gewitterwarnung immer dorthin.
Sie lagen da, flüsternd im Rauschen, schreiend, wenn der Regen auf das Glasdach prasselte, sodass es sich anhörte wie das Quaken von Fröschen.
Alles bestand aus Worten und Tropfen.
Als das Gewitter immer schlimmer tobte, setzte sich der Junge auf. Es störte ihn, dass er das Gewitter nicht richtig sehen konnte, weil ein Baum ins Blickfeld ragte. Die große Eiche, die neben dem Gewächshaus stand und ihre Äste bis über das Glas streckte.
Was er dagegen unternehmen wolle, fragte das Mädchen. Er könne den Baum ja nicht einfach umhauen. Der Junge schlug vor, nach oben zu klettern. Dort würde der Baum definitiv nicht mehr im Weg sein. Das Mädchen hielt das für eine dumme Idee, schließlich schlugen Blitze in Bäume ein. Der Junge hielt es für eine ausgezeichnete Idee, schließlich schlugen Blitze in Bäume ein und nicht in Kinder auf Bäumen.
Das Mädchen machte den Mund auf, aber gegen diese seltsame Logik konnte es nichts vorbringen. Also stand der Junge auf, legte seine Decke auf den Liegestuhl und trat im Schlafanzug in den Regen.
Der Junge kletterte wie ein Affe; er schloss die Augen, wenn ihm Regen ins Gesicht tropfte, und klammerte sich an die Äste. Schon hatte er die Krone erreicht und kauerte sich in eine Gabelung zwischen zwei Ästen. Von dort kletterte er so weit auf den stärksten Ast hinaus, wie er dem Holz traute. Die Abstände zwischen Blitz und Donner wurden immer kürzer. Als es das nächste Mal blitzte, konnte er das Mädchen am Fuß des Baumes sehen. Es hatte den Regenschirm aufgespannt und sich über den hügeligen Boden zum Stamm der Eiche vorgetastet und schrie zu ihm nach oben: »Komm runter!«
Und der Junge antwortete, mit leuchtendem Gesicht: »Erst wenn du oben warst. Das musst du erleben.«
Und obwohl das Mädchen durch die Dunkelheit die erleuchteten Fenster des Hauses sehen konnte, wo es trocken, warm und bestimmt blitzgeschützt war, machte es sich an den Aufstieg. Mit klammen Fingern umkrallte das Mädchen die Äste, während Sturzbäche aus Regenwasser ihm in die Augen rannen und ihm die Sicht nahmen.
Der Junge sah, wie der Schirm davonwirbelte, sobald das Mädchen ihn losgelassen hatte. Er sah die Angst in den Augen des Mädchens und wie es sich für ihn trotzdem nach oben kämpfte. Bei der Astgabelung angekommen klammerte sich das Mädchen an den Stamm. Der Wind peitschte inzwischen in Böen gegen die Äste, und alles schwankte. Donner und Blitze, dazu Regen von allen Seiten. Der Junge riss seinen Blick von diesem Spektakel los. Er stand auf und drehte sich um die eigene Achse. Fast tanzte er, als er auf das Mädchen zubalancierte, ohne sich festzuhalten. Nur eine Böe und er würde fallen.
Dann war er da; federnd ging er in die Hocke. Er berührte das Gesicht des Mädchens, das dreckverschmiert war, mit wirren Haarsträhnen, die auf den Wangen klebten.
Er küsste das Mädchen für die Länge eines Donners.
Danach kletterte der Junge mit dem Mädchen nach unten, wie er es versprochen hatte. Sie rannten die wenigen Meter zum Gewächshaus. Nass, durchgefroren, aber mit einem kribbelnden Lachen im Hals, im Bauch, in den Füßen. Federleicht liefen sie durch den Matsch und über die Löcher im Boden.
Sie waren so durchgeweicht, dass sie die Schlafanzüge auszogen und in Unterwäsche unter die Decken schlüpften. Dicke Tropfen prasselten auf das Glas; durch einen Fensterspalt hörten sie das Rauschen in den Bäumen. Die Blitze waren durch das Dach verzerrt; es wirkte wie in einem Science-Fiction-Film. Der Duft der seltenen Blumen, die die Mutter des Jungen hier züchtete, vermischte sich mit dem Regengeruch. Lange lagen sie einfach nur da, führten eine Unterhaltung mit ihren Atemzügen, die immer noch stoßweise kamen. Irgendwann – das Gewitter war ausgewrungen und tröpfelte bloß noch – beruhigte sich ihr Atem. Die Nacht war wieder dunkel, und das Gesicht des Mädchens nur ein Schemen, als es flüsternd fragte, ob er noch wach sei. Der Junge gab lediglich ein Murmeln von sich.
Das Mädchen fragte: »Warum hast du das gemacht?«
Der Junge antwortete nicht sofort, aber in der Stille konnte das Mädchen hören, wie er die Worte in seinem Mund hin und her drehte. Schließlich beugte er sich über die Lücke zwischen den Liegestühlen, den Mund am Ohr des Mädchens.
Und er wisperte: »Denkst du, dass du diesen Kuss vergessen wirst?«
Nein, würde ich nicht.
Ich konnte seinen Atem fast auf meiner Haut spüren.
»Wow«, sagte das pinke Mädchen und strich sich die Gänsehaut von den Armen. »Und, seid ihr zusammen?«
»Wir waren zehn Jahre alt«, sagte Ben. »Da muss man nichts hineininterpretieren.«
Er erzählte immer noch die Wahrheit. Das war der erste und letzte Kuss zwischen uns gewesen.
Das Mädchen lächelte. Erleichtert, hoffnungsvoll, was weiß ich.
Sie rückte ein Stück näher an Ben heran. Ich musste von ihren Lippen ablesen, was sie sagte.
»Ist sie da?«, fragte sie.
Sie. Ich.
Ben schaute auf. Sein sanfter Blick fand mich sofort. Wie lange wusste er schon, dass ich hier stand?
»Hallo, Hanna«, sagte er, weich. Ich hatte den Klang seiner Stimme vermisst. Wie sie meinen Namen aussprach und gleichzeitig mitklang, wie lange wir uns kannten und was wir zusammen erlebt hatten.
Wie es sich anfühlte, ihn zu sehen?
Als hätte ich einen Monat lang durch einen Strohhalm geatmet.
Ich drehte mich um und ging.
Die Nachtluft war kühl, und ich trat so schnell in die Pedale, dass der Fahrtwind meine Finger einfror. Mein Herz pumpte. Wa-rum. War. Er. Jetzt. Wie-der. Da?
Warum tat er so, als wäre nichts passiert?
Ich verstand ihn noch weniger als sonst. Ben verstehen war wie durch eine Kamera zu schauen, ohne fokussieren zu können. Manchmal konntest du für einen perfekten Moment klar sehen, dann verschwamm wieder alles.
Die Straßen waren leer, kein Auto unterwegs um halb zwölf.
Daheim stellte ich das Fahrrad in die Garage und schlich mich ins Haus. Mama würde mir meine Gefühle ansehen, und ich wollte nicht darüber reden.
Ich putzte Zähne, legte mich ins Bett und schaltete das Licht aus.
Das Zimmer war schwarz, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Licht fiel durch den schmalen Spalt zwischen den Vorhängen. Die Sterne leuchteten. Ben hatte sie in erfundenen Sternbildern an die Decke über meinem Bett geklebt.
Ich schaute nach oben. Wie lange es wohl dauerte, bis die Sterne das gespeicherte Licht abgegeben hatten? Kurz bevor ich einschlief, leuchteten sie noch.
Hell. Jemand hatte meine Nachttischlampe angeknipst.
Außerhalb des Lichtscheins erkannte ich das Gesicht meiner Mutter. Sie hatte nicht erwartet, dass ich so schnell die Augen öffnen würde, denn sie blickte mich immer noch an, als sei ich ihre schlafende, nuckelnde Baby-Tochter.
»Guten Morgen, mein Herz«, sagte sie. Sie beugte sich herunter und küsste mich auf die Stirn. »Es tut mir leid, dass ich dich wecke.«
Ich setzte mich auf. »Schon okay. Hast du ja angekündigt, als wir gestern telefoniert haben.«
»Es tut mir leid, dass die Präsentation ausgerechnet heute ist.«
»Schon gut, Mama.«
»Entschuldigung.«
Ich nahm ihre Hand und drückte sie.
Sie schaute auf unsere Hände und lächelte. »Bist du bereit für den Kuchen?«
Ich nickte.
Sie ließ meine Hand los und huschte nach draußen. Ich spähte zu meinem Wecker. Sechs Uhr.
Meine Mutter drückte die Tür mit der Schulter auf und balancierte eine monströse Geburtstagstorte zu meinem Bett. Sie hatte ein Geburtstagshütchen auf.
»Auspusten, auspusten!«
Ich pustete die Kerzen aus. Meine Mutter zog zwei Gabeln aus ihrer Hosentasche, reichte mir eine und setzte sich im Schneidersitz auf mein Bett. Die Frau nahm weder Rücksicht auf ihre Klamotten noch auf ihre Figur. Das nenne ich Mutterliebe.
»Du zuerst«, sagte sie. »Deine Torte.«
Ich schob mir eine Gabel Torte in den Mund. Geschmackssorte Schokolade-Birne-Glückseligkeit.
»Wann hast du den gebacken?«, fragte ich.
Für ihren Job war sie viel unterwegs und ging am Wochenende oft noch Unterlagen durch. Offiziell war sie Beraterin für Unternehmenskommunikation – sie selbst beschrieb ihren Job als teure Nachhilfe in gesundem Menschenverstand.
»Gestern Nacht. Ich bin pünktlich gelandet«, sagte sie. »Wie war die Party?«
Ich schluckte. Das Stück Birne wollte einfach nicht nach unten rutschen.
»Ganz okay«, sagte ich.
Meine Mutter zog nur die Augenbrauen nach oben.
»Ben war da«, sagte ich.
Sie hielt die Gabel auf dem Weg zum Mund an. »Hat er etwas gesagt?«
Ich schüttelte den Kopf. Doch: Hallo, Hanna.
»Ich … ich bin gleich gegangen.«
»Was denkst du darüber?«, fragte sie und schob die Gabel langsam in den Mund.
»Ich bin sauer«, sagte ich. »Was soll das, einen Monat zu verschwinden, ohne ein Wort?«
Meine Mutter rutschte näher an mich heran. Die Tortenplatte klemmte zwischen uns. »Als ich letztes Mal mit ihm gesprochen habe, schien es ihm nicht gut zu gehen«, sagte sie.
»Ja«, sagte ich. »Ich weiß, dass ihn irgendetwas umtreibt. Aber ich weiß nicht, was, und er redet auch nicht mit mir darüber.«
Meine Mutter nickte. »Gib ihm doch trotzdem eine Chance, es zu erklären.«
»Wie kommst du auf die Idee, dass ich das nicht tue?«
Sie schaute auf. Also bitte, sagte ihr Blick.
»Warum sollte ich?«, sagte ich.
Sie zeigte mit der Gabel auf die Torte, die ungefähr doppelt so groß war wie mein Kopf. »Wir können das natürlich auch alleine essen«, sagte sie. »Zwei Tage lang reicht das bestimmt. Kuchen zum Frühstück, Sahneschicht zum Mittagessen, angebratener Boden zum Abendessen. Wie klingt das?«
»Fett«, sagte ich.
Sie lachte und spuckte die Torte fast über ihre Seidenbluse. Als sie sich wieder gefangen hatte, legte sie ihre Gabel auf das Tablett.
»Manchmal hält man es mit einem Menschen nicht mehr aus«, sagte sie. »Man weiß, dass man zusammenbricht, wenn man länger bleibt, und deshalb macht man sich davon. Aber es ist ein schmaler Grat, denn das sind meistens die Menschen, die machen, dass wir uns am lebendigsten fühlen.«
Ich zuckte die Achseln – da war ein Flackern in ihrem Blick, wie immer, wenn das Thema meinen Vater streifte. Ich hatte ihn nie kennengelernt und wusste nicht, wo er war. Sie schaute mich an, ihr Blick ging tiefer als reine Sorge um mich.
»Themawechsel«, sagte sie. »Wegen der Abschiedsfeier morgen – ich hoffe, ich bin rechtzeitig wieder da, wenn nicht, musst du dir ein Taxi nehmen.«
»Ich könnte zur Turnhalle auch laufen«, sagte ich.
»Nicht in den hohen Hacken.«
Sie nahm meine Hand. »Es tut mir leid, dass du heute alleine feiern musst. Bekomme ich Pluspunkte dafür, dass ich jeden Tag deinen Geburtstag feiere?«
»Du bekommst Pluspunkte für ein Geschenk«, sagte ich.
Meine Mutter lächelte.
Sie tippte auf ein Kästchen, das auf dem Tablett stand. Vor lauter Torte hatte ich es übersehen. Es war aus Holz und mit einer Schleife umwickelt.
»Mach es auf«, sagte sie.
Ich zog an einem Band der Schleife und hob den Deckel an.
Eine geschliffene Träne brach das Lampenlicht. Lichtpunkte tanzten über die Wand.
»Dein Vater hat es mir zu meinem achtzehnten Geburtstag geschenkt«, sagte sie, aber dieses Mal klang nichts in ihrer Stimme mit. Sie hatte sich von den Erinnerungen losgemacht, bevor sie mir das Kästchen gegeben hatte.
Der Anhänger hing an einer Silberkette, und ich streifte sie mir über den Kopf.
»Es ist wie in deiner Lieblingsgeschichte.«
»Die kleine Meerjungfrau«, sagte ich.
Weit hinaus im Meer ist das Wasser so blau, wie die Blätter der schönsten Kornblume, und so klar, wie das reinste Glas, aber es ist sehr tief, tiefer als irgend ein Ankertau reicht; viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Boden bis über das Wasser zu reichen.
»Danke.«
Sie beugte sich vor und küsste mich auf den Kopf. »Ich sehe dich morgen.« Sie nahm das Tablett und verschwand aus dem Raum.
Ich löschte das Licht. Um meinen Hals spürte ich den feinen Zug des Anhängers. Es war ein guter Anfang eines Geburtstags, dachte ich. Aber da kannte ich Bens Geschenk ja noch nicht.
Nur zwei Stunden später jaulte mein Wecker, und ich wachte zum zweiten Mal auf.
Ich verfluchte Melissas Party. Nächstes Mal würde ich sie bestimmt davon abhalten, so viele Leute einzuladen – oder ich würde mich selbst davon abhalten, ihr fürs Aufräumen zuzusagen. Trotzdem zog ich mich an und radelte zu ihr.
Melissa öffnete mir gähnend die Tür. Ihr Bob war verwuschelt, und ihr rundes Gesicht zerknautscht von zu viel Alkohol und zu wenig Schlaf.
»Hey«, sagte sie und umarmte mich. »Alles, alles Gute zum Geburtstag, du Rumpraline. Mögen die Umpalumpas immer auf deinem Rasen tanzen.« Sofort fühlte ich mich weniger genervt – Umarmungen waren Melis Spezialität, und ihr weicher Körper war geschaffen dafür. Sie war genauso groß wie ich (also ziemlich klein), nur breiter, deshalb waren wir perfekt umarmungskompatibel.
Sie tappte vor mir her in die Küche.
»Cornflakes?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf, und sie stellte nur eine Müslischale voll Kaffee vor mich auf den Tisch, bevor sie sich auf ihren üblichen Platz auf der Eckbank setzte.
Die Küche sah schlimm aus, und meine Laune sank weiter. Die ganze Anrichte war voll dreckigem Geschirr, dazwischen zerknüllte Servietten und angekautes Essen. Draußen würde es noch mehr davon geben.
»Wenn du gestern länger geblieben wärst, hätten wir dir ein Ständchen gesungen«, sagte Melissa. »Aber ich kann verstehen, warum du gegangen bist.«
Sie machte eine Pause, um mir die Möglichkeit zu geben, das Thema selbst anzuschneiden, aber sie kannte mich zu gut, um das ernsthaft zu erwarten.
»Es war ein Schock, dass er wieder da war, oder?«
Ich nickte nur.
»Hast du schon mit ihm geredet?«
Ich schüttelte den Kopf.
Außer meiner Mutter war Melissa die Einzige, die wusste, dass ich mir Sorgen um Ben gemacht hatte. Ich hatte sogar seine Mutter angerufen, der es wie erwartet ziemlich egal war, wo Ben war, und die mir in Erinnerung rief, dass er volljährig sei und machen könne, was er wolle. Nicht, dass ich den Monat nur zu Hause rumgesessen und mich gelangweilt hätte – ich hatte meine Nachhilfeschüler durch das Schuljahr gebracht, war bei den Stadtmeisterschaften einen zweiten Platz auf die zehn Kilometer gelaufen und hatte meine Cousine in London besucht. Aber der Gedanke an Ben war stärker geworden, je länger er weg war, wie eine Wunde, die sich langsam entzündete.
»Weißt du, was du ihm sagen willst?«
Wieder schüttelte ich den Kopf. Ich wollte nicht noch mal das gleiche Gespräch führen, das ich heute Morgen schon mit meiner Mutter gehabt hatte. Außerdem wusste ich selbst noch nicht genau, was ich Ben sagen würde.
Melissa seufzte. »Manchmal, ganz manchmal, ist Reden besser als Grübeln, weißt du?«
Sie hievte sich von der Bank und ließ Spülwasser einlaufen. Sollte ich ihr erzählen, worüber Ben und ich gestritten hatten? Dass er fand, dass Fabian viel zu langweilig für mich war? Wie ich ihn angeschrien hatte, weil ich wütend war, dass er sich darüber ein Urteil erlaubte? Und wie wütend ich erst geworden war, als ich in der Funkstille danach festgestellt hatte, dass er recht hatte.
Nein, ich erzählte nichts. Stattdessen schüttelte ich eine Mülltüte auf und ging nach draußen, um den Abfall einzusammeln.
Die Stelle, wo das Lagerfeuer gewesen war, sah bei Tageslicht anders aus, und die Geschichte war schon weitergezogen. Ein glitzernder Tau kühlte die Luft und meine Gedanken, als ich anfing, den Müll einzusammeln.
Hatte mir der Monat nicht gezeigt, wie es in ein paar Wochen sowieso sein würde – mit mir in Regensburg und Ben in Berlin? Unter unserer bücherfressenden Quatsch-Fassade waren wir sehr unterschiedlich. Wir strebten in unterschiedliche Richtungen. Als hätten wir uns an den Händen gehalten und uns um die eigene Achse gewirbelt, bis die Beschleunigung jetzt zu stark wurde und uns auseinanderriss.
Noch etwas fiel mir auf: Tränen sehen aus wie Tau.
Als ich wieder in die Küche kam, den vollen Müllsack hinter mir herziehend, war Melissa schon am Abtrocknen. Sie sah mein Gesicht und legte das Geschirrtuch weg.
»Setz dich erst mal«, sagte sie und drückte mir ein Päckchen in die Hand.
Vorsichtig löste ich die Schleife und faltete das Papier auseinander: ein Sandsack und eine Schaufel.
»Just in case«, sagte Melissa. »In Regensburg gibt es öfter Hochwasser.«
»Danke.« Ich umarmte sie.
Sie setzte sich neben mich auf die Eckbank. »Das ist ein leichter Themenwechsel, aber da ist noch etwas. Teresa ist in meiner Tanzgruppe, das weißt du, oder?«
Teresa war Bens ältere Schwester. Er hatte auch noch eine jüngere Schwester, Nathalie. Ich fragte mich, was jetzt kommen würde.
»Ich habe es dir nicht erzählt, um dich nicht aufzuregen, aber als Ben verschwunden war und du dir offensichtlich Sorgen gemacht hast, obwohl du den Mund nicht aufbekommen hast, habe ich sie nach ihm gefragt. Sie hat nur ›keine Ahnung‹ genuschelt und sich dann in den Spagat gesetzt. Rücken gerade. Thema erledigt. Da war er schon zwei Wochen weg. Ihr Bruder. Und es war ihr komplett egal. Es schien ihr sogar besser zu gehen als sonst.«
»Wie war das, als Bens Vater gestorben ist?«, fragte ich.
Melissa nickte. »Es war komisch, als sie weg war, weil es bei den Wettbewerben auf einmal so leise war. Normalerweise hat sie immer Stimmung gemacht. Sie hat wochenlang gefehlt, und als sie zurückkam, war sie gebrochen. Sie zuckte zusammen, wenn man zu schnelle Bewegungen machte, und man war vorsichtig, wenn man mit ihr herumalberte, weil jedes Wort einen falschen Gedanken lostreten konnte.«
ENDE DER LESEPROBE