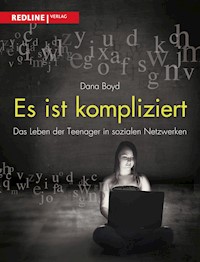
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Für Jugendliche sind Onlineplattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube zu völlig normalen Bestandteilen ihres Alltags geworden. Doch welche Auswirkungen haben diese Netzwerke auf ihr Leben und wie beeinflussen sie ihr Handeln und Denken? Für ihr Buch hat Danah Boyd über mehrere Jahre hinweg unzählige Jugendliche mit unterschiedlichstem sozialem und ethnischem Background zu ihren Onlinetätigkeiten befragt und diese untersucht. Dabei deckt sie einige der typischen Vorurteile und Mythen über den Gebrauch sozialer Netzwerke bei jungen Leuten auf und macht deutlich, dass der Versuch von Eltern und Gesellschaft, Jugendliche vor den Gefahren des Internets schützen zu wollen, nicht immer sinnvoll ist. Ein spannendes, verständlich geschriebenes Buch, welches das Phänomen und die Faszination der Onlinenetzwerke auf Jugendliche erklärt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
[email protected]
1. Auflage 2014
© 2014 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© 2014 by danah boyd
Die englische Originalausgabe erschien 2014 bei Yale University Press unter dem Titel It‘s complicated.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Almuth Braun
Redaktion: Jordan T. A. Wegberg, Berlin
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, München
Umschlagabbildung: istockphoto.com
Satz: Carsten Klein, München
E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-86881-555-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-666-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-667-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Inhalt
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
Einführung
1. Identität – Warum wirken Jugendliche online so merkwürdig?
2. Privatsphäre – Warum teilen Jugendliche alles der Öffentlichkeit mit?
3. Internetsucht
4. Gefahrenquelle Internet – Lauern überall Sexualstraftäter?
5. Cybermobbing – Werden Gehässigkeit und Grausamkeit von sozialen Medien noch verstärkt?
6. Ungleichheit – Lassen sich mit sozialen Medien soziale Gräben überwinden?
7. Internetkompetenz – Ist die heutige Jugend von Natur aus technisch versiert?
8. Auf der Suche nach ihrer eigenen Öffentlichkeit
Anhang: Demografische Daten zu den befragten Jugendlichen
Danksagung
Über die Autorin
Literaturhinweise
Anmerkungen
Vorwort
Es war das Jahr 2006, und ich befand mich im Norden von Kalifornien, wo ich mit Jugendlichen über ihre Nutzung sozialer Medien chattete. Dabei lernte ich Mike kennen, einen fünfzehnjährigen YouTube-Fanatiker.1 Mit Leidenschaft beschrieb er mir ein Video mit dem Titel »Extreme Diet Coke and Mentos Experiments«, das kurz zuvor große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. Heerscharen von Internetnutzern klickten YouTube an, um sich die schäumenden Fontänen anzusehen, die entstehen, wenn man die Pfefferminzbonbons mit Cola light mischt. Mehrere Teenager hatten dieses Experiment durchgeführt, einfach weil sie sehen wollten, was passiert – Mike war einer von ihnen. Er war völlig aus dem Häuschen und wollte mir unbedingt das selbst gedrehte Video zeigen, das ihn und seine Freunde dabei zeigte, wie sie mit handelsüblichen Lebensmitteln experimentierten.
Während er mich durch seine zahlreichen weiteren YouTube-Videos geleitete, erklärte er mir, dass er sich in seiner Schule für Studienzwecke eine Videokamera ausleihen konnte. Die Schule spornte ihre Schüler dazu an, als Teil von Gruppenarbeiten Videos oder andere Medien herzustellen, um sie anschließend im Unterricht zu präsentieren. Mike und seine Freunde liehen die Kamera üblicherweise freitags aus. Zunächst machten sie die Aufnahmen für ihre Gruppenprojekte, und anschließend stand ihnen die Kamera für das restliche Wochenende zur Verfügung, um unterhaltsamere Videos zu erstellen.
Keines der Videos zeichnete sich durch eine besondere Qualität aus, und obwohl sie sie bei YouTube zur öffentlichen Ansicht hochluden, wurden diese Videos nur von ihren Freunden angesehen. Trotzdem gerieten sie stets in helle Aufregung, wenn ein weiterer Besucher das Video anklickte – selbst wenn es nur ein Freund war, den sie mehr oder weniger dazu genötigt hatten.
Während wir uns unterhielten, lachten und Mikes Videos ansahen, machte Mike plötzlich eine Pause und sah mich mit ernstem Gesicht an. »Können Sie mir einen Gefallen tun?«, fragte er. »Könnten Sie mit meiner Mutter reden und ihr sagen, dass ich nichts Unrechtes im Internet mache?« Ich antwortete nicht gleich, und so setzte er nach, um jeden Zweifel auszuräumen. »Ich meine, sie denkt, dass alles im Internet schlecht ist. Sie scheinen aber zu verstehen, worum es geht, und Sie sind eine Erwachsene. Können Sie nicht mit ihr sprechen?« Ich lächelte und versprach ihm, mein Bestes zu tun.
Dieses Buch ist nichts weiter als das: mein Versuch, das vernetzte Leben Jugendlicher denjenigen zu beschreiben und zu erklären, die sich um Jugendliche Sorgen machen – Eltern, Lehrern, politischen Entscheidungsträgern, Journalisten und gelegentlich auch Gleichaltrigen. Dieses Buch ist das Produkt achtjähriger Bemühungen zur Erforschung der verschiedenen Aspekte der Begeisterung von Jugendlichen für soziale Medien und andere Netzwerktechnologien.
Um mir einen Eindruck vom Internetverhalten Jugendlicher zu machen, reiste ich zwischen 2005 und 2012 kreuz und quer durch die USA und interviewte und beobachtete Jugendliche aus 18 Bundesstaaten und einem breiten Spektrum an sozioökonomischen und ethnischen Gemeinschaften. Ich verbrachte unzählige Stunden damit, Jugendliche mithilfe der Spuren, die sie über soziale Netzwerke, Blogs und andere soziale Medien hinterließen, zu beobachten. Ich verbrachte Zeit mit Jugendlichen in Schulen, öffentlichen Parks, Einkaufsmeilen, Kirchen und Fastfood-Restaurants.
Um noch tiefer in diesen besonderen Themenbereich einzudringen, führte ich zwischen 2007 und 2010 166 formale, semistrukturierte Interviews mit Jugendlichen in ihrem häuslichen Umfeld, in der Schule und an verschiedenen öffentlichen Plätzen.2
Einführung
Eines Abends im September 2010 befand ich mich bei einem Football-Match der High School auf der Tribüne eines Sportstadions in Nashville, Tennessee, und hatte ein eindrucksvolles Déjà-vu-Erlebnis. In den 1990er Jahren hatte ich als Mitglied des Marschorchesters meiner High School zahllose Freitagabende auf Tribünen in ganz Pennsylvania verbracht und die Footballmannschaft meiner Schule angefeuert, um hinterher mit meinen Freunden ausgehen zu können. Die Szene im Sportstadion in Nashville im Jahr 2010 hätte genauso gut zu meiner High-School-Zeit vor zwanzig Jahren stattfinden können. Es war ein ganz und gar amerikanischer Abend, wie er klassischer nicht hätte sein können. Ich musste angesichts dieser Ironie innerlich lächeln, weil ich doch in Nashville war, um mit Jugendlichen darüber zu sprechen, wie die Technologie ihr Leben verändert hatte. Während ich also auf der Tribüne saß, dachte ich: Je mehr sich verändert hat, desto mehr scheint alles gleich geblieben zu sein.
Ich erinnere mich, dass ich mit einem Jugendlichen namens Stan sprach, den ich drei Jahre zuvor in Iowa kennengelernt hatte. Er hatte mir gesagt, ich solle aufhören, nach Unterschieden zu suchen. »Sie wären überrascht, wie wenig sich die Dinge ändern. Ich nehme an, die emotionalen Dramen sind immer noch dieselben, nur das Format hat sich geändert. Man könnte sagen, der Schrifttyp und die Hintergrundfarbe sind heute anders.« Er spielte auf technologische Aspekte an, um mich daran zu erinnern, dass die Technologie eigentlich nichts Wesentliches verändert hatte.
In Nashville schrien die Cheerleader aus Leibeskräften »Verteidigung« und wirbelten ihre bunten Pompons durch die Luft, während sich Jungs im Frack und Mädchen in schicken Kleidern am Rande des Footballfelds zu tummeln begannen und signalisierten, dass es kurz vor der Halbzeit war. Dies war ein Spiel im Rahmen der traditionellen Homecoming-Feier, und zur Halbzeit marschierte die Abordnung der Schülervertreter – der Homecoming Court – in Formation und offizieller Uniform aufs Feld, bevor der Moderator sie dem Publikum vorstellte und den Ballkönig und die Ballkönigin – Homecoming King und Homecoming Queen – kürte. Die Abordnung bestand aus acht Mädchen und acht Jungen, die zur Hälfte weiß und zur Hälfte schwarzer Hautfarbe waren. Ich dachte über das Fehlen asiatisch- oder hispanischstämmiger Jugendlicher in einer Stadt nach, deren demografische Zusammensetzung in Veränderung begriffen war. Der Moderator stellte jedes Mitglied vor und hob dabei ihre Freizeitinteressen, ihre Aktivität in einer der lokalen Kirchen und ihre Zukunftsträume hervor.
Währenddessen saß die Mehrheit der Schüler auf der Tribüne. Sie waren in den Farben ihrer Schule gekleidet, und nicht wenige hatten sich zur moralischen Unterstützung ihrer Mannschaft auch das Gesicht entsprechend bemalt. Allerdings achteten sie kaum auf die Geschehnisse auf dem Spielfeld. Abgesehen von einem kurzen Blick auf den Homecoming Court verbrachten sie die meiste Zeit damit, sich zu unterhalten und die seltene Chance zu nutzen, als Freunde und Schulkameraden echte unverplante Freizeit zu genießen.
Wie an vielen Schulen, die ich im Verlauf der Jahre besucht habe, wurden die Freundschaften an der Schule in Nashville im Wesentlichen von Rassen- und Geschlechtszugehörigkeit, sexuellen Neigungen und Jahrgangsstufen bestimmt, und diese Netzwerke waren auf einen Blick sichtbar; man musste nur darauf achten, wer sich mit wem unterhielt oder wer mit wem zusammensaß. Generell befanden sich die Schüler in ihrem eigenen Bereich an den Seitenrändern der Tribüne, während die Eltern und die »ernsthafteren« Fans die Sitzreihen im Mittelbereich einnahmen. Die meisten Schüler waren weiß und nach Jahrgangsstufen unterteilt: Die Angehörigen höherer Jahrgänge saßen in den Reihen, die dem Spielfeld am nächsten lagen, während die Jüngsten weit nach hinten verwiesen worden waren. Die Mädchen saßen selten allein mit einem Jungen zusammen, aber wenn, dann hielten sie Händchen.
Die Teenager, die sich unterhalb und rechts von der Tribüne tummelten, repräsentierten einen anderen Teil der Schule. Anders als ihre Mitschüler auf der Tribüne waren die meisten Schüler, die sich unten tummelten, schwarz. Abgesehen vom Homecoming Court war nur eine Gruppe rassengemischt, und diese unterschied sich von den anderen hauptsächlich durch ihr »künstlerisches« Äußeres – leuchtend bunte Haarfarben, Piercings und schwarze Kleidung, die nach meiner Kurzanalyse von Hot Topic stammte, einem beliebten Geschäft der gleichnamigen Bekleidungskette im Einkaufszentrum, das Gothic-, Punk- und andere Subkulturklamotten verkaufte.
Lediglich zwei Dinge waren ein klares Indiz dafür, dass dies nicht 1994 war: die Mode und die Mobiltelefone. Fort waren die von den 1980er Jahren inspirierten Ponyfrisuren, Dauerwellen und die exzessive Verwendung von Haargel und Haarspray, die meine High-School-Zeit bis weit in die 1990er Jahre geprägt hatten. Und anders als 1994 waren die Mobiltelefone allgegenwärtig. Soweit ich es beurteilen konnte, hatte jeder Teenager an diesem Abend ein solches Gerät: iPhones, Blackberrys und andere teure Smartphones schienen an dieser High School der oberen Mittelschicht besonders beliebt zu sein. Es überrascht nicht, dass die Telefone der weißen Studenten oft teurer oder die Marken elitärer waren als bei ihren schwarzen Mitschülern.
Die Allgegenwart der Mobiltelefone auf der Tribüne ist eigentlich kein aufregendes Thema: Bereits 2010 besaßen mehr als 80 Prozent der High-School-Studenten ein solches Gerät.3 Überraschend war vielmehr – zumindest für die meisten Erwachsenen –, dass die Jugendlichen sie kaum als Telefone benutzten. Die Teenager, die ich beobachten konnte, riefen niemanden an. Sie machten Fotos vom Homecoming Court, und viele tippten Textnachrichten wie die Weltmeister, während sie versuchten, sich gegenseitig in der Menge auszumachen. Sobald sie sich gefunden hatten, hörten sie im Allgemeinen auf zu schreiben.
Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen das Telefon tatsächlich klingelte, war die typische Antwort ein genervtes »Mom!« oder »Dad!«, was darauf hindeutete, dass ein Elternteil angerufen hatte, um sich nach dem Rechten zu erkundigen, und – wie man an der Reaktion ablesen konnte – eine äußerst unerwünschte Unterbrechung darstellte. Und obwohl viele Teenager fleißige Texter zu sein schienen, widmeten sie den Großteil ihrer Aufmerksamkeit nicht den Mobiltelefonen. Wenn sie sich mit ihren Handys beschäftigten, zeigten sie den Bildschirm oft der Person, die neben ihnen saß, um sich gemeinsam irgendetwas anzusehen.
Die Eltern auf der Tribüne waren weitaus intensiver mit ihren Telefonen beschäftigt. Sie waren durchweg mit Smartphones ausgerüstet, und diese nahmen ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Ich konnte nicht ausmachen, ob sie ihre E-Mails prüften oder das Football-Match einfach durch andere Inhalte aufpeppten, weil sie entweder gelangweilt oder abgelenkt waren. Viele Erwachsene starrten jedoch intensiv auf die Bildschirme ihrer Telefone und sahen kaum auf, wenn ein Touchdown erzielt wurde. Und anders als die Jugendlichen teilten sie weder Textnachrichten noch Fotos mit ihren Sitznachbarn.
Zwar beklagen viele Eltern, die ich kennengelernt habe, die Handybesessenheit ihrer Kinder, aber die Jugendlichen von Nashville behandelten ihre Telefone in erster Linie als eine glorifizierte Kamera mit Koordinierungsfunktion. Der Grund lag auf der Hand: Ihre Freunde saßen gleich neben ihnen; daher brauchten sie kein Telefon.
Ich war nach Nashville gekommen, um besser zu verstehen, wie soziale Medien und andere Technologien das Leben von Jugendlichen verändert hatten. Ich war von den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien fasziniert, die seit meiner High-School-Zeit entstanden waren. Ich hatte meine eigenen Jugendjahre online verbracht und gehörte zur ersten Generation von Teenagern, die ihr Leben weitgehend im Internet verbrachten. Allerdings war das eine andere Zeit: Anfang der 1990er Jahre waren nur wenige meiner Freunde überhaupt an Computern interessiert. Und mein eigenes Interesse am Internet hatte mit meiner Unzufriedenheit mit meiner lokalen Gemeinde zu tun. Das Internet eröffnete mir eine weite Welt, bevölkert von Menschen, die meine speziellen Interessen teilten und bereit waren, sie zu jeder Tages- und Nachtzeit zu diskutieren. Ich wuchs in einer Zeit auf, in der Internetsurfen ein Fluchtmechanismus war, und ich wollte meiner Umgebung unbedingt entfliehen.
Die Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, benutzen beliebte soziale Medien wie Facebook und Twitter oder Mobiltechnologien wie Apps und Textmessaging aus ganz unterschiedlichen Gründen. Anders als ich und andere sogenannte »Early Adopters« – so werden die Menschen bezeichnet, die zu den ersten Anwendern einer neuen Technologie gehören –, die wir einen Bogen um unsere lokale Gemeinde machten und uns stattdessen lieber in Chatrooms und Bulletinboards tummelten, gehen die meisten Jugendlichen heute online, um mit Leuten aus ihrer Gemeinde virtuell zusammenzutreffen. Ihre Online-Teilnahme ist nicht exzentrisch; sie ist ganz normal und wird sogar erwartet.
Am Tag nach dem Football-Match in Nashville interviewte ich ein Mädchen, das auch bei dem Spiel gewesen war. Wir saßen zusammen und scrollten durch ihre Facebook-Seite, auf der sie mir verschiedene Fotos vom Vorabend zeigte. Während des gesamten Spiels hatte sie nicht an Facebook gedacht, aber sobald sie zu Hause angekommen war, lud sie ihre Fotos ins Netz, taggte ihre Freunde und begann, die Fotos der anderen zu kommentieren. Die Status-Updates, die ich auf ihrer Facebook-Seite sah, waren angefüllt mit Verweisen auf Gespräche, die während des Spiels stattgefunden hatten. Sie nutzte Facebook, um den Spaß zu verlängern, den sie während des Football-Matches mit ihren Klassenkameradinnen gehabt hatte. Auch wenn sie anschließend keine weitere physische Zeit mit ihnen verbringen konnte, blieb sie mit ihren Freundinnen über Facebook in Kontakt.
Soziale Medien spielen im Leben vernetzter Teenager eine maßgebliche Rolle. Auch wenn sich die spezifischen Technologien ändern, bieten sie Jugendlichen insgesamt einen Raum, in dem sie sich aufhalten und virtuell mit Freunden zusammentreffen können. Diese virtuellen Treffen ergänzen oder unterstützen zum Teil ihre persönlichen Begegnungen. Im Jahr 2006, als sich MySpace auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit befand, teilte die 18-jährige Skyler ihrer Mutter mit, dass MySpace absolut unabdingbar für ihr Sozialleben war. Sie erklärte: »Wenn du nicht bei MySpace bist, existierst du einfach nicht.« Damit meinte Skyler, dass die soziale Akzeptanz von der Fähigkeit abhängt, mit anderen an einem »coolen« Ort zusammenzutreffen.
Jede Altersgruppe hat andere Räume, die für sie cool sind. Das war einst das Einkaufszentrum, und für die heutige Jugend, die Thema dieses Buches ist, sind es soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches gibt es unweigerlich schon wieder neue Apps und Tools, die soziale Netzwerke möglicherweise altmodisch erscheinen lassen. Der virtuelle Ort mag sich ändern, aber die Organisationsprinzipien sind immer die gleichen.
Zwar treffen sich Jugendliche immer noch im Einkaufszentrum und bei Footballspielen, aber die Entstehung der sozialen Medien hat die Landschaft definitiv verändert. Sie ermöglichen die Schaffung eines als »cool« empfundenen Treffpunkts, ohne dass man sich physisch von dem Ort wegbewegen muss, an dem man sich gerade befindet. Aufgrund einer Reihe sozialer und kultureller Faktoren haben sich die sozialen Medien zu einem wichtigen öffentlichen Raum entwickelt, an dem Teenager informell zusammentreffen und mit anderen Teenagern kommunizieren können. Jugendliche suchen nach ihrem eigenen Ort, um die Welt jenseits ihres häuslichen Zimmers zu begreifen. Die sozialen Medien haben ihnen ermöglicht, vernetzte Öffentlichkeiten – wie ich sie nenne – zu erschaffen und an ihnen teilzunehmen.
In diesem Buch dokumentiere ich, wie und warum soziale Medien im Leben so vieler Teenager von maßgeblicher Bedeutung sind und wie sie sich mithilfe dieser Technologien in vernetzten Öffentlichkeiten bewegen, die sie selbst erschaffen haben.4 Ich beschreibe und hinterfrage außerdem die Ängste und Befürchtungen vieler Erwachsener mit Bezug auf die intensive Nutzung der sozialen Medien seitens der Jugendlichen. Indem ich ihre Praktiken, Gewohnheiten und die Spannungen zwischen Teenagern und Erwachsenen beleuchte, versuche ich wichtige Erkenntnisse über das vernetzte Leben der heutigen Jugend zu vermitteln.
Was sind soziale Medien?
Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts haben sich die sozialen Medien von einem esoterischen Technologiegewirr in eine Reihe von Websites und -services verwandelt, die den Kern der heutigen Kultur ausmachen. Jugendliche haben Zugriff auf ein riesiges Spektrum beliebter Online-Dienste, um miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, Informationen weiterzugeben oder einfach nur virtuell gemeinsam Zeit zu verbringen. Auch wenn sich dieses Buch mit einer ganzen Bandbreite an vernetzten Technologien beschäftigt, einschließlich des Internets als übergeordneter Kategorie und mobiler Dienste wie des Versands von Textnachrichten, konzentriert sich ein Großteil auf eine Auswahl von Online-Diensten, die als soziale Medien bezeichnet werden.
Ich verwende den Begriff soziale Medien für alle Websites und -services, die in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts entstanden sind, einschließlich sozialer Netzwerke, Video-Sharing-Sites, Blogging- oder Microblogging-Plattformen und verwandter Tools, und die es den Teilnehmern ermöglichen, ihre eigenen Inhalte zu erschaffen und mit anderen zu teilen. Abgesehen von dem Bezug auf verschiedene Kommunikationstools und -plattformen weisen soziale Medien auch auf eine kulturelle Mentalität hin, die sich Mitte der 2000er Jahre als Teil des technischen und unternehmerischen Phänomens herausgebildet hat und als »Web 2.0« bezeichnet wird.5 Die Plattformen, die als soziale Medien bekannt sind, sind weder die ersten noch die einzigen Tools, die eine virtuelle soziale Interaktion ermöglichen beziehungsweise Teenager in die Lage versetzen, an für sie wichtigen Online-Communitys teilzunehmen. Auch wenn sie inzwischen nicht mehr so beliebt sind wie früher, werden Tools wie E-Mail, Instant Messaging und Online-Foren nach wie vor von Jugendlichen verwendet. Als kulturelles Phänomen haben jedoch die sozialen Medien die Informations- und Community-Landschaft geprägt.
In den 1980er und 1990er Jahren verwendeten die Pioniere unter den Internetnutzern Dienste wie E-Mail und Instant Messaging, um mit Bekannten zu chatten. Wenn sie mit Unbekannten kommunizieren wollten, gingen sie in öffentliche Chatrooms und Bulletinboards. Zwar wurden viele Leute, die an den ersten Online-Communitys teilnahmen, echte Freunde, aber die meisten Early Adopters begaben sich in diese öffentlichen Räume, ohne die anderen Teilnehmer zu kennen. Online-Communitys waren nach Themen organisiert, wobei es für jeden Themenbereich – vom Nahen Osten über Gesundheitsratschläge bis zur Entdeckung der Funktionsweise verschiedener Programmiersprachen – einen eigenen Chatroom gab.
Ungefähr ab dem Jahr 2003 konfigurierte die zunehmende Beliebtheit des Bloggings und der sozialen Netzwerke diese themenorientierte Landschaft neu. Wenngleich die meisten sichtbaren Blogging-Plattformen dazu beitrugen, Menschen mit gemeinsamen Interessen im Netz zusammenzubringen, schrieb die überwältigende Mehrheit der Blogger für Leute, die sie kannte, und las auch nur die Blogs von Bekannten.6 Die ersten sozialen Netzwerke wie Friendster und MySpace waren darauf ausgerichtet, ihren Nutzern neue Bekanntschaften zu ermöglichen und vor allem die Freunde von Freunden kennenzulernen, die womöglich die gleichen Interessen, die gleichen Leidenschaften und den gleichen Geschmack teilten. Vor allem Friendster wurde als Website für Partnersuche konzipiert.
Mit anderen Worten: Soziale Netzwerke waren auf soziales Netzwerken ausgerichtet. Was diesen Diensten jedoch zu derart unerwarteter Beliebtheit verhalf, war der Umstand, dass sie außerdem eine Plattform boten, auf der Leute ihre Freunde treffen konnten. Anstatt sich auf die Freunde von Freunden zu konzentrieren, die sie über diese Services erreichen konnten, kommunizierten viele Early Adopters einfach mit ihren Freunden. Auf dem Gipfel seiner Popularität lautete die Tagline von MySpace »A Place for Friends« (»Ein Ort für Freunde«), und das traf die Bedeutung dieser Website im Kern.
Soziale Netzwerke haben das Wesen der Online-Communitys verändert. Während die ersten Online-Community-Tools wie Usenet und Bulletinboards nach Interessen organisiert waren, selbst wenn sie dazu benutzt wurden, um mit Freunden in Kontakt zu treten, waren Blogs wie auch Homepages nach Individuen organisiert. Über Links konnte man Freunde und andere Personen markieren, die dieselben Interessen teilten. In den sozialen Netzwerken spielten die Interessen keine so große Rolle mehr; stattdessen wurde die Freundschaft zum Organisationsprinzip.
Early Adopters hatten die Internettechnologien schon lange genutzt, um mit anderen zu kommunizieren, allerdings eher im Rahmen einer Massenkultur; die Teilnahme an Online-Communitys galt oft als esoterische Praxis für Internetbesessene und andere soziale Außenseiter. Im Rahmen der massenhaften Verbreitung der Internetnutzung und des Aufstiegs der sozialen Netzwerke – insbesondere MySpace, Facebook und Twitter – Mitte der 2000er Jahre wurden der Informationsaustausch und das virtuelle Zusammentreffen mit Freunden für viele Menschen, vor allem die Jugendlichen, die damals gerade das Erwachsenenalter erreichten, zum integralen Bestandteil des täglichen Lebens. Die Teilnahme an sozialen Medien galt nicht mehr als Subkultur, sondern als normatives Verhalten.
Wenngleich Teenager zahllose Tools zur Kommunikation verwenden, ist ihr Engagement in sozialen Netzwerken beispiellos. Jugendliche, die 2013 Facebook, Instagram oder Tumblr nutzten, galten nicht als absonderlich – genauso wenig wie Jugendliche, die Anfang bis Mitte der 2000er Jahre Xanga, LiveJournal oder MySpace nutzten. Auf der Höhe ihrer Popularität werden die bekanntesten sozialen Medien weder mit Geringschätzung betrachtet, noch gilt die Teilnahme daran als Zeichen für asoziale Tendenzen. Wie ich im Verlauf dieses Buches immer wieder betone, ist sie vielmehr ein ganz normaler Bestandteil des täglichen Lebens, so wie Fernsehen oder Telefonieren. Hier hat seit meiner Erfahrung mit frühen digitalen Technologien eine erhebliche Veränderung stattgefunden.
Auch wenn viele der Tools und Dienste, die ich im Verlauf des Buches nenne, inzwischen aus der Mode sind, sind die Kernaktivitäten, über die ich spreche – Chatten, sich unterhalten, Selbstausdruck, der Kampf um die Privatsphäre und der Austausch von Medien und Informationen –, zu festen Dauerthemen geworden. Die spezifischen Sites und Apps mögen sich ständig verändern, aber die Praktiken, mit denen Jugendliche sich in vernetzten Öffentlichkeiten tummeln, sind dieselben. Neue Technologien und mobile Apps verändern fortwährend die Landschaft, aber der Umgang von Teenagern mit sozialen Medien über ihre Mobiltelefone erweitert ähnliche Vorgehensweisen und Aktivitäten auf geografisch völlig unabhängige Umgebungen. Die technischen Veränderungen, die seit Beginn dieses Projekts und zwischen der Entstehung und der Lektüre dieses Buches stattgefunden haben, sind wichtig, allerdings reichen viele der Argumente, die auf den folgenden Seiten genannt sind, über bestimmte technische Momente hinaus, selbst wenn die konkreten Beispiele, die ich zur Verdeutlichung verwendet habe, zeitlich festgeschrieben sind.
Die Bedeutung von vernetzten Öffentlichkeiten
Jugendliche suchen mit Leidenschaft ihren Platz in der Gesellschaft. Was als Ergebnis der sozialen Medien anders ist, ist der Umstand, dass der immer gleiche Wunsch der Jugendlichen nach sozialer Eingebundenheit und Autonomie heute in vernetzten Öffentlichkeiten ausgedrückt wird. Vernetzte Öffentlichkeiten sind Öffentlichkeiten, die von vernetzten Technologien restrukturiert wurden. Als solche sind sie gleichzeitig (1) der Raum, der durch vernetzte Technologien entsteht, und (2) die imaginäre Community, die sich als Ergebnis der Schnittstelle aus Menschen, Technologie und Praxis bildet.7 Zwar wird der Begriff öffentlich in der Alltagssprache vielfach verwendet und hat eine klare Bedeutung, allerdings neigt das Konstrukt der Öffentlichkeit – von Öffentlichkeiten ganz zu schweigen – eher dazu, akademischer Natur zu sein. In dieser Hinsicht kann Öffentlichkeit ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Es kann sich um einen frei verfügbaren Raum handeln, an dem sich Menschen nach Belieben zusammenfinden können. Eine Öffentlichkeit kann aber auch, wie der Politikwissenschaftler Benedict Anderson schreibt, eine Ansammlung von Menschen sein, die sich als Teil einer imaginären Gemeinde empfinden.8 Menschen sind Teil vielzähliger Öffentlichkeiten, die sich als Publikumsgruppen oder nach geografischen Aspekten bilden, und dennoch überschneiden sie sich oft beziehungsweise sind miteinander verflochten. Die Reden von US-Präsidenten zur Lage der Nation wurden zwar meist mit Blick auf die amerikanische Öffentlichkeit verfasst, aber ihre Ansprachen sind inzwischen weltweit abrufbar. Als Folge ist nie ganz klar, wer zu der Öffentlichkeit gehört, die sich der Präsident im Geiste vorgestellt hat.
Öffentlichkeiten dienen unterschiedlichen Zwecken. Sie können politischer Natur sein oder um gemeinsame Identitäten und soziale Praktiken herum gebildet sein. Das Konzept einer Öffentlichkeit beschwört oft das Bild einer staatlich kontrollierten Einrichtung herauf, aber Öffentlichkeiten können auch private Akteure beinhalten, zum Beispiel Unternehmen, oder kommerzielle Räume, zum Beispiel Einkaufszentren. Aufgrund der Involvierung der Medien in die heutige Öffentlichkeit sind Öffentlichkeiten auch mit dem Konzept des Publikums verbunden. Alle diese Konstrukte verschwimmen und werden von Wissenschaftlern infrage gestellt.
Indem ich den Begriff Öffentlichkeiten verwende, versuche ich nicht, in dieser Debatte Position zu beziehen, sondern ein breites Spektrum von unterschiedlichen, miteinander verflochtenen Themen zu nutzen, die dieser Begriff signalisiert. Öffentlichkeiten bieten Menschen einen Raum und eine Gemeinschaft, um sich zu treffen, Kontakt zu knüpfen und dazu beizutragen, eine Gesellschaft nach unserem Verständnis zu bilden.
Vernetzte Öffentlichkeiten sind Öffentlichkeiten sowohl im räumlichen Sinne als auch im Sinne einer imaginären Gemeinde oder Community. Sie entstehen durch und auf Basis von sozialen Medien und anderen aufstrebenden Technologien. Als Räume existieren die vernetzten Öffentlichkeiten, weil soziale Medien den Menschen ermöglichen, zusammenzukommen und sich auszutauschen, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam Spaß zu haben. Von Technologien erzeugte vernetzte Öffentlichkeiten dienen den gleichen Funktionen wie öffentliche Räume, wie zum Beispiel Einkaufszentren oder Parks früheren Generationen von Jugendlichen dienten. Als soziale Gebilde erzeugen soziale Medien vernetzte Öffentlichkeiten, die den Menschen ermöglichen, sich als Teil einer breiteren Gemeinschaft wahrzunehmen. So wie gemeinsames Fernsehen Jugendlichen einst ermöglichte, sich über den Konsum von Massenmedien verbunden zu fühlen, ermöglichen soziale Medien den heutigen Jugendlichen, sich selbst als Teil einer kollektiven imaginären Gemeinschaft wahrzunehmen.
Teenager nutzen vernetzte Öffentlichkeiten aus den gleichen Gründen, aus denen sie schon immer Öffentlichkeiten gesucht haben: Sie wollen Teil der Welt sein, indem sie Kontakt zu anderen Menschen suchen und ihre Bewegungsfreiheit nutzen. Ähnlich fürchten viele Erwachsene vernetzte Technologien aus den gleichen Gründen, aus denen sie die Teilnahme der Jugend am öffentlichen Leben und ihre Zusammenkünfte in Parks, Einkaufszentren und an anderen von Jugendlichen frequentierten Plätzen schon immer misstrauisch beäugt haben. Wenn ich eines aus meinen Recherchen gelernt habe, dann dies: Soziale Medien wie Facebook und Twitter eröffnen Jugendlichen neue Gelegenheiten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, und ebendiese Bewegungsfreiheit ist das, was viele Erwachsene am meisten besorgt.
Zwar werden die Strukturen, die physischen Räumen zugrunde liegen, sowie die Beziehungen, die diese Räume ermöglichen, in der Breite verstanden, allerdings sind sowohl die Architektur der vernetzten Räume als auch die Wege, über die das Zusammentreffen verschiedener Menschen und der zwischenmenschliche Austausch stattfinden, anders. Selbst wenn Jugendliche motiviert sind, sich an vernetzten Öffentlichkeiten zu beteiligen, um ihren Wunsch nach sozialem Austausch zu befriedigen, der älter ist als das Internet, haben vernetzte Technologien das soziale Ökosystem verändert und damit die soziale Dynamik beeinflusst.
Um zu unterscheiden, was neu ist und was nicht, ist es wichtig zu verstehen, auf welche Weise die Technologie neue soziale Möglichkeiten eröffnet und auf welche Weise diese die bisherigen Annahmen über den täglichen zwischenmenschlichen Austausch infrage stellen. Das Design und die Architektur von Umgebungen begünstigen bestimmte Typen der Interaktion. Runde Tische sind für einen offenen Austausch förderlicher als eine Reihenbestuhlung, wie sie für Schulklassen üblich ist. Zwar kann sich ein Schüler umdrehen und mit der Person hinter ihm sprechen, eine typische Schulklassenbestuhlung ist jedoch in erster Linie auf Frontalunterricht ausgerichtet, bei dem sich alles auf die Lehrkraft konzentriert.
Die besonderen Eigenschaften beziehungsweise Charakteristiken einer Umgebung lassen sich als Affordanzen9, das heißt als Elemente mit unmittelbar wahrnehmbarem Aufforderungs- beziehungsweise Angebotscharakter verstehen, die Nutzerreize aussenden, weil sie bestimmte Praktiken ermöglichen und in einigen Fällen bewusst zu einer bestimmten Nutzung aufrufen, auch wenn sie nicht bestimmen, welche Praktiken sich entfalten.10 Die Affordanzen einer bestimmten Technologie oder eines Raums zu verstehen ist wichtig, weil dies erklärt, welche Elemente Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele nutzen oder ignorieren können. Die Affordanz eines dreifach verglasten Fensters ermöglicht, dass sich die Menschen sehen, aber nicht hören können. Um miteinander zu kommunizieren, greifen sie vielleicht zu Pantomime, halten geschriebene Botschaften hoch oder zerbrechen das Fensterglas. Die Affordanzen des Fensters treffen keine Vorhersage darüber, wie die Menschen miteinander kommunizieren werden, so oder so gestalten sie jedoch die Situation.
Weil vernetzte Öffentlichkeiten mit Technologie zu tun haben, besitzen sie andere Eigenschaften als traditionelle physische öffentliche Räume. Insbesondere vier Affordanzen prägen zahlreiche der medienbestimmten Umgebungen, die von sozialen Medien geschaffen werden:
•Persistenz: die Dauerhaftigkeit der Online-Inhalte und Ausdrucksformen;•Sichtbarkeit: das potenzielle Publikum, das darüber Zeugnis ablegen kann;•Verbreitbarkeit: die Leichtigkeit, mit der sich die Inhalte weiterleiten und austauschen lassen;•Auffindbarkeit: die Möglichkeit, Inhalte zu finden.Diese Affordanzen sind zwar an sich nicht neu, aber ihre gegenseitigen Verflechtungen, die mit den vernetzten Öffentlichkeiten entstanden sind, schaffen neue Chancen und Herausforderungen. Inhalte, die mithilfe sozialer Medien verbreitet werden, sind oft sehr lange abrufbar, weil Technologien darauf ausgerichtet sind, Persistenz zu ermöglichen. Die Tatsache, dass Inhalte oft langlebig sind, birgt erhebliche Implikationen. Unter anderem ermöglicht sie einen asynchronen Austausch. Alice kann Bob mitten in der Nacht schreiben, während Bob tief und fest schläft. Doch wenn er morgens aufwacht oder drei Wochen später von einem Sommerlager zurückkommt, ist Alices Nachricht immer noch da, selbst wenn Alice sie längst vergessen hat.
Persistenz bedeutet, dass Gespräche, die über soziale Medien geführt werden, nicht flüchtig, sondern langlebig sind. Persistenz ermöglicht andere Formen der Interaktion als ein flüchtiges Gespräch, das zum Beispiel in einem Park geführt wurde. Alices Nachricht verflüchtigt sich nicht in dem Moment, in dem Bob sie liest; vielmehr kann er sie so lange aufheben, wie er möchte. Persistenz bedeutet auch, dass die Äußerungen derjenigen, die soziale Medien nutzen, in nie dagewesener Weise »protokolliert« werden.
Mithilfe sozialer Medien können die Menschen sich mit einem breiten Publikum austauschen und aus großen Entfernungen auf alle möglichen Inhalte zugreifen, was die potenzielle Sichtbarkeit jeder einzelnen Nachricht erhöht. Meistens sind die Inhalte, die Menschen mithilfe sozialer Medien online stellen, für eine breite Nutzerbasis abrufbar, weil die meisten Systeme darauf ausgelegt sind, Mitteilungen standardmäßig einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Viele populäre Systeme verlangen von ihren Nutzern, dass sie die Sichtbarkeit ihrer Mitteilungen aktiv eingrenzen, wenn sie nicht wollen, dass jeder sie sehen kann. Das unterscheidet die virtuellen von physischen Räumen, in denen die Menschen bewusste Anstrengungen unternehmen müssen, damit ihre Mitteilungen einem breiten Publikum zur Verfügung stehen.11 In vernetzten Öffentlichkeiten sind Mitteilungen im Allgemeinen automatisch öffentlich und werden nur durch bewusste Eingrenzung privat.
Soziale Medien sind oft darauf ausgerichtet, Menschen bei der Verbreitung von Informationen zu unterstützen, sei es durch die ausdrückliche oder stillschweigende Aufforderung, Links weiterzugeben, durch das Angebot von Reblogging- oder Favoriting-Tools, mit denen man Bilder oder Texte neu versenden kann, oder durch eine einfache Copy-and-paste-Funktion, mit der sich Inhalte von einem Ort auf einen anderen übertragen lassen. Ein Großteil der Inhalte, die Nutzer online stellen, ist daher mit wenigen Klicks leicht verbreitbar.12 Einige Systeme bieten »Forward«-, »Repost«- oder »Share«-Buttons zur Weiterleitung von Inhalten an speziell gegliederte und betreute Empfängerlisten. Selbst wenn diese Funktionen nicht bereits ins System integriert sind, lassen sich die Inhalte oft leicht herunterladen oder duplizieren und anschließend weiterversenden. Die Leichtigkeit, mit der jeder Nutzer Informationen online mit anderen teilen kann, ist beispiellos. Das kann positiv und äußerst effektiv, aber auch problematisch sein. Die leichte Verbreitbarkeit von Inhalten kann dazu dienen, Menschen für ein politisches Anliegen zu mobilisieren, sie kann aber auch dazu führen, dass sich üble Gerüchte wie ein Lauffeuer verbreiten.
Seit dem Aufkommen von Suchmaschinen sind die Mitteilungen anderer Menschen auch leicht auffindbar. Meine Mutter hätte für ihr Leben gern einen Suchknopf gedrückt, um zu sehen, wo meine Freunde und ich uns aufhielten und worüber wir redeten. Heute kann jeder neugierige Nutzer Datenbanken anzapfen und zahllose Nachrichten abrufen, die andere geschrieben haben. Selbst Mitteilungen, die für den öffentlichen Zugriff bestimmt sind, wurden nicht unbedingt mit dem Gedanken online gestellt, dass sie über eine Suchmaschine immer wieder aufgerufen werden können. Suchmaschinen machen es leicht, geheime Gedankenaustausche ans Licht zu bringen. Sie sind oft darauf ausgelegt, kontextbezogene Hinweise auszuschalten, womit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass aus dem inhaltlichen Zusammenhang gerissene Suchergebnisse kritiklos übernommen werden.
Keine der Möglichkeiten, die soziale Medien eröffnen, ist wirklich neu. Die Briefe, die sich meine Großeltern während ihrer Werbephase schrieben, waren langlebig. Mitteilungen, die in Schulzeitungen oder an Toilettenwänden verewigt wurden, sind äußerst sichtbar. Klatsch und Tratsch haben sich schon immer wie ein Lauffeuer verbreitet. Und auch wenn Suchmaschinen die Suche nach bestimmten Themen oder Begriffen effizienter gemacht haben, ist die Praxis, sich nach einer Person oder einer Sache zu erkundigen, nicht neu, auch wenn Suchmaschinen bedeuten, dass niemand davon erfährt. Was neu ist, ist die Art und Weise, wie soziale Medien die sozialen Situationen verändern und verstärken, indem sie technische Merkmale bieten, die die Menschen bei ihrer Suche nutzen können.
Durch den Einsatz dieser neuen Instrumente tragen die Nutzer zur Schaffung neuer sozialer Dynamiken bei. Zum Beispiel »stalken« Jugendliche sich gegenseitig, indem sie nach sichtbaren, langlebigen Daten über Menschen suchen, die sie interessant finden. Öffentlichkeitsstarke emotionale Auseinandersetzungen – unter Jugendlichen auch »Drama« genannt – entstehen gerne dann, wenn Jugendliche die Sichtbarkeit von Klatsch und Gerüchten erhöhen, indem sie diese möglichst schnell und auffällig in vernetzte Öffentlichkeiten tragen. Jugendliche suchen auch gerne nach Aufmerksamkeit, indem sie die Affordanzen Auffindbarkeit, Verbreitbarkeit und Persistenz bis zu ihren Grenzen ausschöpfen, um die Sichtbarkeit der YouTube-Videos ihrer Garagenband zu maximieren. Die speziellen Tools, die Jugendliche nutzen, erwecken den Eindruck, dass sich die zugrunde liegenden Motivationen und sozialen Prozesse nicht sehr verändert haben.
Nur weil Jugendliche soziale Medien manipulieren können und das auch tun, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, bedeutet das nicht, dass sie darin entsprechend erfahren sind oder automatisch die Fähigkeit besitzen, die daraus entstehenden Konsequenzen zu steuern. Es bedeutet einfach, dass Jugendliche sich im Allgemeinen mit sozialen Medien wohler fühlen und ihnen gegenüber weniger Berührungsängste haben als Erwachsene.
Sie versuchen nicht, zu analysieren, auf welche Weise die Dinge technologiebedingt anders sind; sie versuchen einfach, sich mit einer öffentlichen Welt zu identifizieren, in der Technologie eine feste Größe ist. Aufgrund ihrer sozialen Position ist es nicht die Technologie, die für sie neuartig ist, sondern das öffentliche Leben, das durch die Technologie ermöglicht wird. Jugendliche lechzen danach, Zugang zum öffentlichen Leben zu haben und es zu verstehen. Die Technologien zu begreifen, die diese Öffentlichkeiten ermöglichen, ist daher eine Selbstverständlichkeit.
Erwachsene besitzen dagegen eine weitaus größere Freiheit, verschiedene öffentliche Umgebungen zu erkunden. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie vernetzte Öffentlichkeiten mit anderen Öffentlichkeiten vergleichen und auch besser dazu in der Lage sind. Im Ergebnis konzentrieren sie sich stärker auf die scheinbar radikale Andersartigkeit der vernetzten Öffentlichkeiten im Vergleich zu physischen Öffentlichkeiten wie der Kneipe an der Straßenecke oder der Kirchengemeinde. Aufgrund ihrer jeweiligen Erfahrung und ihrer Lebensphase konzentrieren sich Jugendliche und Erwachsene typischerweise auf unterschiedliche Dinge. Während sich Jugendliche auf die Frage konzentrieren, was es bedeutet, öffentlich zu sein, konzentrieren sich Erwachsene eher auf die Frage, was es bedeutet, vernetzt zu sein.
Im Verlauf dieses Buches kehre ich immer wieder zu den zuvor genannten vier Affordanzen zurück, um zu diskutieren, wie sich die Nutzung vernetzter Öffentlichkeiten auf die täglichen sozialen Praktiken auswirkt. Hier ist jedoch der Hinweis angebracht, dass das nicht die Art und Weise ist, wie Jugendliche die Veränderungen beschreiben würden, die sich vollziehen. Meistens sind sie sich gar nicht darüber im Klaren, warum sich die vernetzten Öffentlichkeiten, in denen sie sich bewegen, von anderen Öffentlichkeiten unterscheiden, oder warum Erwachsene vernetzte Öffentlichkeiten so merkwürdig finden. Für Jugendliche sind diese Technologien und ihre Eigenschaften einfach ein offensichtlicher Teil des Lebens in einem vernetzten Zeitalter, während die Affordanzen für viele Erwachsene Veränderungen enthüllen, die sie als zutiefst irritierend empfinden. Wenn ich im Verlauf des Buches diese Themen erneut aufgreife, werde ich die Sichtweise der Jugendlichen den Ängsten und Befürchtungen der Erwachsenen gegenüberstellen, um deutlich zu machen, was sich verändert hat und was gleich geblieben ist.
Neue Technologien, alte Hoffnungen und Befürchtungen
Jede neue Technologie, die breite Aufmerksamkeit erfährt, wird vermutlich Ängste, wenn nicht sogar eine handfeste Panik auslösen. Als die Nähmaschine erfunden wurde, gab es Befürchtungen, die Tretbewegungen, die Frauen beim Nähen machen mussten, könnten negative Auswirkungen auf die weibliche Sexualität haben.13 Als der Walkman aufkam, hieß es, das sei eine teuflische Erfindung, die dazu führen würde, dass die Menschen in Parallelwelten abdriften und ihre Fähigkeit verlieren, mit anderen zu kommunizieren.14 Technologien sind nicht die einzigen kulturellen Produkte, die diese sogenannten moralischen Panikattacken auslösen; auch neue Mediengenres gaben Anlass zu angsterfüllten Kommentaren. Die Erfinder der Comics, der Spielhallen und des Rock ’n’ Roll galten als sinistre Figuren, die nichts anderes im Sinn hatten, als aus Kindern jugendliche Straftäter zu machen.15 Romane galten als Gefahr für die weibliche Moral, eine Sorge, die Gustave Flauberts Roman Madame Bovary aufs Eindrucksvollste dramatisiert. Selbst von Sokrates heißt es, dass er mit Hinweis auf die Folgen für das Gedächtnis und die Fähigkeit, Wahrheiten zu vermitteln, vor den Gefahren des Alphabets und des Schreibens gewarnt habe.16 Heute klingen diese Befürchtungen lächerlich, aber als diese neuen Technologien beziehungsweise Medien zum ersten Mal auftauchten, wurden sie sehr ernst genommen.
Selbst die flüchtigste Bekanntschaft mit der Geschichte der Information und der Kommunikationstechnologien weist darauf hin, dass moralische Paniken episodischer Natur sind und mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Das gilt auch für utopische Visionen, die sich einfach als unrealistisch erweisen. Ein beliebtes T-Shirt, das von John Slabyk entworfen wurde und über die Website Threadless verkauft wird, bringt die Desillusion über technologische Utopien auf den Punkt:
•Sie haben uns belogen•Dies sollte die Zukunft sein•Wo ist mein Raketenrucksack,•wo ist mein Roboterkamerad,•wo ist mein Abendessen in Pillenform,•wo ist mein wasserstoffbetriebenes Auto,•wo ist mein atomstrombetriebenes Schwebehaus,•wo ist meine Heilung für diese Krankheit.Technologien werden oft als Lösung für große Weltprobleme gepriesen. Wenn diese Lösungen nicht eintreffen, sind die Menschen desillusioniert. Das kann zu einer Gegenreaktion führen, da sich die Menschen plötzlich auf all die schrecklichen Dinge konzentrieren, die vielleicht gerade wegen dieser Technologien passieren können.
Ein großer Teil dieser Ängste und Befürchtungen im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien durch junge Menschen ist das Ergebnis von Missverständnissen oder geplatzten Hoffnungen.17 Was aus der Verwirrung der Menschen entsteht, nimmt meistens die Form utopischer und dystopischer Rhetorik an. Dieses Problem wird im Verlauf dieses Buches immer wieder auftauchen. Gelegentlich, zum Beispiel im Fall von Sexualstraftätern und anderen internetbezogenen Sicherheitsproblemen, sind es Missverständnisse, die zu einer moralischen Panik führen. In anderen Fällen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Schreckensvision, dass Jugendliche süchtig nach sozialen Medien sind, oder der utopischen Vorstellung, dass sich Ungleichheit durch Technologie beseitigen lässt, verschleiert die Fixierung auf Technologie einfach die Wirkung anderer Dynamiken.
Beide Extreme beruhen auf einer Form des magischen Denkens, das Wissenschaftler als technologischen Determinismus bezeichnen.18 Utopische und dystopische Visionen gehen gleichermaßen davon aus, dass Technologien eine intrinsische Macht besitzen, die auf alle Menschen in allen Situationen auf die gleiche Weise einwirkt. Die utopische Rhetorik geht davon aus, dass die Übernahme einer Technologie durch die Masse der Menschen zu einer umwälzenden Veränderung der Gesellschaft führt, während dystopische Visionen auf mögliche Schreckensszenarien fokussieren, die nach Meinung ihrer Verfechter Wirklichkeit werden, wenn sich eine vermeintlich zerstörerische Technologie in der Breite durchsetzen sollte. Diese Hysterien sind für das Verständnis der tatsächlichen Entwicklungen und Dynamiken, die sich im Falle einer breiten Akzeptanz einer neuen Technologie entfalten, gleichermaßen ungeeignet. Die Realität ist nuancenreich, ungeordnet und birgt sowohl Vor- als auch Nachteile. Das Leben in einer vernetzten Welt ist kompliziert.
Kinder bleiben Kinder
Wenn man den Stimmen der Jugend lauscht, enthüllt die Geschichte, die man sich daraus zusammenreimen kann, eine bunte Mischung an Chancen und Herausforderungen, Veränderungen und Kontinuität. Genau wie beim Football-Match in Nashville sind zahlreiche Elemente der amerikanischen Jugendkultur im digitalen Zeitalter unverändert geblieben. Die Schule macht einen sehr vertrauten Einruck, und viele der Befürchtungen und Hoffnungen, die meine Jugend geprägt haben, sind heute immer noch erkennbar. Andere sind auffällig anders; was sie jedoch so anders macht, hat weniger mit Technologie und mehr mit einer verstärkten Konsummentalität und einem intensiveren Wettbewerb um den Zugang zu beschränkten Möglichkeiten zu tun sowie mit dem erheblichen Druck, den insbesondere Eltern aus wohlhabenderen Kreisen ausüben.19 Oft ist es leichter, sich auf die Technologie einzuschießen als auf die breiteren systemischen Probleme, die hier im Spiel sind. Das liegt daran, dass die technischen Veränderungen leichter wahrnehmbar sind.
Die Wehmut nach vergangenen Zeiten behindert das Verständnis der Beziehungen zwischen Jugendlichen und Technologie. Erwachsene mögen im Rückblick ihre Kindheit idealisieren und dabei die Kämpfe und Probleme vergessen, die sie auszufechten hatten. Viele Erwachsene, die ich kennenlerne, gehen einfach davon aus, dass ihre eigene Kindheit besser und intensiver, einfacher und sicherer war als die vernetzte, digitale Welt, in der die heutige Jugend aufwächst. Sie assoziieren den Aufstieg der digitalen Technologie mit sozialem, intellektuellem und moralischem Untergang. Die Rechercheergebnisse, die ich hier vorstelle, lassen eher vermuten, dass das Gegenteil der Fall ist.
Zahlreiche der oft und laut diskutierten Befürchtungen im Zusammenhang mit Technologie sind keineswegs neu (zum Beispiel Mobbing), sondern fördern eher Fehlannahmen (zum Beispiel die Befürchtung, das Internet beeinträchtige die Aufmerksamkeitsfähigkeit) oder lenken von den wahren Risiken ab (zum Beispiel im Hinblick auf sexuelle Aggressoren). Die meisten Mythen entstehen im Zusammenhang mit wahren Vorfällen oder Daten, die aus dem Zusammenhang gerissen oder bewusst aufgebauscht werden, um Ängste zu schüren. Die Medienkultur übertreibt diese Dynamik, indem sie Befürchtungen anheizt und Ängste schürt. Damit Erwachsene die Stimmen der Jugend hören können, müssen sie ihre Vergangenheitsnostalgie und ihre Befürchtungen überwinden. Das ist keine leichte Aufgabe.
Jugendliche befinden sich in der unbequemen Position zwischen Kindheit und Erwachsenendasein, zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Sie kämpfen darum, ihre eigene Identität zu finden, die nicht allein von Familienbanden bestimmt wird. Sie wollen nicht nur als Sohn, Tochter, Schwester oder Bruder wahrgenommen werden. Diese Kämpfe um die Selbstfindung finden auf vertraute Weise statt, indem Jugendliche um Freiheit kämpfen, während sie allerdings nicht immer bereit oder in der Lage sind, Verantwortung und Pflichten zu akzeptieren. Jugendliche lieben und hassen, brauchen ihre Eltern und andere Erwachsene und lehnen sie gleichzeitig vehement ab. Umgekehrt haben viele Erwachsene Angst vor Jugendlichen und um sie.
Die Bemühungen von Jugendlichen, ihre Selbstdarstellung zu steuern, oft durch Kleidungsstile und Frisuren, die ihre Eltern gesellschaftlich inakzeptabel finden, oder durch Verhaltensweisen, die ihre Eltern riskant finden, stehen eindeutig im Zusammenhang mit ihrem übergeordneten Streben nach Selbstdarstellung und persönlicher Autonomie. Indem sie sich kleiden wie Popsternchen, signalisieren sie ihren Wunsch, als unabhängige junge Erwachsene wahrgenommen zu werden. Modeentscheidungen gehören zu den vielen Ausdrucksmöglichkeiten, die dazu dienen, eine eigene Identität zu entwickeln, die weniger von Familie und stärker von Altersgenossen geprägt ist.
Bedeutsame Freundschaften zu entwickeln ist eine Kernkomponente des Reifeprozesses. Freunde bieten vieles: Rat, Unterstützung, Unterhaltung und eine emotionale Verbindung, die der Einsamkeit entgegenwirkt. Sie erleichtern den Übergang zum Erwachsenendasein, indem sie einen Kontext fern der Familie und des häuslichen Umfelds bieten. Zwar ist die Familie immer noch wichtig, aber viele Jugendliche nehmen begeistert die Chance wahr, Beziehungen zu knüpfen, die nicht familiär vorgegeben, sondern bewusst von ihnen selbst ausgewählt sind.
Die Bedeutung von Freunden für die soziale und moralische Entwicklung ist zweifelsfrei dokumentiert.20 Die Befürchtungen rund um die Nutzung der sozialen Medien durch Jugendliche übersehen diesen grundlegenden Wunsch nach sozialer Verbindung jedoch. Oft projizieren Eltern ihre Werte auf ihre Kinder und erkennen nicht, dass für die meisten Jugendlichen die Schule nicht das wichtigste Anliegen ist. Viele Eltern fragen sich: Warum kleben meine Kinder an ihren Mobiltelefonen oder texten ununterbrochen mit Freunden, selbst wenn sich diese im selben Raum befinden? Warum drängt es sie, hundertmal am Tag Facebook nach neuen Mitteilungen zu überprüfen? Sind sie technologieabhängig, oder verschwenden sie einfach nur wertvolle Zeit? Wie werden sie es aufs College schaffen, wenn sie ständig abgelenkt sind? Diese Fragen werden mir bei öffentlichen Vorträgen von besorgten Eltern immer wieder gestellt, und dieses Verhalten von Jugendlichen ist in Elternratgebern und Artikeln über die intensive Nutzung sozialer Medien durch Jugendliche ein dominierendes Thema.
Wenn wir die sozialen Motivationen anerkennen, die dem Verhalten der Jugendlichen zugrunde liegen, erscheinen diese Fragen jedoch weitaus weniger dringlich und schwierig. Die meisten Jugendlichen sind nicht von den technischen Geräten als solchen fasziniert, sondern von Freundschaft. Die Geräte sind nur als Mittel für einen sozialen Zweck interessant. Darüber hinaus mag der soziale Austausch eine Ablenkung von der Schule sein, aber oftmals nicht vom Lernen. Wenn man diese grundlegenden sozialen Dynamiken im Auge behält, wirkt das Phänomen des vernetzten Teenagers plötzlich nicht mehr so besorgniserregend und seltsam.
Denken Sie zum Beispiel an die weit verbreitete Befürchtung der Internetabhängigkeit. Gibt es Jugendliche, die eine ungesunde Beziehung zu Technologie haben? Gewiss. Aber die meisten Jugendlichen, die »süchtig« nach ihrem Mobiltelefon oder ihrem Computer sind, sind eigentlich nur von dem Wunsch beseelt, in einer Welt, in der die Möglichkeiten zu einem persönlichen Treffen stark eingegrenzt sind, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Besessenheit der Jugendlichen von ihren Freundschaften geht einher mit dem Wunsch, die öffentlichen Räume zu erobern, die Erwachsenen frei zugänglich sind. Die Möglichkeit, öffentliche Räume zum sozialen Austausch aufsuchen zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil des Reifeprozesses. Allerdings sind viele öffentliche Räume, in denen sich Erwachsene treffen – Bars, Clubs und Restaurants –, für Jugendliche nicht zugänglich.
In der Übergangsphase von der Kindheit ins Erwachsenendasein versuchen Jugendliche, ihren Platz in der Welt zu finden. Sie wollen sich in öffentlichen Räumen aufhalten, aber sie blicken auch auf Erwachsene, einschließlich öffentlicher Figuren, um zu verstehen, was Erwachsensein bedeutet. Sie beobachten ihre Eltern und andere Erwachsene in ihrer Umgebung, um Vorbilder des Erwachsenseins zu finden. Aber sie verfolgen auch Prominente wie Kanye West und Kim Kardashian, um sich die Freiheiten vorzustellen, die sie genießen würden, wenn sie berühmt wären. Im Guten wie im Schlechten tragen Medienstorys dazu bei, eine allgemeine Schilderung der Funktionsweise des öffentlichen Lebens zu entwerfen. Reality-Fernsehshows wie die amerikanische Serie Jersey Shore signalisieren den potenziellen Spaß, den junge Erwachsene haben können, die sich nicht an Eltern und Lehrer anpassen müssen.
Einige Jugendliche mögen die Botschaften des Erwachsenendaseins ablehnen, die sie hören oder sehen, aber sie lernen trotzdem aus all den Signalen, die sie aus ihrer Umgebung empfangen. Wenn sie beginnen, sich selbst als junge Erwachsene wahrzunehmen, spielen sie mit den Grenzen verschiedener Freiheiten und feilschen um Autos und eine Verlängerung der abendlichen Ausgehzeit. Die Entschlossenheit von Jugendlichen, ihre eigenen Interessen und Prioritäten zu definieren, kann für einige Eltern nervenaufreibend sein, insbesondere für diejenigen, die ihre Kinder vor jeder möglichen Gefahr schützen wollen. Das Erwachsenwerden ist angefüllt mit Selbstbestimmung, Risikowagnis und harten Entscheidungen.
Jugendliche wollen oft selbst die Regeln für ihre Freundschaften bestimmen, ohne elterliche Überwachung und in aller Öffentlichkeit. Paradoxerweise ermöglichen ihnen die vernetzten Öffentlichkeiten, in denen sie sich bewegen, ein Maß an Privatsphäre und Autonomie, das zu Hause, wo Eltern und Geschwister oft zuhören können, nicht möglich ist. Das zu erkennen ist wichtig, wenn man die Beziehung Jugendlicher zu sozialen Medien verstehen will. Auch wenn viele Erwachsene das anders sehen, ist das Interesse von Jugendlichen an einem öffentlichen Leben mithilfe sozialer Medien keine Absage an die Privatsphäre. Jugendliche möchten womöglich die Vorteile einer Teilnahme am öffentlichen Leben genießen, fühlen sich aber auch in der Intimität wohl und schätzen die Fähigkeit, ihre soziale Situation steuern zu können. Ihre Fähigkeit, Privatsphäre zu wahren, wird oft von neugierigen Erwachsenen – zumeist Eltern und Lehrern – unterminiert; allerdings unternehmen Jugendliche große Anstrengungen, um innovative Strategien zur Wahrung der Privatsphäre in vernetzten Öffentlichkeiten zu entwickeln.
Soziale Medien ermöglichen eine Art des jugendzentrierten öffentlichen Raums, der ansonsten kaum Zugang bietet. Da dieser Raum jedoch äußerst sichtbar ist, löst er bei Erwachsenen, die Jugendliche bei der Suche nach ihrem Platz in der Welt beobachten, oft Sorgen aus.
Ein Platz, den sie ihr Eigen nennen
Als ich 2007 mit Heather, einem 16-jährigen Mädchen aus einer Kleinstadt im Bundesstaat Iowa, in einem Café saß, kamen wir unter anderem auf die Haltung der Erwachsenen gegenüber Facebook zu sprechen. Heather hatte kurz zuvor gehört, irgendwelche Politiker plädierten dafür, Jugendlichen den Zugang zu sozialen Netzwerken zu verbieten, und war hell empört. »Ich bin wirklich stinksauer. Es ist ein soziales Netzwerk; das ist eine Form der Kommunikation, und wenn sie sie verbieten, wird es wirklich schwer, mit Leuten zu kommunizieren, die man nicht oft sieht.« Ich fragte sie, warum sie ihre Freunde nicht einfach persönlich treffe. Das Klagelied, das darauf folgte, machte deutlich, dass ich einen empfindlichen Nerv getroffen hatte:
Ich kann praktisch niemanden persönlich treffen; ich schaffe es kaum, meine Freunde am Wochenende zu sehen, geschweige denn mich mit Leuten zu treffen, mit denen ich nicht so eng befreundet bin. Ich bin einfach viel zu beschäftigt. Ich habe irrsinnig viel Hausaufgaben zu erledigen, ich habe einen Job, und wenn ich gerade nicht lerne oder arbeite, treffe ich mich mit meinen engen Freunden. Aber es gibt auch Leute, zu denen ich praktisch den Kontakt verloren habe, mit denen ich aber gerne in Kontakt bleiben würde, weil sie letztlich zu meinen Freunden gehören. Ich habe einfach nur länger nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe dazu aber keine Möglichkeit; wenn sie eine andere Schule besuchen, ist das wirklich schwierig, und ich weiß nicht genau, wo jeder Einzelne wohnt, und habe auch nicht alle Handynummern oder ihre jeweiligen E-Mail-Adressen, daher ist Facebook die einfachste Art und Weise, in Kontakt zu bleiben.
Für Heather sind soziale Medien mehr als ein Kommunikationsinstrument; sie sind eine Lebensader, die ihr ermöglicht, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die ihr wichtig sind, die sie aber nicht persönlich treffen kann. Ohne die verschiedenen Websites und -services, so glaubt Heather wie viele der Jugendlichen in ihrem Alter, würde ihr Sozialleben erheblich leiden. Heather hält Facebook nicht für inhärent nützlich, aber das ist einfach der Ort, an dem sich alle ihre Bekannten austauschen. Und es ist der Ort, den sie aufsuchen kann, wenn sie sonst keine Möglichkeit sieht, jemanden zu kontaktieren.
Die sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, sind direkte Nachfolger der physischen Plätze und öffentlichen Orte, an denen sich Teenager seit Jahrzehnten treffen. Was für amerikanische Jugendliche in den 1950er Jahren der Drive-in und in den 1980er Jahren das Einkaufszentrum waren, sind Facebook, SMS, Twitter, Instant Messaging und andere soziale Medien für die heutige Jugend. Dort kommen Jugendliche in dem Wissen zusammen, dass sie ihre Freunde treffen und andere Klassenkameraden und Altersgenossen näher kennenlernen können. Sie nutzen soziale Medien aus ungefähr den gleichen Gründen, aus denen frühere Generationen Jugendlicher zu Rock-’n’-Roll-Tanzveranstaltungen gingen, sich auf Parkplätzen oder den Eingangsstufen eines Hauses versammelten oder für Stunden die Telefonleitung belegten. Jugendliche wollen flirten, quatschen, sich beklagen, Notizen vergleichen, Leidenschaften und Gefühle teilen und herumwitzeln. Sie wollen sich untereinander und ohne Gegenwart Erwachsener austauschen – selbst wenn das bedeutet, dass sie online gehen müssen.
Heathers Leidenschaft für Facebook und andere Internettools bedeutet eine wichtige Veränderung der Erfahrungen von Jugendlichen. Diese Veränderung wurzelt nicht in sozialen Medien, sondern trägt vielmehr zur Erklärung der Popularität digitaler Technologien bei. Viele amerikanische Teenager verfügen über eine begrenzte räumliche Bewegungsfreiheit, wenig Freizeit und sind von zahlreichen Regeln umgeben. In vielen US-Gemeinden sind die Zeiten, in denen Jugendliche nach der Schule bis zur Dunkelheit draußen herumtollten, lange vorbei.21 Viele Jugendliche in Vororten oder ländlichen Gegenden sitzen zu Hause fest, bis sie alt genug sind, um den Führerschein zu machen. Für jüngere Teenager hängt die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, von der flexiblen Zeitplanung und der Bereitwilligkeit ihrer Eltern ab, sie durch die Gegend zu chauffieren.
Außerdem sind Treffen mit Freunden eher eine häusliche Angelegenheit. Oft kommen Jugendliche in häuslicher Umgebung und nicht an öffentlichen Plätzen zusammen. Es ist auch keine Überraschung, dass die Zahl der öffentlichen Räume, die Jugendlichen zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen, aufgrund der zunehmenden Regulierungen immer mehr schrumpft. Das Einkaufszentrum, einst einer der wichtigsten Treffpunkte für Kids aus den Vororten, ist längst nicht mehr so leicht zugänglich wie früher.22 Da Einkaufszentren Privateigentum sind, können die Eigentümer jedem den Zutritt verwehren, und viele von ihnen haben ein Aufenthaltsverbot für Gruppen von Jugendlichen verhängt. Außerdem sind Eltern nur ungern bereit, ihren Kindern den Aufenthalt in Einkaufszentren zu erlauben, aus Sorge, sie könnten dort auf nicht vertrauenswürdige Fremde treffen.
Jugendliche haben einfach kaum noch Plätze, an denen sie sich in der Öffentlichkeit treffen können.23 Der Erfolg der sozialen Medien muss zum Teil als Antwort auf die schrumpfende soziale Landschaft verstanden werden. Facebook, Twitter und MySpace sind nicht nur öffentliche Räume; sie sind oftmals die einzigen »öffentlichen« Räume, in denen sich Jugendliche problemlos mit großen Gruppen Gleichaltriger treffen können. Und das, während sie sich physisch nicht von zu Hause wegbewegen.
Jugendliche haben mir immer wieder gesagt, sie würden sich viel lieber persönlich mit ihren Freunden treffen, aber ihr hektisches und minutiös verplantes Leben, die fehlenden Möglichkeiten der physischen Mobilität und die Sorgen ihrer Eltern hätten persönliche Treffen mit Altersgenossen zunehmend unmöglich gemacht. Amy, eine 16-Jährige aus Seattle, brachte es auf den Punkt: »Meine Mutter lässt mich nicht oft aus dem Haus, daher kann ich nicht viel mehr tun, als bei MySpace mit anderen zu sprechen, zu texten und zu telefonieren, weil meine Mutter immer irgendeinen komischen Grund findet, um mich zu Hause festzuhalten.« Soziale Medien mögen als eigenartiger Ort für jugendliche Zusammenkünfte erscheinen, aber für viele Jugendliche, die Facebook und Twitter nutzen, sind sie die einzige Möglichkeit, sich mit Gruppen von Freunden, Klassenkameraden und anderen Gleichaltrigen zu treffen. Meistens geht ihre Leidenschaft für soziale Medien auf den Wunsch nach einem Sozialleben zurück.
Nur weil Jugendliche gerne soziale Medien zum kommunikativen Austausch nutzen, heißt das nicht, dass sie technologieversiert sind. Viele Teenager sind nicht annähernd so fit, wie die oft getroffene Annahme nahelegt, sie seien »geborene Techies«. Die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen haben, wussten, wie man Google aufruft und dort eine Suchanfrage eingibt, aber sie hatten keine Ahnung, wie man eine Anfrage formuliert, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erhalten. Sie wussten, wie man Facebook benutzt, aber ihr Wissen über die Einstellungen zur Wahrung der Privatsphäre passte nicht zu der Art und Weise, wie sie ihre Konten konfiguriert hatten. Wie die Soziologin Eszter Hargittai so treffend scherzte, sind viele Jugendliche wahrscheinlich eher »Digital Naives« (digitale Naivlinge) als »Digital Natives« (geborene digitale Experten).24
Der Ausdruck Digital Natives ist ein Blitzableiter für die endlosen Hoffnungen und Sorgen, die viele Erwachsene im Zusammenhang mit dieser neuen Generation haben. Medienberichte suggerieren oft, die heutige Jugend, das heißt alle, die mit digitalen Technologien groß geworden sind, verfüge über wundersame neue Supertalente. Ihre Fähigkeit zum Multitasking verblüfft die Erwachsenen angeblich genauso wie ihre dreitausend Textnachrichten pro Monat. Gleichzeitig warnen dieselben atemlosen Medienberichte die Öffentlichkeit, diese Jugendlichen seien für beispiellose neue Gefahren anfällig: sexuelle Übergriffe, Cybermobbing und zahllose Formen des intellektuellen und moralischen Verfalls, einschließlich Internetsucht, Aufmerksamkeitsdefiziten, abnehmender Lese- und Schreibfähigkeiten, leichtsinniger Übermitteilsamkeit und so weiter. Wie die meisten Ängste und Befürchtungen sind sie nicht vollkommen unbegründet, aber oft übertrieben und fehlgeleitet. Der Schlüssel zum Verständnis der Art und Weise, wie Jugendliche sich in sozialen Medien bewegen, liegt darin, sensationslüsterne Schlagzeilen zu ignorieren – im Guten wie im Schlechten – und sich eingehender mit den nuancenreichen Wirklichkeiten junger Menschen zu befassen.
Meine Erfahrung im Zusammentreffen mit Jugendlichen hat mich davon überzeugt, dass die größten Herausforderungen, mit denen sich junge Menschen konfrontiert sehen, keineswegs neu sind. Einige wurzeln in der langen Geschichte der sozialen und rassenbedingten Ungleichheit in den USA; was zunimmt, sind jedoch die Auswirkungen der unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnisse. Amerikanische Jugendliche leben und lernen nach wie vor unter extrem ungleichen Bedingungen. Ich habe Schulen mit hochmoderner Ausstattung, ausgezeichneter Reputation und spezialisierten Abteilungen und Schülern gesehen, die ganz besessen davon sind, eine Eliteuniversität zu besuchen. Umgekehrt habe ich auch heruntergekommene Schulen mit Metalldetektoren an den Türen besucht, in denen eine Vielzahl von »Ersatzlehrern« Vollzeitlehrkräfte ersetzt und die Schüler während des Unterrichts Marihuana rauchen. Die Gründe für diese gewaltigen Unterschiede sind komplex, und die Ungleichheit wird in naher Zukunft kaum behoben werden können.
Auch wenn fast alle Teenager zu diesem Zeitpunkt Zugang zu Technologie haben, variiert dieser sehr stark. Einige besitzen sündhaft teure Smartphones mit Telefon- und Internet-Flatrates, einen eigenen Laptop und drahtlosen Internetzugang zu Hause. Andere besitzen lediglich billige Prepaidtelefone mit Grundfunktionen und können nur mit den Schul- oder Bibliothekscomputern ins Internet gehen, die über entsprechende Zugangsfilter verfügen. Auch hier spielt die wirtschaftliche Ungleichheit eine große Rolle.
Der Zugang ist jedoch nicht die einzige Trennlinie. Technische Fertigkeiten, Medienversiertheit und sogar grundlegende sprachliche Fertigkeiten prägen die Art und Weise, wie Jugendliche die neuen Technologien erleben. Einige lernen den Umgang damit von ihren Eltern, während andere ihren Eltern zeigen, wie man eine Suchanfrage startet oder ein Online-Bewerbungsformular ausfüllt.
Eine der größten Hoffnungen in Bezug auf das Internet lautete, dass es als der große Gleichmacher wirken würde. Meine Recherchen über die Jugendkultur und soziale Medien haben – neben den Ergebnissen anderer Forscher – ergeben, dass die rassenblinde, körperlose soziale Welt, die das Internet hätte ermöglichen sollen, nicht Wirklichkeit geworden ist. Und diese unselige Realität – die Realität der Rassenspannungen und der Rassendiskriminierung, die schon lange vor den digitalen Medien existierte – scheint sich unserer öffentlichen Aufmerksamkeit zu entziehen.
Währenddessen hören wir eine Menge darüber, dass Webspaces, die Teenager frequentieren, sinistre Welten sind, in denen sich vornehmlich sexuelle Aggressoren oder Mobber tummeln. Nur selten erfahren wir, dass viele Teenager gerade außerhalb des Internets Opfer von Mobbing und sexuellen Übergriffen werden. Mobbing, Rassenhass, sexuelle Gewalt, Slut-shaming25 und andere bösartige Praktiken, die im Internet praktiziert werden, sind außerordentlich wichtige Themen, die behandelt werden müssen, auch wenn sie nicht neu sind.
Jungen Menschen dabei zu helfen, sich sicher im öffentlichen Leben zu bewegen, sollte ein wichtiges öffentliches Anliegen sein. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass an diesen Problemen nicht die Technologien schuld sind; sie machen die vorhandenen Probleme nur sichtbarer. Genauso wichtig ist die Erkenntnis, dass die Nachrichtenmedien die Technologien gerne nutzen, um Sensationsstorys über die Jugend zu veröffentlichen. Die öffentliche Sichtbarkeit risikoanfälliger Jugendlicher sollte uns alle aufrütteln, aber es ist nichts damit gewonnen, wenn wir uns lediglich darauf konzentrieren, das, was wir sehen, möglichst unsichtbar zu machen.
Das Internet spiegelt und vergrößert die Realität und macht das Gute, das Schlechte und das Hässliche des Alltags deutlich sichtbar. Indem Jugendliche diese Instrumente übernehmen und in ihren täglichen Gebrauch integrieren, zeigen sie uns, auf welche Weise sich unsere übergeordneten sozialen und kulturellen Systeme auf ihr Leben auswirken. Wenn Jugendliche außerhalb des Internets verletzt werden, zeigen sie ihre Verletzungen öffentlich im Internet. Wenn ihre Erfahrungen von Rassismus und Frauenfeindlichkeit geprägt sind, wird das im Internet sichtbar. Jugendliche tragen die Werte und Überzeugungen, die ihre Erfahrungen außerhalb des Internets geprägt haben, in die sozialen Medien. Als Gesellschaft müssen wir die Sichtbarkeit der sozialen Medien nutzen, um zu verstehen, wie sich die sozialen und kulturellen Verwerfungslinien, die das amerikanische Leben prägen, auf Jugendliche auswirken. Und wir müssen Maßnahmen ergreifen, die den Jugendlichen, die Opfer dieser Verwerfungslinien sind, unmittelbar helfen.
Seit das Internet zum festen Bestandteil des Alltags geworden ist, und insbesondere seit der großen Verbreitung der sozialen Medien werden wir mit Geschichten bombardiert, wie die neuen Technologien unser soziales Geflecht zerstören. Inmitten eines Stroms von Schreckensgeschichten preisen Techno-Utopisten den erstaunlichen Nutzen der Online-Welt, während Cyber-Hasser beschreiben, wie unsere Gehirne durch die fortgesetzte Beschäftigung mit Maschinen zersetzt werden. Diese polarisierenden Sichtweisen von Technologie drängen die Debatte über die Begeisterung der Jugend für soziale Medien in zwei extreme Frontenbildungen: soziale Medien sind gut oder sie sind schlecht. Diese Extreme sowie die hartnäckigen Mythen, die daraus entstehen, verstellen den Blick auf die Wirklichkeit der jugendlichen Gewohnheiten und drohen die Kluft zwischen den Generationen in einen tiefen Abgrund zu verwandeln. Sie verzerren die Realität des Lebens von Jugendlichen – gelegentlich indem sie es idealisieren, aber meistens indem sie es dämonisieren.
Empfehlungen für die Lektüre dieses Buches
Die folgenden Kapitel widmen sich den unterschiedlichen Problemen im Zusammenhang mit der Leidenschaft Jugendlicher für soziale Medien. Viele drehen sich um Befürchtungen im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen, die sich in der amerikanischen Gesellschaft hartnäckig halten. Jedes Kapitel bietet eine solide Grundlage zur Betrachtung eines bestimmten Problems. Zwar kann jedes Kapitel unabhängig von den anderen gelesen werden, jedoch sind sie insgesamt so angeordnet, dass sie sich von individuellen und familienbezogenen Herausforderungen zu breiteren gesellschaftlichen Herausforderungen bewegen. In einer abschließenden Schlussfolgerung fasse ich meine Argumente zusammen und liefere eine eingehende Analyse der Bedeutung, die vernetzte Öffentlichkeiten für die heutige Jugend haben.





























