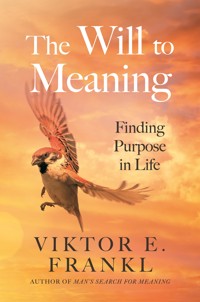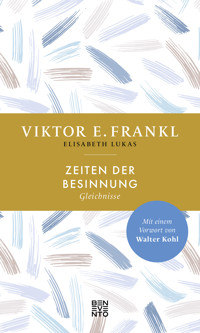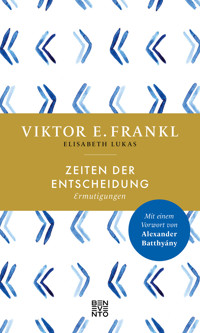19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bisher unveröffentlichte Texte des Psychotherapeuten und Begründers der Logotherapie, Viktor E. Frankl, spiegeln eindrucksvoll die ungebrochene Bereitschaft, jeder Krisensituation im Leben mit der Frage nach dem „Wie?“ zu begegnen. Vor dem Hintergrund neuer Berichte Frankls über das Erlebte im Konzentrationslager bekommt diese Bereitschaft eine existenziell radikale Dimension.
Frankl antwortet in den Texten auf Fragen nach Menschenwürde, Versöhnung, Kriegsfolgen und Daseinsfragen in der ihm eigenen Philosophie. Herausgegeben werden die Texte von Professor Alexander Batthyány. Er leitet das Viktor Frankl Institut in Wien und arbeitet zusammen mit DDr. h.c. Eleonore Frankl den privaten Nachlass Viktor Frankls auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Im Fortsetzungsband des berühmten Holocaustberichtes … trotzdem Ja zum Leben sagen erzählt Viktor E. Frankl von der Zeit unmittelbar nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager. Die teilweise noch unveröffentlichten Texte und Briefe aus dem Privatnachlass gewähren nicht nur überraschende Einblicke in Frankls Biografie, sie dokumentieren auch seine Position zu Fragen nach kollektiver Schuld, Verantwortung und Wiedergutmachung.
Viktor E. Frankl (1905–1997) war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien. Er entwickelte die Logotherapie, wofür er u.a. in San Diego eine Professur erhielt. Seine Erinnerungen … trotzdem Ja zum Leben sagen wurden in 22 Sprachen übersetzt.
Viktor E. Frankl
Es kommt der Tag, da bist du frei
Unveröffentlichte Briefe, Texte und RedenHerausgegeben von Alexander Batthyány
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2015 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: Weiss Werkstatt München
Umschlagmotiv: © picture-alliance / IMAGNO/ Viktor Frankl Institut / Bildnr. 31040334
Abbildungen im Buch: © picture-alliance / IMAGNO/ Viktor Frankl Institut
ISBN 978-3-641-17996-0
www.koesel.de
Für weitere Informationen über Viktor E. Frankl und über Logotherapie und Existenzanalyse:
Viktor Frankl Institut & Archiv Wien
Prinz Eugenstr. 18/12
A-1040 Wien, Österreich
Tel.: +43-676-9345 750
E-Mail: [email protected]
Webseite: www.viktorfrankl.org
Für Elly, der es gelungen ist, den einstigen »homo patiens« in einen homo amans zu verwandeln. Viktor
Inhalt
Einleitung
Editorische Notiz
»Zeitzeugen« Juni 1985
Briefe 1945–1947
Aus dem Konzentrationslager befreit
Was ihr noch leiden solltet, muss ich leiden
Ein Mensch um mich, der imstande war, alles zu wenden
Texte und Beiträge 1946–1948
Was sagt der Seelenarzt zu dieser Zeit?
Vom Sinn und Wert des Lebens
Vom Sinn und Wert des Lebens III
Leben wir provisorisch? Nein: Jeder ist aufgerufen!
Lebenswert und Menschenwürde
Die Existenzanalyse und die Probleme der Zeit
Zur Frage der rassisch verfolgten KZler
Zum letzten Mal: Das verhängte Fenster
Ein Psychotherapeut antwortet auf aktuelle Fragen
»Die Furche« und Spinoza
Nicht der Dieb, sondern der Bestohlene ist schuldig
Die Mörder sind unter uns
Gedenkreden 1949–1988
In memoriam
Versöhnung auch im Namen der Toten
Alle, die guten Willens sind
Viktor E. Frankl: Leben und Werk
Über den Herausgeber
Verwendete Literatur
Anmerkungen
O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen
und was auch unsere Zukunft sei:
Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen,
denn einmal kommt der Tag – Dann sind wir frei!
Refrain des Buchenwaldlieds
Einleitung
von Alexander Batthyány
Alle im Lager wussten es und sagten es einander: es gibt kein Glück auf Erden, das je wiedergutmachen könnte, was wir erleiden. Um Glück war es uns auch nie zu tun – was uns aufrecht hielt, was unserem Leiden und Opfern und Sterben Sinn geben konnte, war nicht Glück. Trotzdem: auf Unglück – darauf war man kaum gefasst. Diese Enttäuschung, die nicht wenigen von den Befreiten in der neuen Freiheit vom Schicksal beschieden war, ist ein Erlebnis, über das diese Menschen nur schwer hinweggekommen sind und, seelenärztlich gesehen, auch sicherlich nicht leicht hinweggebracht werden können. Diese Feststellung ist aber nichts, was den Seelenarzt entmutigen dürfte – im Gegenteil: sie hat ihm Ansporn zu sein, denn sie hat Aufgabencharakter.
So oder so – einmal kommt der Tag, für jeden der Befreiten, an dem er, rückschauend auf das gesamte Erlebnis des Konzentrationslagers, eine merkwürdige Empfindung hat: er kann es nun selber nicht verstehen, wie er imstande war, all das durchzustehen, was das Lagerleben von ihm verlangt hat. Und wenn es in seinem Leben einen Tag gab – den Tag der Freiheit –, an dem ihm alles wie ein schöner Traum erschien, dann kommt einmal der Tag, an dem ihm alles, was er im Lager erlebt, nur mehr wie ein böser Traum vorkommt. Gekrönt wird aber all dieses Erleben des heimfindenden Menschen von dem köstlichen Gefühl, nach all dem Erlittenen nichts mehr auf der Welt fürchten zu müssen – außer seinen Gott.
Mit diesen Zeilen endet Viktor Frankl seinen 1945 verfassten Holocaustbericht … trotzdem Ja zum Leben sagen. Was aber unmittelbar danach geschah: weshalb Frankl in das heimatliche Wien zurückkehrte und wie der ehemalige Lagerhäftling die ersten Tage, Wochen und Monate nach der Befreiung erlebte und unter welchen Lebensumständen er seinen berühmten Holocaustbericht verfasste – all dies ist in … trotzdem Ja zum Leben sagen nicht oder meist nur mit wenigen Worten angedeutet, viel mehr noch blieb aber einer größeren Leserschaft bisher verborgen oder gänzlich unbekannt.
Im Anschluss an seine Vorträge ist Viktor Frankl daher des Öfteren über die Zeit unmittelbar nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager befragt worden. Im Laufe der Jahre und, so scheint es, mit wachsendem zeitlichen Abstand hat Frankl mit zunehmender Offenheit über die ersten Wochen und Monate in der Freiheit erzählt. Ab ungefähr Anfang der 1990er-Jahre hat Frankl dann erstmals persönliche Notizen und Briefe aus seinem Privatarchiv zur Einsichtnahme und Veröffentlichung freigegeben – offenbar in der Überzeugung, dass auch diese bislang kaum beachtete Lebensphase seiner Heim- und Rückkehr es verdiente, vor dem Vergessen bewahrt zu werden; vielleicht auch in der Hoffnung, dass auch über sie zu lesen womöglich jenen, die schon aus der Lektüre von … trotzdem Ja zum Leben sagen Trost und Kraft geschöpft haben, helfen könne, wieder Mut und Zuversicht für ihr eigenes Leben zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund rekonstruiert dieses Buch einige der wichtigsten Stationen und Leitmotive der Befreiung und Heimkehr mithilfe von teilweise noch unveröffentlichten Briefen und Dokumenten aus Viktor Frankls privatem Nachlass in Wien. Eine weitere Intention dieses Buches ist es, ein oft kolportiertes, mitunter aber allzu vereinfachendes Narrativ über Frankls Biografie in den ersten Nachkriegsjahren zu korrigieren. Tatsächlich enthalten einige der hier veröffentlichten Texte und Briefe in dieser Hinsicht auch für Kenner von Frankls Biografie Überraschendes, insofern sie beispielsweise zu einer zurückhaltenderen Lesart etwa der Frage auffordern, wie »leicht« es Frankl fiel, nach der Beendigung der Lagerhaft in vier Konzentrationslagern (Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering und Türkheim) wieder zurück in ein Leben in Freiheit zu finden. Auch zeigen vor allem die frühen politischen Stellungnahmen und Vorträge, um wie viel differenzierter als bisweilen dargestellt Frankls Standpunkt zu Fragen nach kollektiver Schuld, Verantwortung und Wiedergutmachung gewesen ist. Dieses Buch beleuchtet somit als Ergänzungs- und Fortsetzungsband von … trotzdem Ja zum Leben sagen eine im Allgemeinen weniger bekannte Werk- und Lebensphase Viktor Frankls.
Der Textapparat ist in drei Hauptteile gegliedert – der erste, biografische, Teil enthält Briefe und Gedichte aus den Jahren 1945–1947, der zweite Teil enthält Vorträge, Interviews und Stellungnahmen zum Themenbereich Holocaust, Nationalsozialismus und Weltkrieg aus den Jahren 1946 bis 1948; der dritte Teil Gedenkreden aus den Jahren 1949–1988.
Dem ersten Hauptteil vorangestellt ist ein Zeitzeugenbericht Frankls aus dem Jahr 1985. Dieser Vortrag erhellt den lebens- und werkgeschichtlichen Zusammenhang der in diesem Band vorgestellten Texte anhand eines kurzen Abrisses von Frankls Lebensgeschichte in den Jahren 1938 bis 1945.
1. Briefe 1945–1947
Der erste Teil zeichnet anhand von zwischen 1945 und 1947 verfassten Briefen den in den letzten Abschnitten von … trotzdem Ja zum Leben sagen nur anskizzierten Weg der Rückkehr nach. Gegen Ende von … trotzdem Ja zum Leben sagen ist die Beschwerlichkeit dieses Weges ansatzweise angedeutet, wenn Frankl schreibt:
Wehe dem, für den das, was ihn im Lager als Einziges aufrecht gehalten hat – der geliebte Mensch –, nicht mehr existiert. Wehe dem, der jenen Augenblick, von dem er in tausend Träumen der Sehnsucht geträumt hat, nun wirklich erlebt, aber anders, ganz anders, als er sich ihn ausgemalt. Er steigt in die Straßenbahn ein, fährt hinaus zu jenem Haus, das er Jahre hindurch im Geist und nur im Geist vor sich gesehen hat, und drückt auf den Klingelknopf – ganz genauso, wie er es in tausend Träumen ersehnte … Aber es öffnet nicht der Mensch, der nun öffnen sollte –, er wird ihm auch nie mehr die Tür öffnen …
Diese Zeilen gewinnen an zusätzlicher Bedeutung, wenn man sie vor dem Hintergrund von Frankls Biografie liest. In Theresienstadt hatte Frankl den Tod seines Vaters miterlebt, hegte aber bis zuletzt die Hoffnung, dass vor allem seine Mutter und seine erste Frau Tilly Frankl, geborene Grosser, die Lager überlebt hätten. In einem der frühesten erhaltenen Schreiben nach der Befreiung begründet Frankl mit dieser Hoffnung (und der daraus erwachsenen »Gewissensnot«, nach beiden in Wien zu suchen) auch seine vorzeitige Kündigung – zwecks Rückkehr nach Wien – vom Militärspital der Alliierten Truppen im bayerischen Bad Wörishofen, in dem er in den ersten Wochen nach seiner Befreiung als Arzt arbeitete (vgl. Brief an Captain Schepeler, ohne Datum, 1945).
Erst nachdem er die Hoffnung, seine Mutter und seine Frau wiederzusehen, aufgeben musste – Frankl erfuhr noch in München, dass seine Mutter in Auschwitz ermordet wurde, und unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Wien, dass seine erste Frau Tilly in Bergen-Belsen in den Wochen nach der Befreiung an den Folgen der Lagerhaft verstorben war –, spricht Frankl von seinem Überleben nicht mehr als Gnade, sondern als Last. Geblieben war ihm nun nur noch das Bewusstsein der Aufgabe seines geistigen Werks, der Logotherapie und Existenzanalyse, und die Niederschrift seines bereits vor der Deportation begonnenen Buches Ärztliche Seelsorge:
Es ist begreiflich, wenn ich mir im großen Ganzen vorkomme wie ein Junge, der in der Schule nachsitzen muss: die andern sind schon fort, ich bin noch da, ich habe meine Arbeit noch fertig zu machen, dann darf auch ich nach Hause. (23. Juni 1946)
Und:
Kein Glück ist mir in diesem Leben geblieben seit den Martyrien meiner Mutter und meiner jungen Frau. Nichts ist geblieben – außer der Verantwortung gegenüber dem geistigen Werk, das ich zu erfüllen habe – immer noch und trotz, oder: vielleicht auch gerade, weil ich so zu leiden habe. (1945)
Frankl war nach seiner Rückkehr nach Wien tatsächlich außerordentlich produktiv: Er veröffentlichte zwischen 1945 und 1949 acht Bücher, darunter einige der Haupt- und Grundlagentexte der Logotherapie und Existenzanalyse; auch hielt er zahlreiche viel beachtete Vorträge und Rundfunkansprachen im In- und Ausland. Ab Februar 1946 konnte er zudem seine ärztliche Tätigkeit wiederaufnehmen: Frankl wurde zum Vorstand der Neurologischen Abteilung der Wiener Poliklinik berufen – eine Position, die er 25 Jahre, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1970, innehatte.
Aber die beruflichen und wissenschaftlichen Erfolge beschreiben wie gesagt nur eine Seite von Frankls Leben nach der Befreiung. Die andere, bisweilen auch in der zeitgenössischen Franklrezeption übersehene Seite kommt im Verhältnis zu den äußeren Erfolgen umso kontrastreicher vor allem in den frühen Briefen an die Schwester und die engeren Freunde zum Ausdruck. Hier spricht Frankl offen über die Einsamkeit und die inneren Nöte, die ihn nach seiner Rückkehr nach Wien bewegten: die Trauer um seine Familienangehörigen und seine erste Frau, um die zahlreichen Freunde, die die nationalsozialistische Verfolgung nicht überlebt hatten.
Ab April 1946 dokumentieren die Briefe dann aber, wie Frankl durch die Bekanntschaft mit seiner zukünftigen zweiten Frau, Eleonore, geborene Schwindt, und der Geburt der Tochter Gabriele im Dezember 1947, zunehmend Mut und neue Kraft schöpft. In seinem Schreiben an Rudolf Stenger beschreibt Frankl das Kennenlernen von Eleonore Schwindt denn auch als den entscheidenden Wendepunkt nach der Befreiung:
Ich kann Dir heute, überhaupt seit wenigen Tagen, nicht wiederholen, wie es um mich »stand«. Denn es »steht« seit Kurzem eben anders um mich, Du wirst wohl erraten, was ich meine. […] Seither – und diese Andeutung genüge für heute – ist ein Mensch um mich, der imstande war, mit einem Schlag alles zu wenden. (An Rudolf Stenger, 10. Mai 1946)
Aber auch nach diesem Wendepunkt ist der Schatten des Erlebten noch deutlich sichtbar. So trifft Frankl in Rücksprache mit der in Australien lebenden Schwester Vorbereitungen, für den Fall einer Wiederholung der Geschichte ohne Verzug gemeinsam mit seiner Frau Eleonore und der Tochter Gabriele nach Australien auswandern zu können; auch richtet er bei seiner Schwester ein Notarchiv ein, um sicherzustellen, dass sein wissenschaftliches Werk unter allen Umständen (gemeint ist offensichtlich eine erneute politische Gefährdung) überleben würde.
2. Die Texte und Beiträge 1946–1948 und Gedenkreden 1949–1988
Ein wiederkehrendes Motiv der frühen Briefe nach der Befreiung ist Frankls Wahrnehmung der »Verpflichtung«, neben der Niederschrift seiner Bücher als Überlebender des Holocaust und vor allem auch als Arzt »psychologische Wiederaufbauarbeit« zu leisten.
Diese seelische »Wiederaufbauarbeit« drehte sich vor allem um drei Themenkomplexe: persönliche, politische und soziale Verantwortung, sowie Leid und Schuld. Denn zu dem, was Frankl und viele andere Heimkehrer in Form der Leidbewältigung beschäftigte, gesellte sich – oft nicht minder drängend – die Schuldfrage der anderen, und damit das Problem, wie die Überlebenden mit ihren jeweiligen jüngsten Biografien umgehen sollten. Die österreichische und die deutsche Gesellschaft nach 1945 war vor diesem Hintergrund tief greifend gespalten: hier diejenigen, die unfassbare Erniedrigungen und Leid erfahren hatten, und dort diejenigen, die dieses Leid wenigstens zugelassen oder direkt oder indirekt verursacht hatten; und bei letzterer Gruppe wiederum jene, die ihre Verwicklungen aufrichtig bereuten, aber nun umso mehr mit der Last des eigenen Schuld- und Verantwortungsbewusstseins konfrontiert waren. Weltkriegs- und Holocausterfahrung wurden somit zu in dieser Dichte wohl historisch einmaligen Brennpunkten existenzieller Auseinandersetzungen mit Leid, mit Schuld und mit Tod – gelitten hatten Millionen; schuldig geworden waren viele, und nahezu jede Familie hatte ihre Toten zu beklagen:
Dem Zweiten Weltkrieg blieb es vorbehalten, die Verbreitung [der existenziellen Fragen] zu fördern, [sie] zu aktualisieren und, darüber hinaus, extrem zu radikalisieren. Fragen wir uns aber nach dem Grund hierfür, dann haben wir uns zu vergegenwärtigen, dass dieser Zweite Weltkrieg von vorneherein mehr bedeutete als das bloße Fronterlebnis: er brachte für das ›Hinterland‹ (das es nun nicht mehr gab) das Erlebnis des Bombenkellers – und das Erlebnis des Konzentrationslagers. (Frankl 1947)
Wenn der Heimkehrer Frankl diese Themen aufgreift, fällt zugleich auf, dass er von Anbeginn an zwar einerseits den historisch einmaligen Kontext und Charakter des Holocaust würdigt, zugleich aber seine Hörer und Leser auf die jenseits der konkreten Umstände bleibende Dringlichkeit der ja nicht erst durch den Holocaust aufgeworfenen, sondern durch diesen bloß »radikalisierten« existenziellen Fragestellungen hinweist. In einer Schlüsselstelle bringt Frankl diese Dialektik zwischen Geschichtlichkeit und Zeitlosigkeit der durch die Ereignisse zwischen 1938 und 1945 so drängend gewordenen Fragen wie folgt zum Ausdruck:
Und auch der irrt, der da meinte, der Nationalsozialismus sei es gewesen, der das Böse erst geschaffen habe: dies hieße den Nationalsozialismus überschätzen; denn er war nicht schöpferisch – nicht einmal im Bösen. Der Nationalsozialismus hat das Böse nicht erst geschaffen: er hat es nur gefördert – wie vielleicht kein System zuvor.
Was demzufolge für das Böse gilt, gilt in gleicher Weise auch für das Leid und die Schuld, die aus diesem Bösen erwachsen sind: Sie sind mit Blick auf den Holocaust historisch einmalig in ihrem Ausmaß, nicht aber ihrem Wesen nach als fortwährende Bestimmungsmomente menschlichen Daseins. Die »tragische Trias« – Leid, Schuld und Tod – ist Teil menschlicher Erfahrung; kein Lebenslauf wird von ihr verschont bleiben.
Wenn Frankl sich daher dieses Problems annimmt, so tut er dies nicht nur mit Blick auf die Frage, wie die Kriegs- und Holocaustüberlebenden, sondern wie der Mensch im Allgemeinen auf die tragische Trias antworten soll – ob etwa ein Leben, welches sehr wahrscheinlich früher oder später einmal an die Grenzen des Versteh- und Ertragbaren herangeführt wird, überhaupt noch lebenswert und sinnvoll sei.
Frankls Antwort auf diese Frage kommt in einer zweiten Schlüsselstelle zum Ausdruck. In ihr formuliert er zugleich das Leitmotiv seines »tragischen Optimismus«, der die argumentative Grundlage bildet, auf der der Mensch befähigt werden soll, »trotzdem Ja zum Leben sagen« zu können:
Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, einen Fehler zu begehen, wenn ich an dieser Stelle persönlich werde; vielmehr denke ich, es Ihnen irgendwie schuldig zu sein, um damit Ihr Verständnis dafür zu erleichtern, was ich Ihnen auseinandersetzen möchte. Nun: im Konzentrationslager gab es viele, und schwere, Probleme; aber das Problem für die Häftlinge lautete letztlich: »Werden wir überleben? Denn nur dann hätte unser Leiden einen Sinn.« Doch für mich lautete das Problem anders – mein Problem war genau das umgekehrte: Hat das Leiden, hat das Sterben einen Sinn?
Denn nur dann – könnte das Überleben einen Sinn haben! Mit anderen Worten: nur ein sinnvolles – ein auf jeden Fall sinnvolles – Leben erschien mir wert, erlebt zu werden, ein Leben hingegen, dessen Sinnhaftigkeit dem rohesten Zufall ausgeliefert ist – dem Zufall nämlich, ob man mit ihm, dem Leben, nun davonkommt oder nicht –, ein solches Leben, mit so fragwürdigem Sinn, musste mir eigentlich auch dann nicht lebenswert erscheinen, wenn man mit ihm davonkommt …
Bestand meine Überzeugung vom unbedingten Sinn des Lebens – einem dermaßen unbedingten Sinn, dass er auch noch das scheinbar sinnlose Leiden und Sterben mit einbegriff –, jene härteste Probe aufs Exempel, bestand sie dieses ich möchte sagen: experimentum crucis, das das Konzentrationslager war, nun, dann hatte sie sich bewährt, und endgültig bewährt. Hätte meine Überzeugung von einem so unbedingten Sinn des Lebens, des Leidens, des Sterbens, die Probe nicht bestanden, dann freilich wäre ich bis aufs Letzte desillusioniert worden, und dies unheilbar. Nun, meine Überzeugung hat die Probe bestanden: denn wäre mir das Leben nicht gerettet worden, so würde ich nicht hier vor Ihnen stehen; aber wenn ich mir nicht jene Überzeugung gerettet hätte, dann würde ich nicht heute zu Ihnen sprechen …
Diese Wendung der Sinnfrage im Leiden führt Frankl von der exklusiven Schau auf Bedingtheit des Menschen (dem »rohesten Zufall«) hin zum zweiten Kernthema seines Nachkriegswerks: der Entscheidungsfähigkeit und Verantwortung des Menschen für sein Handeln und Unterlassen in Vergangenheit und Gegenwart.
Aber angesichts dessen, wofür sich viele nach 1945 zu verantworten hatten, galt es zunächst einmal, weit verbreiteten Widerstand und Scheu vor einer ehrlichen Bilanz des eigenen Handelns anzusprechen. Tatsächlich gingen nicht wenige Österreicher nach 1945 den scheinbar leichteren – und zugleich zweifelhaften – Weg, die Verantwortung für das Unglück und Elend der NS-Herrschaft von sich zu weisen und alleine denDeutschen zuzusprechen. Aus den geschichtlichen Tatsachen lässt sich eine solche Entlassung aus der Verantwortung allerdings nicht ableiten. Jenen Österreichern, die etwa pauschal die Deutschen, nicht oder weniger aber die österreichischen Nationalsozialisten zur Verantwortung ziehen wollten, konnte Frankl – zumal aus der Perspektive des Überlebenden von vier Konzentrationslagern – daher nur wenig Entlastendes bieten:
Man rede lieber nicht allzu viel von dem Leid, das Deutsche über Österreich gebracht haben. Denn man frage erst die Opfer selbst, frage die Österreicher, die in den Konzentrationslagern waren, – und er wird von ihnen erfahren, wie die Wiener SS, aller übrigen SS voran, gefürchtet war! Er frage die österreichischen Juden, die den 10. November 1938 in Wien miterlebt hatten, und dann in den Konzentrationslagern von ihren ›altreichsdeutschen‹ Glaubensgenossen zu hören bekamen, um wie viel milder die deutsche SS am gleichen Tage, demselben Befehl von oben gehorchend, vorgegangen war. […] Ich weiß, ich laufe mit solchen Bemerkungen Gefahr, im hochverräterischen Sinn missverstanden zu werden. Aber jeder verantwortungsbewusste Österreicher muss ein derartiges Missverständnis in Kauf nehmen, sobald er die große Gefahr von heute wittert: das österreichische Pharisäertum. (Frankl 1946)
Es sind vor allem die frühen Texte zur politischen Verantwortung, die jene eingangs angedeutete im Allgemeinen weniger bekannte Seite von Viktor E. Frankls Nachkriegswerk zum Vorschein bringen.
Hier nimmt er weniger allein die Rolle des Seelenarztes ein als die eines politischen Mahners:
Viele von uns wenigen überlebenden Rückkehrern aus den Lagern sind voll Enttäuschung und Verbitterung. Enttäuschung darüber, dass unser Unglück noch nicht aufgehört hat, und Verbitterung darüber, dass auch das Unrecht noch fortbesteht. Gegen das Unglück, das uns oft erst bei der Rückkehr erwartet hat, lässt sich häufig nichts unternehmen. Umso mehr müssen wir gegen das Unrecht vorgehen und uns aus der Lethargie herausreißen, in die Enttäuschung und Verbitterung so manchen zu stürzen droht.
Vielfach hat man den Eindruck, als ob man die Menschen, die man mit dem schönen Wort »KZler« etikettiert hat, jetzt bereits irgendwie als eine unzeitgemäße Erscheinung des öffentlichen Lebens ansieht. Ich erkläre: Der Typus des KZlers ist und bleibt so lange zeitgemäß, als es in Österreich auch nur einen einzigen Nazi gibt, getarnt oder – wie man wieder sieht – offen. Wir sind das lebendige schlechte Gewissen der Öffentlichkeit.
Wir Nervenärzte wissen nur allzu gut, dass der Mensch dazu neigt, das schlechte Gewissen, um mit Freud zu sprechen – »zu verdrängen«. Wir werden uns aber nicht verdrängen lassen. Wir werden eine Kampfgemeinschaft bilden, eine überparteiliche Gemeinschaft, die aber einen gemeinsamen Gegner kennt: den Faschismus.
»Lethargie« und Flucht vor der Verantwortung barg zugleich nicht nur politische und soziale, sondern auch eminente psychologische und existenzielle Gefährdungen des Menschen – und sie stellte wiederum den Psychiater vor die Herausforderung, den durch Schuld- und Leiderfahrung ermüdeten und verunsicherten Menschen davor zu bewahren, sich in die Unverbindlichkeit provisorischer oder fatalistischer Lebenshaltungen zurückzuziehen:
Diese Generation hat zwei Weltkriege erlebt, daneben einige ›Umbrüche‹, Inflationen, Weltwirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Terror, Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeiten – zu viel für eine Generation. Was soll sie noch glauben – und müsste sie glauben, um aufbauen zu können. Sie glaubt an nichts mehr – sie wartet, auch sie. In der Vorkriegszeit hieß es: Jetzt etwas unternehmen? Jetzt, wo es jeden Augenblick zum Kriege kommen kann? Im Krieg hieß es: Was können wir jetzt tun? Nichts, als auf das Kriegsende warten – abwarten; dann werden wir weitersehen. Und kaum war der Krieg aus, hieß es wieder: Jetzt sollen wir etwas unternehmen? In der Nachkriegszeit ist nichts zu machen – alles ist noch provisorisch. (Frankl 1946)
Nun wissen wir aus zahlreichen psychologischen Arbeiten, dass die provisorische Daseinshaltung in den Nachkriegsjahren ein virulentes massenpsychologisches Problem gewesen sein muss; wir wissen aber auch, dass dieses Problem nicht auf die Nachkriegsjahre beschränkt blieb, sondern scheinbar paradoxerweise vor allem auch in Zeiten relativen Wohlstands in beunruhigend hohem Ausmaß beobachtet wird. Ebenso wie Frankls Argumentation für den tragischen Optimismus hat daher auch sein Appell an die bewusste Wahrnehmung der persönlichen und sozialen Verantwortlichkeit des Einzelnen wiederum kein geschichtliches oder psychologisches Verfallsdatum. Tatsächlich scheint er heute angesichts zunehmend um sich greifender Resignation und Lebensabsage aktueller denn je, weshalb man auch für die Texte zur Pathologie des Zeitgeists geltend machen muss: Der Anlass ihrer Niederschrift ist historisch einmalig, die Botschaft dagegen höchst zeitgemäß.
Dass schon Frankl selbst einen über den zeitgeschichtlichen Kontext hinausgehenden Geltungsanspruch auch für seine auf den ersten Blick mehr historischen Arbeiten erhob, zeigt nicht zuletzt auch die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von … trotzdem Ja zum Leben sagen. Beschreibt dieses Buch auch ein Einzelschicksal, so zielte Frankl eigenen Angaben zufolge mit seiner Niederschrift weniger nur auf die persönliche Schilderung seiner eigenen Erlebnisse in vier Konzentrationslagern ab, als auch darauf, an einem konkreten Beispiel den Kerngedanken der Logotherapie zu veranschaulichen, dass selbst die größte Not doch nicht mächtig genug sein kann, um die potenzielle Sinnhaftigkeit des Daseins und die unbedingte Würde jedes Einzelnen infrage zu stellen:
Ich wollte dem Leser […] anhand eines konkreten Beispiels aufzeigen, dass das Leben unter allen – selbst den schlimmsten – Umständen einen potenziellen Sinn hat. Und ich dachte, dass mein Buch Gehör finden würde, wenn ich dies anhand einer derart extremen Situation wie der des Konzentrationslagers zeigen könnte. Deshalb fühlte ich mich dafür verantwortlich, niederzuschreiben und festzuhalten, was ich durchmachen musste, da ich dachte, dass es vielleicht für diejenigen hilfreich sein könnte, die selbst nahe der Verzweiflung sind. (Frankl 1992)
Wir hoffen, dass die hier erstmals in dieser Zusammenschau publizierten Briefe und Texte aus dem privaten Wiener Nachlass diese Intention Frankls ebenso erfüllen wird wie sein KZ-Buch; und dass sie ebenso wie der Erlebnisbericht … trotzdem Ja zum Leben sagen zu zeigen vermag, dass
so einzigartig die jeweilige Situation auch sein mag, – es keine Situation gibt, die nicht einen potenziellen Sinn in sich bergen würde, und sei es auch nur, dass er darin bestünde, Zeugnis abzulegen für die menschliche Fähigkeit, auch noch die tragische Trias »Leid – Schuld – Tod« in einen persönlichen Triumph zu verwandeln. (Frankl 1993),
und:
Solange der Mensch atmet, solange er überhaupt noch bei Bewusstsein ist, trägt er Verantwortung für die jeweilige Beantwortung der Lebens-Fragen. Dies braucht uns nicht zu wundern in dem Moment, wo wir uns darauf zurückbesinnen, was wohl die große Grundtatsache des Menschseins ausmacht – Menschsein ist nämlich nichts anderes als: bewusst sein und verantwortlich sein!
Editorische Notiz
Bei den Texten in Teil II und III handelt es sich um Vortragsskripten oder -mitschriften oder gedruckte bzw. ursprünglich für den Druck vorgesehene Beiträge. Anders verhält es sich mit den Briefen (Teil I) und den Faksimiles und Bildern aus Frankls Privatnachlass in Wien, die ursprünglich nicht für eine Veröffentlichung bestimmt waren. Hier hat der Herausgeber nach Rücksprache mit der Familie Viktor Frankls angesichts der Fülle der noch unveröffentlichten Korrespondenzen von Einzelfall zu Einzelfall entschieden, ob ein Brief Aufnahme in diese Textsammlung findet oder nicht. Grundsätzlich haben wir uns hierbei an Frankls eigene Vorgaben im Umgang mit Dokumenten, vor allem Briefen, aus dem privaten Nachlass orientiert. Die Entscheidung, einige der nach der Befreiung verfassten Briefe (1945–1947) zu veröffentlichen, fiel vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Frankl zu Lebzeiten den vollständigen Briefwechsel mit Wilhelm Börner zur Publikation freigab bzw. auch andere Briefe seinem Biografen Haddon Klingberg auszugsweise zur Verfügung stellte.
Zudem haben wir es uns vorbehalten, einige der Texte geringfügig zu kürzen – einerseits, um vor allem in Teil II Wiederholungen zu vermeiden, andererseits waren Auslassungen vor allem bei den in Teil I abgedruckten Briefen notwendig. Nicht wiedergegeben sind etwa Eigennamen und Verweise auf Privatpersonen (mit Ausnahme von Personen des öffentlichen und wissenschaftlichen Lebens, Verwandte und langjährige Wegbegleiter Frankls) und Adressen. Auch private – vor allem familieninterne – Inhalte, die sich dem Leser der Briefe ohne detaillierte Kenntnis der Familienverhältnisse Frankls ohnedies nicht erschlossen hätten, wurden ebenfalls ausgelassen. Abgesehen von diesen geringfügigen Auslassungen hat der Herausgeber dem Anliegen des vollständigen Abdrucks der Briefe Rechnung getragen. Auslassungen sind durch eckige Klammern […] gekennzeichnet.
Einige der Texte sind mit editorischen Bemerkungen am Ende versehen; diese geben Auskunft über Entstehungsdaten und -umstände und stellen dort, wo eine solche Anbindung möglich oder inhaltlich notwendig erschien, Querverweise zu anderen Texten in diesem Buch her. Neben diesen kurzen Erläuterungen über ihren werkgeschichtlichen Hintergrund sind einige der Textbeiträge und Briefe mit erläuternden Endnoten des Herausgebers versehen; Endnoten im Original sind hingegen als solche [Anm. i. Orig.] gekennzeichnet.
»Zeitzeugen« Juni 1985Vortrag von Viktor E. Frankl. ORF Studio Salzburg
In den Dreißigerjahren kam zuerst der Ständestaat: also das Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Man hat damals versucht, den Nationalsozialisten, von denen es ja bereits einige Illegale in Österreich gegeben hat, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man ihnen zumindest ihren Antisemitismus abgekauft hat. Und trotz aller moralischen Prinzipien, die dem entgegenstehen hätten sollen, war es zum Beispiel so, dass ich damals fast vier Jahre auf dem psychiatrischen Krankenhaus Steinhof gearbeitet hatte, aber als Jude immer wieder trotz meiner Qualifikation und meiner Publikationen übergangen und nicht pragmatisiert wurde. 1937 habe ich mich dann als Facharzt zur Neurologie und Psychiatrie etabliert und eine Privatpraxis eröffnet. Das hat aber nicht lang angehalten, denn 1938 kam der Umbruch – und der hat sich für mich auf eine ganz eigenartige Weise abgespielt. Am Vormittag desselben Tages war ich noch auf der Psychiatrischen Universitätsklinik von Professor Otto Pötzl, da kommt nach der Visite Dozent Karl Novotny, der führende Individualpsychologe, auf mich zu und sagt: »Herr Frankl, könnten Sie nicht heute Abend in der Urania einen Vortrag von mir an meiner Stelle halten? Ich kann heute nicht.« Sage ich: »Was für ein Thema?« Sagt er: »Nervosität als Zeiterscheinung«.
Diese Spannung und Nervosität lag damals in der Luft an dem Tag des Umbruchs. Nun konnte ich das ohne Weiteres machen, denn die Urania war nur fünf Gehminuten von zu Hause. Nichtsahnend gehe ich also an diesem Tag in den Vortragssaal, fange meinen Vortrag an, und nach vielleicht 20 Minuten reißt plötzlich jemand die Tür sperrangelweit auf, stellt sich breitbeinig in die Tür, mit den Händen in die Hüften gestützt, und starrt mich mit wütendem Blick an: ein SA-Mann. Ich hatte bis dahin so etwas noch nicht gesehen.
Daraufhin ist mir in Bruchteilen einer Sekunde durch den Kopf gegangen, dass ich als Student den Professor Fremel erlebt habe. Wir Medizinstudenten hatten damals noch kein Prüfungsfach in Ohrenheilkunde zu absolvieren. Wir mussten uns nur inskribieren, aber keiner musste es lernen. Wir gehen also zur gegebenen Zeit hin, wollen die Unterschrift für die Bestätigung haben – da steht dort der Professor Fremel und sagt: »Da haben Sie die Unterschrift. Aber wollen Sie nicht doch noch eine Weile bleiben – ich erzähle Ihnen etwas über das Trommelfell.« Was sollten wir machen? Wir blieben also einen Moment stehen. Dann beginnt er, uns über das Trommelfell zu erzählen. Und: wir konnten uns nicht wegbewegen – wir waren fasziniert, wir waren gebannt, und sind dort stehen geblieben. Wie ein Mensch so über das Trommelfell sprechen kann – das war unglaublich!
In dem Moment durchzuckt mich der Gedanke: »Zum Teufel, jetzt rede ich ruhig weiter und spreche in einer Weise, dass dieser SA-Mann stehen bleibt und mir zuhört.« Ob Sie es glauben oder nicht: Er ist weitere 40 Minuten in der Tür mit seinen gespreizten Beinen und seinem wütenden Blick da stehen geblieben und hat zugehört. Er hat mir nichts getan, er hat nicht einmal den Vortrag unterbrechen lassen. Sie sehen also, was alles möglich ist, wenn man an die Möglichkeit glaubt.
Dann wurde ich nach dem berühmten Epilepsieforscher Professor Felix von Frisch, der nach England emigriert war, zum Primarius der Nervenstation des Rothschildspitals berufen. Dort bin ich dann bis zu dem Zeitpunkt geblieben, als im Jahr 1942 das Rothschildspital aufgelöst wurde und ich mit meinen alten Eltern zunächst einmal in das Lager Theresienstadt verfrachtet wurde.
Als wir deportiert wurden, habe ich meinen Vater – sogar lächelnd – die Worte sagen gehört: »Wie Gott will, ich halt still.« Das ist eine phänomenologische Tatsachenbeschreibung. Ich deute sie so, dass er einen bedingungslosen Glauben an eine letzte Sinnhaftigkeit unseres Daseins damit zum Ausdruck bringen wollte – in seiner zwar liberalen, aber doch echt religiösen Lebenshaltung. Mein Vater war damals so alt, wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, was ich, wenn ich heute überraschend diesen Weg gehen müsste, sagen würde.
In Theresienstadt ist mein Vater dann im Alter von über 81 Jahren an Hunger gestorben. Aber das letztlich Auslösende war eine schwere Pneumonie. Als mein Vater dann im Sterben lag, habe ich ihn in seiner Kaserne trotz Ausgehverbots in der Nacht noch besucht. Da hatte das terminale Lungenödem bereits begonnen – das, was der Laie den »Todeskampf« nennt.
Es war somit damals zumindest medizinisch indiziert, dass ich ihm etwas Morphium verabreicht habe. Die Morphiumampulle hatte ich ins Konzentrationslager geschmuggelt. Ich wusste, dass ihm das Linderung in diesem sogenannten Todeskampf verschafft – vor allem diese schreckliche Atemnot mildert. Dann habe ich gewartet, bis das Morphium zu wirken begann, und ihn gefragt:
»Willst du mir noch was sagen?«
Sagt er: »Nein danke.«
Ich: »Willst du mich noch was fragen?«
Er: »Nein danke.«
Ich: »Hast du irgendwelche Beschwerden?«
»Nein danke.«
»Geht’s dir gut?«
»Ja.«
Ich schlich mich davon und wusste, ich würde ihn am nächsten Morgen nicht mehr lebend antreffen. Und wie ich dann weg und zurück in meine Kaserne gegangen bin, habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, das dem entspricht, was Maslow ein Gipfelerlebnis nennen würde – eine absolute Zufriedenheit. Ich war glücklich. Es war ein herrliches Gefühl: Ich hatte das Meinige getan und ich hatte erreicht, dass ich bis zum letzten Bewusstseinsaugenblick bei meinem Vater sein konnte.
Schließlich und endlich war ich ja meiner alten Eltern wegen in Wien geblieben. Ich hätte ausreisen können.
Ich hatte jahrelang auf das Visum warten müssen, das mir die Einreise in die USA ermöglicht hätte. Endlich wurde ich kurz vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg schriftlich dazu aufgefordert, im Konsulat der USA zu erscheinen und mir das Visum ausfertigen zu lassen. Da stutzte ich: Sollte ich meine Eltern allein zurücklassen? Meine Eltern standen ja als meine Angehörigen unter Deportationsschutz, solange ich als Arzt im Rothschildspital tätig war. Ich wusste also, welches Schicksal ihnen bevorstand, wenn ich Wien verließ: die Deportation in ein Konzentrationslager. Sollte ich ihnen also Adieu sagen und sie einfach diesem Schicksal überlassen? Das Visum galt ja ausschließlich für mich!
Unschlüssig verlasse ich das Haus, gehe ein wenig spazieren und denke mir: »Ist das nicht die typische Situation, in der ein Wink vom Himmel nottäte?« Als ich heimkomme, fällt mein Blick auf ein kleines Marmorstück, das auf einem Tisch liegt. »Was ist das?«, wende ich mich an meinen Vater. »Das? Ach, das habe ich heute auf einem Trümmerhaufen aufgelesen, dort, wo früher die Synagoge gestanden ist, die von den Nazis niedergebrannt worden ist. Da dachte ich mir: ›Das ist etwas Heiliges, das kann ich nicht einfach auf der Straße liegen lassen.‹ Das Marmorstück ist ein Stück von den Gesetzestafeln. Wenn es dich interessiert, kann ich dir auch sagen, auf welches der Zehn Gebote sich der eingemeißelte hebräische Buchstabe da bezieht. Denn es gibt nur ein Gebot, dessen Initiale er ist.«
»Und zwar?«, dringe ich in meinen Vater. Darauf gibt er mir zur Antwort: »Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebest im Lande …« Und so blieb ich »im Lande«, bei meinen Eltern, und ließ das Visum verfallen.
Es waren dann, nachdem ich das Visum verfallen ließ, noch zwei Jahre, und während dieser Zeit konnten auch sie in Wien bleiben. Ich musste natürlich riskieren, dann mit ihnen in ein Lager gehen zu müssen. Aber das war dafürgestanden – und in diesem Augenblick, als ich mich in Theresienstadt von meinem Vater verabschiedete, hatte sich das bestätigt. Für mich war das eine ganz einfache Rechnung, und sie war mir geglückt. Es war ein unsägliches Glücksgefühl. Stellen Sie sich vor: Der Vater stirbt und Sie sind glücklich. Das gibt es in solchen Zusammenhängen. Denn in abnormen Situationen ist das Abnorme das Normale, oder sagen wir in diesem Fall: das Richtige, das eine, was nottut. Und dann, was war dann? Dann kam ich aus Theresienstadt nach Auschwitz.
Und als es dann so weit war, und ich mit meiner ersten Frau Tilly nach Auschwitz abtransportiert wurde und ich mich von meiner Mutter verabschiedete, bat ich sie im letzten Moment: »Bitte, gib mir den Segen.« Und ich werde nie vergessen, wie sie mit einem Schrei, der ganz aus der Tiefe kam und den ich nur als inbrünstig bezeichnen kann, gesagt hat: »Ja, ja, ich segne dich« – und dann gab sie mir den Segen. Das war eine Woche, bevor sie ebenfalls nach Auschwitz gekommen ist.
Ich erinnere mich genau, wie ich in Auschwitz am Bahnhof angekommen bin. Das war die Situation, als ich vor Mengele stand – mit ein, zwei Meter Entfernung. Ich wurde auf der Rampe, bei der sogenannten Selektion, nach rechts geschickt. Ich weiß nur zufällig aus späteren Statistiken, dass meine Überlebenschancen damals auf der Bahnhofsrampe stehend sich genau auf 1:29 beliefen. Sie müssen verstehen, dass ein solcher Mensch nicht, wie die Psychoanalytiker in Amerika behaupten, unter survival guilt, Schuldgefühlen leidet, sondern vielmehr eine große Verantwortung empfindet.
Ein solcher Mensch wird im Allgemeinen, wenn er die Situation wirklich erfasst und nicht vergisst, das Gefühl haben, dass er sich Tag für Tag fragen muss, ob er dieser Gnade, zu überleben, auch würdig gewesen ist. Und er wird sich Tag für Tag sagen: eigentlich kaum, trotz allen Bemühens. Also es gibt eine survival responsibility, ein Verantwortlichsein im Angesicht des Überlebthabens, aber nicht von vornherein ein Schuldgefühl, geschweige denn eine reale existenzielle Schuld.
Ich war aber nur wenige Tage im Lager Auschwitz und bin dann zwei Tage lang in einem Viehwaggon nach Kaufering, einem Filiallager von Dachau, transportiert worden. Danach kam ich nach Türkheim. In Türkheim habe ich dann hohes Fieber bekommen. Erst nachträglich hat sich herausgestellt, dass es sich um Fleckfieber gehandelt hat. Ich habe damals 40 kg gewogen und 40 Grad Fieber gehabt. Und ich wusste als Arzt, dass, wenn ich in der Nacht einschlafe bzw. bewusstlos werde, es zu einem kardiovaskulären Kollaps kommt: der Blutdruck sinkt ab und ich bin verloren. Daher habe ich mich künstlich wach zu halten versucht.
Ein Lagerkamerad hatte aus der Kanzlei der SS kleine Zettel gestohlen – ich besitze sie heute noch. Es waren vorgedruckte Formulare – aber die Rückseite war frei; und dann hat er mir noch zusätzlich einen kleinen Bleistiftstummel herausgeschmuggelt. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Und auf den Rückseiten dieser Formulare habe ich mit dem Bleistiftstummel in Form stenografischer Stichworte das Manuskript meines ersten Buches rekonstruiert.
Das hatte ich nämlich mit nach Auschwitz genommen – versteckt, eingenäht im Mantelfutter. Natürlich hatte ich in Auschwitz alles – den Mantel, alle Kleidung, einfach alles – wegwerfen müssen. Und kahl geschoren wurden wir auch, nicht zuletzt wegen der Fleckfiebergefahr. Jedenfalls war das Manuskript verloren – und das war mein großer Schmerz. Die Überlebenschancen dieses Buchmanuskripts waren also nicht 1:29, sondern von vornherein praktisch null. Und jetzt habe ich im Jahr 1945 im März und April im Lager Türkheim die Zeit darauf verwendet, das Buch zu rekonstruieren. Diese Notizen waren mir später nach der Befreiung sehr dienlich. Wie gesagt, ich besitze diese Zettel heute noch.
Dann wurde ich am 27. April 1945 von den Texanern befreit und ging nach München, bis ich mit dem ersten möglichen Transport nicht ganz legal nach Wien kommen konnte. Noch in München habe ich erfahren, dass meine Mutter ins Gas gegangen war. Und am ersten Tag in Wien erfuhr ich, dass meine Frau in Bergen-Belsen, im Alter von 25 Jahren, umgekommen ist.
BRIEFE 1945–1947
Aus dem Konzentrationslager befreit
… trotzdem Ja zum Leben sagen1946
Und jetzt wollen wir uns dem letzten Abschnitt innerhalb einer Psychologie des Konzentrationslagers zuwenden: der Psychologie des aus dem Lager befreiten Häftlings. Der seelischen Hochspannung folgte nun eine totale innere Entspannung; wer aber denkt, dass nun unter uns große Freude geherrscht habe, der täuscht sich. Wie war es damals aber wirklich?