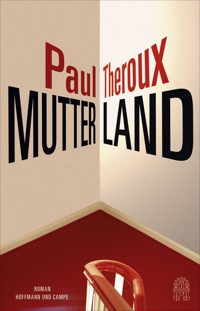Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geisterhand
- Sprache: Deutsch
»Immer, wenn ich fedrig leichten Schnee langsam an einer Scheibe herunterrieseln sehe, der sich zu einem weißen Polster auf der Fensterbank türmt, und der Wind leise stöhnend durch eine Ritze in ein Zimmer drängt, wo Flammen im Kamin singen, muss ich an das Weihnachtsfest denken, an dem ich neun war, und an unser Haus in Indian Willows. Wir hatten uns verirrt.«Marcel, Louis und ihre Eltern wollen die Festtage zum ersten Mal in ihrem Ferienhaus am See verbringen, doch sie geraten in einen Schneesturm, und der Vater verfährt sich hoffnungslos im Wald. Endlich entdecken sie ein Haus, in dem noch Licht brennt. Ein eigenwilliger, alter Mann nimmt sie auf und verspricht, ihnen am nächsten Tag den Weg zu zeigen. Doch am Morgen ist der Mann fort. Aber er hat eine Weihnachtskarte hinterlassen, die sie zu ihrem Haus führen soll. Dass es sich dabei nicht um eine gewöhnliche Karte handelt, wissen nur Marcel …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Theroux
Es muss ein Zauber sein
Eine Gespenstergeschichte
Aus dem amerikanischen Englisch von Renate Orth-Guttmann
Gatsby
1
Immer, wenn ich fedrig leichten Schnee an einer Scheibe herabrieseln sehe und er sich zu einem weißen Polster auf der Fensterbank türmt, während der Wind leise stöhnend durch eine Ritze in ein Zimmer drängt, wo Flammen im Kamin singen, muss ich an das Weihnachtsfest denken, an dem ich neun war, und an unser Haus in Indian Willows.
Wir hatten uns verirrt, das sagte mir Vaters frostige Stimme. Er blaffte mich und dann meinen kleinen Bruder Louis an. Hätte er gewusst, wo wir waren, hätte er Witze mit uns gemacht. Wir fuhren in unserem Familienauto über Land. Als es anfing zu schneien und der Wagen auf der vereisten Straße schlingerte, beugte sich Vater knurrend übers Lenkrad. Das Land war weiß und der Himmel schwarz. Es war, als würden wir im Zwielicht über Wasser fahren. Ich machte mir Sorgen, weil er sich welche machte und mir nichts einfiel, womit ich ihn hätte aufheitern können. Und die Kälte auf dem Rücksitz verstärkte meine Beklemmung.
Die Fahrt war an sich eine harmlose Unternehmung. Bis Weihnachten waren es noch drei Tage, wir wollten zum ersten Mal in das Haus. Mein Vater war gerade von einer Rundreise in Asien zurückgekommen – er war Vertreter –, und unsere Freude über seine Rückkehr war groß. Am Anfang der Reise hatten wir uns gebannt seine Geschichten angehört – von Schlangenbeschwörern, von Elefanten, die dazu abgerichtet wurden, Rupien zu erbetteln, und von Tanzbären. Er hatte von einem Affen gehört, der immer mit einem Tiger reiste, weil der Tiger blind war und den Affen als Pfadfinder brauchte. Es waren magische Geschichten, und ich spürte, dass auch Vater von dieser Magie, diesem Zauber angerührt war. Seine Erzählungen weckten in uns die Sehnsucht, auch solche Dinge zu erleben, denn wir glaubten, dass man quer durch die Welt reisen müsse, durch eine Wüste von Schnee und Feuer, um sich derart verzaubern zu lassen – mit goldenen Tempeln, Fakiren und Wahrsagern, Menschen, die in einer Rauchwolke verschwanden.
Vater widersprach. »Man muss nicht so weit gehen, um Magie zu erleben«, sagte er – und in diesem Augenblick fing es an zu schneien. Er lächelte. »Was ist Magie?«, fragte er. »Etwas, das als Beweis für etwas angeführt wird, was man nicht unbedingt verstehen muss, aber glauben soll. Der Trick ist der Befehl des Magiers, der da lautet: ›Glaubt an mich.‹«
Wir sahen auf den Schnee. Er wogte im Wind, es war, als wehten uns weißgekleidete Gespenster auf der Straße entgegen.
»Magie gibt es überall«, sagte Vater.
»In unserem Haus?«, fragte Louis.
»Überall«, bekräftigte Vater, »vor allem aber hier.« Er tippte sich mit dem Zeigefinger an den Kopf.
Das Haus in Indian Willows war Vaters Überraschung. Es sei ein Geschenk für uns, weil wir so geduldig auf seine Rückkehr gewartet hätten. Er hatte uns ein Foto gezeigt, an einem sonnigen Sommertag aufgenommen – ein großes scheunenartiges Gebäude mit Blick aufs Meer.
Ich sah mir die Aufnahme an. »Gibt es da auch Kinder?«
»Keine Nachbarn weit und breit«, erklärte er stolz. »Keinen einzigen. Es ist ganz abgelegen.«
Ich war enttäuscht, denn ich hatte auf andere Kinder zum Spielen gehofft. Und deshalb fürchtete ich mich, noch ehe wir unsere warme Stadtwohnung verlassen hatten, vor dem riesigen Holzhaus mit den dunklen Fenstern und dem grünen Hahn auf der Wetterfahne. Ich wollte da nicht hin, besonders nicht zu Weihnachten, wo ich zu Hause alles hatte stehen und liegen lassen. Aber Vater meinte, das Haus würde uns bestimmt gefallen. »Es hat einen Kamin«, sagte er. »Einen ganz großen altmodischen. Wir können Holz hacken und ein gewaltiges Feuer machen.«
Es war das einzige Bild, das mich hoffen ließ – die Vorstellung der flammenden Scheite in dem gemauerten Kamin von Indian Willows. Ich sah uns an einem verschneiten Abend um das Feuer sitzen, bis das Bild für all das stand, was Weihnachten ausmachte – Licht und Freude. Das Feuer wandelte sich ständig, wurde von einem Strauß riesiger Federn zu einem Sonnenaufgang und dann zu einem prächtigen Tier. In einem Haus mit einem lebendigen Feuer zu wohnen war so, als kauerte ein Tiger an der Zimmerwand, gähnend und flackernd und strahlend wie ein Gott.
An einem kalten Morgen fuhren wir los. Es war so früh, dass die Straßenlaternen noch brannten, einsame gelbe Leuchtfeuer in der leeren Stadt. Wir fuhren durch die Dunkelheit, als wären wir auf der Flucht. Wir hatten einen Picknicklunch mitgenommen, den wir am Straßenrand im Auto verzehrten, und während Mutter Sandwiches verteilte, studierte Vater die Karte. Am späten Nachmittag auf einer schmalen Straße (Vater redete wieder von Magie) kam der Schnee, erst als leichtes Gestöber, dann in Wolken kleiner schwungvoller Flocken. Mit dem Schnee kam die Dunkelheit. Die Häuser und Geschäfte, an denen wir vorbeifuhren, waren geschlossen, die Fenster wie blinde Augen.
»Können wir anhalten und was kaufen?«, fragte ich.
Aber ich wollte nichts kaufen, ich wollte wissen, warum diese Häuser verlassen waren.
»Geht nicht«, sagte Vater. »Sie haben nur im Sommer geöffnet.«
Der Sommer schien sehr fern. Von der langen Fahrt und der Winterkälte war mir übel. Ich beneidete Louis, der fest schlief und schnarchte, die Hände in den Taschen vergraben.
»Warum?«, wollte ich fragen, aber da herrschte Vater uns an, wir sollten still sein. Mutter beugte sich nach hinten und strich mir übers Haar. Ich wusste, dass Vater sich verfahren hatte. Deshalb wirkte er so wütend, aber in Wirklichkeit sorgte er sich.
»Bestimmt gibt es ein Hotel«, sagte Mutter.
»Im Winter geschlossen«, sagte Vater und fluchte mit Wörtern, die er uns immer verboten hatte.
Der Wagen wurde langsamer. Durch den Schnee, der im Scheinwerferlicht tanzte, sah ich eine Kreuzung.
Mutter raschelte mit der Karte. »Ich werde daraus nicht klug«, sagte sie.
»Fahr nach links«, sagte ich.
Vater drehte sich um. »Warum?«
Die linke Straße war breiter, ich sah Reifenspuren und Telefonmaste und einen vertrauenerweckend soliden Zaun. Sie strahlte Sicherheit aus. Aber ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte. Auf breiten Straßen hatte ich immer das Gefühl, als wären wir auf dem Weg nach Hause, auf schmaleren hatte ich meine Zweifel, ob wir je ankommen würden, und bei ganz kleinen Straßen war mir, als könnten wir einfach verschwinden – da vorn, wo sie scheinbar aufhörten.
»Weil auf dieser hier Spuren sind«, sagte ich.
»Wir fahren schon seit Stunden«, sagte Mutter.
»Mit den Spuren hat Marcel vielleicht recht«, sagte Vater und bog nach links ab. Hier lag der Schnee hoch, und es schneite weiter. Wir fuhren durch einen weißen Tunnel, der uns lautlos einschloss. Der Wagen schlingerte, und Vater fluchte. Ich hätte mich gern bewegt, um mich ein bisschen aufzuwärmen, aber ich traute mich nicht. Lieber Gott mach, dass wir bald ankommen, betete ich.
Ich hatte Vater immer vertraut. Er war lustig, er war stark, er hatte lange und gefährliche Reisen unternommen, aber heute war er anders. Der Schneesturm und dass er nicht genau wusste, wohin – das warf ihn aus der Bahn.
Der Schneesturm brachte Angst und Schrecken und ungewohnte Geräusche. Machte, dass meine Zehen wegen der schneidenden Kälte schmerzten, war schuld an dem muffigen Geruch im Wagen, brachte Verzögerung. Ich war reisekrank, ich war ungeduldig, ich bedauerte, dass wir hergekommen waren. Ich hatte nicht wirklich sagen