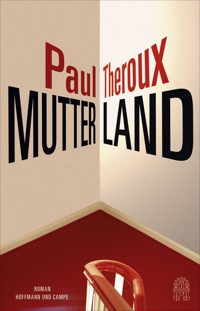
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Mutterland zu lesen ist, als sähe man einem Autounfall in Zeitlupe zu. Es ist eine bösartige Abrechnung. Und es macht Spaß.» Stephen King Alle in Cape Cod halten Mutter für eine wunderbare Frau: fleißig, fromm, genügsam. Alle außer ihrem Ehemann und ihre sieben Kinder. Für sie ist sie eine engstirnige und selbstsüchtige Tyrannin. Der Erzähler Jay, Reiseschriftsteller mittleren Alters, ist eines der sieben Kinder. Zusammen mit den Geschwistern findet er sich bei der Mutter ein, als der Vater stirbt – die erstickende Enge dort, im wortwörtlichen Mutterland, evoziert eine Bandbreite an Gefühlen, die dem Leser auf unheimliche Weise genau das präsentieren, was sonst immer nur der Horror der anderen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 892
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Paul Theroux
Mutterland
Aus dem amerikanischen Englisch von Theda Krohm-Linke
Hoffmann und Campe
»Mother, Mother, Mother, Mother, Mother, please. Mother, please, please, please. Don’t – don’t do this. Don’t do this. Lay down your life with your child.«
Jim Jones, Jonestown, »Death Speech«,28. November1978
Der Raum war klein, der Hass war groß,
Es versehrte uns gleich zu Beginn.
Ich empfing bereits im Mutterschoß
Meinen fanatischen Sinn.
William Butler Yeats
Teil I
1Mutter des Jahres
Wetter ist Erinnerung. Sogar der Wind spielt eine Rolle. Das Rauschen des Regens kann Erinnerungen auslösen, ebenso wie ein bestimmtes Licht. Man braucht keinen Kalender, um sich an persönliche Krisen zu erinnern. Man kann sie riechen, sie auf der Haut fühlen, sie schmecken. Wenn man Jahr für Jahr immer am gleichen Ort lebt, bekommt das Wetter eine Bedeutung, es ist voller Omen, und an jedem Jahrestag rufen die Temperatur, das Sonnenlicht, die Bäume und Blätter Gefühle hervor. Alle religiösen Feste verlaufen nach diesem Prinzip der Vertrautheit mit dem Wetter: Sie haben ihren Ursprung in einer Jahreszeit, an einem bestimmten Tag.
An jenem schönen Morgen im Mai wurden wir alle nach Hause gerufen und erfuhren, dass Vater krank war. Mutter – sparsam sogar in Notfällen – führte selten Ferngespräche, deshalb konnte dieser teure Anruf nur bedeuten, dass Vater im Sterben lag und wir für die Totenwache zusammengetrommelt wurden. Ein denkwürdiges Ritual schon als solches.
Eine Familie ist wie ein fernes Land, aus dem jemand kommt. Unseres war völlig abgelegen und hatte seine eigenen Sitten und Grausamkeiten. Niemand kannte uns, und wir vermieden es, die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Deshalb sagte ich mir, dass ich zum geeigneten Zeitpunkt meine Familie – das »Mutterland« in jeder Hinsicht – auf der Landkarte einzeichnen würde.
Wir waren acht Kinder, eines davon tot. Unsere Eltern waren streng, eine Folge der harten Arbeit und der Angst vor der Verelendung, die sie in der Weltwirtschaftskrise kennengelernt hatten. Uns kamen sie uralt vor, aber solange sie in unserem Leben waren, ganz gleich wie tatterig, blieben wir ihre kleinen, ungezogenen Kinder, auch als Mutter schon ein lebendes Fossil war. Im Alter lebten wir unsere wahre, schreckliche Kindheit aus – komische Käuze unter der Fuchtel ihrer selbstherrlichen Mutter.
Dass zwei von uns Schriftsteller waren, war den anderen ein Dorn im Auge und oft auch peinlich, da Schreiben in der Familie kein Ansehen genoss. Schriftsteller war für sie gleichbedeutend mit Faulheit. Man nahm mir das, was ich schrieb, übel. Ich bezweifle, dass mein Schreiben in dieser Familiengeschichte eine große Rolle spielen wird, außer wo sie zufällig ein Problem für die anderen wird. Mir geht es hier um das Leben, das ich gelebt habe, als bei mir noch Fluchtgefahr bestand, die Zeit, bevor ich mit ungefähr achtzehn von zu Hause wegging, und die Zeit, als ich vierzig Jahre später zurückkehrte, um Tod, Versagen und Verwirrung gegenüberzustehen – der Anfang und das Ende. Nicht die Bücher meines Lebens, sondern die Buchstützen.
Als ich noch sehr klein war, pflegte meine Mutter mir mit strahlendem Lächeln die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der gehängt werden sollte. Als letzte Bitte äußerte er: »Ich will mit meiner Mutter sprechen«. Sie wurde zum Galgen gebracht, wo ihr Sohn bereits in Handschellen stand. »Komm näher, Mutter«, sagte er, und als sie den Kopf zu ihm neigte, tat er so, als wolle er vertraulich mit ihr sprechen, und biss sie ins Ohr. Als sie vor Schmerzen schrie, spuckte der Verurteilte das Stück Ohr aus und sagte: »Du bist der Grund, warum ich hier bin und gleich sterben muss!«
Wenn sie diese Geschichte erzählte, faltete meine Mutter die Hände im Schoß und nickte zufrieden. Wollte sie mir damit sagen, dass ich besser dran war als dieser Mann, dass sie nicht so eine Mutter war? Oder fand sie, ich sei zu stolz und störrisch? Ich wusste nicht, warum, aber die Geschichte machte mir Angst, weil ich mich oft wie jener verurteilte Mann fühlte, jemand, der bestraft werden musste, ein Kind unter verstockten Kindern, ein potenzieller Ohr-Abbeißer.
Sechzig Jahre später benahmen wir uns noch immer gleich – streitsüchtig und von Neid zerfressen wie eh und je. Die Rangeleien nahmen kein Ende. Schubsende, drängelnde, alternde, dickbäuchige Kinder mit Glatzköpfen und ersten Gebrechen, die übereinander lästerten und drohend mit dicken Fingern wackelten. Als wir älter waren, gab es viel mehr, über das man lästern konnte.
Unser kindisches Verhalten war so offensichtlich, dass Floyd einmal sagte: »Wer war noch mal der versonnene französische Philosoph, der von der ›ewigen Kindheit‹ sprach? Eine bewegungslose, ewige Kindheit im Mantel der Geschichte. Niemand in dieser Familie hat natürlich eine Ahnung! Pecos Bill? Zeit ist der Erz-Satiriker. Nein, es war Gaston Bachelard.«
Wir alle hatten den gleichen Vater. Er war eine feste Größe, wenn auch oft krank. Er war ein zwanghafter Geizkragen. Sparen war seine Obsession. Er teilte einen Streifen Kaugummi in der Mitte durch, weil es nutzloser Luxus war, einen ganzen Streifen zu kauen. Er sammelte Bindfäden, rostige Nägel und Schrauben in einer Dose, sammelte alte Holzbretter, einfach alles. Gegen Ende seines Lebens entwickelte er eine große Vorliebe für die städtische Müllhalde und die Schätze, die er dort fand. Zur Müllhalde zu gehen war für ihn wie ein Sonntagsspaziergang. Wenn er aufbrach, lächelte er, als ginge er zu Filene’s Basement, wo es immer Sonderangebote gab. Er nahm den vollen Mülleimer und trug ihn zur Müllhalde, brachte ihn aber halb gefüllt mit allen möglichen Fundstücken zurück. Die Müllhalde war einer seiner Treffpunkte. Er hatte Freunde dort. Der andere Treffpunkt war die Kirche. Eine Kindheit in Armut hatte ihn mit einer schwelenden Krankheit geschlagen. Er trug sie sein ganzes Leben lang in sich. Doch er war dankbar, am Leben zu sein.
Mutter war undurchschaubar und rätselhaft, manchmal uneinsichtig, wie eine zornige Gottheit. Unsicher in ihrer Macht besaß sie eine ungeduldige, fordernde Grausamkeit, die aus einem anderen Jahrhundert, einer anderen Kultur zu stammen schien und nie befriedigt war. Das machte sie zu einem notorischen Spielverderber. In ihren Widersprüchlichkeiten, ihren Launen, ihrer Ungerechtigkeit, ihrer Illoyalität und ihrer Willkür war sie zu jedem von uns anders: Jeder musste mit seiner eigenen Version von ihr klarkommen, jeder hatte eine andere Mutter oder übersetzte sie, so wie ich es jetzt tue, in sein ganz eigenes Idiom. Fred könnte zum Beispiel dieses Buch lesen und sagen: »Wer ist diese Frau?« Franny oder Rose hätten bestimmt Einwände. Hubby würde knurren: »Du Vollidiot.« Gilbert kannte die Frau nicht, die mich großgezogen hat. Aber Floyd, der andere Schriftsteller in der Familie, wusste, wovon ich sprach, und wenn wir miteinander redeten, ballte er die Faust und sagte: »Die Furien! Der Verrat! Der Kannibalismus! Es ist das Haus des Atreus!«
Mutters Geschichten und Vertraulichkeiten variierten, je nachdem mit welchem Kind sie redete. Ich hätte schon früh darauf kommen können, weil sie uns für gewöhnlich immer nur einzeln empfing. Sie ermutigte uns, sie einzeln zu besuchen, und deutete an, dass sie es liebte, mit Geschenken überrascht zu werden. Aber ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel war das Telefon. Es kam ihrem Bedürfnis nach Geheimniskrämerei und Manipulation entgegen. Sie wurde gerne vom Klingeln des Telefons überrascht, liebte die Unberechenbarkeit des Gesprächs, die Macht aufzulegen. In sieben Telefonaten – bedürftige Leute sind chronische Telefonierer – erzählte sie sieben unterschiedliche Versionen ihres Tages.
Vielleicht war Fred am Telefon, das einzige Kind, dem sie sich unterordnete. Er war Anwalt, mit der typischen Verbindlichkeit eines Anwalts und der Fähigkeit, zwei gegensätzliche Ansichten im Kopf zu haben, an die er beide nicht glaubte. Sie schüttete ihm ihr Herz aus, und er sagte: »Genau so solltest du es tun, Ma«, und im selben Atemzug: »Oder du könntest es so machen.« Später wurde er zu ihrem Berater, ihrem Verteidiger, ihrem Welterklärer.
Vielleicht rief auch Floyd an, der zweitälteste, den sie verachtete und fürchtete. Über ihn sagte sie: »Er hatte immer unrecht.« Er war Universitätsprofessor und ein gefeierter Lyriker. Floyd pflegte zu sagen: »Kunst ist das Paradies, in dem Adam und Eva die Schlange essen.«
Oder die Schwestern, Franny oder Rose, beide korpulent und atemlos wie diese anonymen, erschreckten Augenzeugen im Fernsehen, die keuchen: »Ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier, und so etwas habe ich noch nie gesehen!« Beide waren Grundschullehrerinnen und redeten mit jedem, als sei er ein Kind.
Oder Hubby, der Grübler, von dem Mutter sagte: »Er ist so geschickt mit den Händen«. Er war Krankenpfleger in der Notaufnahme und besaß einen unerschöpflichen Fundus an grausigen Geschichten.
Oder Gilbert, ihr Liebling, Diplomat, auf eine fröhliche Art unaufrichtig. »Er hat so viel zu tun, der arme Junge, aber ich bin stolz auf ihn.« Mutter konnte ihm nichts abschlagen.
Oder ich. Von Geburt an wurde ich nur JP genannt. Mutter war misstrauisch mir gegenüber und kniff verunsichert die Augen zusammen, wenn ich sie besuchte. Von der ersten Minute an wartete sie ungeduldig darauf, dass ich wieder ging. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn ich Arzt geworden wäre. Dass ich Schriftsteller war, hat ihr nie gefallen. Wenn jemand eines meiner Bücher lobte, sagte sie: »Na, so was.« Wie jemand, den man stupst, weil er eingeschlafen ist.
Mutter redete auch mit Angela – indem sie betete. Angela war das tote Kind. Sie war bei der Geburt gestorben, war kaum eine Stunde alt, als ihr Leben erlosch. Aber sie hatte einen Namen. (»Sie war wie ein Engel.«) Sie hatte eine Persönlichkeit, gewisse liebenswerte Marotten und war Teil der Familie. Oft wurde Angela geradezu als Wunderkind hingestellt, an dem wir uns ein Beispiel nehmen sollten.
»Du weißt bestimmt, dass Paul Verlaines Mutter ihre beiden totgeborenen Kinder in einem Einmachglas auf einem Regal im Wohnzimmer aufbewahrte«, sagte Floyd. »Zumindest dieses Schauspiel hat uns Mutter erspart.« Hier blickte er über den Rand seiner Halbgläser hinweg. »Föten, ausgestellt zu Trauerzwecken.«
Aber Angela war sehr wohl präsent und auch sichtbar. Gerade weil sie ein Gespensterwesen war, konnte sie so bequem Rat und Trost spenden und die Familie leiten. Man kennt das von Naturvölkern und wilden Stämmen, wo die Lebenden und die Geisterahnen friedlich koexistieren. Das Motiv der »dankbaren Toten« bei Lévi-Strauss.
Wenn Mutter ein unanfechtbares Argument, ein Gottesurteil, brauchte, dann kam es von Angela. Angela verriet ihr auch, wenn illoyal über sie, unsere Mutter, getuschelt wurde, und warnte sie vor bösen Omen. Angela hatte nicht nur einen Namen und eine Persönlichkeit, sie hatte auch eine Geschichte. Sie wurde an jedem 8. Januar betrauert. An diesem Tag war Mutter gelähmt vor Kummer und musste besucht oder angerufen werden, damit sie ihr Leid klagen und die Geschichte ihrer schwierigen Schwangerschaft im Krieg erzählen konnte. Die tote Angela diente auch dazu, die Familie zu vergrößern, wie die toten Seelen in Gogols Roman. Sie machte unsere Familie größer und gab ihr gleichzeitig einen fiktionalen Anstrich.
»Wir sind eine Familie«, sagen Leute selbstbewusst lächelnd, und ich denke, Gott stehe euch bei. Bei dem Ausdruck »große, glückliche Familie« sehe ich keine verschworene Gemeinschaft vor mir. Ich assoziiere sonderbare Marotten, Verrat, Gier und Grausamkeit, etwas, was in der Natur einem Stamm von Kannibalen am nächsten kommt. Ich pauschalisiere. Ich verwende Begriffe wie »wilde Stämme« und »Kannibalen« unfairerweise, um den melodramatischen Aspekt zu betonen. Wenn man diese Wörter liest, kommen einem sofort komische halbnackte Gestalten im Dschungel in den Sinn, mit Knochen in der Nase und Pfeil und Bogen, die Trommeln schlagen und sich in ihrer Freizeit gegenseitig Grausamkeiten antun. Sie stoßen gutturale Laute aus, stampfen mit ihren großen Füßen herum und blecken die Zähne. Solche Leute gibt es in der realen Welt nicht. Ich habe einmal in den Gebieten am Äquator gelebt, wo es solche »Wilden« angeblich geben soll, und ich fand die Volksstämme dort alles andere als wild. Sie benahmen sich feinsinnig, ritterlich, großherzig und würdevoll. Die nackte Wildheit begegnete mir stattdessen im ländlichen Amerika. Hier begriff ich, dass all die mythischen Charakteristika, die mit Kannibalen assoziiert werden, in meiner engsten Familie beobachtet werden konnten.
Mein Vater war der unter dem Pantoffel stehende Häuptling, meine Mutter seine Gefährtin. Alle waren unzufrieden und frustriert, ein Haufen unermüdlicher Rivalen, die um die Vorherrschaft kämpften und glaubten, sich alles erlauben zu können. Wir hatten unsere eigene Sprache und unsere eigenen Trauerfälle, Kümmernisse und Jahrestage. Und obwohl wir launisch, mitleidlos und neidzerfressen waren, taten wir immer so, als sei das Gegenteil der Fall. Dazu bedurfte es der soliden Heuchelei religiöser Fanatiker. In großen Familien wird fast immer ein strenger, unerbittlicher Glauben praktiziert. Jedenfalls war das bei uns so. Du denkst nicht »glücklich« oder »traurig«, du denkst an die Wut des Überlebens, der Verdammnis und der Schuld.
Solche Familien gibt es in der westlichen Welt mit ihren kleinen Häusern, dem begrenzten Raum und den steigenden Kosten kaum noch. Die Geburtenzahlen in Europa gehen zurück, was zu kleineren Familien führt. Deshalb ist die Geschichte jeder großen Familie es wert, erzählt zu werden, weil solche Familien in Vergessenheit geraten sind. Und doch haben die Mitglieder solcher komplexen und durchgeknallten Clans dazu beigetragen, die Welt so zu formen, wie wir sie jetzt kennen. Wahrscheinlich allerdings zum Schlechteren hin.
Wir wurden als große, glückliche Familie angesehen, und wir traten der Welt lächelnd entgegen. Zwar glaubten wir nicht daran, dass es so etwas gab, doch wir verkauften uns als glückliche Familie, weil wir so viel zu verbergen hatten. Zynismus ist ein weiteres Attribut großer Familien. Ein Teil unserer Verzweiflung rührte bestimmt von dem Wissen, dass unsere Familie zu groß war, um zu überleben, zu unbeholfen, um zu gedeihen. Wir waren ein monströses Phänomen, das groteske Produkt eines vergangenen Jahrhunderts, ein wütender, isolierter Volksstamm im Krieg mit sich selber, regiert von einer unerklärlichen Wesenheit, der Vorstandsvorsitzenden, der launischen Königin in »Mutterland«.
Die meiste Zeit meines Lebens wurde ich ermutigt, in meiner Mutter eine Heilige zu sehen. Eine etwas nervtötende Heilige, aber rechtschaffen und loyal. Natürlich nährte sie diese Fiktion, arbeitete daran, sie zu formen. Und ich wurde auch durch ihr Bild in der Öffentlichkeit beeinflusst, denn sie war so etwas wie eine lokale Berühmtheit – ehemalige Lehrerin, geachtet von ihren Schülern, aktiv in der Kirche, klug in finanziellen Fragen, verständnisvoll in Herzensangelegenheiten, eine gottesfürchtige Wichtigtuerin, die alle liebten. Für die Welt war meine Mutter eine tatkräftige, hart arbeitende Frau, die sieben Kinder großzog (und die Erinnerung an ein achtes wachhielt) und schließlich durchs College brachte. Die Matriarchin einer großen, glücklichen Familie. Sie identifizierte sich mit klugen, leidgeprüften Muttergestalten in den Nachrichten, vor allem mit der alljährlichen »Mutter des Jahres«, in der sie nie ein Vorbild, sondern immer nur eine Rivalin sah. Sie verglich sich auch mit gewissen »weisen alten Frauen« in den Comic-Strips – Mary Worth war eine davon – und mit der guten Seele in der Fernsehserie Geheimnis der Mutter. Ständig betete sie zur Jungfrau Maria, und ihre Frömmigkeit nährte die Annahme, dass sie und die Muttergottes viel gemeinsam hatten, wenn man von der Qualität des Nachwuchses einmal absah. Sie hätte sich sicher auch sehr mit Mutter Hawa – der Eva des Islam –, der Mutter der Menschheit, verbunden gefühlt.
Ich kann über meinen naiven Kinderglauben, dass sie sich für uns aufopferte, nur staunen, denn als ich größer wurde, unterdrückte meine Mutter mich gnadenlos, und ich sehnte mich danach, ihrer Willkürherrschaft zu entfliehen. Dad war milde, aber sie verlangte von ihm, dass er uns regelmäßig züchtigte, wie üblich mit dem Rasierriemen. Er hatte Angst vor ihr, und so gehorchte er und wurde zu ihrem Handlanger.
»Komm her, du wildgewordener Handfeger«, sagte er.
Wir konnten nicht protestieren. Mutter hatte immer das letzte Wort, und für gewöhnlich war es eine Lüge, weil sie nach der Maxime verfuhr: Warum soll ich die Wahrheit sagen, wenn eine Lüge zu deinem Besten ist? Die Wahrheit war immer das, was sie uns an diesem speziellen Tag glauben lassen wollte. Sie tat alles, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Sie war wütend, aufgebracht, böse oder auch sanft – immer mit einem Hintergedanken. Oder sie war krank. Sie konnte so demonstrativ krank sein, dass wir ihr zwangsläufig zuhörten. Möglicherweise bot sie uns auch Geschenke an, aber sie ähnelten grob geschnitzten Objekten, wie sie gewisse Volksstämme im Dschungel austauschten.
Sie war schon ziemlich alt, bevor ich mir eingestehen konnte, wer diese Frau wirklich war. In dem Alter, in dem sie eigentlich zum Objekt von Dankbarkeit und Nachsicht werden sollte, wirkte sie nur wie eine dem Wahnsinn verfallene Monarchin. Die Leute sagten immer zu mir: Deine Ausbildung, deine Lesungen, deine Reisen, deine vielen Stunden am Schreibtisch. Nein, keineswegs, das machte mir alles nichts aus. Es war die schiere Bösartigkeit unserer Mutter, die bei mir den Fluchtinstinkt auslöste.
Wenn jemand von einer Mutter erzählt, die ihre Kinder abgöttisch liebt, die sich die Finger für sie wund arbeitet (eine Redensart unserer Mutter), die ihre Kinder bittet, sie zu besuchen, oder die mit Geschenken zu Besuch kommt – eine scheinbar freundliche Frau voller ernster, strenger Ratschläge –, dann denke ich: Was um alles in der Welt will die scheinheilige Alte? Sie kann nur hinterlistig und manipulativ sein, und jeder, der ihr vertraut, ist ein Narr. Sie wird dich benutzen. Sie wird dich bei lebendigem Leibe fressen und dich unverdaut wieder ausscheiden.
Und doch ist mir das bei meiner Familie erst klar geworden, als Vater starb.
2»Es ist das Beste so«
In sieben Telefonaten und einem Gebet in Richtung Angela, die seit zweiundvierzig Jahren tot war, sagte Mutter zu jedem von uns etwas anderes. »Ich finde, du solltest kommen«, sagte sie zu mir – ich versauerte gerade in Polynesien. Zu Fred: »Als Ältester musst du jetzt Verantwortung übernehmen.« Zu Floyd: »Dad ist krank. Ich glaube, er möchte gerne, dass du da bist.« Zu Franny: »Ich glaube, ohne dich komme ich nicht zurecht.« Zu Rose: »Franny braucht jetzt deine Hilfe.« Zu Hubby: »Du musst uns fahren.« Zu Gilbert: »Dein Vater war in der letzten Zeit recht schwierig. Ehrlich, manchmal hätte ich ihn am liebsten geschlagen.«
Die Sterilität des Krankenhauses war wie die Vorbereitung für sein Dahinscheiden. Der kalte Ort schien ein Vorzimmer des Grabes zu sein. Das Zimmer war so öde wie ein Sarg. Nichts an diesem schmucklosen Ort konnte ich mit Dad assoziieren, der unordentlich war und wie viele sparsame Menschen kein Minimalist. Dad war sammelwütig. Er sammelte jede Art von Krimskrams und jede Menge Müll. Die Regale in seiner Garage waren so vollgepackt wie ein chinesischer Kaufmannsladen, auch ähnlich asymmetrisch und vornüber kippend. Er war heilfroh, dass er nahe am Meer wohnte, denn er sammelte auch Strandgut. »Das kann man noch gut gebrauchen.«
Wie ein Wrack lag er da, angeschlossen an Apparaturen, mit denen sein Herz und seine Lungen überwacht wurden. Mutter war im Flur geblieben. Sie hatte uns bedeutet, ohne sie ins Zimmer zu gehen und Vater zu begrüßen. Seit Jahren waren wir nicht mehr alle zusammen gewesen, und als wir gegen Abend um sein Bett herum standen, um für ihn zu beten, mussten wir ausgesehen haben wie abergläubische Dschungelbewohner, die ihre Götter anriefen. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass Floyd womöglich recht hatte: Im Grunde waren wir nichts anderes als Wilde.
Vater bemühte sich zu sprechen. Er keuchte durch sein Beatmungsgerät: »Alle wieder vereint.«
Wir hatten uns kaum von dem Schock erholt, ihn so hinfällig zu sehen, als Mutter uns wieder auf den Krankenhausflur beorderte. Dort stand sie, aufgeplustert vor lauter Autorität. Sie nahm die Dinge in die Hand und sagte: »Wir halten es für das Beste, ihn vom Beatmungsgerät zu nehmen. Er quält sich nur.«
Ihn vom Beatmungsgerät zu nehmen, bedeutete, ihn sterben zu lassen. Ich wollte protestieren, aber sie ließ es nicht zu.
»Der Arzt sagt, er hat nicht mehr lange. Ich halte es für das Beste.«
Ich sagte: »Aber ohne Beatmung wird er sterben!«
»Wir sollten ihre Wünsche respektieren«, sagte jemand so leise, dass ich nicht mitbekam, wer es war.
Mutters Augen waren glasig. Sie wirkte entschlossen, aber sie war nicht sie selbst, verbarg sich hinter einem Panzer. Die Situation gefiel ihr nicht, doch sie hielt sich aufrecht, schien förmlich unter Strom zu stehen. Sie würde jedem die Stirn bieten, der es wagte, sich ihr zu widersetzen. Sie war dreiundachtzig, aber rüstig. Sie wirkte wesentlich jünger. Ich erkannte sie nicht wieder. Das war nicht die zitternde alte Frau, die während Vaters Krankheit so gelitten hatte. Sie war eine Fremde, eine Ersatzmutter – wild entschlossen, taub für Ratschläge.
Vor Angst bekam ich einen Kloß im Hals. »Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung«, sagte ich lahm und dachte: sich quälen ist besser, als tot zu sein.
»Siehst du denn nicht, dass es so das Beste ist?«, sagte sie in gereiztem Tonfall, der klarmachte, dass ich Unsinn redete.
Dass ich schwach und widersetzlich war. Er sollte auf würdige Art sterben dürfen, ich hingegen drängte sie, ihn am Leben zu lassen, was grausam und unsensibel war. Ich hatte offensichtlich keine Ahnung.
»Wozu ihn unnötig quälen?«
Ihre stumme Botschaft lautete, dass ich es war, der hier grausam war, nicht sie.
»Wollen wir nicht alle essen gehen?«, schlug Gilbert mit leichter, versöhnlicher Stimme vor. »Es ist gerade Krebssaison.«
Franny und Rose standen zu beiden Seiten von Mutter, eher Kammerzofen als Töchter, und schienen sie zu stützen. Dabei ließen sie beide die Schultern hängen und trauerten in zerknitterten, schweißfleckigen Kleidern.
»Ich glaube, ich bleibe bei Dad«, sagte ich.
»Wir sollten zusammenbleiben«, sagte Mutter.
»Wir könnten ja alle bei Dad bleiben.«
»Lassen wir ihn lieber in Ruhe«, sagte sie, wieder in einem Tonfall, der andeutete, wie uneinsichtig und grausam ich war.
»Lass uns tun, was Mama sagt«, sagte Franny.
»Das ist doch nicht zu viel verlangt«, fügte Rose hinzu.
Mutter lächelte ihr herausforderndes Lächeln.
Fred sagte zu Mutter: »Du solltest tun, was du für richtig hältst.«
Floyd sagte: »Ich kapiere das nicht. Das ist so, als würden wir mit Sherpas auf den Everest klettern und als Seilschaft den Grat überqueren. Dad rutscht aus und baumelt tief unten am Seil, und wir wissen nicht, ob wir das Seil durchschneiden und ihn zurücklassen oder ob wir ihn den Berg mit hinunterschleppen sollen. Ein Schneesturm kommt auf, und wir können ihn nicht hören. Und weit und breit kein Sherpa Tenzing. Ich bezweifle, dass Hallmark für solche Fälle Trauerkarten hat.«
Hubby sagte: »Du musst mal wieder dramatisieren.«
»Oh, Entschuldigung, stimmt ja, alles halb so wild. Es ist ja nur Dad, der stirbt. Habe ich vergessen, Hubby.«
»Arschloch«, sagte Hubby.
»Ich könnte dir eine reinhauen«, sagte Floyd.
Franny sagte: »Wir wollen uns doch nicht streiten.«
»Ihr regt Mama auf«, sagte Rose.
»Ich tue weiß Gott mein Bestes«, sagte Mutter, aber nicht in ihrem üblichen selbstmitleidigen Singsang, sondern trotzig.
Wir gingen in ein Restaurant in der Nähe. Fred setzte seine Brille ab und überflog die Speisekarte. Als ältester und herrischster von uns bestellte er für alle das Tagesmenü. »Gilbert hatte recht mit den Krebsen.« Wir saßen da wie eine Trauergesellschaft, obwohl Vater nur vier Blocks entfernt noch um sein Leben kämpfte. Ich blickte in die Gesichter am Tisch, Mutter am Kopf der Tafel zwischen Gilbert und Fred, Franny und Rose daneben. Die vier beobachteten Mutter mit aufgesetztem Lächeln, loyal und unterwürfig, und blinzelten uns anderen aufmunternd zu. Hubby und Floyd saßen mit gesenkten Köpfen da. Sie wirkten unsicher.
»Es wird schon alles gut werden«, sagte Franny.
»Es ist am besten so.«
Mein ganzes Leben lang hatte ich solche Floskeln gehört, aber ich glaube, erst da ist mir klargeworden, wie viel Zynismus, Ignoranz und Feindseligkeit aus ihnen spricht.
Franny und Rose wandten sich Mutter zu und sagten: »Iss ein bisschen Brot, Ma.«
»Dad hätte es so gewollt«, sagte Mutter. »Dass wir alle zusammen sind.«
Ich entschuldigte mich leise, was leicht war, da alle am Tisch annahmen, ich ginge zur Toilette. Diesen Trick hatte ich schon als kleiner Junge in der Sonntagsschule angewandt. Ich hob einfach die Hand und sagte: »Entschuldigung, Father.« Und der Priester, der gerade so schwungvoll predigte, entließ mich mit einem Winken, weil er dachte, ich ginge zur Toilette. Stattdessen ging ich nach Hause.
Ich ging zurück zum Krankenhaus. Dad war allein in seinem Zimmer. Die Krankenschwester sagte mir, man habe ihn vom Beatmungsgerät genommen und statt der Natriumchloridlösung bekäme er eine Morphin-Infusion. Der verängstigte Ausdruck in seinen Augen erschreckte mich. Er war wie ein Gefangener, der gegen seinen Willen an einen unbekannten Ort gebracht wurde. Und genau so war es. Ich hielt seine Hand. Sie war heiß und weich wie die Hand von jemandem, der sehr krank ist. Das Morphium dämpfte den Schmerz, aber es schwächte auch den Patienten. Ihm fehlte die Kraft, sich am Leben festzuhalten. Ich konnte Resignation in seinen schlaffen Fingern spüren.
Die Messgeräte neben seinem Bett zeigten mit hüpfenden Lichtpunkten seinen Herzschlag an. Das Muster auf dem Monitor erinnerte an das Echolot auf einem Schiff, das die Gräben auf einem unregelmäßigen Meeresboden abtastet. Die Lichter und Töne, sie waren seine letzten Lebenszeichen.
Sein Atmen wurde angestrengt und rasselnd, als ob er nicht halb aufgerichtet im Bett läge (was der Fall war), sondern flach auf dem Rücken, mit einem Dämon, der auf seiner Brust hockte. Er atmete und schien doch keine Luft zu bekommen. Die Luft blieb in seinem Mund und füllte seine Lungen nicht, sodass er keuchte, während sich seine weit aufgerissenen Augen mit Tränen füllten. Die Angst zu ersticken stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Die Krankenschwester kam herein und beugte sich über die Monitore.
»Hat er Schmerzen?«, fragte ich sie.
»Ich kann ihm mehr Morphium geben«, sagte sie. Ich nahm das als Ja. Es ging ihm gar nicht gut.
»Er scheint keine Luft zu bekommen.«
»Agonale Atmung.«
Sie sagte es beiläufig, aber ich fand den Ausdruck entsetzlich.
Ich hielt immer noch seine Hand. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, aber irgendwann wurde sein Atem ganz flach, und alle Nadeln und Anzeiger zitterten und gingen nach unten. Vaters Kinn wurde schlaff. Sein Mund stand offen. Ich umklammerte seine Hand und drückte sie an mein Gesicht. Ich küsste seine stoppelige Wange.
Nimm mich mit, dachte ich.
Kurz darauf kam die Krankenschwester zurück. Sie sah mit einem Blick, was geschehen war.
»Mit Ihnen alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich.
Ich ging zurück ins Restaurant und stellte fest, dass sie alle weg waren. Ja, natürlich, es waren ja auch vier Stunden vergangen. Ich rief Mutter an.
Sie sagte: »Wo bist du gewesen? Du bist einfach gegangen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Du hast nicht einmal dein Essen angerührt. Fred und die Mädchen haben deine Krebse gegessen. Sie sind jetzt alle hier. Wir reden über Dad und erzählen uns Geschichten. So viele wundervolle Erinnerungen. Gilbert wollte gerade im Krankenhaus anrufen, um zu fragen, wie es um ihn steht.«
»Er ist tot«, sagte ich.
3This’ll be the day
Die Totenwache im Bestattungsunternehmen in Osterville war ein einziges Chaos, eine Mischung aus Tragödie und Farce. Die entfernte Verwandtschaft traf ein. Wir begrüßten uns mit Bemerkungen darüber, wie dick, wie dünn oder wie kahlköpfig man geworden war. Immer wenn wir uns trafen, was selten vorkam, wurden wir wieder zu Kindern. Wir hassten unsere Cousins und Cousinen und machten uns über sie lustig. Dann folgten die pietätvollen Bemerkungen über Dad. Dann Tränen. Danach saßen sie einfach herum und blätterten in den Fotoalben, die der eine oder andere mitgebracht hatte: Hochzeiten der Kinder, Enkel. Ferien, Haustiere und Gärten. Fotos von wertvollen Besitztümern, Autos und Häusern. Kultobjekte, wie sie prahlerische Stammesangehörige nun einmal zu einem Clan-Treffen anschleppen. »Sein Name ist Chanler! Das ist Chad! Sie heißt Tyler! Das ist Blair!«
»Kannst du dich noch an Jake erinnern?«
»Wie könnte ich Jake und den Becher jemals vergessen!«
Der kleine Jake hatte als abenteuerlustiges Kleinkind einmal einen Styroporbecher gegessen, war danach weggelaufen und hatte sich versteckt.
Mutter saß neben dem Sarg, thronte eher, empfing Leute, die ihr kondolierten – und auch sie wirkten wie Gesandte von anderen Stämmen, die großen Familien in unserer Verwandtschaft, von denen einige sogar noch größer waren als unsere. Den Ausdruck auf Mutters Gesicht kannte ich aus dem Krankenhaus: Als würde sie unter Strom stehen, mit dem starren, glitzernden Blick einer Schlange.
Weitere Rituale. Der Trauergottesdienst in der Kirche, die Platitüden, die Präsentation des glänzenden Sargs, über den Weihwasser gesprenkelt wurde, die Prozessionen und Gebete, all das wirkte auf mich geradezu heidnisch. Ich musste die ganze Zeit über an nackte, bunt bemalte Leute in Neuguinea denken, die ähnliche Rituale vollzogen, um einen Stammesältesten zu bestatten. Sie riefen die Götter an, ihn zu beschützen und seine Seele rasch in die nächste Welt zu schicken. Mutter war nun der alleinig zurückbleibende Würdenträger. Sie drückte einen Kuss auf den polierten Deckel des Sargs und ging mit lächelndem Hochmut an den Blumengestecken vorbei.
Wir fuhren in einem langen Autokorso hinter dem Leichenwagen her zum Friedhof. Mutter saß im ersten Auto hinten zwischen Franny und Rose, Fred am Steuer, Gilbert neben ihm. Hubby und seine Familie folgten im nächsten Wagen, dahinter Floyd und ich, die gescheiterten, geschiedenen Söhne.
Ich fragte Floyd, wie das Essen im Restaurant verlaufen war, das ich verpasst hatte.
»Ich bin auch nicht geblieben«, sagte er. »Ich bin spazieren gegangen. Hubby auch, aber in eine andere Richtung. Da waren wohl nur noch Ma und die anderen. Ich habe ein Gedicht darüber geschrieben.«
»Ich glaube, Ma war sauer, dass ich nicht geblieben bin. Es war wohl so eine Art Loyalitätstest.«
Floyd hörte mir nicht zu. Er sagte: »Das ist unheimlich«, und drehte das Radio lauter. Sie spielten »American Pie«.
»Erinnerst du dich noch an Grannys Beerdigung?«, sagte Floyd. Lachend schüttelte er den Kopf.
Es war eine der Fußnoten unserer Familiengeschichte, dass während des Leichenzugs zu Grandmas Beerdigung unser Cousin Allie, ein Blödmann, das Radio anhatte, und dieser Song gespielt wurde. Er sang mit und trommelte mit seinen schmierigen Affenfingern auf dem Lenkrad, während wir dem Leichenwagen mit Grandmas Sarg folgten. Ihm wurde nie zum Vorwurf gemacht, pietätlos gehandelt zu haben. Alle hielten es für eine lustige kleine Einlage. Drove my Chevy to the levee … Auf dem Friedhof trotteten wir an Grabsteinen vorbei zu dem frisch ausgehobenen Loch für Vaters Sarg. Was wie eine Gemeinschaft vieler verschiedener Trauergäste aussah, bestand in Wirklichkeit hauptsächlich aus Mitgliedern unserer eigenen Familie – Ehegatten, Ex-Ehegatten, Kinder, Enkel, Urenkel. Der Rest waren entfernte Verwandte. Freunde waren kaum da, denn meine Eltern waren in einem Alter, in dem die meisten ihrer Freunde entweder tot oder zu krank waren, um zu kommen.
Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass bei einer großen Familie wie der unseren Freunde nicht willkommen sind. In einer Familie wie der unseren gibt es keinen Platz für Fremde. Sie fühlt sich äußerst unwohl, wenn Außenstehende in die Privatsphäre des Haushalts eindringen und zu Zeugen von Wutausbrüchen werden, zu Mitwissern von Geheimnissen. Selbst Fremde, die der Familie wohlwollend gegenüberstehen, werden auf Distanz gehalten. Gerade sie, denn von ihnen muss vieles ferngehalten werden, damit die hohe Meinung, die sie von einem haben, nicht zerstört wird. Auch ein Volk von Wilden ist Fremden gegenüber misstrauisch, wenn nicht offen feindselig eingestellt. Wir waren grausam zueinander, aber gegenüber Außenstehenden waren wir noch viel grausamer. Das hatte unser »Mutterland« gemeinsam mit Albanien in seiner maoistischsten Phase, als es sich von der Welt abschottete. Man verrät sein Volk nicht!
Mutter machte immer wieder deutlich, dass die angeheirateten Ehegatten Außenseiter waren, und hinter ihrem Rücken machte man sich über sie lustig. Schlimm genug, wenn einer von ihnen Probleme machte, aber noch schlimmer war es, wenn sie versuchten, nett zu sein, womöglich Geschenke machten, Essen kochten, für etwas bezahlten. »Stell dir mal vor, so viel Geld dafür aus dem Fenster zu werfen!« Das Geschenk war lachhaft, das Essen war ein Witz, und wenn sie es sich offensichtlich mühelos leisten konnten, für etwas zu bezahlen, wo blieb da das Opfer? Einer angeheirateten Ehefrau wurde nur dann ein gewisses Maß an Respekt entgegengebracht, wenn sie selbstbewusst genug war, um eine gewisse Bedrohung darzustellen. Nur wenn Angst im Spiel war, wurden sie ansatzweise toleriert.
Zum Zeitpunkt von Vaters Beerdigung waren weder Floyd noch ich verheiratet, und unsere Ex-Frauen und meine Kinder waren nicht anwesend. Ich versuchte mir vorzustellen, was sich die Mitglieder meiner Familie über meine zwei Frauen erzählten, aber ich wusste, dass meine Phantasie dafür nicht ausreichte. Ich würde ihre Missgunst immer unterschätzen. Nach der Trennung zogen beide Frauen weit weg von mir und meiner großen Familie. Vielleicht hatten sie immer geahnt, dass sie nicht willkommen waren, und wussten, dass man sich über sie lustig gemacht hatte.
Der Priester stand im Wind, sein Gewand bauschte sich, als er seine Verse rezitierte. Was er sagte, kam mir nur formelhaft vor, nicht empfunden. »Asche zu Asche, Staub zu Staub« – das hatten wir alle schon einmal gehört, und jetzt war Vater an der Reihe. Vieles von dem, was der Priester sagte, ging im Rauschen des Verkehrs jenseits der Friedhofsmauer unter.
Floyd wiegte den Kopf. »Weißt du noch, wie Grandma hier Löwenzahn ausgegraben hat?«
Nicht Grandma Justus, sondern Mutters Mutter, eine gebürtige Italienerin aus einer anderen großen, weit verzweigten Familie. Sie grub den Löwenzahn aus, als sei er eine Delikatesse, die ignorante Leute verschmähten, und würdigte ihn, indem sie ihn bei seinem italienischen Namen nannte, soffione. Sie verwendete ihn in Salaten und Suppen. Auf dem Friedhof konnte man ihn gut ernten, weil hier keine Hunde herumliefen.
Floyd schwelgte in Erinnerungen. Es konnte aber auch sein, dass er mich zum Lachen bringen wollte. Jemanden auf Beerdigungen zum Lachen zu bringen, war eine der Fähigkeiten, die wir als Ministranten erworben hatten. Selbst Vaters Beerdigung war kein so feierliches Ereignis, als dass man es nicht wenigstens versuchen musste.
Wir hielten die Köpfe gesenkt. Wir beteten oder taten zumindest so. Floyd summte: This’ll be the day that I die. Ja, er versuchte mich zum Lachen zu bringen, indem er mich an »American Pie« erinnerte. Ich blickte zur Seite. Mutters Gesicht hatte einen Ausdruck, den ich noch nie an ihr gesehen hatte. Ihre Haltung, mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern, war die einer Trauernden, doch ihr Gesicht verblüffte mich. Der hochmütige Ausdruck war verschwunden, ebenso die glitzernden Schlangenaugen. Sie wirkte erleichtert, zufrieden, fast jubilierend, wie jemand, der ein Martyrium überlebt hat – erschöpft, aber triumphierend.
Vaters Sarg wurde nicht hinuntergelassen. Er blieb, bedeckt mit einem Samttuch, stehen. Ihn vor unseren Augen in die Grube zu lassen, wurde wahrscheinlich als zu grausig und deprimierend empfunden – irgendwie geschmacklos.
Der Priester sprach ein letztes Gebet, und mir fiel auf, dass er Vaters Namen ständig falsch aussprach. Wurde dadurch das Gebet ungültig? Danach gingen wir alle wieder zu unseren Autos.
Die meisten Berichte von Familienbeerdigungen enden hier – sie stellen in der Tat ein Ende dar. Aber als wir weggingen und Vater zurückließen, war das ein Anfang, und er begann schon, bevor wir den Friedhof verließen.
Mutter war langsam zwischen Franny und Rose auf den Parkplatz zugegangen, sie sah klein aus, eingeklemmt von ihren beiden Töchtern, deren übertrieben feierliche Gesichter bei jedem Schritt bebten und den Ausdruck veränderten.
»Lass dir Zeit, Mama«, sagten sie.
»Ich habe heute früh mit Angela geredet. Es hat mir so viel Kraft gegeben. ›Sei stark, Ma‹, hat sie gesagt. Ihr wisst ja, wie sie ist.«
Als Mutter sah, dass ich mich gerade vom Grab abwandte und ihnen folgen wollte, löste sie sich von den Mädchen und machte kehrt. Sie sah wieder aus wie früher, ziemlich dick und selbstzufrieden. Sie trat auf mich zu und drückte mir fest die Hände.
»Ich will, dass du heiratest. Such dir eine nette Frau. Tu es für mich. Machst du das?«
Sie hatte den gleichen Blick in den Augen wie im Krankenhausflur, als sie verlangt hatte, dass Vaters Beatmungsgerät ausgeschaltet werden sollte, und sie gesagt hatte: »Siehst du nicht, dass es so das Beste ist?«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie hatte Macht. Der Tod ihres Mannes – Vaters Tod – hatte ihr Kraft gegeben. Der König war tot, und sie, als Königin, war die Alleinherrscherin im Königreich. Sie war dreiundachtzig, aber für sie begann gerade in jeder Hinsicht ein neues Leben. Es würde ein langes Leben werden und so ereignisreich, dass man ein Buch damit füllen konnte.
»Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen zusammensetzen«, sagte Hubby.
Wir standen auf dem Parkplatz des Friedhofs. Ehegatten und Kinder standen ein wenig abseits, mit dem verkniffenen Ausdruck misstrauischer Leute, die erwarten, schlecht behandelt zu werden.
»Dad hätte es sicher gewollt. So was wie ein Familienessen, wie neulich Abend«, sagte Hubby.
»Ich glaube nicht, dass er das gewollt hätte«, sagte Rose. »Er hat Restaurants gehasst. Er hat immer gesagt, Restaurants sind Geldverschwendung.«
»Du hattest deine Chance und hast sie vertan«, sagte Franny. »Du bist neulich abends aus dem Restaurant verschwunden. So wie Floyd und JP. Was soll das also?«
»Ma soll entscheiden«, sagte Fred.
Wir blickten sie an. Einen Moment lang sah sie alles andere als stark aus. Sie machte eine theatralische Geste, legte eine behandschuhte Hand an die Stirn und sagte: »Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.«
Franny und Rose beeilten sich, sie zu stützen. Gilbert trug ihre Handtasche, und auch Fred schlich um sie herum.
Wir Übrigen gingen unserer Wege. Im Auto sagte Floyd: »Fred ist ein solches Arschloch. ›Ma soll entscheiden‹«.
Ich rief Mutter an jenem Abend an, aber sie ging nicht ans Telefon. Stattdessen nahm Franny den Hörer ab.
»Sie ist müde«, sagte Franny. »Rose und ich bleiben noch ein paar Tage hier, um uns um sie zu kümmern. Das war ein schrecklicher Schock für sie. Ihre Nerven sind angegriffen.«
Ein schrecklicher Schock? Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Schock für sie gewesen sei, nur eine große Belohnung, ein Zuwachs an Gesundheit und Kraft, neuer Spannkraft und Selbstvertrauen.
Ich rief sie am nächsten Tag an, und sie sagte, es ginge ihr besser, zumal Franny und Rose bei ihr seien. Ihre Anwesenheit kam mir merkwürdig vor, denn sie waren beide berufstätig als Lehrerinnen und vernachlässigten jetzt offensichtlich ihre Arbeit.
Als sie ein paar Tage später allein war, rief sie mich an. »Ich schicke dir ein bisschen was. Von den Kosten für Dads Beerdigung ist Geld übriggeblieben.«
Mutter bezahlte einen Nachbarn dafür, dass er Dads Schuppen, in dem er die Werkzeuge aufbewahrt hatte, ausräumte. Auch die Garage. Dads gesammelte Besitztümer kamen auf den Müll. Die Farbdosen, die Dosen mit den Nägeln, die Seile, die Drahtrollen, die rostigen Schraubenzieher, die Bindfäden, der Stapel sorgfältig gefalteter brauner Einkaufstüten. Die vergilbten Zeitungsausschnitte. Er hatte sie an die Wand geheftet. Einige davon waren sehr alt: Auf einem stand DER KRIEG IST VORBEI, auf einem anderen ENDLICH FRIEDEN, die Bostoner Zeitung von 1945. Manche Ausschnitte waren Zeitungsfotos von uns. Floyd, der in der Turnhalle der High School einen Korb warf. Fred in Eishockeymontur, mit erhobenem Schläger, als würde er im nächsten Moment den Puck stoßen. Ich mit einer Medaille für ein Forschungsprojekt an der Schule. Hubby in einer Gruppe ernst aussehender Pfadfinder auf dem Weg zu einem Ferienlager. Ausgeschnittene Artikel über Ereignisse wie Band-Konzerte und Sportveranstaltungen. Dann wieder Fotoaufnahmen. Franny und ihr erschrockener Abschlussball-Tanzpartner. Franny als Nonne, in ihrem Pinguin-Habit. Rose, ein hübsches Kind in einem weißen Kleid, mit gefalteten Händen: Erstkommunion. Gilbert, der hinter dem Steg seiner Geige lächelt. Es gab auch ein paar Versuche von Familienfotos, aber sie waren amateurhaft und chaotisch. Wir waren einfach zu viele, die Kamera war billig. Wir sahen aus wie ein aufgebrachter Mob. Vaters Holzofen wurde aus dem Wohnzimmer entfernt. Er hatte ihn bis zu dem Abend, als er ins Krankenhaus kam, am Brennen gehalten. Niemand wollte den alten Ofen. Als er weggerückt wurde, quoll Asche heraus, und der graue Staub, der den Boden bedeckte, war eine makabre kleine Erinnerung an ihn.
»Er hat ihn nie gründlich saubergemacht«, sagte Mutter.
Einen Monat später fuhr ich noch einmal auf den Friedhof. Vaters Grab sah neu und farblos aus. Ich pflanzte ein paar Geranien vor dem Stein und einen kleinen Wacholder auf jede Seite. Ich sagte es Mutter.
Sie lächelte mitleidig, wie sie es immer tat, wenn ich einen Fehler begangen hatte. Sie sagte: »Er sieht es nicht, das ist dir doch wohl klar.«
Sie schickte mir einen Scheck über fünfhundert Dollar. Ich wollte das Geld nicht, aber ich wusste auch nicht, was ich hätte tun sollen. Die ungeheuerliche Tatsache, Geld von Mutter zu erhalten, verwirrte mich so sehr, dass ich es behielt.
Franny und Rose waren geschäftiger denn je. Manchmal kamen sie auf dem Weg zu Mutter bei mir vorbei und brachten mir Süßigkeiten vorbei oder Donuts, Dinge, von denen sie dachten, dass jeder sie essen würde.
»Wir besuchen sie jeden Sonntag«, sagte Franny eines Tages. Rose lächelte nur. Sie hatten es sich auf meinem Sessel gemütlich gemacht. Ich war fasziniert davon, wie die Federn unter ihrem Gewicht ächzten. »Wir wissen ja, wie viel du zu tun hast. Du brauchst nicht mitzukommen, wenn du nicht willst.«
Kurz darauf kaufte sich jede von ihnen ein neues Auto.
»Mama liebt Besuche«, sagte Rose. »Du weißt ja, wie sie ist.«
Ich sagte ja, ich wüsste es. Aber wusste ich es wirklich? In Mutterland war nichts einfach.
4Treueschwüre
Für die Welt – und die Welt war unsere Kleinstadt, unsere Nachbarschaft, unsere Kirche, die Schulen, in die wir gingen – waren wir eine vorbildliche Familie. »Deine Leute sind das Salz der Erde«, sagte Father Furty zu mir, wenn er mich schalt. Er tadelte mich, indem er sie pries. »Säulen der Gemeinde«, sagte er ein anderes Mal. Mich nahm er nicht für voll, aber meine Eltern galten als loyal und gottesfürchtig. Seine hohe Meinung von ihnen wurde in unserer kleinen Welt allgemein geteilt. Unsere Familie war größer als die meisten anderen und wegen ihrer Größe umso bewundernswerter. Wir wurden geschätzt für unseren Einsatz, unsere Rechtschaffenheit, unseren Anstand. Nicht zimperlich, nicht versnobt. Auf uns konnte man sich verlassen. Wir waren gute Leute. Wir waren … Ja, es ist ziemlich unerträglich, aber ich bitte um Ihr Verständnis.
Dad, Inhaber einer schlecht laufenden Firma, arbeitete hart. Er war ein stolzer Mann, ein treusorgender Ehemann und Vater. Er kam selber aus einer großen Familie, die vornehme Ahnen hatte (Franko-Kanadier und Indianer), aber sonst keinerlei Errungenschaften vorweisen konnte. Der Nebel der Vergangenheit umhüllte auch das Geheimnis des Familiennamens. Ursprünglich hatte die Familie Justice geheißen, als sie in Neufrankreich gelebt hatten. Als sie dann weiter nach Süden in die Vereinigten Staaten zogen, wurde Justus daraus. »Mein Großonkel Pierre buchstabierte den Namen J-U-S-T-I-S-S«, sagte Dad. Er liebte es, seinen Namen zu erklären, und wenn er ihn französisch aussprach, stülpte er die Lippen nach vorn wie ein Fisch und sagte süßlich: »Justiiis.«
Dads Familie hatte drei Jahrhunderte in Nordamerika gelebt. Sie konnten keinen romantischen Gründungsmythos vorweisen, keine Geschichte von Aufbruch und Neuanfang, von entsagungsvoller Plackerei und schließlichem Erfolg, die amerikanische Familien so gern zu erzählen pflegen. Nur die Namensänderung war ein Hinweis darauf, wann Dads Familie angekommen war, obwohl alle Geburtsurkunden verlorengegangen waren. Auf der Seite seiner Mutter waren sie Ureinwohner gewesen, die seit Tausenden von Jahren in den Wäldern hausten. Dads Leidenschaft für Müllhalden war wohl ein Erbe seiner Jäger-und-Sammler-Vorfahren.
»Grandma hat immer mit den Indianern gespielt«, sagte Dad, seine Art, darauf hinzuweisen, dass sie Indianerin war. »Sie hat einmal sogar Buffalo Bill gesehen.«
Einer von Dads Ahnen, Antoine Justice, gilt als Mitbegründer der Stadt Detroit, unter Antoine de la Mothe Cadillac. Aber damit befinde ich mich schon im Reich der Legenden. Tatsache ist, dass dieser Vorfahr, der noch unseren unveränderten Familiennamen trug, Matrose in der französischen Marine war. Er war rekrutiert worden, weil er in seiner Heimatstadt Verdun-sur-Garonne, in den Pyrenäen nahe Toulouse, Fährmann auf dem Fluss gewesen war. Seine Muttersprache war nicht Französisch, sondern, da er aus der Provinz kam, Gaskognisch. 1693, in seinem ersten Winter in Kanada, stöhnte dieser Sohn der Gascogne also nicht: »Le temps est très froid«, oder: »Il fait froid«, sondern stellte wortreicher fest: »Dieu vivent! Fa pla fred a pr’aici.« Und da er so weit von zu Hause weg war, murmelte er: »Soi pla lan d’enta ieu«, statt: »Je suis bien loin de chez moi.«
Die meisten anderen Soldaten kamen aus der Normandie. Antoine, der Gascogner, hielt sich daher abseits und redete hauptsächlich mit sich selbst. Damit etablierte er eine wichtige Familientradition. Er nervte die Eingeborenen und wurde schließlich selber einer in der Wildnis von Kanada, wo er sich als Pelztrapper durchschlug und sich nach seiner Entlassung aus der Marine eine Farm zulegte. Dreihundert Jahre lang lebte die Familie in ihrem Dorf in Québec. Sie waren älter als die Eichen, älter als das Weidegras, das ihrem winzigen Dorf seinen irokesischen Namen gab, Yamaska, Ort des Schilfs.
Wie Dad war auch Dads Familie beispielhaft in ihrer Ausdauer und ihrem Gleichmut. Sie besaßen Fähigkeiten zum Überleben, aber die Passivität steckte ihnen von Geburt an in den Knochen. Wie die Ureinwohner hassten sie Veränderung, hatten Angst vor jeder Neuerung und waren misstrauisch Fremden gegenüber. In ihren schlammigen Stiefeln blieben sie Bauern, und als sie von der fernen Französischen Revolution hörten, kümmerte sie das nicht. Wenn die Ernte schlecht war, fuhren sie von Kanada in die Vereinigten Staaten und wieder zurück, ungeachtet der internationalen Grenze, da die Familie vorher da gewesen war. Sie hatten kein Heimatland. Sie hatten eine Familie und ein Stück Land. Pässe kannten sie nicht. Sie konnten nicht lesen, sie wählten nicht. Langsam, wortkarg, freundlich, besaßen sie die Tugenden von Gemüsebauern und Hühnerzüchtern. Sie prahlten nicht, waren stolz, nicht groß herumgekommen zu sein, blieben da, wo sie waren, sanftmütig und bescheiden. Wie es für Bauern üblich ist, spotteten sie über Reichtum, Materialismus, Weltgewandtheit und schönen Schein. Sie hassten die Engländer nicht, obwohl sie von ihnen besiegt und kolonialisiert worden waren. Sie hielten die Engländer einfach für eine andere Spezies, schwer zu verstehen, komisch in ihrem Ehrgeiz und gefährlich, wenn man sie reizte. In Vaters Familie waren Hühner und Kühe die Währung. Sie kannten keine Gesetze außer ihre eigenen. Sie waren ganz sie selbst und hatten nicht vor, sich irgendwie zu verändern. Sie konnten nicht schreiben, und so wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Standesamt, als sie den Namen nannten, den sie nicht schreiben konnten, aus »Justice« Justus.
Mutters Familie war das genaue Gegenteil. Sie waren um die Jahrhundertwende aus Italien gekommen, neue Amerikaner, mit der Energie von Rüsselkäfern: ambitioniert, dünnhäutig, ruhelos, spöttisch, hektisch, konkurrenzbewusst. Sie mussten sich und den anderen stets etwas beweisen, wollten immer mehr und bekamen nie genug. Sie waren von Natur aus Aufsteiger und zu ehrgeizig, um aufrichtig zu sein. Aus ihnen hätte auch ohne weiteres ein Haufen Krimineller werden können.
Aber da es ihnen an Einfluss mangelte, sie das Gesetz fürchteten und auf Konventionen nicht verzichten mochten, waren sie gezwungen, ihren eigenen Klischees zu glauben und schließlich nach ihnen zu handeln, indem sie sie in Taten verwandelten. Sie strebten nach Bildung, gaben sich bürgerlich. Man erwartete von den Kindern, dass sie Erfolg hatten. Ein Sohn als Bauingenieur, ein anderer als Unternehmer, zwei Töchter als Lehrerinnen, eine andere als Krankenschwester, und der Jüngste erfüllte seine spirituelle Rolle in der katholischen Familie und wurde Priester, Father Louie. Mutter verehrte ihn, wegen seines Gelübdes, und sie pries auch die Erinnerung an ihren Vater: »Er war ein Heiliger.« Vor ihrer Heirat war Mutter Lehrerin gewesen, und als Gilbert in die Schule kam, begann sie wieder zu unterrichten. Gilbert war ihr Musterschüler in der ersten Klasse.
Wir gingen regelmäßig in die Kirche. Alle Pfarrer kannten und schätzten uns. »Die Familie, die zusammen betet, bleibt auch zusammen«, tönte Father Furty von der Kanzel. Die gute Meinung der Priester war, als ob Gott auf uns herab lächelte, denn schließlich waren sie Gottes Gesandte auf Erden, seine Mittler und Stellvertreter. Sie besaßen die Macht, uns von der Sünde zu erlösen, sie konnten Gott unsere Seelen empfehlen und uns durch ihr Eingreifen vor der Hölle bewahren. Sie konnten uns in den Himmel bringen.
Dad war im Kirchenchor, und seine Söhne waren Ministranten. Franny und Rose wollten Nonnen werden. Wir waren fleißig und klagten nicht. Ich packte im »Stop and Shop« die Waren der Kunden ein, sortierte Dosen in die Regale. Fred arbeitete für Dad, der andeutete, dass Fred die Firma übernehmen würde. Floyd arbeitete in einem Laden, der Büroartikel verkaufte. Hubby trug Zeitungen aus, und später, weil er das letzte Kind war, übernahm sogar Gilbert Teilzeitjobs. Die Mädchen hüteten die Nachbarskinder. Wir waren der Inbegriff einer harmonischen, fleißigen Familie.
Das größte Verdienst wurde dabei Mutter zugesprochen. Sie galt als bescheiden und sparsam. Eine fürsorgliche, kluge, praktische, durch nichts aus der Fassung zu bringende, umsichtige Hausfrau und Mutter. Die Auszeichnung »Mutter des Jahres« war für sie kein Witz. Obwohl sie es nie sagte, ließ sie durchblicken, dass sie durchaus dafür qualifiziert sei, dass sie aber so in ihrer Mutterrolle aufging und so viel zu tun habe, dass sie die Sache nicht verfolgen könne.
Aber warten Sie. Nichts von dem entsprach der Wahrheit. Es waren allenfalls Halbwahrheiten, wenn nicht schlicht und einfach Lügen.
Was die Welt von uns wusste, stimmte nicht. Wir machten die Tür unseres großen, achtbaren Hauses zu und zogen uns zurück in das heruntergekommene, düstere Innere mit seinen wackeligen Tischen und den unbequemen Stühlen, wie Ratten, die ihr Nest schützen und ihre gelben Zähne blecken. Ratten, die nicht nur die Welt auf Distanz hielten, sondern gleichzeitig versuchten, den Schein zu wahren.
Unsere Familiengeheimnisse waren viel zu schrecklich, um enthüllt zu werden. Nehmen wir zum Beispiel Father Louie. Für die Welt war er ein fromme Mann, aber wir kannten ihn als schimpfenden Besserwisser, als Erzähler unanständiger Geschichten, als Prahlhans und Tyrann. Er war grausam und wahrscheinlich schlichtweg wahnsinnig. Wir fürchteten seine Besuche. Er trank bitter schmeckende Moxie-Limonade, rauchte eine Fatima-Zigarette nach der anderen, kniff uns mit zwei Fingern und drehte sie um. Er sagte, wir seien faul und bösartig. Er hackte auf Floyd herum, schimpfte ihn vor uns allen aus: »Machst immer noch ins Bett! Deine arme Mutter!« Floyd sagte, er würde Onkel Louie am liebsten zu Brei schlagen.
Wir hassten unsere Jobs nach der Schule. Fred schämte sich für Dads lächerlich dahintröpfelndes Schuhgeschäft. Floyd verabscheute seinen Chef im Schreibwarenladen. Sogar an dem Tag, als er in der Schule einen Preis für gute Leistungen gewann, musste er dort arbeiten und verpasste deshalb die Urkundenübergabe. Weil ich abends im »Stop and Shop« arbeitete, konnte ich nie an Aktivitäten nach der Schule teilnehmen und hatte immer Mühe, meine Hausaufgaben zu machen. Für gewöhnlich blieb ich noch da, wenn der Laden zumachte, um beim Auffüllen der Regale zu helfen – ich drückte einen vollen Karton an die Brust und räumte die Dosen ein. Ich war schnell, ich wusste, wie man mit einem Etikettierer umging und den Preis in violetter Tinte auf die Dosen brachte. Ich konnte eine Kiste Toilettenpapier mit einem Teppichmesser aufschneiden, ohne den Inhalt zu zerfetzen, dreißig Einkaufswagen auf einmal schieben und Eisbergsalat zu symmetrischen Haufen arrangieren, aber ich konnte keinen Ball mit einem Baseballschläger schlagen und keinen Fußball ins Netz kicken.
Faul waren wir nicht, aber bösartig. Wir verleumdeten einander, waren hinterhältig, stritten uns ständig. Und uns waren die anderen Geschwister peinlich. Auch Mutters kreischende Wutausbrüche waren peinlich. Sie ertrug es nicht, dass so viele Leute im Haus waren, wir hockten ihr ständig auf der Pelle und verschwendeten ihre Zeit. »Kinder machen jede Ehe kaputt«, sagte Dad – eine seiner Redensarten, aber er sagte sie nur Mutter zuliebe. Er schien eigentlich Spaß an uns zu haben. Mutter hingegen rühmte sich zwar der Tatsache, uns geboren zu haben, beklagte sich aber darüber, dass wir da waren.
War ihr Vater, unser Grandpa, ein Heiliger? Ich kannte ihn als schnurrbärtigen Patriarch, der an einer Nähmaschine saß, Faden von einer Spule abbiss und ihn mit den Zähnen knotete, wie ein Otter, der einen Hering zerlegt. Er hielt mir Vorträge über Manieren, während er einen Nadelstreifenstoff mit einem kleinen Stück Markierseife bearbeitete. Weil er Schneidermeister war, machte er seine Anzüge selber. Er war gekleidet wie ein Dandy, mit Weste und Uhrkette, immer eine dicke Zigarre zwischen den Lippen.
Später sagte Floyd: »Grandpa sah aus wie Alexander Woolcott.« Er hob seinen kleinen Finger. »Woolcott, immer nach Lavendel duftend, der einmal zu Anita Loos gesagt hat: ›Mein Leben lang war es mein größter Wunsch, Mutter zu sein‹.«
Grandpa stand unter der Knute seiner Frau – der stöhnenden, mondgesichtigen Grandma, berühmt für ihre Sparsamkeit, den Löwenzahn, den sie ausgrub, die angeschlagenen Dosen und das einen Tag alte Brot, das sie kaufte. Sie war auch berühmt dafür, dass sie die Ehe ihrer Tochter mit unserem Vater missbilligte. Sie hielt ihn für einen ausgemachten Dummkopf und machte kein Geheimnis daraus, dass sie die gesamte Familie Justus für Pack hielt.
Mutter war unsere Anwesenheit zuwider. Sie beklagte sich über den Lärm, den wir machten, hasste es, die Wäsche zu waschen, und konnte nicht gut kochen. Ihr fehlt die Geduld, ihr fehlte vor allem die nötige Liebe zum Kochen.
Mutter schien ihre Inkompetenz zu genießen und uns damit herausfordern zu wollen. Ihre Erbsensuppe war so klumpig, dass man sie nicht schlucken konnte. Sie war verbrannt und klebte am Topfboden an. Auch ihre Hafergrütze konnte man nicht schlucken, weil sie so klumpig war. Ihren Haferbrei konnte ich nicht essen, ohne mich übergeben zu wollen. Wenn sie Spaghetti kochte, klebten sie wie ein einziger Tampen aneinander, weil Mutter zu sehr in Eile war, um umzurühren. Sie kochte Niereneintopf, speziell für Vater, dessen Mutter das immer gekocht hatte. Wir alle fürchteten den Niereneintopf: sehnige Innereien, die nach Kuhpisse stanken, gemischt mit krümeligen Kartoffeln, halb rohen Zwiebeln und Dosenerbsen. »Du kochst wundervoll, Mutter«, sagte Vater.
Ihre kostengünstige Hausmannskost wurde für gewöhnlich in einem einzigen großen schwarzen Topf serviert, und wir aßen aus Angst, sie zu beleidigen. Eines Abends nahm Mutter den Deckel vom schwarzen Topf und servierte ein Gericht, das mir unheimlich war. Ich konnte es nicht anrühren. Sie verlangte, dass ich meinen Teller leer aß. Ich vermutete, dass sie uns absichtlich dieses entsetzliche Essen auftischte, weil sie uns nicht leiden konnte, und ich weigerte mich, Teil dieser Strafaktion zu sein.
»Ich mag nicht«, sagte ich.
Vater sagte: »Iss! Ich mag auch viele Dinge nicht, und ich esse sie trotzdem.«
Mutter warf ihm einen bösen Blick zu. Wir hatten beide bei ihr verspielt. Sie verzieh ihm diese Indiskretion nie.
»Du gehst erst dann zur Schule, wenn du deinen Haferbrei gegessen hast«, sagte Mutter immer, und ich saß da, während mein Haferbrei fest und immer fester wurde. Mutter war stur, und sie blieb so lange drohend neben mir stehen, bis ich ein paar Löffel hinunterwürgte. Allein der Geschmack trieb mir die Tränen in die Augen. Einige Male kam ich deswegen zu spät zur Schule, und die Entschuldigung, die ich in meiner Not vorbrachte, kam der Wahrheit näher, als ich ahnte: »Meine Mutter ist krank.«
Weißbrot mit Erdnussbutter und Gelee, Marshmallows in großen, zerknitterten Tüten, eine Art Schmierkäse auf Crackers und Karo-Sirup auf Toast – all das bereiteten wir uns selbst zu, aßen es allein und sagten uns, dass es uns schmeckte.
Unser unaussprechliches Geheimnis war, dass Dad pleite war. Seine Firma wurde liquidiert, aber er erfuhr es erst an dem Tag, als es passierte. Eine Insolvenz verläuft immer leise. Verschwiegenheit ist das A und O. Die Leute, die es eigentlich betrifft, erfahren die Hiobsbotschaft oft erst, wenn es zu spät ist. American Oak war ein Lederhändler, der Kuhhäute an Schuhfabrikanten lieferte. Vater war mit dem stinkenden Gerben von Tierhäuten, einer der geruchsintensivsten Branchen der Welt, aufgewachsen. »Es geht nichts über Leder«, pflegte er zu sagen. Was Schuhleder anging, war er ein Kenner – genarbtes Leder, Spaltleder, Ziegenleder, handgenäht, gepresst, die Lasche, der Rahmen, der Schaft, das Blatt. »Hier hat sich der Stier an einem Stacheldrahtzaun gerieben«, sagte er einmal zu mir und zeigte mir eine Narbe auf einer dicken Lederhaut. Aber jetzt war das Unternehmen pleite, und bald schon würden die Schuhfabriken in Neuengland der Vergangenheit angehören.
Vater erholte sich nie wieder davon. Er war Mitte vierzig, noch relativ jung, doch er besaß weder Ehrgeiz noch die nötige Phantasie, um so etwas wie einen Neuanfang zu wagen. Die Finanzwelt war ihm ein ewiges Rätsel. Dad war naiv, und obwohl er ein erfindungsreicher Geschichtenerzähler sein konnte, war er eigentlich ein schüchterner Mann. Er hatte durchaus seine Auftritte, in denen er agierte wie ein Schauspieler, oft lustig, manchmal streng, wenn er zum Beispiel Mutter in einem ihrer Wutausbrüche gegen uns beistand, eine Hand hob, um uns zum Schweigen zu bringen, und sagte: »Schmerzlicher als der Schlange Zahn ist ein undankbares Kind!«
In der Zeit ohne Einkommen brauchte er Arbeit, aber er suchte weniger nach einem Job als nach einem Wohltäter. Er war in einer Kultur aufgewachsen, in der Arbeit Mangelware und ein Job eine Gunst waren. Seine einzige Sorge war es, seine Würde zu bewahren, respektabel zu wirken – um der Familie willen. Er machte ein finsteres Gesicht und reagierte stur und mit Schweigen, als ihn Mutter darauf hinwies, dass in der Kirche die Hausmeisterstelle frei war. Vater war entsetzt – seine natürliche Frömmigkeit machte ihn von Natur aus antiklerikal. Und uns erschreckte die Aussicht, zu sehen, wie Vater in Latzhose mit einem Besen den Gang fegte, nicht so sehr, weil er unter der unwürdigen Arbeit leiden würde, sondern weil uns dieser Anblick peinlich gewesen wäre.
Doch er wurde vor dieser Schmach bewahrt. Er fand eine Stelle in einem Herrenbekleidungsgeschäft am Markt – in der Schuhabteilung. Er war zwar nur noch Angestellter, besaß aber so viel Selbstachtung und Stolz – schließlich war er tief gefallen –, dass er immer noch wie ein Lederbaron in Nadelstreifenanzug herumlief und das Wort »Herrenausstatter« verwendete. Ich gewöhnte mich so an seine Art zu sprechen, dass ich erst hinterher merkte, dass seine Euphemismen sich seiner Scham verdankten.
Er sagte nie, er sei müde. Er war »bettreif«. Und wenn er bettreif war, nahm er »eine Mütze voll Schlaf«. Wenn ihn eine Ungerechtigkeit aufregte, sagte er: »Das bringt mich auf die Palme.« Um seine Verwunderung auszudrücken, sagte er: »Das schlägt dem Fass die Krone aus«, und: »Donnerschlag!« Sein Auto war »die Karosse«, und als er sie mit Gewinn verkaufte, war er »bass erstaunt«. Uns Kinder nannte er »kiddos«. Auch auf Französisch, das er fließend sprach, war er euphemistisch. Wenn er sich über einen seiner Söhne aufregte und ihn schlagen wollte, nannte er ihn »mo’ psi’ bonhomme« (mon petit bonhomme, junger Mann). Er sagte »clem«, wie in Québec üblich, für »crème«, und »clem à la glass« für Speiseeis, und wenn wir Krach machten oder das Haus in Unordnung brachten, bedachte er uns mit einem Wort, das es zwar in Französisch-Kanada, aber nicht in Frankreich gibt: »plaquoteurs!« Nichtsnutze!
Wenn die Leute ihn nach dem Bankrott seiner Firma versuchten aufzuheitern, zuckte er nur mit den Schultern und sagte mit seinem Québecer Akzent: »Les gens heureux n’ont pas d’histoire.«
Sein tiefer Fall beschämte und erschreckte mich, und selbst als Kind von neun Jahren – das war 1950 – bemitleidete ich ihn dafür, dass er das Gespött und die schlechten Witze seiner Kollegen ertragen musste, vier oder fünf lächerliche Angestellte, mit ihrem zweifelhaften Fachwissen in Sachen Hemden und Krawatten. »Ein Hathaway-Hemd ist nicht zu schlagen … Das sähe schick aus mit einer Krawatte … Was Sie brauchen, ist eine Weste … Französische Manschetten sind ein Zeichen von Klasse … Dieser Mantel ist zu elegant.« Vater unterschied zwischen Schnürstiefel und Halbschuh, sprach von Budapestern und Stiefeletten, von Fußanatomie, Spann und Ballen, und empfahl zum Beispiel einen Schuh, indem er sagte: »Er stützt das Fußgewölbe gut, er hat einen Stahlschaft.« Er sagte, der linke und der rechte Fuß seien immer leicht unterschiedlich in der Größe: »Sie sind Rechtshänder«, sagte er zum Beispiel, denn der linke Fuß eines Rechtshänders war größer als der rechte. Er hatte zwar keine leitende Position, aber er versah seine Arbeit mit großer Sachkenntnis und Umsicht. Er war so vertraut mit dem menschlichen Fuß wie ein Podologe. »Was Sie für Ihre Füße brauchen, ist adstringierender Puder.«
»Er ist kein Schuhverkäufer, er ist Schuhliebhaber«, sagte Floyd.
Mutter machte ihm mit ihren Launen zu schaffen. Manchmal erinnerte sie ihn daran, dass er nur wenig Geld verdiente, und er nahm ihr ihre Macht so übel, dass er seinen Ärger an uns ausließ. Er war hilflos, ein weiteres von Mutters verzweifelten Opfern.
Er war Mutters Vollstrecker. Ein Versager als Selbständiger, doch als Angestellter so zufrieden, wie dies nur möglich war. Mutter kannte das Geheimnis seiner Schwäche, seinen Stolz auf seine adrette, förmliche Kleidung, sein Verlangen, ihr zu gefallen, und deshalb beutete sie seine Unsicherheit aus. Sie stöhnte über uns, flüsterte ihm ihren Kummer ins Ohr. Sie besaß die Fähigkeit, Vaters Zorn zu erregen – er war irrational und gewalttätig, wenn er wütend war, und weil er uns leidenschaftlich liebte, wurde er außer sich vor Wut, fast wie von Sinnen in seiner Verwirrung und schlug uns umso fester.





























