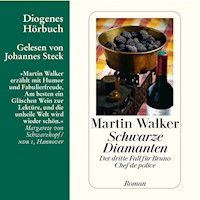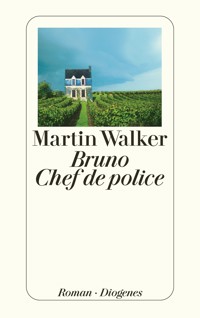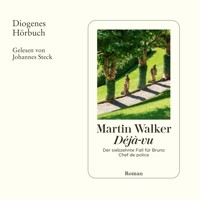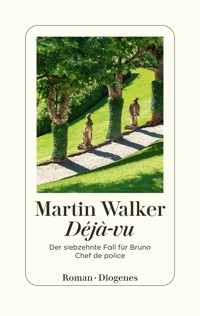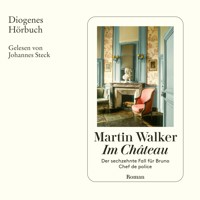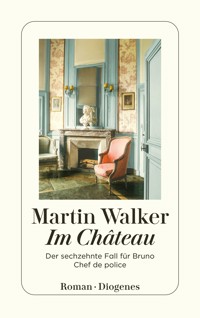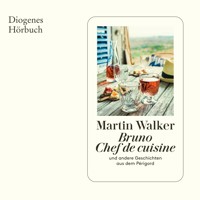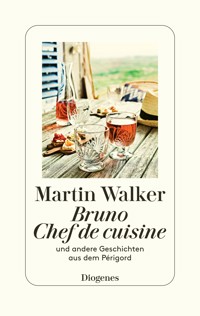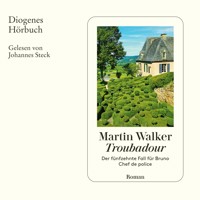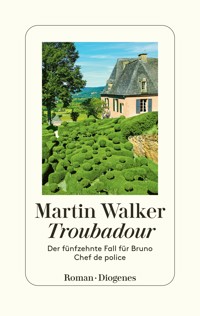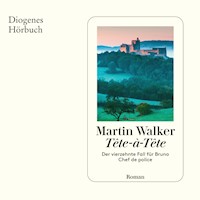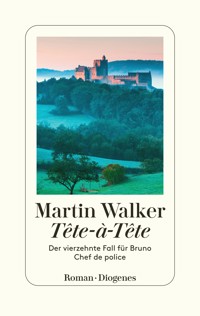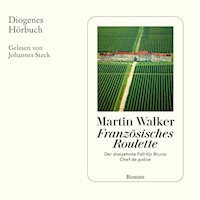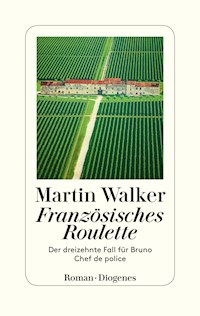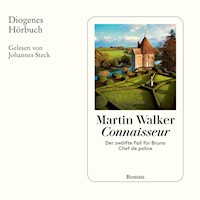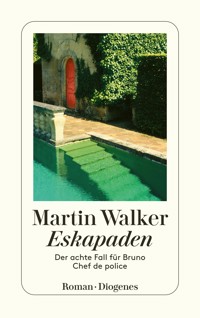
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Das Périgord ist das gastronomische Herzland Frankreichs – neuerdings auch wegen seiner aus historischen Rebsorten gekelterten Weine. Doch die Cuvée Éléonore, mit der die weitverzweigte Familie des Kriegshelden Desaix an ihre ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen will, ist für Bruno, ›Chef de police‹, eindeutig zu blutig im Abgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martin Walker
Eskapaden
Der achte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Dieses Buch ist drei wundervollen Frauen gewidmet: Micheline Morissonneau von Périgord Tourisme sowie Marie-Pierre Tamagnon und Anne Lataste von Vins de Bergerac. Ich danke ihnen für ihre unermüdliche Hilfe, Unterstützung und Freundschaft. Ohne sie hätte ich nicht annähernd so viele der Reize unserer herrlichen Region kennengelernt.
1
Benoît Courrèges, Chef de police der Kleinstadt Saint-Denis und allen bekannt als Bruno, hatte sich so sehr auf diesen Tag gefreut, dass er nie auf die Idee gekommen wäre, er könnte tragisch enden. Die Aussicht darauf, den Helden seiner Jugend zu treffen, von ihm auf sein Schloss eingeladen zu werden und die Hand eines der illustresten Söhne Frankreichs zu schütteln, ließ ihn vor Ehrfurcht erschauern. Was bei ihm nur selten der Fall war.
Bruno interessierte sich für den Patriarchen, seit er als Junge im Wartezimmer eines Zahnarztes in einer zerlesenen Paris Match auf einen Artikel über ihn gestoßen war und von seinen Heldentaten gelesen hatte, und zwar so brennend, dass er am liebsten ein Album über ihn angelegt hätte, um sämtliche Bilder und Reportagen über ihn darin zu sammeln. Aber weil er als Waisenkind und später als Mündel seiner Tante keinen direkten Zugriff auf Zeitungen oder gar Illustrierte hatte, musste er mit Büchereien vorliebnehmen, zuerst mit der des kirchlichen Waisenhauses und später mit der öffentlichen Bibliothek von Bergerac. Die Bilder waren ihm unauslöschlich im Gedächtnis haftengeblieben: sein Held vor einem Kampfflieger in Tarnfarben in hohem Schnee; in kurzen Hosen und mit einem schweren Bajonett bewaffnet in der Wüste; mit einem Drink in der Hand in einem eleganten Schloss oder Salon. Auf seinem Lieblingsbild war er als Pilot zu sehen, mit zerzaustem Haar, den Fliegerhelm in der Hand, mit dem er einer Gruppe Mechaniker und Fliegerkameraden zuwinkte, die jubelnd auf ihn zuliefen, um ihn als ersten Franzosen zu feiern, der die Schallgrenze durchbrochen hatte.
Jetzt war der große Moment gekommen, und Bruno musste unwillkürlich grinsen, als ihm bewusst wurde, wie aufgeregt er war. Als ehemaliger Soldat kannte er das Durcheinander von Befehlen und Gegenbefehlen, all die aufreibenden Spannungen, die der Krieg mitbrachte, nur zu gut und wusste, dass im öffentlichen Bild des Patriarchen alle Makel, Misserfolge und gescheiterten Operationen einfach ausgeblendet waren. Und eigentlich hätte Bruno aus seiner Heldenverehrung mittlerweile herausgewachsen sein sollen. Aber ein Rest jugendlicher Schwärmerei für diesen Mann, den er für den letzten französischen Helden hielt, glühte wohl noch immer in ihm.
Als er sich in die Schlange der Gratulanten einreihte, die darauf warteten, dem Jubilar die Hand zu schütteln, wurde Bruno bewusst, dass er noch nie einem so prunkvollen und exklusiven Ereignis beigewohnt hatte. Das Château war zwar nicht besonders groß – nur dreigeschossig und mit jeweils vier Fenstern zu beiden Seiten des imposanten doppelflügeligen Portals –, dafür perfekt proportioniert und liebevoll restauriert. Der angrenzende Turm mit seiner trutzigen Brustwehr stammte aus dem Mittelalter, während das Schloss selbst die diskrete Eleganz des 18. Jahrhunderts ausstrahlte. Auf der breiten Terrasse mit Blick auf den französischen Garten spielte ein Streichquartett den Herbstsatz aus Vivaldis ›Vier Jahreszeiten‹, der vor Brunos innerem Auge die bukolischen Gemälde von Fragonard erstehen ließ, die er sich sehr gut als Wandschmuck in den unteren Salons vorstellen konnte.
Am Fuß der Treppe in den Schlosspark hatten sich über hundert Gäste eingefunden, die an Champagnergläsern nippten, miteinander plauderten und über die Kieswege zwischen den symmetrisch angelegten Beeten schlenderten. Oben auf der Terrasse, wo Bruno stand, drängten sich fast ebenso viele Menschen, die sich von Kellnern in Luftwaffenuniformen mit Getränken bedienen ließen und sich auf Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Arabisch unterhielten. Bruno zählte mindestens ein Dutzend unterschiedliche Paradeuniformen und erkannte Politiker aus Paris, Toulouse und Bordeaux wieder, fast ausschließlich Mitglieder der konservativen Partei, aber auch einige sozialistische Bürgermeister und Minister der aktuellen Regierung in Paris.
Alle Männer hatten nur Augen für eine blonde, überaus attraktive Frau, von der Bruno nun seit wenigen Minuten wusste, dass sie die Schwiegertochter des Patriarchen war, Madeleine hieß und seine, Brunos, Tischdame sein würde. Sie hatte ihn, als er ihr vorgestellt wurde, mit kühlem Lächeln taxiert und, kaum dass er ihr die Hand gegeben hatte, mit einstudierter Bewegung an ihren Gatten weitergereicht, der neben ihr stand.
Hinter dem Schlosspark erstreckten sich zur Rechten bis ans Dordogne-Ufer nichts als Felder und Wiesen, auf denen spielzeugkleine Charolais-Rinder grasten, während man zur Linken zwischen zwei Felsvorsprüngen die Vézère im Sonnenlicht glitzern sah. Selbst das Wetter, dachte Bruno, spielte beim 90. Geburtstag des distinguierten Sohnes Frankreichs mit.
»Ist das nicht das schönste Panorama, das man sich vorstellen kann?«, schwärmte neben ihm eine alte Dame, genannt die Rote Komtesse, und sah verschmitzt lächelnd aus ihrem Rollstuhl zu Bruno auf. »Besonders mit dem Kirchturm auf dem einen Flussufer und der Schlossruine auf dem anderen. Marco hat das alles hier sehr günstig erstanden. Es war ein Spontankauf, wobei«, fuhr sie mit einem zufriedenen Lächeln fort, »der Umstand, dass mein eigenes Château ganz in der Nähe liegt, durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben mag.«
»Wo hast du ihn eigentlich kennengelernt, grand-mère?«, fragte Marie-Françoise, ihre Urenkelin, die in ihrem farblich auf ihre blauen Augen abgestimmten schlichten Seidenkleid einfach bezaubernd aussah, in fast akzentfreiem, flüssigem Französisch. Seit sie vor kurzem aus ihrem Geburtsland Amerika nach Frankreich gekommen war und besonders seit sie an der Universität in Bordeaux studierte, hatten sich ihre Sprachkenntnisse deutlich verbessert.
»In Moskau. Es war nach Stalins Beisetzung während eines Empfangs im Kreml. Er sah einfach umwerfend aus in seiner Uniform, am Revers den Goldenen Stern am roten Band, das ihn als Helden der Sowjetunion auswies. Jeder kannte ihn, und unser Botschafter war ziemlich echauffiert, weil er neben Marco kaum beachtet wurde. Chruschtschow ging auf Marco zu und nahm ihn in den Arm – es heißt, sie waren sich nach der Schlacht um Stalingrad persönlich begegnet, irgendwo an der Front in der Ukraine.«
Die Komtesse lachte fröhlich, was sie um Jahrzehnte jünger aussehen ließ. »Ich werde die frostigen Blicke der anderen Frauen nie vergessen, als Marco auf mich zukam und mir seinen Arm reichte. Was für ein bemerkenswerter Mann! Ist er ja irgendwie immer noch.«
Bruno folgte ihrem Blick zur Flügeltür, die von der Terrasse ins Schloss führte und wo der alte Herr mit der weißen Löwenmähne und dem markanten Kinn kerzengerade in dunkelblauem Anzug und zum Band der Ehrenlegion passender roter Krawatte die Honneurs machte. Als Bruno und die Rote Komtesse in ihrem Rollstuhl mit Gratulieren an der Reihe gewesen waren, hatten sich Marcos braune Augen, denen nichts entging, neugierig auf Bruno gerichtet, doch kaum hatte die alte Dame ihn als den hiesigen Chef de police vorgestellt, dem sie ihr Leben verdankte, war ein warmes, anerkennendes Lächeln in sein Gesicht getreten.
»Das ist das Magische an dieser Frau«, hatte er mit überraschend jugendlicher Stimme gesagt und sich zu einem Kuss über ihre Hand gebeugt. »Sie wird immer einen Ritter finden, wenn sie Hilfe braucht.«
Colonel Jean-Marc Desaix wurde von seinen Fliegerkameraden und den Frauen, die er geliebt hatte, Marco genannt. Für das übrige Frankreich war er der Patriarch, ein Kriegsheld zweier Länder, Träger des Großkreuzes der Légion d’honneur und als Held der Sowjetunion ausgezeichnet mit dem goldenen Stern am roten Band. Die Ehrenlegion war ihm von seinem Freund Charles de Gaulle verliehen worden, der Stern von Stalin während einer glanzvollen Zeremonie im Kreml.
Wie die meisten französischen Jungen hatte Bruno schon als Kind gewusst, dass das Jagdfliegergeschwader Normandie-Njemen, das während des Zweiten Weltkriegs auf Seiten der Roten Armee der Sowjetunion gegen die Achsenmächte kämpfte, aus französischen Piloten bestand, die in ihren sowjetischen Jak-3-Jagdfliegern mehr feindliche Flugzeuge abgeschossen hatten als jede andere französische Fliegerstaffel. Nach den sowjetischen Luftstreitkräften, die 273 Abschüsse vorzuweisen hatten, war es das erfolgreichste Geschwader überhaupt.
22 feindliche Flugzeuge waren allein von Marco Desaix vom Himmel geholt worden, damals ein blendend aussehender junger Mann, der ständig in sowjetischen Wochenschauen und Zeitungen zu sehen war. Im besetzten Frankreich, das von seinen Husarenstücken in den Rundfunknachrichten der BBC hörte, wurde Marco in einer Zeit zum Helden, als Frankreich diese bitter nötig hatte.
Bruno hatte in den illustrierten Geschichtsbüchern im Waisenhaus die exotischen Namen der Etappen des jungen Fliegers in Syrien und Persien auszusprechen versucht und sich die lange Zugreise von der Wüstenhitze in die russische Kälte vorgestellt. Bis heute wusste er auswendig, dass die französischen Flieger am 5. April 1943 den ersten Treffer gelandet hatten, und zwar auf ein deutsches Jagdflugzeug vom Typ Focke-Wulf. Gegen Ende des Sommers hatten sie siebzig weitere Maschinen abgeschossen und selbst nur noch sieben überlebende Piloten in den eigenen Reihen. Trotzdem hatten sie mehr gewonnen als nur ihre Kurvenkämpfe. Feldmarschall Wilhelm Keitel, der diese Männer als Aufrührer und Verräter an ihrer von Vichy aus regierten Heimat anprangerte, hatte den Befehl erlassen, die gefangengenommenen französischen Piloten standrechtlich zu erschießen und ihre Familien in Frankreich festzunehmen und in Konzentrationslager zu deportieren.
Als Junge hatte Bruno unbedingt Pilot werden wollen, wie sein Held. Doch dann hatte er sich von einem überarbeiteten Lehrer an seiner überfüllten Schule in harschen Worten anhören müssen, seine Noten in Mathematik und Physik seien so schlecht, dass er sich keine Hoffnungen zu machen brauche, von der Armée de l’air aufgenommen zu werden. Als Nächstbestes hatte er sich deshalb noch vor seinem 17. Geburtstag freiwillig zur französischen Armee gemeldet. Was nicht hieß, dass er nicht weiter die Berichte über die abenteuerliche Karriere von Marco Desaix verschlang, der 1945 an der Spitze von 40 Jak-Jägern nach Frankreich zurückgekehrt war, die Stalin den Piloten von Normandie-Njemen mitgegeben hatte, damit sie nach Hause fliegen und sich der wiederauferstandenen Armée de l’air anschließen konnten.
Von höchsten Stellen diskret gedeckt, flog Marco dann 1948 Einsätze für den jungen Staat Israel. Im Cockpit eines Messerschmidt-Jägers, der Israel von der tschechischen Regierung geschenkt worden war, erwies er sich einmal mehr als Ass am Steuerknüppel. Zurück in Frankreich, arbeitete er als Testpilot für Dassault Aviation und durchbrach als erster französischer Pilot die Schallmauer. Er half Dassault, seine Düsenjäger vom Typ Mystère und Mirage zu verkaufen, die zum Kernbestand der israelischen Luftstreitkräfte avancierten, und startete seine nächste Karriere als Geschäftsmann, indem er ins Management bei Dassault und später bei Air France und Airbus aufstieg. In Anerkennung seiner patriotischen Verdienste wurde er schließlich in den Senat gewählt.
Es war ein abenteuerliches Leben, und Bruno war überglücklich gewesen, als er die Einladung zum 90. Geburtstag des Patriarchen erhalten hatte, obwohl er ahnte, dass er nicht um seiner selbst willen, sondern in erster Linie als Begleiter der Roten Komtesse eingeladen worden war, als Mann, dem man einen Rollstuhl und seine gebrechliche Fracht anvertrauen konnte.
2
Unter den Gästen im Garten entdeckte Bruno eine Handvoll Leute, die er kannte. Der Bürgermeister und Dr. Gelletreau aus Saint-Denis plauderten mit Hubert, dem Eigentümer des berühmten Weinkellers der Stadt, und mit Clothilde Daunier, der modebewussten Kuratorin des prähistorischen Museums in Les Eyzies und Wissenschaftlerin von internationalem Ruf. Hinter ihnen stand Brunos Freund Jack Crimson, angeblich ein ehemaliger britischer Meisterspion, der sich in einem Haus außerhalb von Saint-Denis zur Ruhe gesetzt hatte. Er unterhielt sich mit dem französischen Außenminister.
Neben Crimson entdeckte Bruno Pamela, seine Geliebte seit einiger Zeit, obwohl ihn zunehmend der Gedanke beschlich, dass die Affäre wohl nicht mehr lange Bestand haben würde. Zu ihrer großen Freude hatte Crimson sie gebeten, ihn zum Geburtstag des Patriarchen, dem Ereignis der Saison, zu begleiten. Höflichkeitshalber hatte sie Bruno daraufhin gefragt, ob er damit einverstanden sei. Natürlich, hatte er mit einem Anflug von Neid gesagt, der sich aber sofort legte, als er von der Komtesse gebeten wurde, sie und ihre Urenkelin zu begleiten. Als er nun sah, dass auch sie ihren Blick auf ihn richtete, winkte er sie herbei, weil er die Komtesse nicht allein lassen wollte. Doch zu seiner Verwunderung zuckte Pamela nur kühl mit den Achseln und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Crimson.
»Wer ist das?«, wollte die Komtesse wissen.
»Eine Freundin«, antwortete Bruno und wechselte sofort das Thema, indem er sich nach der Familie des Patriarchen erkundigte. Die Komtesse kannte die Verhältnisse offenbar genau. Sein Sohn Victor, ebenfalls ein ehemaliger Pilot, leitete die Geschäfte des im Familienbesitz befindlichen Weinguts. Er und seine Frau Madeleine hatten die alte Dame zur Begrüßung herzlich umarmt. Bruno schätzte Victor um die sechzig, seine lebhafte Frau dagegen sehr viel jünger, Anfang dreißig. Umso überraschter war er, als deren Tochter Chantal auftauchte, die die zwanzig offenbar überschritten hatte und zufällig eine Kommilitonin von Marie-Françoise war. Somit musste ihre Mutter mindestens vierzig sein, in Brunos Alter.
Als Chantal die Komtesse und ihn begrüßte, tauchte plötzlich ihre Mutter neben ihr auf. Sie stellte sich zwischen ihre Tochter und deren Freundin, legte beiden jungen Frauen eine elegante Hand auf die Schulter und sagte nach einem kurzen, kritischen Seitenblick auf Bruno zur Komtesse: »Marie-Françoise ist Ihnen ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie sind bestimmt sehr stolz auf sie.«
»In meinem Alter, liebe Madeleine, ist es ein großes Privileg, das Urenkelkind zu einer schönen jungen Frau heranwachsen zu sehen«, erwiderte die Komtesse. »Von Marco weiß ich, dass er es kaum erwarten kann, dass eines Ihrer Kinder ihn zum Urgroßvater macht.«
»Hör nicht auf sie, chérie«, sagte Madeleine zu ihrer Tochter mit einem Lachen, das wohl weniger unbeschwert klang als beabsichtigt. »Ich hab es durchaus nicht eilig, Großmutter zu werden, weder durch dich noch durch deinen Bruder.« Und dann, nachdem sie Bruno von Kopf bis Fuß gemustert hatte, wieder zur Komtesse: »Das ist also der Polizist, der Sie vor Ihrer schrecklichen Schwester gerettet hat.«
»Mich hat er ebenfalls gerettet, in der Höhle«, ergänzte Marie-Françoise. »Ich werde nie vergessen, wie sich diese Schüsse in der Felskammer angehört haben.«
Bruno erinnerte sich an den entsetzten Blick des Mädchens, an sein blutverschmiertes Gesicht und den von einem Pistolenknauf eingeschlagenen Mund. Davon waren keine Spuren geblieben, und die Zähne sahen so perfekt aus, wie sie nur von extra teurer Dentalkosmetik wiederhergestellt werden konnten.
»Kommen Sie doch bitte einmal zum Lunch aufs Weingut, und erzählen Sie uns, was in der Höhle passiert ist«, sagte Chantal. »Ich habe nie die ganze Geschichte gehört.«
»Gute Idee«, entgegnete Madeleine. »Vielleicht zusammen mit Großvater. Ich weiß, dass auch er gern mehr darüber hören würde. Und Sie müssten auch kommen, Hortense«, sagte sie zur Komtesse. »Sie wissen ja, wie gern Großvater Sie in seiner Nähe hat. Ich rufe Sie demnächst an und schlage einen Termin vor.«
Bruno spürte Madeleines Augen auf sich gerichtet, als ihre Tochter die Komtesse um Erlaubnis bat, Marie-Françoise zu entführen, um ihr die anderen jungen Gäste im Garten vorzustellen. Die beiden gingen, gefolgt von Madeleine. Bruno schaute ihnen nach. Von hinten sahen alle drei verblüffend ähnlich aus, schmal in den Hüften, langbeinig und elegant, anmutig und selbstbewusst in ihren Bewegungen.
Bruno erkundigte sich bei der Komtesse nach den nicht-französischen Familienmitgliedern des Jubilars und bekam zur Antwort: »Es gibt da eine sehr nette Frau, die Sie kennenlernen sollten, Marcos Tochter aus der Ehe mit seiner israelischen Frau. Marco hatte sich gerade von ihr scheiden lassen, als wir uns begegnet sind. Raquelle, die gemeinsame Tochter, lebt nun schon vierzig Jahre hier im Périgord und ist seit eh und je mein Liebling. Sie ist Künstlerin und hat an der Rekonstruktion der Lascaux-Höhle mitgewirkt. Und dann wäre da noch Jewgeni, Marcos Sohn von einer russischen Frau aus der Kriegszeit. Als ich Jewgeni das erste Mal in Moskau sah, war er ein kleiner Junge – und da ist er.«
Ein bulliger Mann mit breiten Schultern, Mitte bis Ende sechzig, war wie aufs Stichwort neben dem Rollstuhl aufgetaucht. Er beugte sich über die Komtesse, gab ihr einen geräuschvollen Kuss auf die Wange und hockte sich dann vor ihr auf die Fersen, um auf Augenhöhe mit ihr sprechen zu können.
»Man hat mir gesagt, du seiest bettlägerig«, sagte er mit starkem Akzent. »Wie schön, dass das offensichtlich nicht stimmt.«
»Auch wenn manches übertrieben dargestellt wird – was mir meine Schwester und ihr betrügerischer Enkel angetan haben, war trotzdem schlimm genug«, entgegnete sie. »Du kannst dich bei diesem Mann hier dafür bedanken, dass die Sache nicht schlimmer ausgegangen ist.« Sie deutete auf Bruno, worauf sich Jewgeni erhob und ihm die Hand schüttelte. »Wie alt warst du noch, als wir uns das erste Mal begegnet sind, sieben oder acht?«, fragte sie.
»Acht. Und so jemanden wie dich hatte ich bis dahin nicht gesehen, in Kleidern von Dior und mit einer langen Zigarettenspitze, wie aus einem Kinofilm«, sagte Jewgeni lächelnd. »Du hast mir französische Schokolade geschenkt. Seitdem liebe ich dich, weißt du das?«
»Nach allem, was man so hört, sagst du das zu vielen Frauen, Jewgeni. Stimmt es, dass du seit neuestem in der Nähe wohnst?«
»Ja, ich habe ein Haus in der Nähe von Siorac, mit einer großen, hellen Scheune, die ich als Atelier nutze. Du musst unbedingt kommen und dir meine neuen Bilder ansehen.« An Bruno gewandt, sagte er: »Ich habe eine Reihe von Porträts der Komtesse gemalt und sie Parischanka genannt, die Frau aus Paris. Die ersten habe ich aus der Erinnerung gemalt, aber als sie dann später wieder nach Moskau kam, hat sie mir Modell gestanden.«
»Das ist lange her«, sagte die Komtesse. Bruno rechnete innerlich nach. Wenn Jewgeni im Todesjahr Stalins acht Jahre alt gewesen war, musste er 1944 oder 1945 geboren worden sein. Die israelische Tochter Raquelle war ein kleines Mädchen gewesen, als ihr Vater, frisch von ihrer Mutter geschieden, 1953 die Komtesse kennengelernt hatte. Jewgenis Halbschwester war somit einige Jahre jünger als er. Das machte mit Victor, der das Weingut bewirtschaftete, drei Kinder von drei verschiedenen Müttern, die alle in der Nähe lebten und jetzt den Geburtstag ihres Vaters feierten.
Es sagte viel über den alten Mann aus, dass er seinen Kindern so nahestand, dass diese ihm auch örtlich nahe sein wollten. Vielleicht lag die eigentliche Attraktion aber auch in dem zu erwartenden Erbe, dachte Bruno und blickte vom Château über den sorgfältig gepflegten Park. Dem Vernehmen nach war der Patriarch ein vermögender Geschäftsmann, durch seine diversen Aufsichtsratsposten reich geworden. Das Weingut der Familie in den Hügeln oberhalb von Lalinde war gut angesehen und produzierte vor allem rote und weiße Bergerac-Weine. Dann gab es noch einen kleineren Weinberg in Monbazillac, der ebenfalls der Familie gehörte. Doch beide Güter waren wohl nicht das, was man als Goldmine bezeichnen konnte. Bruno kannte die alte Volksweisheit, nach der es für jemanden, der mit Wein ein kleines Vermögen machen will, unabdingbar ist, mit einem großen zu beginnen.
Die Gratulanten in der Schlange bekamen Zeit, die Fotos an den Wänden der Eingangshalle zu betrachten, auf denen Marco mit jedem Präsidenten Frankreichs zu sehen war, ebenso mit zwei amerikanischen Präsidenten, außerdem mit Stalin und Chruschtschow, Breschnew, Gorbatschow, Jelzin, Putin und Deng Xiaoping. Auch mit Päpsten, deutschen Kanzlern, britischen Premierministern, etlichen Generälen, Astronauten, Filmstars und Opernsängern war er abgelichtet worden. Der Komtesse dürfte ein Foto geschmeichelt haben, das sie während der Filmfestspiele in Cannes an seiner Seite zeigte, zusammen mit einer blutjungen Brigitte Bardot; doch der Patriarch schien nur Augen für die Komtesse gehabt zu haben.
Plötzlich wurde die kultivierte Atmosphäre durch das Zersplittern von Glas gestört. Irgendwo unterhalb der Terrasse schien es Streit zu geben. Stimmen wurden laut, und in die Gästeschar geriet Bewegung. Ein älterer, offenbar betrunkener, wenn auch tadellos gekleideter stattlicher Mann im Zweireiher und mit dem roten Band der Ehrenlegion im Knopfloch versuchte, Chantal am Arm mit sich zu ziehen, was diese, mit Unterstützung von Marie-Françoise, vehement ablehnte. Der Mann schwankte, seine Augen wirkten glasig, und die dichten grauen Haare, die ihm ständig in die Stirn fielen, wirkten verwildert.
Nun bahnte sich Victor, der jüngste Sohn des Patriarchen, gefolgt von Dr. Gelletreau, einen Weg durch die Menge. Aus einer anderen Richtung eilten Pater Sentout, der Pfarrer von Saint-Denis, und ein hübscher junger Mann herbei, der dem Patriarchen verblüffend ähnlich sah.
Ehe Bruno die Treppe zum Garten erreichen konnte, hatten die vier Helfer Chantal aus dem Griff des Betrunkenen befreit, und ein weiterer Mann, großgewachsen und robust, in Tweedjackett, Stiefeln und Gamaschen, die ihm das Aussehen eines altmodischen Wildhüters verliehen, schlang beide Arme um den Betrunkenen, hob ihn in die Luft und trug ihn um die Terrasse herum auf den mittelalterlichen Turm zu. Die anderen folgten bis auf den hübschen jungen Mann, der bei Chantal zurückblieb. Dankbar sank sie ihm an die Brust, schien aber keinen ernstlichen Schaden davongetragen zu haben.
Die Geräuschkulisse war für einen Moment verstummt, weil alle die Hälse reckten, um zu sehen, was es mit dem Tumult auf sich hatte. Das Streichquartett aber spielte tapfer weiter, und bald setzte sich auch das Geplauder fort, zumal es nichts mehr zu sehen gab.
»Wer waren diese jungen Männer?«, fragte Bruno die Komtesse.
»Den großen kenne ich nicht – scheint einer der Bediensteten zu sein. Der hübsche ist Raoul, Victors Sohn, Marcos Enkel. Er macht sich mit dem Familiengeschäft vertraut, bevor er zum Studium nach Amerika geht. Marco findet, dass er gut zu Marie-Françoise passen würde. Der Meinung bin ich auch, deshalb sorgen wir dafür, dass sich die beiden möglichst oft sehen. An einer Heirat wäre beiden Familien gelegen.«
Bruno wunderte sich. Er hatte gedacht, die Zeit solcher Arrangements wäre längst vorbei. Aber vielleicht währte für die Komtesse und das Château das Althergebrachte fort. Das Geld des Patriarchen und die Besitztümer und Titel der Komtesse würden wohl eine gute Kombination ergeben.
»Haben Sie je an eine Verbindung mit dem Patriarchen gedacht?«, fragte er sie.
Sie blickte amüsiert zu ihm auf. »Es gibt Männer, mit denen man eine Familie gründet, und solche, mit denen man ins Bett geht, ausschließlich zum eigenen Vergnügen. Es wäre wohl wenig sinnvoll, das eine mit dem anderen zu verwechseln.«
»Wer war der Betrunkene, der an Chantal herumgezerrt hat?«
»Gilbert, ein alter Freund der Familie«, antwortete sie. »Einer der jungen Draufgänger, die davon geträumt haben, in Marcos Fußstapfen treten zu können. Dumm für ihn, dass es keinen Krieg mehr gab, der ihm Ruhm und Ehre hätte einbringen können.«
Sie erklärte, dass Gilbert und Victor Freundschaft geschlossen hatten, als sie als Kadetten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Salon-de-Provence stationiert gewesen waren und anschließend bis zu Victors Wechsel zur zivilen Luftfahrt in derselben Staffel als Kampfpiloten gedient hatten. Gilbert war beim Militär geblieben und als Luftwaffen-Attaché an die Französische Botschaft in Moskau gegangen, wo er offenbar für einen kleineren Skandal gesorgt hatte. Genaueres wusste die Komtesse nicht. Immer noch schneidig und charmant, aber als ausgemachter Alkoholiker mit einer Altlast aus Affären, Schulden und gescheiterten Ehen war er im Grunde zu nichts mehr tauglich. Doch der guten alten Zeiten wegen hatte Victor ihn in einem kleinen Haus des Familienbesitzes untergebracht und mit einem nominellen Job ausgestattet: Er sollte die Archive des Patriarchen katalogisieren.
Bruno machte sich auf den Weg, um die Komtesse mit Canapés zu versorgen. Der Rollstuhl hatte eine kleine, ausklappbare Tischplatte, von der sie essen konnte. Als er, zwei gefüllte Champagnergläser und zwei Teller balancierend, zu ihr zurückkehrte, unterhielt sie sich mit einer elegant gekleideten Frau, durch deren weiße Haare sich eine pechschwarze Strähne zog. Die braunen lachenden Augen verrieten die Verwandtschaft mit dem Patriarchen.
»Darf ich vorstellen?«, sagte die Komtesse, »das ist Raquelle, Marcos Tochter, die inzwischen bestens über Sie informiert ist. Ach, geben Sie ihr doch bitte mein Glas Champagner. Ich halte mich lieber an den Weißwein.«
Bruno gab Raquelle die Hand, sagte, wie sehr er ihre Arbeit an der Höhlenkopie von Lascaux bewundere, und fragte, womit sie zurzeit beschäftigt sei.
»Mit Tierdarstellungen für den prähistorischen Park von Le Thot«, antwortete sie in einer tiefen attraktiven Stimmlage. »Nach Vorlage der Plastiken schaffen wir virtuelle Realitäten und Animatronics, bewegte Mammuts und Auerochsen, die am Computer entwickelt werden. Nächste Woche kommen ein paar Familienmitglieder, um bei mir zu Mittag zu essen und sich anzusehen, was bislang entstanden ist. Vielleicht haben Sie Lust mitzukommen.« Sie reichte ihm ihre Visitenkarte, auf der wild aussehende Männer in Fellen ein Wollhaarmammut umzingelten und mit Speeren bedrohten. Auf der Rückseite standen Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Plötzlich schlug jemand einen Löffel gegen ein Glas, zum Zeichen, dass er eine Rede halten wollte. Das Streichquartett verstummte, und der Patriarch trat mit ausgebreiteten Armen an die Terrassenbrüstung und bat um Ruhe.
»Exzellenzen, Generäle, Freunde, ihr wisst, dass ich keine Reden schwinge, schon gar keine längeren«, begann er und legte eine kurze Pause für den Applaus ein. »Ich möchte mich einfach nur dafür bedanken, dass ihr bis in mein geliebtes Périgord gekommen seid, um meinen neunzigsten Geburtstag mit mir zu feiern, und ich hoffe, ihr werdet in zehn Jahren zur Doppelnull wieder hier sein.« Viele lachten, es gab vereinzelte Hurrarufe.
»Wenn die heutige Armée de l’air noch so pünktlich ist wie zu meiner aktiven Zeit, empfehle ich euch jetzt, euch die Ohren zuzuhalten. Ich wünschte nur, ich säße selbst am Knüppel.« Damit wandte er den Blick nach Westen und zeigte auf den Horizont.
Bruno hörte ein fernes Dröhnen, das stetig anschwoll, und sah dann die Sonne auf Tragflächen blitzen. Mit einem schließlich monströsen Geheul, das ihm durch Mark und Bein ging, zogen drei rafales über ihn hinweg, unglaublich tief und rasend schnell. Frankreichs jüngste Kampfjäger, ein jeder über hundert Millionen Euro teuer und in der Spitze zweimal schneller als der Schall, zündeten ihre Nachbrenner und setzten zu fast vertikalem Steigflug an, rote, weiße und blaue Rauchfahnen im Schlepp, Seite an Seite, um schließlich auseinanderzustieben. Irgendwo über Sarlat kamen sie wieder zusammen, machten kehrt und flogen von Osten herbei, und als sie über den Kopf des Patriarchen hinwegbrausten, vollführte jede der drei Maschinen eine Siegesrolle.
»Mon Dieu, das hat mir gefallen«, sagte der Patriarch, als der Düsenlärm verhallt war. »Ich bedanke mich bei meinen Freunden, dem Verteidigungsminister und bei General Dufort für diese prächtige Demonstration und möchte in diesem Zusammenhang auch an meinen alten, hochverehrten Chef Marcel Dassault erinnern, der so viele vorzügliche Flugzeuge für Frankreich entwickelt hat. Schließlich möchte ich auch den französischen Steuerzahlern danken, die dieses wunderschöne Geburtstagsgeschenk finanzieren. Und nun amüsiert euch, genießt den Rest der Party.«
Die Komtesse war müde und ließ sich von Chantal versprechen, Marie-Françoise später nach Hause zurückzubringen. Nachdem sich die alte Dame verabschiedet hatte, rollte Bruno sie in ihrem Stuhl durchs Schloss hinaus zu ihrem Wagen und fuhr sie zu ihrem eigenen Château. Ein bemerkenswerter Tag, sinnierte er. Dem Patriarchen persönlich zu begegnen hatte seine jugendliche Bewunderung nicht im Geringsten geschmälert. Und er war sogar zu einem Lunch auf seinem Weingut eingeladen worden, wo er den großen alten Mann erneut erleben und vielleicht ein paar Geschichten von ihm hören würde. Bruno übergab die Komtesse ihrer Pflegerin und fuhr nach Hause, wo er seinen Hund ausführte, die Hühner fütterte und im Gemüsegarten nach dem Rechten sah. Als er sich Pamela und ihr auffallend kühles Benehmen in Erinnerung rief, ahnte er nichts von dem Drama, das sich in dem Schloss abspielte, das noch vor kurzem vom Donnergetöse der rafales erschüttert worden war.
3
Die Sonne war gerade aufgegangen, und Bruno hatte mit seinem Basset Balzac zu frühstücken begonnen, als Brunos Handy klingelte. Am anderen Ende war ein völlig aufgewühlter Bürgermeister, der vom Schloss des Patriarchen aus anrief. Es habe einen Todesfall gegeben. Bis Bruno, dem es vor Schreck die Sprache verschlug, nach Einzelheiten fragen konnte, hatte der Bürgermeister bereits aufgelegt.
Seltsam, dachte Bruno, als er etwas später in seine Uniform schlüpfte und nach draußen zu seinem Polizeitransporter eilte. Normalerweise wurde er bei überraschenden Todesfällen entweder von der Feuerwehr, einem Arzt oder einem Priester davon in Kenntnis gesetzt. Als Polizist war Bruno Angestellter der Stadt von Saint-Denis und direkt dem Bürgermeister unterstellt. Es war das erste Mal, dass dieser ihn über einen Todesfall informierte, und Bruno fragte sich, was der Bürgermeister zu so früher Stunde am Wohnsitz des Patriarchen zu suchen hatte.
Das Château wirkte vollkommen anders im Morgenlicht, fast düster und ganz ohne jenen Glanz, den ihm die heitere Gesellschaft am Vorabend verliehen hatte. Bruno stellte seinen Transporter ab und ging, als er im Eingangsbereich niemanden antraf, laut rufend um das Gebäude herum zur Terrasse. Fast glaubte er schon, zum Narren gehalten worden zu sein, als endlich der Bürgermeister heraustrat.
»Sie müssen sich nur um ein paar Formalitäten kümmern«, sagte er und führte Bruno ins Haus. »Doktor Gelletreau hat den Totenschein bereits ausgefüllt.«
Der Tote befand sich im Erdgeschoss des mittelalterlichen Turms, in einem großen, halbrunden Raum, in dem Gartenmöbel und Werkzeuge aufbewahrt wurden. Er lag auf einem Liegestuhl, und in der Luft hing der Geruch von Alkohol und Erbrochenem, und obwohl es drinnen so dunkel war, dass man kaum etwas sehen konnte, schien der Raum voller Menschen zu sein. Für Licht sorgten nur der schmale Schlitz eines Fensters und die offene Tür, die zum Hauptgebäude führte. Als sich Brunos Augen an die Düsternis gewöhnt hatten, erkannte er Victor und Madeleine, die Hand in Hand neben dem Liegestuhl standen. Mit der freien Hand bedeckte Victor seine Augen, und seine Schultern bebten. Seine Frau hielt sich ein Taschentuch vor die Nase.
Dr. Gelletreau war gerade dabei, sein Stethoskop in seinen uralten Arztkoffer zu packen. An den feuchten Stellen auf Augen und Stirn des Toten sah Bruno, dass Pater Sentout, der ebenfalls anwesend war, bereits die Letzte Ölung an ihm vollzogen hatte. »Tod durch Unfall«, sagte der Arzt. »Todeszeitpunkt irgendwann in der Nacht. Er war schwer betrunken. Verdachtsmomente liegen keine vor.« Er trat neben Bruno und flüsterte ihm ins Ohr: »Der arme Kerl ist an seinem eigenen Erbrochenen erstickt.«
Bruno wunderte sich über den schnellen Befund. Normalerweise ließ sich Gelletreau dafür immer sehr viel Zeit. »Wer hat ihn gefunden?«
»Ich. In aller Frühe. Ich habe ihm sein Frühstück gebracht und dachte, dass er wieder mal seinen Rausch ausschläft«, antwortete Victor sichtlich verstört. Er ließ die Hand seiner Frau los, trat auf Bruno zu und zeigte auf einen kleinen Beistelltisch, auf dem ein Tablett stand, darauf eine Kaffeekanne, eine Tasse und ein Glas Orangensaft. »Ich habe versucht, ihn wach zu rütteln, doch er war schon ganz steif, so dass mir nichts anderes übrigblieb, als Doktor Gelletreau anzurufen.«
»Die Nacht war nicht allzu kalt, deshalb vermute ich, dass er um Mitternacht gestorben ist, kurz davor oder danach«, sagte der Arzt. »Dafür sprechen die Leichenflecken und die Körpertemperatur. Er ist da, wo er liegt, gestorben und ist nicht bewegt worden.«
Bruno trat an den Liegestuhl und betrachtete die Leiche des Mannes, der Chantal bedrängt hatte und von einigen jungen Männern in die Schranken gewiesen worden war. Jemand hatte ihm Gesicht und Kinn abgewischt, doch auf der Brust und auf dem Liegestuhl waren noch Reste des erbrochenen Mageninhalts zu sehen. Bruno erinnerte sich an den Namen des Toten, Gilbert, und daran, dass er ein Luftwaffenkamerad Victors gewesen war und, als er für schnelle Jets zu alt wurde, als Attaché nach Moskau gegangen war.
»Mein Beileid«, sagte Bruno zu Victor. »Es tut mir leid, aber Sie werden verstehen, dass ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen muss. Ich habe gesehen, dass Ihr Freund gestern Nachmittag weggebracht wurde, kurz bevor die Fliegerparade für Ihren Vater abgehalten wurde. Wohin? In diesen Raum hier?«
»Ja. Er bot sich an, weil er ganz in der Nähe war«, antwortete Victor. »Gilbert war sturzbetrunken, voll wie eine Haubitze. Ich wusste, dass die Fliegerstaffel bald kommen würde, und wollte nicht riskieren, dass er meinem Vater den großen Augenblick verdirbt. Der Patriarch hatte sich seit Wochen darauf gefreut.«
»Mir ist aufgefallen, dass Gilbert von jemandem weggebracht wurde, der kein Gast zu sein schien«, entgegnete Bruno. »Wer war das?«
»Fabrice, unser Wildhüter«, antwortete Madeleine. »Die Weisung kam von mir.«
»Haben Sie anschließend noch einmal nach Gilbert gesehen?«
»Ja. Irgendwann kurz nach sieben, als alle außer den Übernachtungsgästen gegangen waren«, sagte Madeleine. »Er schnarchte und hatte sich zu dem Zeitpunkt offenbar noch nicht übergeben. Das hätte ich gerochen. Eine Flasche war auch nicht da. Die hätte ich mitgenommen. Ich habe ihn mit der Decke da zugedeckt und bin gegangen.«
»Es war das Gleiche so gegen zehn, als ich vor dem Schlafengehen bei ihm reingeschaut habe. Kein Erbrochenes, und er war zugedeckt, als hätte er sich die ganze Zeit nicht gerührt.«
»Es heißt, er war Alkoholiker. Stimmt das?«
»Er hat immer viel getrunken«, antwortete Victor. »Als er aus Moskau zurückkam, war kaum mehr was mit ihm anzufangen. Wir haben ihn mehrmals in ein Sanatorium eingeliefert und darauf gedrängt, dass er sich von den Anonymen Alkoholikern helfen lässt. Leider ist er immer wieder rückfällig geworden und hat erneut zu trinken angefangen. Vor allem Wodka. Er muss wohl in Russland auf den Geschmack gekommen sein.«
»War er öfter so betrunken, dass er sich im Schlaf erbrochen hat?«
»Nicht, dass ich wüsste.« Er richtete den Blick auf die Leiche seines Freundes. Der Kummer ließ sein Gesicht viel älter wirken, so dass er beinahe als Madeleines Vater durchgegangen wäre. »Auch dass ich ihn ins Bett gebracht hätte, kam selten vor.«
»Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass er noch auf den Beinen stand, kurz bevor er weggetragen wurde«, sagte Bruno. »Hat er sich danach sofort schlafen gelegt?«
»Ja, als wir hier angekommen sind, konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten, und als wir ihm die Schuhe ausgezogen, die Krawatte abgenommen und ihn hingelegt hatten, war er schon völlig weggetreten.«
Bruno wandte sich an Dr. Gelletreau. »Gewohnheitstrinker können doch ziemlich viel vertragen. Ist die beschriebene Reaktion nicht untypisch?«
»Vielleicht. Aber wir haben auch noch das gefunden.« Gelletreau zeigte auf einen mit Leder bezogenen Flachmann, etwa doppelt so groß wie Brunos Jagdversion, den der Tote mit einem Arm an die Brust gepresst hielt. Bruno streifte ein Paar Latexhandschuhe über, zog die Flasche vorsichtig hervor und führte sie an seine Nase. Sie war leer und roch nach Alkohol. Die Verschlusskappe fand er unter dem Liegestuhl. Beides steckte er in eine Beweismitteltüte. Unter dem Boden der Flasche entdeckte er eine Gravur. Er hielt sie in den schmalen Lichtstreifen, der durch den Fensterschlitz fiel, und las Made in England, 12 oz. Er kannte das englische Flüssigkeitsmaß von Whiskyflaschen und wusste, dass zwölf Unzen ungefähr einem Drittelliter entsprachen. Anscheinend hatte Gilbert deutlich über seine Verhältnisse getrunken.
»Was hat er denn für gewöhnlich getrunken?«
»Einen russischen Wodka, Stolichnaya Blue«, antwortete Victor. »Er besteht zu fünfzig Prozent aus reinem Alkohol.«
Bruno runzelte die Stirn. Gilbert war schon um fünf Uhr sturzbetrunken gewesen. Mit dem Inhalt der Flasche hätte er, vorausgesetzt, sie war voll, den Pegel gut und gern bis Mitternacht halten können.
»Wissen Sie, ob er ein Testament hinterlassen oder wo er seine persönlichen Dokumente aufbewahrt hat? Die würde ich mir gern einmal ansehen.«
»Ich bezweifle, dass er ein Testament aufgesetzt hat. Es gab ja nichts zu vererben. Gilbert war bankrott. Er wohnte in einem kleinen Haus auf unserem Weingut und besaß nichts als ein klappriges altes Auto. Das bisschen Geld, das ihm blieb, ging fast ausschließlich für Alkohol drauf.« Victor fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Sie hätten ihn vor Jahren sehen sollen. Er war ein guter Mann, ein fantastischer Pilot, mutig wie ein Löwe.«
»Ans Steuer hat er sich schon seit Jahren nicht mehr gesetzt«, ergänzte Madeleine. »Das hätten wir auch nicht zugelassen. Er fuhr Fahrrad, und wenn er nach Bergerac musste, haben wir ihn mitgenommen.«
»Wenn für mich hier nichts mehr zu tun ist, würde ich jetzt gern in die Klinik fahren«, sagte Dr. Gelletreau und reichte Bruno den Totenschein, in den er »natürliche Todesursache, Alkoholabusus« eingetragen hatte.
»Haben Sie den Bürgermeister informiert? Warum nicht wie sonst zuerst mich?«, fragte Bruno, mehr als erstaunt – er war brüskiert. Vermögende und gut vernetzte Leute in ihren großen Häusern schienen allzu häufig zu glauben, über dem Gesetz zu stehen und rechtliche Probleme dadurch umgehen zu können, dass sie einen befreundeten Politiker einschalteten.
»Ich habe den Bürgermeister angerufen und Victor den Doktor«, erklärte Madeleine. »Tut mir leid, wir hätten wohl zuerst die Gendarmerie verständigen sollen, aber der Schock … Wir waren so durcheinander.«
»Ist Gilberts Familie im Bild?«, fragte Bruno Victor, nachdem Gelletreau gegangen war.
»Er hat keine, nur eine geschiedene Frau und einige verflossene Geliebte«, antwortete Madeleine etwas säuerlich. »Und die meisten von ihnen werden die Nachricht wahrscheinlich feiern.«
»Wissen Sie von irgendwelchen Angehörigen?«, fragte Bruno nach. »Brüdern, Schwestern, Cousins? Er muss doch Verwandtschaft gehabt haben.«
»Formell hat er immer mich als seinen nächsten Angehörigen angegeben«, erwiderte Victor. »Wir waren jahrelang in derselben Staffel und standen uns sehr nah. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Schwester, die ist aber schon lange tot.«
»Ich werde den Bestatter anrufen und dafür sorgen, dass der Leichnam abgeholt wird«, erklärte Bruno und dachte, wie traurig doch das Leben dieses Mannes zu Ende gegangen war, der sich früher einmal als Herr der Lüfte hatte bezeichnen dürfen. Er erinnerte sich, wie sehr er sich in jungen Jahren selbst gewünscht hatte, Pilot zu werden. »Sie werden wohl selbst entscheiden müssen, ob er begraben oder eingeäschert werden soll.«
»In der Hinsicht kann ich helfen«, schaltete sich Pater Sentout ein. »Ich schlage vor, ich rufe Sie später am Tag noch einmal an, und wir reden miteinander, wenn Sie sich alle vom ersten Schreck erholt haben.«
»Nun, dann wäre wohl alles geregelt«, sagte der Bürgermeister auf seine forsche Art, die er immer in Ratsversammlungen hervorkehrte, wenn die wichtigsten Entscheidungen getroffen waren. »Mein aufrichtiges Beileid, Victor, es muss sehr schmerzlich für Sie sein, einen alten Freund und Kameraden verloren zu haben. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass unser Chef de police alles, was noch zu erledigen ist, gewohnt diskret und effektiv abwickeln wird.« Er warf Bruno einen scharfen Blick zu. »Wir wollen schließlich nicht, dass ein Schatten auf das Jubiläum des Patriarchen fällt.«
Bruno nickte freundlich. Er langte mit der Hand hinter den Rücken des Toten und zog eine abgegriffene Brieftasche aus der Gesäßtasche hervor. Darin steckten ein Personalausweis, ein alter Führerschein, der noch aus pinkfarbenem Textilkarton bestand, eine Kreditkarte, eine Krankenversicherungskarte und vier Zwanzigeuroscheine. In einer anderen Tasche fand er einen abgelaufenen Ausweis des Außenministeriums und einen Mitgliedsausweis der Kampffliegervereinigung. Aus einem Etui am Gürtel zog er ein billiges Handy, öffnete die Anrufliste und stellte überrascht fest, dass nur wenige Eingänge verzeichnet waren und Gilbert am Vortag nur eine Nummer gewählt hatte, die Bruno als Victors identifizierte.
»Er hat Sie gestern Morgen angerufen?«
»Ich habe den Anruf entgegengenommen«, sagte Madeleine. »Er wollte wissen, wann wir ihn abholen.«
»Sind Sie nach der Party nach Hause zurückgefahren?«
»Nein, wir haben hier übernachtet«, antwortete Victor ruhig. Seine Frau ergänzte: »Wir leben zwar auf dem Weingut, haben aber hier immer noch eine Wohnung.«
»Hatte Gilbert auch bleiben wollen?«
Victor zuckte mit den Achseln und schaute seine Frau an. Es schien, dass er ihr oft die Führung überließ.
»Nein, die Zimmer im Château waren samt und sonders mit Auswärtigen belegt. Ich schätze, Raoul oder jemand anders hätte ihn zurückgefahren«, sagte sie. »Übrigens, vermutlich werden die ersten Gäste inzwischen aufgewacht sein. Ich müsste mich jetzt um das Frühstück kümmern.«
»Mein Chef de police wird Ihre Gäste nicht stören«, sagte der Bürgermeister mit Nachdruck und schaute demonstrativ auf seine Uhr.
»Eins noch«, sagte Bruno. »Ich möchte mir ein Bild von Gilberts Unterkunft auf Ihrem Weingut machen. Wo genau finde ich sie?«
Madeleine erklärte ihm noch, wie er fahren musste, dann verabschiedete sie sich und ging, gefolgt von Pater Sentout, der vor sich hin murmelte, dass die Messe gleich beginnen werde. Der Bürgermeister trat einen Schritt vor, ergriff Victors Hand und schüttelte sie feierlich. Dann legte er die Hand auf Brunos Schulter und lenkte ihn mit leichtem Nachdruck zur Tür.
»Sie haben doch wohl keinen Grund zur Annahme, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, oder?«, fragte der Bürgermeister, als sie draußen waren.
Bruno legte sich gerade eine ausweichende Antwort zurecht, indem er feststellte, dass er ungern unter Zeitdruck entschied, als sein Handy am Gürtel zu vibrieren begann. Auf dem Display erkannte er die Nummer Alberts, des Hauptmanns der Pompiers.
»Auf der Straße nach Rouffignac, gleich hinter dem Abzweig zum Campingplatz, hat’s einen Unfall gegeben«, sagte Albert. »Wieder mal mit Wildschaden. Bring dein Gewehr mit, für den Fall, dass das arme Tier noch lebt.«
4
Es war kein schwerer Unfall, jedenfalls nicht für die beteiligten Personen. Ein kleiner Citroën Berlingo hatte ein Reh angefahren. Die Motorhaube war eingedrückt und ein Scheinwerferglas zersplittert. Bruno kannte die Fahrerin: Adèle, eine Frau Mitte vierzig, deren Mann für die Milchkooperative arbeitete. Sie war mit ihrer verwitweten Mutter auf dem Weg zur Kirche gewesen. Adèle stand unter Schock und weinte. Ihre Mutter hingegen schien aus härterem Holz geschnitzt. Sie lehnte an dem Lieferwagen, rauchte eine filterlose Zigarette und betrachtete das Reh mit kritischem Blick. Es hatte beide Vorderläufe gebrochen, wimmerte kläglich und versuchte verzweifelt, sich auf die Hinterläufe zu erheben. Es war so erbärmlich dünn, dass sich durch das hellbraune Fell die Rippen abzeichneten, die beim Keuchen auf und ab gingen.
»Zu wenig Fleisch dran, als dass es sich lohnen würde, das Ding nach Hause zu schaffen«, bemerkte die Alte. »Ist bestimmt wieder eins von der Verrückten am Hügel da hinten.«
Bruno bat sie, ihre Tochter im Wagen Platz nehmen zu lassen, während er sich um das Reh kümmern wollte. Aus dem Heck des Polizeitransporters holte er eine Plane hervor und bat Albert, das leidende Tier vor Adèles Blick abzuschirmen, dann erlöste er es mit einem Schuss hinter die Ohren. Nachdem ihm Albert geholfen hatte, das Reh in die Wachsleinwand einzuwickeln und in Brunos Transporter zu hieven, fuhren die beiden Männer die Frauen in deren Berlingo zur Kirche; Adèle, so vermutete er, würde sich nach dem Gottesdienst wieder so weit erholt haben, dass sie sich wieder selbst ans Steuer setzen konnte. Das Tier zum Schlachter fuhr Bruno dann alleine.
»Das lohnt nicht«, sagte auch Valentin, als Bruno das tote Reh auf das Hackbrett im Hinterraum seines Ladenlokals legte. Rot- und Rehwild, so hatte man es in Saint-Denis geregelt, wurde zum Schlachter gebracht, und das Fleisch kam den Bewohnern des Seniorenheims zugute. »Nur Haut und Knochen. Muss wohl eins von Imogène sein. Ich wiederhole mich, Bruno, Sie sollten etwas gegen diese verfluchte Frau unternehmen.«
»Wir tun unser Bestes, haben aber keine gesetzliche Handhabe, um härter durchzugreifen«, entgegnete Bruno. »Für den Zaun hat ihr das Gericht eine Frist gesetzt, und die läuft erst in ein paar Wochen ab. Vielleicht wird sie vorher Einspruch einlegen.«
»Eines Tages«, warnte der Metzger, »wird noch jemand wegen dieser Tiere ums Leben kommen, das sage ich Ihnen.« Valentin griff nach seinem Fleischerbeil.
Bruno hielt seine Sorge für begründet und fuhr auf direktem Weg zum Haus von Imogène Ducaillou, einer ziemlich exzentrischen Witwe, die als Kassiererin und Verwalterin einer der kleinen prähistorischen Höhlen arbeitete, von denen es in der Region etliche gab. Mit ihrem unersättlichen Appetit auf Liebesromane und Tierbücher war sie außerdem eine der fleißigsten Besucherinnen der Stadtbücherei. Sie lebte auf einem großen, mehrheitlich bewaldeten Stück Land, das ihr gehörte und an eine der Hauptzufahrtsstraßen nach Saint-Denis grenzte. Als engagiertes Mitglied der Grünen Partei und strikte Vegetarierin liebte sie alle Tiere, hasste die Jagd und hatte auf ihrem Grund und Boden überall Schilder mit der Aufschrift Chasse interdite aufgestellt, während die städtischen Jagdvereine die Wälder ringsum als Jagdreviere nutzten. Das Rehwild war nicht dumm. Es wusste zwischen bejagtem oder geschütztem Terrain zu unterscheiden und suchte, kaum dass die Jagdsaison begonnen hatte, Zuflucht in Imogènes Wäldern.
Das war anfangs nicht weiter schlimm gewesen, wenngleich sich die Jäger über den geringen Bestand in ihren traditionellen Jagdgründen ärgerten. Bald aber gab es Probleme ganz anderer Art: Die Population auf Imogènes Boden explodierte, worunter vor allem die Vegetation litt, wodurch wiederum die Rehe abmagerten und auf der verzweifelten Suche nach Nahrung den Jägern manchmal direkt vor die Büchsen liefen. Es war nun schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass ein Reh von Imogènes Land gewechselt war und – allen Warnhinweisen und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Strecke zum Trotz – einen Unfall verursacht hatte. Dennoch weigerte sich Imogène weiterhin störrisch, den Bestand auf ihrem Grund und Boden kontrollieren zu lassen. Allerdings hatte der Präfekt nun als letztes Mittel einen Gerichtsbeschluss erwirkt, der sie dazu verdonnerte, innerhalb der nächsten sechs Monate einen Schutzzaun zwischen Straße und Wald zu errichten. Fünf Monate waren bereits vergangen, doch sie hatte, vermutlich auch aus Kostengründen, mit den Arbeiten noch nicht einmal angefangen.
Überall sah Bruno Rotwild, als er die gewundene Schotterpiste zu Imogènes Haus hinauffuhr. Es schälte die Rinde von den Bäumen und wühlte den Waldboden auf, der völlig kahlgefressen war. Am Rand des Grundstücks erhoben sich dunkel und drohend die Hochsitze, die Bruno immer an Bilder von Konzentrationslagern erinnerten, die von ähnlichen, mit Scharfschützen besetzten Türmen überragt wurden.
Bruno hielt an und stieg aus seinem Transporter, um sich das Phänomen aus der Nähe anzusehen: auf der linken Seite völlig abgefressener Waldboden, auf der rechten gesunder Niedrigbewuchs. Plötzlich bemerkte er am Rand seines Blickfelds eine Bewegung und sah, dass einer der fernen Hochsitze bemannt war. Da griff er durch das offene Seitenfenster seines Transporters, drückte auf die Hupe, winkte, und auf ein entsprechendes Signal hin stapfte er durch dichter werdendes Gestrüpp auf die Warte zu. Zwei Männer in Tarnjacken, der eine groß und kräftig, der andere klein und schlank, blickten neugierig auf ihn herab.
»Sind Sie gekommen, um unsere Jagdscheine zu kontrollieren?«, fragte der Größere. An der flachen Tweedmütze erkannte Bruno den Wildhüter des Patriarchen wieder, der am Vorabend Gilbert fortgebracht hatte. Der kleinere Mann hielt sich im Hintergrund, fast als wollte er unerkannt bleiben.
»Könnte ich bei der Gelegenheit gleich auch«, erwiderte Bruno freundlich. »Aber eigentlich wollte ich nur fragen, ob Imogène zu Hause ist.«
»Dieses Miststück!«, antwortete der große Mann. »Hat sich heute noch nicht blicken lassen. Und wir haben auch noch kein Reh vor die Büchse gekriegt, nicht einmal eins ihrer ausgemergelten.«
»Wahrscheinlich wissen die, dass Sie auf der Lauer liegen«, sagte Bruno. Als der kleinere Mann eine Hand hob, um den Schirm seiner Baseballkappe tiefer ins Gesicht zu ziehen, erkannte Bruno Guillaume, der im Sommer auf einem der großen Campingplätze an der Bar bediente und sich für den Rest des Jahres arbeitslos meldete. Die Gendarmerie hatte ihn im Auge, weil er im Verdacht stand, mit Drogen zu dealen, hatte aber bisher nichts Konkretes gegen ihn in der Hand. Guillaume war ein bekannt schlechter Schütze, hatte aber trotzdem seine Abschüsse frei, und andere Jäger, die mit ihrer Quote nicht genug hatten, nahmen Guillaume einfach mit auf die Jagd, schossen an seiner Stelle und teilten das Fleisch mit ihm.
»Bonjour, Guillaume«, grüßte Bruno. »Stellen Sie mir Ihren Freund vor?«
»Ich heiße Fabrice und komme aus Bergerac«, antwortete der Wildhüter. »Hat sich zufällig so ergeben, dass wir hier ansitzen.«
»Arbeiten Sie nicht für den Patriarchen? Ich war auch auf der Party und habe gesehen, wie Sie den Betrunkenen weggebracht haben.«
»Stimmt. Er war ziemlich voll, hat aber keine Scherereien gemacht. Ich habe ihn schlafen gelegt.«
»Haben Sie gehört, dass er tot ist? Einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ich komme gerade vom Schloss.«
Sichtlich überrascht schüttelte Fabrice den Kopf. »Armes Schwein«, sagte er achselzuckend. »Aber es gibt wohl schlimmere Arten abzutreten.«
Bruno überlegte, ob er sich die Jagdscheine ansehen sollte, doch die Zeit drängte, und so wünschte er den beiden Weidmannsheil, sagte, dass er gleich wiederkommen werde, und fuhr dann im Schritttempo weiter, weil er immer wieder vor Rehen anhalten musste, die ihn neugierig beäugten und anscheinend ahnten, dass sie nichts zu befürchten hatten. Ihre Zutraulichkeit gefiel ihm. Ein sicheres Asyl wäre doch ideal, dachte er, wenn es nur ausreichend zu fressen gäbe und Überpopulationen durch geeignete Maßnahmen vermieden würden. Vielleicht könnte man ja mit Spenden Imogène helfen, den Zaun zu errichten und Futter zu kaufen. Aber mit einer Auslese und kontrollierten Dezimierung des Bestandes würde sie wahrscheinlich nicht einverstanden sein. Trotzdem wollte er versuchen, sie zu überreden und darauf hinzuweisen, wie erbärmlich ausgemergelt die erwachsenen Tiere und wie schwach die Kitze waren.
Als er vor ihrem baufälligen Haus aus seinem Transporter stieg und den Blick über das löchrige Dach und einige aus den Angeln gerutschte Fensterverschläge gleiten ließ, näherten sich Rehe mit weit nach vorn gereckten Hälsen. Wahrscheinlich, dachte er, hatte Imogène sie daran gewöhnt, ihr aus der Hand zu fressen. Ihr alter Renault parkte neben dem Haus, ihr Fahrrad lehnte an der Stütze des Vordachs, doch sie selbst ließ sich nicht blicken. Er klopfte und rief ihren Namen, doch erst als er ein lautes »Ich bin’s, Bruno« nachschickte, hörte er hinter der Tür eine misstrauische Stimme fragen:
»Was wollen Sie?«
»Es gab wieder einen Unfall auf der Straße. Eins Ihrer Rehe wurde angefahren.«
»Und Sie haben es wahrscheinlich erschossen, stimmt’s? Was Besseres fällt euch ja nicht ein! Töten, jagen, töten. Warum können Sie die Tiere nicht in Frieden lassen?«
»Weil sie sonst verhungern, Imogène. Die Jungtiere sterben, und die erwachsenen sind so verzweifelt, dass sie ihre Scheu verlieren. Das kann so nicht weitergehen. Machen Sie auf, lassen Sie uns darüber reden. Ich habe da eine Idee.«
Die Tür ging auf. Imogène musterte ihn mit argwöhnischem Blick. »Was denn für eine Idee?« Anders als Bruno erwartet hatte, wirkte sie nicht ungepflegt. Die kurzen grauen Haare waren gekämmt, die braune Kordhose und der weite Sweater, die sie trug, machten einen ordentlichen Eindruck. Im Hintergrund spielte ein Klavierkonzert.
»Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, den Zaun zu ziehen, wie es der Richter von Ihnen verlangt, und wahrscheinlich fehlt Ihnen auch das Geld dafür. Wenn er aber nicht fristgerecht installiert wird, droht Ihnen eine saftige Buße; womöglich müssen Sie sogar Ihren Besitz verkaufen, es sei denn, Sie lassen zu, dass der Wildbestand auf ein natürliches Maß reduziert wird. Sie sind für die armen hungernden Rehe inzwischen eine größere Gefahr als die Jäger.«
»Sie wiederholen sich. Ich versuche, bei Tierfreunden Geld lockerzumachen. Es findet sich bestimmt eine Lösung für das Problem. Aber was ist das für eine Idee, über die Sie mit mir reden wollten?«
»Auf dem Weg hierher ist mir durch den Kopf gegangen, dass es doch wunderschön wäre, wenn es eine echte Schonung für die Rehe mit einem ausreichenden Angebot an Nahrung gäbe, ein umzäuntes Revier, für Autos gesperrt, aber offen für Schulkinder, die zwischen frei laufendem Wild herumtollen könnten. Die Touristen wären vielleicht sogar bereit, Eintritt zu bezahlen. Und mit dem Geld könnte dann Futter zugekauft werden. Voraussetzung wäre natürlich dieser Zaun, doch der ließe sich womöglich über Spenden finanzieren.«
»Da ist doch bestimmt ein Haken dran«, sagte Imogène. »Zugegeben, was Sie sich da vorstellen, wäre ideal für Kinder. Aber … Na gut, kommen Sie rein! Ich mache uns Tee, und dann reden wir miteinander.«
Er betrat ein großes Wohnzimmer, das die Hälfte des Grundrisses einnahm und ganz hinten in eine Küche überging, in der Imogène einen Wasserkessel auf einen altmodischen Holzofen stellte. Das Klavierkonzert war zu Ende, und die Stimme des Ansagers des Senders France Musique kündigte das nächste Stück an. Auf einem alten Sofa hatten es sich drei Katzen bequem gemacht. Davor stand ein großer runder Tisch, übersät mit Skizzenblöcken, Illustrierten und Fotos von Rehen. Ähnliche Fotos mit noch mehr ausgemergelten Rehen bedeckten auch jedes Stück Wand, wo keine Bücherregale standen. Auf einem entdeckte Bruno zu seiner Überraschung Raquelle, die Tochter des Patriarchen, wie sie ein Kitz fütterte.
»Eine Freundin aus der Partei«, erklärte Imogène. »Wir haben zusammen eine Aktion vorbereitet.« Sie reichte Bruno einen angeschlagenen Becher mit einer heißen Flüssigkeit, die nach Pfefferminztee roch. »Mir ist klar, dass mich die meisten Leute aus der Stadt für verrückt halten. Aber glauben Sie mir, ich bin völlig klar im Kopf. Ich weiß, dass die Rehe hungrig sind und mein Land sie nicht ernähren kann.«
Imogène berichtete, dass ihr von mehreren Tierschutzgruppen Unterstützung versprochen worden sei, doch die reiche nicht aus. Allein vierzehntausend Euro würden sie die zweihundert Meter Zaun entlang der Straße kosten.
»Mein Besitz ist beliehen, und was ich an Zinsen zu zahlen habe, übersteigt schon jetzt meine Möglichkeiten«, fuhr sie fort. »Noch mehr Futter für meine Tiere kann ich mir nicht leisten, geschweige denn diesen Zaun. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Mittlerweile wäre ich zu allem bereit, Hauptsache, die Tiere werden nicht gejagt oder getötet.«
Bruno hoffte auf einen Kompromiss. Von ihren Tieren sprach Imogène mit fast religiösem Eifer. Dagegen war wahrscheinlich nicht anzukommen. Dennoch wollte er es versuchen. »Wir müssen ausrechnen, wie viele Rehe auf Ihrem Land maximal leben können. Der jetzige Bestand ist jedenfalls deutlich zu groß. Ihre Bäume sterben an Wildverbiss.«
»Aber was soll aus den überzähligen Tieren denn werden?«, fragte sie.
»Wir könnten versuchen, sie in Zoos oder Tierheimen unterzubringen, oder in Naturschutzparks …«, schlug er vor, selbst auch nicht überzeugt.
»Als hätte ich das nicht alles schon versucht!«, entgegnete sie. »Sämtliche Tierasyle in Frankreich stehen vor den gleichen Problemen. Mancherorts werden sogar Verhütungsmittel eingesetzt, um die Nachkommenschaft zu begrenzen. Und schändlicherweise darf heutzutage in den meisten Naturparks gejagt werden. Nein, Bruno, danke für den Versuch. Dass Sie helfen wollen, weiß ich zu schätzen, aber wir wissen doch beide, dass Ihre Lösung nicht ohne eine jährliche Abschussrate auskommt. Und damit werde ich mich nie und nimmer einverstanden erklären.«
»Imogène! Sie haben nur noch die Wahl, hier entweder eine Art Tierasyl einzurichten und möglichst vielen Rehen zu einem guten Leben zu verhelfen oder Ihren Besitz definitiv zu verlieren, entweder an den Staat oder an den Hunger. Wenn eins Ihrer Rehe einen Unfall verursacht, bei dem Menschen zu Schaden kommen, werden Sie Klagen am Hals haben, die Sie nie mehr auf die Beine kommen lassen.«
»Schon klar. Für mich heißt die Alternative jedoch ganz simpel: Entweder die Tiere überleben, oder sie werden geschlachtet«, sagte sie mit fester Stimme und setzte abrupt ihren Teebecher ab. Plötzlich warf sie sich in die Brust und deklamierte, als stünde sie auf der Bühne: »Und sie werden überleben, koste es mich, was es wolle.«