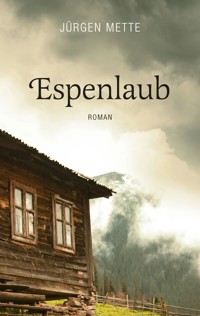
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bergbauer Toni Hinteregger wächst als Waisenkind in den Südtiroler Bergen auf. Mit 18 Jahren lernt er Evi Stockner kennen, die Liebe seines Lebens. Als diese von ihren Eltern zum Medizinstudium nach England geschickt wird, bricht Tonis Welt zusammen. Zudem muss er mit einer schockierenden Diagnose fertigwerden: Parkinson. Für beide beginnt ein dramatischer Kampf zwischen Hoffnung und Resignation, um Liebe und Treue, um Berufung und Erfüllung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jürgen Mette ist Theologe und war bis 2013 geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien. Er stand 22 Jahre dem Stiftungsrat der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor vor. Viele Jahre hatte er einen Lehrauftrag an der Evangelischen Hochschule Tabor inne. Er engagiert sich in diversen christlichen Führungsgremien wie zum Beispiel im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Auch als Buchautor hat er sich einen Namen gemacht. Seine Autobiografie „Alles außer Mikado – Leben trotz Parkinson“ avancierte zum SPIEGEL-Bestseller. Jürgen Mette ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Söhnen.
Inhalt
Abgrund
London
Frühes Leid
Auf dem Raffalthof
Evi
Liebe
Krise
Besuch in Bruneck
Trennung
Warten
Zweifel
Ein Lebenszeichen
Diagnose
Abkehr
Hoffnung
Proband
Oxford
Wende
Gnade
Schreiben
Befreiung
München
Anstoß
Das Wiedersehen
Rückschau und Blick nach vorne
Mut
Finale
Exkurs zum Titel: Populus tremola
Dank
Literaturhinweis
Prolog
Ausgerechnet auf dem Lokus war es passiert, dem anrüchigen Ab-Ort ganz menschlicher Bedürfnisse. Die Krise seines Lebens begann tatsächlich auf der Toilette, besser gesagt in einem kleinen Herzhäuschen aus rohen Brettern – in der Evolution der Aborte ein Verbindungsstück zwischen Donnerbalken über offener Grube und einer Porzellanschüssel mit Brille und Deckel, wie sie in den Fünfzigerjahren im Dorf Einzug gehalten hatte.
Dieser stille Ort war schlicht möbliert: eine Holzkiste mit oval ausgeschnittener Öffnung und einem grob gezimmerten Deckel darauf, ein Nagel in der Wand, der für das Toilettenpapier in Form von sauber zugeschnittenen Zeitungsseiten vorgesehen war. Und das alles in der freien Natur. Auf 1732 Metern Höhe.
Eigentlich ein Ort der körperlichen Entlastung, jetzt aber ein Ort schwerer Belastung. Ein bedrückendes Signal, das sich unerbittlich in sein Bewusstsein fraß.
Es war ihm schon die letzten Monate aufgefallen, dass er sich nicht mehr selbst aufrichten konnte, wenn er auf dem Boden kauerte. Und nun war es so weit: Er schaffte es auch nicht mehr, von dieser Holzkiste auf die Beine zu kommen. So saß er eine Weile in sich versunken, schlagartig von einer düsteren Zukunftsahnung befallen.
Nach einigen mühsamen Verrenkungen und dem Versuch, sich an den Kanten der Bretterverschalung festzukrallen, gelang es ihm schließlich doch, in die Senkrechte zu kommen. Er zog mit zitternden Händen seine Hose hoch und knüpfte sie an die breiten Hosenträger.
Auch dieser alltägliche Handgriff war inzwischen eine große Herausforderung geworden. Entweder waren die Knöpfe zu groß oder die Knopflöcher zu klein. Weil sich aber beides nicht geändert hatte, konnte nur etwas mit seinen Fingern nicht stimmen: Sie brachten solch eine Kleinarbeit einfach nicht mehr zustande.
Vornübergebeugt, die Nasenspitze eineinhalb Meter von der Grasnarbe des Steilhangs entfernt, stieg er die zwanzig Meter zur Almhütte hinauf. Alle paar Schritte blieb er stehen, weil er nach Luft ringen musste, gefährlich wankend ums Gleichgewicht bemüht. Er musste jetzt Vorsorge treffen, da gab es nichts mehr aufzuschieben.
Keuchend betrat er den ebenerdigen Keller der Almhütte, die wie angeklebt am Steilhang hing, suchte in der kleinen Werkstatt ein Stück Strick, ein paar Abschnitte von einem alten Ledertreibriemen, Hammer und Nägel und kehrte zurück zum Abort über dem Abgrund.
Oberhalb der Tür war ein starkes Stück Holz, ein sogenannter Riegel, mit den senkrechten Pfosten verzapft. Dort fixierte er den Strick mit dem alten Lederriemen und nagelte beide Teile fest. Am unteren Ende hatte er einen kräftigen Knoten geknüpft. Wann immer er nun sein unvermeidbares Geschäft verrichtet hatte, griff er nach diesem Strick und zog sich daran hoch.
Aber was sollte bloß werden, wenn irgendwann die Kraft in den Armen nachließe? Er hatte keine Ruhe, bis er ein paar Rundholzpfähle in den nassen Boden geklopft und darauf dünne Rundhölzer genagelt hatte. Eine Art Handlauf zur Sicherung am Abgrund.
Eines Nachts träumte er, man habe ihn auf eine Karre geladen und durch den stockfinsteren Wald nach unten ins Dorf gefahren. Schweißgebadet stand er danach auf, um sich mit ein paar wackeligen Kniebeugen selbst zu beweisen, dass er nicht schon gelähmt war. Manchmal lag er nämlich wie eine Steinplatte im Bett, ohne sich nach rechts oder nach links drehen zu können.
Das bedrückende Erlebnis im Herzhäuschen war wie ein weiterer Meilenstein auf seinem mühsamen Weg in die körperliche Hinfälligkeit.
Schon seit einigen Jahren wurde er von einem ständigen Zittern geplagt, von Gleichgewichtsstörungen und abnehmender Muskelkraft. Und das im besten Mannesalter. Die Leute sagten, er zittere wie Espenlaub. Er kannte weder das Laub noch die Espe.
Aber er wusste, dass sein Lebensweg steiler werden würde. Er war ja mit dem Steilen vertraut, was war in seinem Leben schon flach? Doch von nun an musste er sich in jeder Hinsicht gegen den Absturz stemmen.
In letzter Zeit war er immer öfter vom Melkschemel gefallen. Die Kuh musste sich nur ein wenig in seine Richtung bewegen, dann verlor er das Gleichgewicht und landete halb unter dem Tier. Er konnte sich inzwischen kaum noch von dem niedrigen Arbeitsgestühl mit den drei Beinen erheben. Seine Beine knickten ihm so zitternd weg, dass er in seiner Hilflosigkeit nun auch zwischen den Kühen kurze Stricke befestigte, an denen er sich festhalten konnte.
Irgendwann fiel ihm auf, dass er sich vor dem Schlafengehen nicht mehr auszog: Er hatte solche Mühe, die Hose hochzuziehen, dass er sie lieber gleich anbehielt. Er konnte nicht mehr auf einem Bein stehen und mit dem anderen ins Hosenbein schlüpfen. Oft genug war er bei dieser alltäglichen Prozedur der Länge nach zwischen Stuhl und Tisch geknallt. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert war.
Und wenn er sich zur Körperpflege die Zinkwanne in der Almhütte aufgestellt hatte, um ein Bad zu nehmen, dann konnte er das kaum genießen, weil er ständig daran denken musste, wie er wieder ins Trockene kommen sollte. Einmal wäre er fast mitsamt der gefüllten Wanne umgekippt.
So befestigte er schließlich noch einen Strick an der Decke, der genau über der Wanne pendelte. Und einen Strick über dem Bett. Und einen Strick über seinem Essplatz am Tisch. Irgendwann hatte er einen Strick zu einer Schlinge gebunden und unter seinem Bett versteckt. Für alle Fälle.
Abgrund
Wieder einmal war es Herbst geworden, hoch droben auf der Alm, oberhalb des Pustertaler Bergdörfchens Terenten. Es roch modrig und erdig, als Vorspiel zum nahenden Sterben der Vegetation. Alles musste bald in den frostigen Tod des Winters sinken, um später wieder zum Leben zu erwachen. Doch zunächst zeigten die Bäume unterhalb der Almhütte noch ihr buntes Blätterkleid in leuchtenden Herbsttönen. In der Frühe des Tages glitzerten die Tautropfen, verwoben von Milliarden feinster Spinnfäden, die in den Strahlen der Morgensonne funkelten.
Viele Jahre verbrachte er nun schon den Sommer hier oben. Jahr für Jahr hinauf und wieder hinunter. Leben im Winterquartier, Leben im Sommerquartier. Und immer ein Leben für die Kühe. Auf 1732 Metern Höhe. Fern von Menschen, Geschäften und Fabriken. Das moderne Leben spielte im Tal.
Hier oben diktierte der Rhythmus der Kühe den Alltag des Menschen. Denn der Kuhhirt überwacht und begleitet das Leben einer Kuhherde. Einer der ältesten Berufe überhaupt macht aus einst wilden Tieren zahme Haustiere, die ihrem Besitzer Milch, Leder und Fleisch liefern. An diesem Lieferanten hing die Versorgung der Großfamilie und der wirtschaftliche Ertrag des Hofes. Darum war ihm die Betreuung der Herde zu einer Berufung geworden.
Zum Dank dafür streckten ihm die gutmütigen Vierbeiner das meistens verkleckerte und verkrustete Hinterteil hin. Die Kuh frisst immer, verdaut ausgiebig rauf und runter und übersät alles mit ihren spinatartigen Hinterlassenschaften. „Eine vegetarisch angetriebene Milch- und Fleischproduktion auf vier Beinen, mit zwei Haltegriffen vorne am Kopf!“, so hat es einmal ein Lehrer der Fachschule für Almwirtschaft formuliert. Im Flachland kann man sie fast sich selbst überlassen, die Schwarz-Bunten, auch Holsteiner genannt. In den Bergen brauchen sie hingegen besondere Betreuung, die Rot-Bunten, auch Fleckvieh oder Braunvieh genannt.
Die Kuh will geführt und vor den Abgründen bewahrt werden. Dazu braucht sie einen Menschen, und zwar einen geduldigen. Keinen überdrehten Hektiker, sondern einen gemütlichen und seelenruhigen Hirten, der vorangeht. Einen wie Anton Hinteregger.
Ein Leben für die Kühe am Abgrund, immer mit dem Wetter, den Pflanzen und Tieren im Einklang: Das Hirtenleben hat etwas Archaisches, es ist eine Berufung jenseits aller technischen Errungenschaften. Kein Wunder, dass diese seit Jahrtausenden existierende Beschäftigung das wohl bekannteste biblische Sinnbild für Vertrauen hervorgebracht hat: „Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir.“
Die achtzig Jahre alte Almhütte bestand aus einem Raum zum Buttern und Käsen, zum Kochen und Essen und aus einer Schlafkammer mit Schrank, Bett und Stuhl. Unter Tisch und Bett waren die breiten Dielen des Fußbodens noch so glatt, als wären sie gestern erst verlegt worden. Doch überall dort, wo der Hirte mit seinen genagelten Schuhen seine Spuren eingegraben hatte, waren sie abgewetzt. Diese Spuren im Holz waren die Trampelpfade eines eintönigen Hirtenlebens. Es gab keine Abweichungen vom Kurs, alles war auf dem Holzboden vorgezeichnet, sodass die schlurfenden Füße auch nachts den Weg fanden, wenn der Hirte schlaftrunken, mit halb geöffneten Augen, ins Freie wankte.
Die Schlafkammer war mit kleinen Heiligenbildern geziert, mittendrin ein Porträt des Papstes. Auch einige vergilbte Fotografien von Kühen mit festlichem Kopfschmuck beim Almabtrieb waren zu sehen. In der Ecke stand ein grob gezimmertes Bücherregal, vollgestopft mit stark strapazierten Büchern, die auf gründliche und eifrige Lektüre schließen ließen. An der Wand neben dem Bett hing auf Kopfhöhe eine Fotografie von einer jungen Frau, liebevoll eingerahmt und mit frischen Almblumen verziert. Die Farben waren blass geworden, so als hätte der Betrachter das blühende Antlitz täglich neu in sich aufgesogen.
Auf der Fensterbank des Hauptraumes mit gemauertem Herd stand eine Petroleumlampe mit einem schlanken Glaszylinder, der mit feiner Gravurarbeit verziert war und eigentlich gar nicht zum grob gezimmerten Mobiliar passen wollte. An der Wand über dem Esstisch hing ein Regal, in dem die flachen runden Brotlaibe wie Bücher aufgestellt waren. Davor befand sich ein stabiler Tisch mit der Bruatgromml drauf – eine Holzlade mit einem Messer, das auf einer Seite mit einer Schraube und Öse beweglich befestigt war und am anderen Ende einen Holzgriff hatte, eine Art Brotschneidemaschine für den Handbetrieb.
An der Wand hingen weiße Leinensäckchen, in denen – der lästigen Fliegen wegen – der Speck und die Wurst gelagert wurden, die kräftigenden Grundbestandteile jeder Mahlzeit. Neben dem Herd stand ein Schrank, in dem Grieß, Gerste, Haferflocken, Maismehl, Zucker, Salz und Öl aufbewahrt wurden. Die schwere gusseiserne Pfanne auf dem Herd wurde nie richtig kalt, irgendetwas schmorte immer vor sich hin. Meistens gab es Rahmmuas oder Melchermuas.
Dazu brachte der Hirte in der Eisenpfanne selbst gemachte Butter zum Schmelzen, gab Milch dazu und rührte mit dem Schneebesen Maismehl, Grieß, Zucker und Salz ein. Unter ständigem Rühren wurde die Masse zum Kochen gebracht. Dann musste das Zeug eine halbe Stunde am Rand der Herdplatte schmoren, bis am Boden eine schöne Kruste, die Raschp’n, entstand. Nun ließ man die Pfanne etwas abkühlen, erhitzte Butter in einer kleinen Pfanne, bis sie schön braun war, und goss sie über das Melchermuas. Zum Schluss bestreute man das Ganze mit Zimt und Zucker und aß die bescheidene Alltagsleckerei direkt aus der Pfanne.
Manchmal gab es auch Knödel, Schmarrn oder Plente, ein Brei aus Buchweizenmehl. Einfach, aber nahrhaft. Es roch immer nach Rauch und nach feuchten Kleidern, die am Ofen hingen und trockneten. Denn eine Garnitur Arbeitskleidung war immer nass, die landestypische Südtiroler blaue Schürze mit bunt gesticktem Wappen sowieso. Und über allem lag dieser würzige Geruch aus Käse und Kuh, irgendwie süßlich.
Die Almhütte war unterkellert – dort war es kühl, ideal zum Aufbewahren der Lebensmittel. Da standen die Käseregale und da war auch Platz für eine kleine Werkstatt. Neben der Almhütte befand sich der Kuhstadel mit einem Heulager darüber. Und in Sichtweite, ganz am Abhang, stand das bewusste Herzhäuschen.
Die Holzfassaden der kleinen Gebäude waren von der schroffen Witterung so malträtiert, dass die rauen Bretter silbrig schimmerten. Die Dächer waren mit großen Schindeln gedeckt, die mit Rundhölzern und schweren Feldsteinen gesichert waren.
In den kurzen Sommermonaten kamen hin und wieder Wanderer vorbei, die zur Eidechs- oder Steinspitze hinaufwollten, zum Kompfossee oder zur Tiefrastenhütte, um dort zu übernachten und den Pfunderer Höhenweg entlangzugehen. Aber sonst war es ein ruhiger Ort, abgeschieden vom Touristenstrom unten im Tal. Für Wintersportler war das Hochtal uninteressant, es gab keine Skilifte und keine präparierten Pisten. Ganz selten wagten sich mal Schneewanderer mit ihren unförmigen untergeschnallten Brettern hier hoch.
Das Dörfchen Terenten auf dem Hochplateau auf 1210 Metern Höhe war erst spät vom Tourismus entdeckt worden. Erst Mitte der Siebzigerjahre konnte der Ausbau der sogenannten Sonnenstraße von Vintl über Terenten bis nach Bruneck abgeschlossen werden. Und dann kamen die Touristen. Sie veränderten den sonst so verschlafenen Ort – überall wurde gebaut. Es entstanden Hotels, die Bauern richteten kleine Ferienwohnungen und Pensionen ein. Damit hatten sie einen schönen Zuverdienst zur Landwirtschaft und zum Handwerk.
Anton Hinteregger wurde von dieser Aufbruchstimmung nicht erreicht. Er stand in jeder Hinsicht über den Dingen. Doch manchmal beschlich ihn das Gefühl, sein Leben gelebt zu haben. Was sollte noch kommen?
Er war in seinen besten Jahren, aber er sah nicht so aus. Die breiten Schultern hingen etwas herunter, so als hätte die schwere körperliche Arbeit den einstmals kräftigen Körper zusammengepresst. Dadurch wirkte er 20 Jahre älter: ein gebeugter Mann mit zäher Gangart und auffälligen Trippelschritten. Hager war er und in sich verkrümmt.
Sein markantes Gesicht war braun gebrannt, aber es wirkte wie von grauem Staub überzogen. Sein makelloses Gebiss wurde von einem stachligen Wochenbart eingerahmt. Das Rasieren war inzwischen mühsam geworden, sodass er nur sonntags zu Messer und Seife griff. Und dies auch nur, wenn er anschließend zur Messe hinunter ins Dorf ging. Das Haar war immer noch dicht und füllig, aber es war meistens von einem grauen, speckigen Filzhut behütet.
Sein Leib war das kantige Relief seiner Lebensgeschichte, sein Gesicht ein trauriges Bilderbuch, in dem keiner lesen wollte.
Er war alleinstehend. Ja, noch stehend, aber unendlich allein. Er konnte nicht mit den jungen, wilden Bauernburschen mithalten, diesen rausgeputzten Muskelprotzen, diesen Kleiderschränken mit großer Klappe und kleinem Gewissen. Die quälende Einsamkeit hatte ihn so verletzt und entwurzelt, dass er irgendwann den Wunsch nach einem baldigen Ende in sich trug. Ach, würde sich doch der Hang über der Almhütte lösen und ihn, wie sein Elternhaus damals, für immer verschütten! Er lebte am Abgrund – stets in der Hoffnung, dass dieser sich erlösend auftun würde.
Immer öfter stieg der Gedanke in ihm auf, nicht auf den Tod zu warten, bis er von alleine kommt. Das Ende seines Lebens beschäftigte ihn unablässig: Wie würde es wohl werden? Wer würde ihn vermissen? Würde er hier oben verenden? Oder würde er im Winter unten im Dorf in seiner Kammer oder im Spital in Bruneck ordentlich sterben, unter ärztlicher Aufsicht in weißen Kissen und behördlich registriert?
Ein Tod hier oben hätte den Vorteil, dass die Leute im Dorf ihn gar nicht so schnell mitbekommen würden. Vielleicht eine Woche später, vielleicht zwei Wochen. Das Gebrüll der Milchkühe würde hier oben keiner hören, es sei denn der eher seltene Südwind würde die Klage der Tiere bis zur Englalm am Ende des Hochtals tragen. Er hatte keine Geschwister, nur noch einige weitläufige Verwandte in Sand in Taufers. Sein großer Wunsch war der selbstbestimmte Tod.
Eines Tages saß er wie sonst auch auf der Bank vor der Almhütte. Viel Zeit zum Ruhen fand er allerdings nicht, denn es gab immer etwas zu tun: morgens und abends melken. Die Milch musste sofort weiterverarbeitet werden. Da die Zentrifugen in den Ställen noch nicht Einzug gehalten hatten, wurde die schäumende warme Milch in mehrere flache Schüsseln geschüttet. So setzte sich der Rahm ab, der mit dem hölzernen Rahmmesser, dem Rahmspun, abgestrichen wurde. Dann wurde aus dem Rahm Butter und aus der Milch Käse gemacht. Dazu musste die Milch erhitzt werden. Und dafür war viel trockenes Brennholz nötig, das gesägt und gespalten werden musste.
Außerdem war der Hirte für das Flicken der Zäune zuständig und musste die Wasserläufe zur Tränke sauber halten. Zum Mähen des Grases kam der Bauer mit dem Traktor herauf und brachte den motorgetriebenen Mähbalken auf einem Anhänger mit. Aber es blieben immer noch genügend steile Stellen, die nur mit der Sense gemäht werden konnten. Je nach Wetterlage gab es bis zu drei Grünfutterschnitte.
Das Heu musste mehrmals gewendet werden, dazu kamen auch die Frauen vom Raffalthof mit hinauf zur Alm. Sie rechten das trockene Heu talwärts, von wo aus es dann in großen Leinentüchern geborgen und von den Männern auf den Schultern hinüber zum Stadl geschleppt wurde.
In der sengenden Mittagshitze legten die jüngeren Frauen Jacken und Blusen ab, sodass die Sonne ihre nackten Schultern krebsrot verbrannte. Abends jammerten sie, wenn sich die Haut zu schälen begann. Wie jedes Jahr versprachen sie sich gegenseitig, nächstes Mal besser Vorsorge zu treffen, und ließen sich von den Hüteburschen mit allerlei selbst gemachten Ölen und Salben die Brandstellen pflegen. Die alten Frauen wussten schon, warum sie sich mit einem Kopftuch schützten und Arme und Schultern grundsätzlich bedeckt hielten.
Und immer wieder kam es vor, dass sich die Kühe verletzten. Dann war Anton sofort zur Stelle, um die Wunden zu reinigen und zu pflegen. Das tat er mit einer solchen Hingabe, dass es ihm den Ruf eines Naturheilers einbrachte.
In jeder freien Minute las er – fast immer lag ein aufgeschlagenes Buch neben dem Essen auf dem Tisch. Anton war oft so vertieft in seine Lektüre, dass er kurz nach der Mahlzeit nicht mehr wusste, was er eigentlich gegessen hatte.
Seit seinem zehnten Lebensjahr war er jeden Frühsommer, meistens um den 15. Juni, mit der Viehherde hinauf und im Herbst wieder hinab ins Dorf gezogen. Zunächst als Hütejunge mit einem erfahrenen Hirten, später in eigener Verantwortung. In der großen Familie des Raffaltbauern Alois Schmid hatte er einen festen Platz, ein kleines bescheidenes Zimmer.
Sie nannten ihn alle nur „Toni“.
London
Kurz vor Mitternacht war im 7. Police Department des Londoner Stadtteils Brixton der Hinweis auf eine Frau eingegangen, die einem Wachmann beim nächtlichen Rundgang aufgefallen war. Die Polizisten hatten sich sofort zu der Adresse begeben, die der Wachmann durchgegeben hatte.
Sie betraten einen Hinterhof in der Clark Street, unweit der U-Bahn-Haltestelle Manchester Avenue. Der quadratische Innenhof war von schäbigen Rückseiten heruntergekommener Wohnblöcke umgeben. In einem der Blöcke gab es im Untergeschoss eine kleine Halle, mit etwa 100 Stühlen und einer Bühne an der Frontseite. Die Tür stand halb offen.
Über dem Eingang des Gebäudes prangte der Schriftzug „Last Days Convention“. Der Raum musste früher einmal eine Kneipe oder ein Tanzlokal gewesen sein, für eine größere Menschenansammlung war er auf jeden Fall denkbar ungeeignet. Die Decke war ziemlich niedrig, die Luft zum Schneiden: die übliche Mischung aus kaltem Rauch, Schweiß und Frittierfett von Fish & Chips. Ein Klassiker aus dem Duftbuffet der Londoner Kneipenszene, jedenfalls in der billigen Kategorie.
Die Polizisten fanden die Frau am Rande der Bühne zusammengekauert. Ihre Augen waren glasig und schauten ins Leere. Sie trug Jeans, eine Bluse und darüber einen grünen Parka. Es sah so aus, als sei der Saal fluchtartig verlassen worden. Das Mikrofon war eingeschaltet, die Verstärker zeigten noch Lichtsignale, aber sonst war kein Mensch zu sehen.
Die blonde Frau wirkte fast apathisch, aber gleichzeitig ängstlich. Um sich zu vergewissern, dass sie keine Waffe bei sich trug, tasteten die Beamten sie kurz ab. In diesem Stadtteil waren körperliche Gewalt und Waffenmissbrauch an der Tagesordnung. Doch die Frau war unbewaffnet. Die Polizisten hatten nicht wirklich damit gerechnet, bei ihr eine Waffe zu entdecken und schienen sich selbst ein wenig übereifrig zu finden. Aber man konnte ja nie wissen.
„Are you okay, Madam?“, fragte einer der Polizisten. „Do you need medical assistance?“
Sie winkte ab und stammelte nur ein „Thank you for coming!“
Daraufhin fotografierten die Polizisten den Versammlungsraum und die Stelle, wo sie die Frau gefunden hatten. Sie notierten sich die Personalangaben und halfen ihr auf die Beine. „Mrs Stocker, right?“
Sie nickte und verließ, von den beiden Beamten gestützt, den rätselhaften Ort.
Im Innenhof blieb einer der Beamten stehen, drehte sich um und ging im Licht der Taschenlampe zurück in die Halle. Die verschiedenen Kontrollleuchten am Mischpult waren ihm aufgefallen, sodass er die Anlage noch einmal inspizieren wollte. Er fand einen ins Pult eingeschobenen Rekorder, in dem noch eine Kassette steckte. Er nahm sie an sich. Später wollte er feststellen, ob die letzte Veranstaltung mitgeschnitten worden war.
Im Polizeirevier angekommen, wurde die Frau freundlich nach ihrem Getränkewunsch gefragt. Sie entschied sich für Tee. Kamille.
Ihre Bluse war verschwitzt und wohl in der Eile falsch geknöpft worden. Ihre Jeans wies Schmutzspuren auf und roch nach einem Reinigungsmittel, als hätte man sie über den schmutzigen Boden des Lokals gezogen.
Die beiden Beamten bereiteten das Protokoll vor, während die junge Frau am Tee nippte. Erst jetzt fiel ihnen auf, dass sie eigentlich sehr schön war. Die Grübchen in den Wangen fanden offenbar kaum noch Anlass, das Gesicht zu verzieren; stattdessen hatten sich in ihren Mundwinkeln kleine Sorgenfältchen eingegraben.
„Was ist mit Ihnen passiert, Mrs Stocker, woran können Sie sich erinnern?“, fragte einer der Beamten und schaltete ein Diktiergerät ein.
Sie richtete sich im Stuhl auf, fuhr mit den Händen durch die Haare und begann zögernd zu berichten.
„Ich war gestern Abend in der L. D. C., also im Mittwochsmeeting der Last Days Convention. Ich gehöre seit einigen Jahren zu dieser Gruppe. Richard Mac Cormick leitet den Verein. Sonntag und Mittwochabend treffen wir uns in der Halle.“
„Was ist das für ein Verein?“, unterbrach sie der Polizist.
„Eine alternative Jugendkirche, also nicht Kirche im engeren Sinne, sondern eine Alternative zur High Church. Die Gruppe ist modern und weltoffen, vor allen Dingen für die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. L. D. C. legt keinen Wert auf ‚bells and smells‘ wie die Katholiken, die Anglikaner oder Presbyterianer. Bei uns kann jeder mitmachen, ob getauft oder nicht.“
Ihre Rede wirkte distanziert, wie einstudiert und abgespult, als hätte sie diesen Passus schon öfters zu Protokoll gegeben.
„Verstehe“, sagte der Beamte, obwohl sein Gesicht genau das Gegenteil ausdrückte. Er schien gar nichts begriffen zu haben.
Der zweite Polizist wollte zurück zur Sache kommen: „Warum kauerten Sie vor einer Stunde am Rand der Bühne, obwohl der gesamte Saal leer war?“
„Ich muss wohl von der Bühne gefallen sein.“
„Waren Sie am Programm beteiligt?“
„Ja, ich habe die Ansprache für die deutschsprachigen Gäste übersetzt. Das kommt hin und wieder mal vor.“
„Und keiner hat bemerkt, dass es Ihnen nicht gut ging?“
„Nein, scheinbar nicht“, kam es gequält über ihre Lippen. „Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet, dass mir gelegentlich vor lauter Erschöpfung übel wird. Ich muss wohl kurz bewusstlos gewesen sein.“
Die Beamten schauten sie misstrauisch an. „Nehmen Sie Drogen?“
„Nein, ich nehme keine Drogen.“
„Das werden wir überprüfen“, bemerkte einer der Polizisten und tat dabei so überlegen wie möglich, obwohl er spürte, dass die Frau clean war – so clean, wie sie unbewaffnet war.
„Wer sind Sie? Welche Position haben Sie in der Gruppe?“
„Ich gehörte zum inneren Zirkel, habe Mac Cormick hin und wieder übersetzt, aber ich bin schon eine Weile auf dem Rückzug. Der Gründer und Leiter von L. D. C. hat sich seine Macht derart gesichert, dass er uns wie Sklaven behandeln kann. Er schottet uns immer mehr von der Außenwelt ab und hat in den Bergen Schottlands eine sogenannte ‚Shelter‘ gegründet, in die wir uns als Kommune zurückziehen sollen, wenn der Countdown für das Ende beginnt. Der Mann hat Freiheit versprochen, aber nur er selbst ist frei, wir anderen haben unsere Freiheit verloren. Die L. D. C. ist innen straff organisiert, man fühlt sich bespitzelt. Nur nach außen wirkt der Verein tolerant und zugänglich. Aber warum erzähle ich das alles? Ich bin ein Risiko für die L. D. C., ich weiß zu viel. Mac Cormick wird alles daransetzen, mich unter Kontrolle zu behalten.“
Sie schien zu ahnen, dass jedes weitere Wort mehr Verwirrung stiften würde. „Und außerdem bin ich müde. Brauchen Sie mich noch? Ich möchte jetzt gerne nach Hause gehen.“
Doch die Polizisten bestanden darauf, dass die junge Frau vorher noch ärztlich untersucht werden müsse. Zu diesem Zweck telefonierten sie und zehn Minuten später stand eine ihrer Kolleginnen im Raum. Sie war in Zivil.
Gleichzeitig kam ein Techniker herein, der die Tonkassette untersucht hatte. Es war tatsächlich eine Ansprache mitgeschnitten worden, die sich komplett und gut verständlich abspielen ließ. Einer der Beamten nahm das Band an sich. „Vielleicht müssen wir später noch einmal darauf zurückgreifen. Von uns aus ist der Fall nun aber zumindest vorläufig erledigt.“
Damit verabschiedeten sich die Beamten und übergaben Frau Stocker ihrer Kollegin.
Eine Viertelstunde später befanden sich die beiden Frauen in der Notaufnahme einer Klinik unweit des Polizeireviers. Es war viel Betrieb, aber nach kurzer Zeit betraten sie das Sprechzimmer einer Ärztin, die für die Ambulanz zuständig war. Frau Stocker wurde gründlich untersucht und nach dreißig Minuten verlas die Ärztin in Gegenwart der Polizeibeamtin das Ergebnis:
„Frau Evamaria Stocker, geboren am 3. Juli 1940 in Schladming in Österreich, aufgewachsen in Bruneck in Norditalien …“
Die Frau unterbrach den förmlichen Redefluss der Ärztin: „In Südtirol, bitte schön, nicht in Norditalien!“
„Also nicht Italien?“
„Doch, Italien, aber wir sind eine autonome Provinz. Im Norden liegt Tirol, das gehört zu Österreich, im Süden liegt Südtirol. Wir sprechen Deutsch.“
Die Ärztin lächelte, sagte mit einer Spur Ironie im Tonfall: „Danke für die Nachhilfestunde in Geografie!“, und fuhr wieder ganz förmlich fort: „Seit Sommer 1960 in London lebend, Studentin der Medizin, wurde am heutigen Datum in dem Versammlungslokal der Sekte ‚Last Days Convention‘ in der Clark Street in London-Brixton von Beamten der siebten Polizeistation gegen Mitternacht aufgefunden.“
Sie zögerte. „Das ist doch eine Sekte, oder? Ich meine, das hat jetzt nicht direkt mit meiner medizinischen Zuständigkeit zu tun, aber Sie machen mich neugierig.“
„Vor ein paar Monaten hätte ich diese Bezeichnung abgelehnt, aber schreiben Sie ruhig ‚Sekte‘. Die L. D. C. stiftet erst Angst und bietet dann Hilfen zur Überwindung der Angst. Das ist das Merkmal einer Sekte. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu durchschauen.“
„Interessant“, meinte die Ärztin, die es offenbar weniger interessant als ziemlich verrückt fand. „Sie stiften Angst und treiben sie wieder aus.“ Sie schien von ihrer Auffassungsgabe selbst beeindruckt. „Das klingt nach einem profitablen Geschäftsmodell. Crazy!“ Sie hielt einen Moment inne, um dann wieder zurück ins Protokoll zu finden.
„Also weiter im Text: Bei der klinischen Untersuchung war die Patientin ansprechbar, subjektiv bezeichnete sie ihren Zustand als wie nach einer Trance-Erfahrung. Bei der neurologischen Untersuchung war der Reflexstatus regelrecht, Pupillen normal weit und gerundet, auf Licht reagibel. Es fanden sich keine neurologischen Defizite, auch kein Hinweis auf einen abgelaufenen Krampfanfall. Kein Zungenbiss, kein Einnässen, auch kein Hinweis auf eine äußere Gewalteinwirkung.
Glasgow Scale 15 Punkte. Vitalparameter ansonsten regelrecht mit grenzwertig niedrigem Blutdruck von 95/60 mm Hg, Puls normofrequent, rhythmisch, Sauerstoffsättigung 97 %. Differenzialdiagnostisch kommen ein Zustand nach Drogen-Abusus oder auch eine hypotensive Kreislauf-Dysregulation infrage. Die Laboruntersuchungen des Drogen-Screenings stehen aus. Aktuell besteht keine Indikation zu einer stationären Behandlung.“ Datum, Uhrzeit, Unterschrift der Ärztin. Unterschrift der Patientin. Unterschrift der Polizeibeamtin.
„Sollen wir Ihnen ein Taxi bestellen?“, fragte die Polizistin.
Frau Stocker bedankte sich freundlich, lehnte aber ab und ging zur nächsten U-Bahnstation. Die „Tube“ war wie immer um diese Zeit überfüllt. Darum war die junge Frau froh, einen der Haltegurte an der Stange erwischt zu haben.
Als sie in der Station Liverpool Square ausgestiegen war und sich die lange Treppe hochgequält hatte, umfing sie ein kalter Nieselregen, der den Schmutz aus dem Nebel wusch und auf die nach Hause eilenden Passanten niedergehen ließ. Es dauerte nicht lange, bis die junge Frau den dunklen Eingang eines ungepflegten Hauses erreicht hatte. Im fünften Stock angekommen, schloss sie ihre Wohnungstür auf und ließ sie laut hinter sich zufallen, als wollte sie das zurückliegende dunkle Kapitel ihres Lebens demonstrativ abschließen.
Die Wohnung war nicht teuer, aber geschmackvoll eingerichtet. Der Schreibtisch, überladen mit aufgeschlagenen medizinischen Fachbüchern, war der augenfällige Mittelpunkt der Wohnung. Über einem reichlich mit Papierstapeln belegten Sofa hing eine weiß-rote Flagge mit Adlermotiv.
Bereits im Flur ließ sie den vom Nieselregen feucht gewordenen Parka von ihren Schultern rutschen. Dann fiel alles an ihr herunter: die zerknitterte Bluse, die Jeans, an der noch der Dreck aus der Halle klebte. Mit letzter Kraft zog sie sich das verschwitzte T-Shirt über den Kopf und starrte in den Spiegel. Ihr Gesicht wirkte wie etwas Fremdes über dem sonst makellosen Körper.
Ist das die Evi aus Südtirol?, fragte sie sich, als müsste sie sich über ihre eigene Identität Klarheit verschaffen.
Während der warme Wasserstrahl über ihren kalten Körper floss, wünschte sie sich sehnlichst, auch von innen gereinigt zu werden, damit all das Dunkle aus ihrer Seele gewaschen würde. Sie drehte die Dusche bis zum Anschlag auf – so heiß wie möglich, als könne das Wasser auf diese Weise bis unter die Haut dringen.
Am nächsten Morgen kam eine zivile Polizistin vorbei und erklärte, sie brauche noch einen ausführlichen Bericht darüber, wie Frau Stocker in Kontakt mit dieser Sekte gekommen sei. Ob sie, bitte, noch etwas näher beschreiben könne, worum es bei dieser „Last Days Convention“ gehe?
Seufzend bat Evi Stocker die Beamtin, Platz zu nehmen und begann dann erneut zu erzählen: „Ich stamme aus Südtirol, der autonomen Provinz Alto Adige in Italien, und bin mit zwanzig Jahren nach London gekommen, um hier als Au-Pair zu arbeiten und mich auf ein Studium in Oxford vorzubereiten. Nach einem halben Jahr wurde ich von einer Freundin zu einer Veranstaltung eingeladen.
Es fing alles ganz harmlos an. Da waren an die hundert überwiegend junge Leute, die begeistert Musik gemacht und einen alternativen Lebensstil propagiert haben. Und dies kombiniert mit einer begeisterten Jesus-Verehrung, die ich selbst aus meiner Jugendzeit mitgebracht hatte. Das hat mich sehr angesprochen und so bin ich Mitglied dieser Gruppe geworden.
In den ersten Jahren war die Bibel das geistige Fundament des Vereins. Aus diesem Grund bin ich damals überzeugt in dieses System eingestiegen. Aus dem Glauben an den Erlöser heraus Menschen am Rand der Gesellschaft dienen und die Mächtigen und Reichen zur Rechenschaft ziehen – das war genau das, was ich immer gesucht hatte: einen Glauben, der nicht auf das Jenseits vertröstet, sondern den Menschen hier schon ein wenig Himmel auf Erden verschafft.
Aber irgendwann veränderten sich ganz allmählich die Ziele und die Grundlagen des Klubs. Erst wurden Endzeitängste geweckt, dann wurde kostenpflichtige Beratung und Hilfe angeboten, und am Ende waren die Leute genauso schlau wie vorher, nur um einige Tausend Pfund ärmer. Heute hat das alles mit dem Christentum nicht mehr viel zu tun. Man könnte sagen, Mac Cormick und seine Getreuen haben einen Endzeit-Komplex.“





























