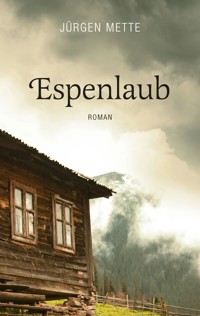Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Als Jürgen Mette während eines Fernsehdrehs mehrfach von einem unkontrollierten Zittern überfallen wird, ahnt er, dass mehr als Kälte und Erschöpfung dahinterstecken. Eine Reihe ärztlicher Untersuchungen bringt schließlich die deprimierende Gewissheit: Parkinson ist in sein Leben getreten. Ein Leben, das vorher bestimmt war durch sein hohes Maß an Energie, Lebensfreude und einen vollen Terminkalender, wird nun von der unheilbaren Krankheit beeinflusst. In diesem Buch erzählt Mette von seinem ereignisreichen Lebenslauf. Und nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen einer chronischen Krankheit, die seinen Alltag mehr und mehr prägt. Skurrile und niederschmetternde Erlebnisse haben darin ebenso Platz wie Mut machende Erfahrungen und tiefe Einsichten darüber, was im Leben trägt und wirklich zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jürgen Mette, gelernter Zimmermann, studierte in Marburg und den USA Theologie. Nach pastoralem Dienst in der Pfalz war er zehn Jahre bundesweit als Referent für Jugendevangelisation tätig. Danach baute er eine Gemeindeberatungspraxis auf und erhielt einen Lehrauftrag in praktischer Theologie. Seit 2002 Geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien und seit 1992 Vorsitzender des Stiftungsrats der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR, Trägerin der Evangelischen Hochschule TABOR in Marburg. Außerdem engagiert er sich in den Vorständen vom Bibellesebund sowie von Willow Creek Deutschland und ist Mitglied des Hauptvorstands der Deutschen Evangelischen Allianz.
Seit 1980 ist Jürgen Mette glücklich verheiratet mit seiner Frau Heike. Der Vater von drei erwachsenen Söhnen liebt Musik von Johann Sebastian Bach, Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo und Philipp Poisel und schreibt für seine Enkelkinder die Familiengeschichte weiter.
Inhalt
Vorwort von Dan Peter
Prolog
1. Die unheimliche Begegnung mit Herrn P.
2. Signieren statt resignieren!
3. Ein feste Burg
4. Den Vorboten verboten
5. Auf der Flucht vor der Diagnose
6. Vom Ende der Täuschung
7. Sich der Wahrheit stellen – das ist Freiheit
8. Wenn die Seele nicht mehr lacht
9. Musik als Heilmittel
10. Lächerliches und Deprimierendes
11. Vom Risiko der Nebenwirkung
12. Parki-Genossenschaft
13. Geschüttelt und gerührt
14. Disziplin? Ab morgen!
15. Zweifelhaftes und Glaubhaftes
16. Ich kann nicht klagen!
17. Eine ziemlich unanständige Wette
18. Wo war Gott?
19. Wo war ich?
20. Schatz in zerbrechlichen Gefäßen
21. Einsichten und Aussichten
Epilog
Literaturempfehlungen des Verfassers
Danke
Gastbeitrag von Dr. med. Jürgen Rieke
Gesund ist,wer noch nicht gründlich untersucht wurde.1
Manfred Lütz
1 Lebenslust – wider die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult, Pattloch, München, 2002
Gesund ist,wer versöhnt lebt und mit seinen seelischen und körperlichen Einschränkungen zuversichtlich leben kann.
Jürgen Mette
Vorwort
Extrovertiert und stilsicher, ganz im Hier und Jetzt, gleichzeitig fest verwurzelt in seinem Glauben – so kennen viele Jürgen Mette. So wird er Ihnen auch in diesem Buch begegnen. Man hört ihm gerne zu, er kann begeistern. Energie, Humor und Witz zeichnen ihn aus, ebenso seine Liebe zur Musik – von Bach bis Grönemeyer. Er hat Maßstäbe und mutige Zeichen gesetzt, nicht zuletzt als geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien.
Was macht nun aber eine Krankheit wie Parkinson aus diesem engagierten Christen? Wie viel Stress bereitet ihm wohl die Einsicht, dass er selbst nicht mehr berechenbar ist, angefangen bei alltäglichen, normalen Abläufen, die plötzlich viel länger dauern als gewohnt? Wie geht er mit zunehmender Schwäche und Nervosität um? Wie lernt er, sein Leben neu zu gestalten und manches vielleicht auch in Gottes Namen loszulassen?
Eine Krankheit bleibt nicht auf Äußerlichkeiten begrenzt, so die Botschaft dieses Buches. Sein Leben lang konnte sich der gelernte Zimmermann und studierte Theologe auf sein gutes Empfinden und sein Bauchgefühl verlassen. Was aber, wenn dieses nun durch die Krankheit irritiert, vielleicht auch aus dem Lot gebracht wird? Kann man sich selbst noch trauen, und wie viel darf man sich überhaupt noch zutrauen, um nicht schwierig für andere zu werden?
Warum soll man ein Buch lesen, in dem Krankheit einen großen Raum einnimmt? Mehr als durch Erziehung und Bildungsveranstaltungen lernt man durch den tagtäglichen »Anschauungsunterricht«, den uns das Leben und andere Menschen gewähren. Bewusste und unbewusste Nachahmung prägen uns Menschen weit mehr als kognitives Lernen – nicht nur in den ersten Lebensjahren. Jeder von uns profitiert vom gelingenden, aber auch vom misslingenden Leben anderer, in Vorbild und Abgrenzung, in Widerstand und Annahme.
Und genau darum geht es in diesem Buch. Es hat die klare Botschaft: Schaut her, so geht es mir! Ich muss selber lernen, mit meiner Krankheit angemessen umzugehen, mit ihr zu leben. Das gelingt einmal besser und ein anderes Mal nicht so gut, aber ich gebe im Gottvertrauen nicht auf und ich nehme auch diese schwierige Lebensführung aus Gottes guten Händen. Ich will mich nicht zurückziehen, sondern mitten unter euch sein. Vielleicht hilft euch die Anschauung meines Lebens, eure Widrigkeiten ebenso anzunehmen und anzugehen.
Sich die Krankheit sozusagen von der Seele zu schreiben, mit ihr umzugehen, sie auch für andere aufzubereiten, sodass eigenes Empfinden und eigene Einsichten nachvollziehbar, ja sogar übertragbar werden, so verstehe ich das tiefere Anliegen seines Autors. So verstehe ich meinen Freund und Vorstandskollegen Jürgen Mette, als einen, der andere teilhaben lässt, sie mitnimmt, bis hinein in die eigene Gefühls- und Gedankenwelt – so erlebe ich ihn auch außerhalb der Buchrealität.
Wie die Krankheit das ganze Leben betrifft, so wird das ganze Leben von Jürgen Mette in seine Krankheitsgeschichte einbezogen. Das erfordert viel Mut, aber auch eine große Sensibilität. Denn als Geschäftsführer einer bekannten Medienstiftung macht man sich durchsichtig und angreifbar, wenn man seine Schwäche und die verletzlichen Seiten zeigt, einen offenen und ehrlichen Einblick in das eigene Leben und Empfinden gewährt und auch die depressiven Phasen nicht ausspart. Jürgen Mette gelingt es aber, in dem vorliegenden Buch weder einen billigen Krankheitsvoyeurismus zu bedienen, noch zu sehr ins Predigen zu verfallen. Es gelingt ihm, die eigene Erfahrung nicht zu überhöhen oder gar das eigene Leben um höherer Anliegen willen zu glätten oder zu beschönigen, sondern auf Augenhöhe zu bleiben. Respekt!
Dieses Buch erlaubt mit einem Schritt Abstand, die eigene Situation zu bedenken. Vielleicht kann ich es ebenso machen, vielleicht muss ich aber auch ganz anders handeln, kann sogar aus den dargestellten Fehlern und Einsichten lernen, bewusst oder unbewusst.
Krankheit ist der Ernstfall des Lebens, aber ebenso der Ernstfall des Glaubens. Denn plötzlich stellt sich die Frage, was das Leben ist und was es wertvoll und lebenswert macht. Ist die Krankheit nur Behinderung oder auch Chance? Ruft sie neue Einsichten, neue Sensibilität hervor oder provoziert sie eher neue Stress- und Konfliktfelder?
Krankheit ist sehr häufig auch ein Ernstfall des Glaubens. Viele Fragen drängen sich auf, ob man will oder nicht: Warum bin ich jetzt schwach, obwohl die Aufgabe alle Kraft erfordert? Was will Gott mir dadurch sagen? Warum lässt Gott das zu? Ist Krankheit vielleicht doch eine Strafe? Jürgen Mette lässt keine dieser Fragen aus, aber er zeigt auch, wie er sie sich beantwortet hat oder wie er mit ihnen lebt. Mitten in seinem Alltag und in den dunklen Stunden trifft er auf sie. Für manche Fragen hat er sein ganz eigenes Rezept entwickelt. Deshalb bleibt es in diesem Band weder dunkel noch traurig. Ganz im Gegenteil: Das Buch verbreitet Hoffnung und Licht, gewürzt mit Musik und Humor und nicht zuletzt durch Glauben und Lebensfreude.
Daher kann ich es Ihnen nur ans Herz legen.
Ihr Dan Peter
Kirchenrat Dan Peter leitet das Referat Publizistik und Gemeinde im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche Württemberg und ist stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien.
Prolog
Es roch immer etwas muffig in dem düsteren, kühlen Hausflur des alten Bauernhauses, sogar im Sommer. Etwas heller wurde es in der blitzsauberen Küche. Von dort aus ging es eine Stufe hoch in die gute Stube. Ein Sofa, ein Ohrensessel, der Tisch, voll mit Zeitschriften aus Landwirtschaft und Kirche, ein Harmonium – mit Pedalen unten für den Blasebalg – und eine Nähmaschine, auch mit Fußbetrieb. Das war das kleine, gemütliche Reich des Altbauern und seiner Frau. Beide waren hochbetagt, aber noch ziemlich frisch im Kopf. Sie flickte die Wäsche oder strickte Strümpfe und wusste immer viel zu erzählen. Auf dem behaglich blubbernden Holzofen stand eine Kanne Malzkaffee und meistens war auch trockener Streuselkuchen im Angebot, an dem kein Besucher vorbeikam.
Der alte Bauer – immer im grünen Lodenzeug – las viel und schwieg viel. Sie hatten das Radiogerät auf den frommen Sender »Trans World Radio« eingestellt und diese Frequenz wurde nur zu den Wettermeldungen des Landfunks verlassen. Die beiden konnten ja nicht mehr zur Kirche gehen. Da war das Radio eine bequeme Möglichkeit, sich innerlich zu orientieren und geistig frisch zu bleiben. Sie waren im Gesangbuch und in der Bibel zu Hause.
Einmal in der Woche kam ein Junge aus der Nachbarschaft und brachte was zum Lesen vorbei. Sie nannten ihn »Jirjen«. Den fragte die alte Bäuerin immer gründlich aus, obwohl sie alle Neuigkeiten aus dem Dorf längst wusste.
Der alte Bauer ging gebeugt und zitterte am ganzen Leibe. Immer wenn »Jirjen« zur Tür hereinkam, weinte der alte Mann im Lodengrün vor Freude und Rührung und wurde regelrecht geschüttelt. Er spielte gern Harmonium, aber dann war er derart aufgeregt, dass er die Tasten verfehlte. Sein Gesicht war starr wie eine Maske, so, als wären die Gesichtsmuskeln mit ihm vor Jahren in Rente gegangen. Das Sprechen fiel ihm zunehmend schwer. Immer wenn er den Mund spitzte, um ein paar Worte wie Zahnpasta aus der Tube zu pressen, musste sich »Jirjen« verschämt abwenden, weil das so komisch aussah. Aber der alte Mann trug sein Leiden mit stiller Würde. Er klagte nie, obwohl er sich kaum vom Sessel entfernen konnte.
Irgendwann in den 60er-Jahren ist der Alte in der Kammer neben dem dunklen Hausflur für immer friedlich eingeschlafen. »Jirjen« war es schwer ums Herz, als er hinter dem Sarg herlief. Der alte Bauer hat zwanzig Jahre seines Lebens gezittert. Nun hatte er endlich seine Ruhe.
»Lieber Gott, mach bitte, dass ich nie diese Zitterkrankheit bekomme«, betete der kleine »Jirjen« abends vor dem Schlafengehen. Aber dieses Gebet muss irgendwie verloren gegangen sein.
*
»Zieht euch ordentlich an, Jungs, heute kommt ein Ehepaar aus Kassel zum Kaffee! Das sind feine Leute. Und wundert euch nicht, der Mann ist krank.« Eine der typisch klaren Ansagen meiner Mutter, die immer gern Gäste einlud. Der Tisch im Wohnzimmer wurde mit feinem Porzellan und Silber gedeckt. Der Kaffee duftete aus der Küche und die Torten waren lecker dekoriert.
Und dann fuhren sie im Dorf vor, die Gäste aus der nordhessischen Metropole. Eigentlich waren es ganz bescheidene Leute, aber meine Mutter machte immer ein bisschen Wirbel, wenn »feine Leute« aus der Stadt zu Besuch kamen. Die Gäste saßen in einem cremefarbenen »Lloyd Alexander«, der mit der Blumenvase und Plastikblume am Armaturenbrett. Der Fahrer schälte sich mühsam aus dem Auto, seine Frau ging ihm dabei zur Hand. Der eine Arm hing wie lahm an ihm herunter, der Gang war schlurfend und schleppend. Er war um die fünfzig, aber er kam nur mühsam die Vortreppe hoch. Der Mann zitterte am ganzen Leibe. Ein Bild zum Erbarmen.
Nach der herzlichen Begrüßung ging es zum Kaffeetisch. Seine Frau knüpfte ihm liebevoll ein riesiges Lätzchen um den Hals, ein halbes Bettlaken – wie beim Friseur. Er versuchte die Tasse zum Mund zu führen, aber die Hälfte ging daneben. Und dann erst der Kuchen. Der lockere Mürbeteig fiel ihm samt der in Sahne gebetteten Erdbeeren von der Gabel. Der ganze Kaffeetisch vibrierte. Aber der Gast bewahrte die Fassung, unterhielt sich geistreich mit meinem Vater über Kirche und Welt im Allgemeinen und Theologie im Besonderen, obwohl er Vermessungsingenieur war. Er hatte seine theologische Kompetenz als ehrenamtlicher Prediger erworben. Ein zitternder Pastor, ein Tatterich auf der Kanzel, das passt eigentlich gar nicht.
Der Zittermann brachte dann doch die wackelige Kuchenprozedur einigermaßen hinter sich. Meine Mutter guckte ganz verlegen, weil sie den falschen Kuchen gebacken hatte. Platter Hefekuchen mit festem Belag hätte besser zu diesem geplagten Mann gepasst, aber das konnte sie ja nicht wissen.
Er sprach mit leiser, gebrochener Stimme, freundlich, warmherzig und mit großem Interesse am Ergehen seiner Gastgeber. Der Mann hatte Tiefgang. Er hatte nichts zu lachen, aber etwas zu sagen. Er bewahrte Stil, obwohl er mit dem großen Lätzchen wie ein Kind im Hochstuhl aussah.
Der freundliche Herr kam noch öfter in unser Haus. Und jedes Mal tat er mir so entsetzlich leid, dass ich inständig hoffte, nie solch eine erbärmliche Krankheit zu bekommen. 45 Jahre später sollte es dann doch anders kommen.
1. Die unheimliche Begegnung mit Herrn P.
»Warum zitterst du so?«
Weil es zu kalt ist auf der Wartburg in Eisenach. Ich bitte darum, Heizlüfter aufzustellen, schließlich drehen wir die Fernsehserie mitten im frostig kalten Januar. Bei Kälte zittere ich immer. Aber ich weiß, dass es andere als thermische Gründe sind, die mich fremdbestimmen. Ich wollte es nur noch nicht wahrhaben.
Direkt vor dem Altar der Schlosskapelle war eine rote Sesselgruppe aufgebaut: ein Tischchen, Stative, Gleise für die fahrbare TV-Kamera. Und wir drei Akteure dieser zwölfteiligen Gesprächsreihe: ein Professor der Theologie für Neues Testament, eine TV-Journalistin und ich als Gastgeber und Moderator. Wir bildeten mit den Kamera-, Licht- und Tonleuten, der Visagistin, dem Produzenten und Regisseur ein kreatives und improvisationsfähiges Team. Vormittags berieten wir gemeinsam das Drehbuch, nachmittags dokumentierte ich alles schriftlich und abends, wenn die letzten Touristen die Burg verlassen hatten, wurden wir in Szene gesetzt. Und dann hieß es bis Mitternacht »Kamera läuft! Ton ab!« Alles ohne Teleprompter, diesem Gerät, das den Text auf einen Bildschirm der Kamera projiziert, damit der Moderator seinen Text vor Augen hat. Alles freihändig, möglichst druckreif und die Stoppuhr stets im Blick.
Ich hatte mich nicht für diesen Job beworben, geschweige denn ein Casting durchlaufen. Der Sender, für den ich oft Radiosendungen gemacht habe, traute mir diese Aufgabe als TV-Moderator einfach zu.
Mit dem Einstieg in die mediale Welt des bewegten Bildes begann die unheimliche Entdeckung, dass mich irgendetwas emotional und muskulär gegen meinen Willen bewegt. Das war der Anfang eines langen Weges, auf dem ich zunehmend meine Freiheit verlieren sollte. Der geheimnisvolle Herr P. war in mein Leben getreten. Er hatte seinen Besuch längst angekündigt, aber das wollte ich nicht wahrhaben. Ich hatte die scheuen Vorboten schöngeredet.
Die neue und alles beherrschende Frage war: Warum zittere ich eigentlich? Ich hab noch nie im Leben Lampenfieber gehabt.
Mit 18 stand ich als Sänger der Musikgruppe unseres christlichen Jugendkreises zum ersten Mal auf der Bühne. Als 22-Jähriger war ich Frontmann einer Studentenband, mit 25 Jahren Dirigent eines Jugendchores, und von da an habe ich fast jeden Sonntag auf irgendeiner Bühne oder Kanzel gestanden. Ich habe nie vor und schon gar nicht während eines Bühnenauftritts gezittert.
Jetzt nehme ich es wahr. Das Zittern wird latent, bisher war es nur in Stresssituationen akut. Jetzt nistet es sich ein, etabliert sich, manifestiert sich. Meine linke Hand zittert und ich kann es nicht verbergen. Meine Muskeln machen sich selbstständig. Irgendeine Schaltung im Gehirn macht, was sie will. Irgendein Prozessorjagt mir Zuckungen in den Arm, dem ich eigentlich den Auftrag erteilt hatte, mir eine Gabel Pasta in den Mund zu schieben. Und wenn die Pasta in Tomatensauce gebadet hat, ist das Ergebnis dieser unklaren Kommandostruktur eine ziemlich unansehnliche Sache. Wo ich doch so gern Spaghetti esse und auch gern weiße Hemden trage.
Irgendein Teil meines Nervensystems spinnt und verweigert mir zunehmend den Gehorsam. Ich bin nicht mehr selbstbestimmt. Ich teile die Steuerung meiner Bewegungsabläufe mit einer mir unbekannten Macht. Da hört nicht irgendeine Körperfunktion auf zu funktionieren; darauf könnte ich mich ja vielleicht noch einlassen. Was mich so verrückt macht, ist die Entdeckung, dass mein Organismus ohne mein Einverständnis eine neue Motorik entwickelt, die nicht nur völlig überflüssig und unbrauchbar ist, sondern auch furchtbar lästig. Wer braucht die zusätzliche Fähigkeit, am ganzen Leib zu zittern? Der virtuose Violinist vielleicht, der beim Vibrato eine zittrige Hand am Griffbrett nötig hat, aber doch nicht ich. Was ist das? Und warum kann ich diesem unheimlichen Muskelwahnsinn nicht mit einem klaren Befehl aus dem Gehirn den Saft abdrehen? Ich kann diesen Reflex nicht abstellen. Es gibt keinen Schalter. Ich ahne, was Menschen mit Restless-leg-Syndrom durchmachen, die, sobald sie sich hinlegen, unruhige Beine bekommen und keinen Schlaf finden.
»Na, was fehlt dir denn?« »Mir fehlt nichts! Im Gegenteil, ich kriege einen zu viel. Ich habe noch eine Körperfunktion dazubekommen. Ich kann zittern, ohne dass mich einer mit der Waffe bedroht.«
Das konnten bisher nur zwei: der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz, der in dem Film »Der Untergang« den parkinsonkranken Adolf Hitler spielte. Wie hatte der diesen permanenten Reflex bloß trainiert, den ich mir so gern abtrainieren würde?
Und das kann in hinreißend komischer Perfektion der fränkische Comedian Volker Heißmann vom Kabarett-Duo »Rassau und Heißmann« aus Fürth, wenn er »das Mariechen« spielt, eine kauzige Zitteroma. Das ist der beste Parkinsonimitator überhaupt. Nur, der kann den Tatterich hinter der Bühne abstellen. Ich nicht!
Das alles verunsichert mich heftig. Aus Verunsicherung wird Angst, aus Angst wird Panik, aus Panik wird Zorn. Und Zorn klingt nur ab, wenn sachliche Informationen die Emotionen runterkühlen. Darum gab ich nachts im Hotelzimmer auf der Wartburg das Stichwort »Parkinson« in eine Internetsuchmaschine ein und las zum ersten Mal etwas über diese Krankheit. Nur ein paar Fragmente. Schnell wieder raus aus den Fachartikeln und der Selbsthilfe-Betroffenheitsliteratur. Ich will mich nicht damit befassen. Das würde mich nur runterziehen. Aber ich verlasse den Laienstand und unterziehe mich widerwillig dieser medizinischen Lektion. Ich lerne einige Symptome namentlich kennen, die mich für den Rest meines Lebens beschäftigen werden.
Tremor? Nie gehört. Was ist das? Zittern im Ruhezustand. Na ja, immerhin besser als gelähmt.
Dopamin? Ein biogenes Amin aus der Gruppe der Katechomaline. Verstehe! Ein wichtiger Neurotransmitter, im Volksmund auch Glückshormon genannt. Damit bin ich offenbar reichlich gesegnet, ich glückliche Frohnatur, so meine erste laienhafte Wahrnehmung. Tatsache ist allerdings, dass es mir an Dopamin fehlt. Das Gleichgewicht der verschiedenen Botenstoffe ist gestört.
Transmitter? Botenstoffe? Ich wusste gar nicht, dass das Zeug mobil ist. Was man jetzt alles erfährt.
Meine laienhafte Phantasie malt sich aus, dass diese Botenstoff-Spediteure streiken. Wegen Eiweißablagerungen in den Gehirnzellen? Klingt eigentlich gar nicht so gefährlich. Morgen früh lieber kein Frühstücksei köpfen? Quatsch! Eiweiß im Hirn hat nichts mit Eiweiß in der Omelette-Pfanne zu tun.
Ich falle in die Kissen des komfortablen Hotelbetts, schreie lautlos zu Gott und finde keinen Schlaf. Der geheimnisvolle Herr P. ist in mein Leben getreten. Ich schieße mich zornig auf ihn ein, personifiziere ihn, nenne ihn beim Namen. Dieser P. scheint fest entschlossen zu sein, mich zu einem Behinderten zu machen. Für immer!
Wer bist du, Unbekannter?
Wann hast du dich heimlich in mein Leben geschlichen?
Wo hast du dich so lange versteckt, du Dämon der alten Leute, du Quälgeist der Tattergreise?
Hau gefälligst ab, du Undercover-Agent der neuen dementen Gesellschaft! Du kommst viel zu früh. Melde dich noch mal, wenn ich 80 bin. Da zittern fast alle.
Wer gibt dir das Recht, in meinem Kopf Blockaden zu errichten?
Was geht dich der Eiweißgehalt meiner Gehirnzellen an, Fremder?
Wer hat dir erlaubt, meine Dopamin-Transmitter heimlich zu beeinflussen, sodass diese ihre Transportarbeit zunehmend verweigern? Warum hast du diese treuen Arbeiter in meinem Kopf gegen mich aufgehetzt? Gehen die nach und nach alle in den unbefristeten Streik?
P., ich hasse dich! Und ich werde dich täglich verachten. Ich denke nicht daran, mit dir mein Leben zu teilen. Ich dementiere die Demenz, du Totengräber der Hoffnung auf einen schönen Ruhestand.
Was wollte ich nach dem aktiven Berufsleben noch alles tun! Meinen Söhnen Häuser bauen oder Wohnungen einrichten, unser eigenes Haus gründlich renovieren, den Garten neu anlegen – endlich so, wie meine Frau es sich seit 30 Jahren wünscht. Sie hat romantische Gartenphantasien – bei mir muss es praktisch sein. Sie träumt von Rosenlauben, während ich frage, ob das alles rasenmäherkompatibel ist. Ich gehe gern mal mit der Kettensäge in den Garten, sie mit der Rosenschere. Aber im Ruhestand wollte ich sie glücklich machen, dann sollte sie ihren Traumgarten bekommen.
Und Europareisen wollte ich machen: Fahrradtouren von Passau nach Wien und die E-5-Bergtour von Meran nach Oberstdorf oder den GR 20 von Calenzana nach Conza auf Korsika. Warum habe ich die schönen Dinge des Lebens immer vor mir hergeschoben?
Nun kann ich diesen Wunschzettel auf ein Seniorenprogramm zusammenstreichen. Als Fahrradfahrer – vielleicht bald mit dem E-Bike – auf der Rentnertrasse an der Lahn entlang und mit der Seilbahn auf die Zweitausender.
Wie habe ich früher über die Turnschuh-Alpinisten mit ihren Spazierstöcken und Trachtenanzügen gelästert, wenn sie – mit Kameras behangen – aus der Gondel auf die Terrasse der Bergstation gespuckt wurden, um ein paar Meter Trampelpfad mit ihrer Leibesfülle zu verdichten und der ohnehin strapazierten und kümmerlichen Flora den Rest zu geben. Bin ich auch bald einer dieser schnaufenden Edelweißkameraden, die oberhalb der Baumgrenze ihr Hefeweizen schlürfen und deftigen Schweinsbraten mit Knödeln verdrücken? Noch schnell ein Gruppenbild vor der grandiosen Bergkulisse und dann ab in die Gondel talwärts.