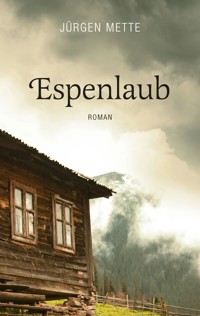Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In den Allgäuer Alpen wird die Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Für Hauptkommissar Bachhuber, der mit dem Fall betraut wird, und seine Kollegin Maria Sonnlaitner scheint der Fall bald klar zu sein. Doch dann beginnt eine Reise voller Überraschungen in das Umfeld und die Vergangenheit des Opfers. Dabei lernen die Kommissare eine christliche Glaubensgemeinschaft kennen, die ihre Mitglieder in sektiererischer Endzeitpanik systematisch manipuliert und geistlich missbraucht. Durch die Tragödie geraten bei allen Beteiligten die Grundfesten ihrer Glaubensüberzeugungen ins Wanken. Für einige ist dies der Beginn einer heilsamen Entwicklung. Sie werden überrascht von der befreienden Kraft der Gnade ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jürgen Mette ist Theologe und war bis 2013 geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien. Aufgrund seiner Parkinsonerkrankung gab er diese Position ab. Er hatte einen Lehrauftrag an der Evangelischen Hochschule Tabor und engagiert sich in den Führungsgremien der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor, des Bibellesebunds und bei Willow Creek Deutschland; außerdem gehört er zum Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz.
Jürgen Mette ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Söhnen.
Inhalt
1 Oberstdorf, Oberallgäu
2 Lugenalpe, Oytal, Oberstdorf
3 Gerichtsmedizin München, Obermaiselstein, Kempten
4 Jahre zuvor, Highland Park, Illinois (USA)
5 Hotel Himmelsblick, Oberstdorf
6 Feldberg-Klinik, Taunus
7 Haßloch, Pfalz
8 Hunspach, Elsass, Frankreich
9 Feldberg-Klinik, Taunus
10 Kempten, Allgäu
11 Neustadt an der Weinstraße
12 Hunspach, Elsass
13 Neustadt und Elsass
14 Feldberg-Klinik, Taunus
15 Hunspach, Elsass
16 Neustadt
17 Kempten
18 Calvi, Korsika
19 Hotel Himmelsblick, Oberstdorf
20 Kempten
21 Livorno, Italien
22 Luzern, Schweiz
23 Kempten
24 Pfalz
25 JVA, Kempten
26 Monate später, Haßloch
27 Vier Wochen später, JVA Frankenthal
28 Haßloch
29 Altenheim, Ludwigshafen
30 Oberstdorf
Epilog
Dank
1
Oberstdorf,Oberallgäu
Bachhuber hatte schon viele Tote gesehen, aber dieses Mal würgte ihm der Brechreiz die halb verdauten fetten Bratkartoffeln des Abendessens die Kehle hoch, als müsse er gleich Bröckchen husten. 30 Jahre machte er diesen Job schon, aber dieses grauenhafte Bild fraß sich in seinem abgebrühten Hirn fest und es würde ihn nie wieder verlassen.
Kurz nach den heute-Nachrichten im Zweiten war der Anruf von der Kripo Kempten bei ihm eingegangen. Gerade als er durch die Programme zappen wollte, reichte ihm Hilde das Mobiltelefon, das leise vibrierend quer über den Esszimmertisch krabbelte. Sie hatte sich auf einen gemütlichen Abend mit Alois gefreut, ein Bayrisch-Hell von seiner Lieblingsbrauerei Zötler aus Rettenberg eingeschüttet und ein paar Käsewürfel von der Sennerei Schlappold-Alpe auf das Tischchen zwischen den beiden Fernsehsesseln gestellt. Aber daraus sollte nichts werden.
Nichts Neues für Hilde, schließlich war sie 30 Jahre mit einem Polizeibeamten verheiratet, Oberkommissar Alois Bachhuber von der Kripo Kempten, wohnhaft in Oberstdorf. Ein Bär von einem Mann und trotzdem eine Seele von Mensch. Gut, er kämpfte seit der Hochzeit mit seinem Gewicht, aber solch ein Mannsbild musste ja auch standfest sein.
Die Allgäuer Küche war nun mal weniger vegan, eher hochkalorisch und ganz schön fleischlich. Krautkrapfen und Schupfnudeln, Kässpatzen und Nonnafürzle. Alois pflegte öfters zu sagen, er habe eben ein erweitertes „Speck-drum“. Hilde konnte über diesen Spruch nicht mehr lachen, sorgte sie sich doch so sehr um Leib und Leben ihres geliebten „Liese“, wie sie ihn im Oberstdorfer Dialekt zärtlich nannte.
Beim letzten Arztbesuch hatte man erhöhte Zuckerwerte festgestellt und ihm zur Ernährungsumstellung geraten. Aber das war schwer – bei solch einem aufregenden Lebensstil. Seit er das seinem Nachbarn erzählt hatte, einem drahtigen Veganer, zog der ihn immer mit dem Spruch „Diabetes ist kein Zuckerschlecken“ auf. Er konnte es schon nicht mehr hören.
Und er war stolz auf sein „Oberschtdorf“. Die Bachhubers gehörten zum Oberstdorfer Urgestein, seit Generation dort zu Hause, wo andere Urlaub machen. Wann immer er über Kempten hinaus Richtung Lindau, Ulm oder München musste, fühlte er sich wie amputiert. Am schönsten war dann immer die Rückreise vom Norden kommend in den südlichsten Zipfel Deutschlands – dann schwelgte er in heimatlichen Gefühlen. Wenn er hinter Sonthofen den letzten Hügel vor dem imposanten Talkessel überwunden hatte, wo links das Rubihorn und das Nebelhorn mächtig aufragen und wo rechts der Weg in die südlichste und schönste Sackgasse Deutschlands – das Kleinwalsertal – führt und geradeaus der Himmelschrofen das Trettachtal und das Stillachtal trennt, dann wurde ihm immer warm ums Herz.
Dabei waren es gar nicht die Berge, die wilden Schluchten und das immer schäumende Illerdelta, die ihm Heimatgefühle bescherten, auch nicht das scheppernde Kuhglockeninferno beim Alpabtrieb und der sich daraus ergebende spinatartige Kuhfladenparcours. Das war ja alles vertraut und alltäglich. Es waren vor allem die Menschen, mit denen er in Oberstdorf aufgewachsen war: der wettergegerbte, knorrige, maximal gesichtsbehaarte und schier unverständlich kommunizierende Älpler – wenn er denn überhaupt mit anderen redet –, der Oberallgäuer schlechthin. Menschen, auf die man sich immer verlassen konnte.
Das Nebelhorn liegt oft im Nebelbett, wen wunderts? Oberstdorf ist ein Feuchtgebiet, 1650 Millimeter Jahresniederschlagsmenge. Zieht man den Niederschlag ab, der als feinster Pulverschnee die Skisaison aufs Lieblichste verzuckert, dann hat Oberstdorf schon wieder einen Hauch von Toskana.
Bachhuber hatte im Oberallgäu noch nie „schlechtes“ Wetter erlebt, weil er immer mit der richtigen Kleidung unterwegs war. Es gab hier kein schlechtes Wetter, sondern bestenfalls nörgelnde Urlauber, die doch besser zum Massentoast auf die Kanaren geflogen wären. Und weil diese schroffe Bergwelt von einem zuweilen schroffen Wetter saftig gesegnet wird, braucht der Gast und der Einheimische zwei Dinge, um glücklich zu sein: stets eine wasserdichte Außenhaut auf dem Leib und ein wasserdichtes Zuhause. Nirgends war es schöner als bei Hilde. Sie verstand es immer wieder, ihm und den Kindern ein heimeliges Zuhause zu bereiten.
„Tote Frau im Oytal gefunden!“ Das war es dann mit dem gemütlichen Abend. Die Oberstdorfer Bergwacht war von einem Hüttenwirt informiert worden und die alarmierte die Oberstdorfer Polizeiinspektion. Nach der Begutachtung des Tatortes und der Leiche wiederum schalteten die Beamten das K1 von der Kripo Kempten ein.
Wenige Minuten später saß Bachhuber im X3 aus der bayerischen Autoschmiede, die Bergstiefel noch nicht fertig geschnürt, den grünen Lodenjanker flüchtig übergeworfen, die Dienstwaffe in das Schulterhalfter geschoben, die Taschenlampe griffbereit auf dem Beifahrersitz. Sein Assistent, der Brutscher Sepp, hätte eigentlich Bereitschaft gehabt, aber der war mal wieder nicht zu erreichen. Bachhuber fluchte still vor sich hin, weil auf den Sepp kein Verlass war. Wahrscheinlich hockte der wieder im Faltenbachstüble und hört sein Handy nicht. Er funkte die Kollegen in Kempten an und lotste sie ins Oytal. Der Notruf war vom Wirt der Unteren Gutenalpe gekommen, einer nur im Sommer bewirtschafteten Hütte im Hochtal auf 1100 Meter.
Als Bachhuber die Steigung an der Schattenberg-Sprungschanze mit heulendem Motor hochjagte, fiel sein Blick rechts auf das beleuchtete Oberstdorf. Im Hintergrund das Söllereck und dahinter der Hohe Ifen mit seinem markanten schräg liegenden Grat. In der nebligen Dämmerung des Septemberabends überholte er auf der Höhe des Wasserhochbehälters ein paar Fußgänger, die zügigen Schrittes an dem durch Rundhölzer gesicherten Abhang hochliefen. Jeder hatte ein Buch unter dem Arm. Zwei trugen Gitarren auf dem Buckel. Wo wollen die denn noch hin, fragte sich Bachhuber. Zur Märchenstunde? Aber er hatte die Kemptener Kollegen am Telefon, die gerade zwischen Fischen und Langenwang waren, darum dachte er nicht weiter über die kleine Wandergruppe nach. „Schicked uib!“, keuchte er ins Telefon, was so viel wie „Beeilt euch!“ hieß.
Dieser Streckenabschnitt war für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Gäste des Hotels „Himmelsblick“ brauchten zur Anreise eine Sondergenehmigung. Dort waren gerade noch ein paar Autos mit heimischen Kennzeichen vorgefahren, obwohl der Gästeparkplatz schon ziemlich voll war. Von der Geiger Maria, einer Freundin seiner Frau, die im „Himmelsblick“ putzte, wusste er, dass dort abends öfters fromme Veranstaltungen abgehalten wurden. Keine Messe wie in der Kirche – „Bibelstunden“ nannten sie das. Vielleicht war die kleine Wandergruppe am Kühberg auf dem Weg zu solch einer Bibelstunde. Er hatte keine Ahnung, was es mit den Bibelstunden auf sich hatte. Bachhuber war katholisch, wie fast jeder Oberstdorfer. Die evangelischen Zugereisten waren ihm egal; das waren für ihn fast schon Sektierer. Sein System Kirche funktionierte seit Menschengedenken verblüffend simpel: Leben und leben lassen, beichten und beten lassen, und dann das Ganze von vorn.
Alois war mal in der bigBOX in Kempten in einer Vorstellung des rheinischen Kabarettisten Jürgen Becker gewesen. Der hatte ein Lied drauf, das ihm richtig gut gefiel:
„Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch binDie haben doch nix anderes als Arbeiten im SinnAls Katholik, da kannste pfuschen, dat eine ist gewissAm Samstag gehste beichten und fott ist der janze Driss.“
Das war seine Religion.
Und im Übrigen war er der Meinung, dass der Pfarrer für die Bibel zuständig ist. Er hatte ein Prachtexemplar von Bibel zu Hause, mit Goldschnitt und geprägtem weinroten Ledereinband. Er schonte diese Kostbarkeit, die in der Vitrine neben den Bildbänden und den Kochbüchern vom Schuhbeck ihren Stammplatz hatte. Er hatte sie seit seiner Kommunion nicht mehr in der Hand gehabt. Die Geschichten da drin sagten ihm nichts. Ja, von Adam und Eva hatte er natürlich gehört und von der Arche Noah und dem Turmbau zu Babel, aber dann wurde es schon dünner mit der Bibelkenntnis. Sein Gottesdienst war nämlich die Jagd, der Hochwald, die Pirsch draußen in Spielmannsau. Da spürte er die Nähe des Schöpfers.
Als seine Mutter vor ein paar Monaten hochbetagt gestorben war, hatte er sich unter Hildes Drängen am Sonntag nach der Beerdigung wieder in die Kirch begeben. Die Messe, die feierliche Musik und die Eucharistie, das gefiel ihm schon, aber die Predigt sagte ihm nichts, gar nichts. Sein Onkel, Bruder seiner Mutter, war Priester und Missionar in Indien, aber zu dem hatte er keinen Kontakt mehr. Den hätte er gern mal gefragt, warum die Kirche so reich war und warum sich der Bischof von Limburg solch ein Luxusbad leisten durfte. Alois hatte eine sehr klare Vorstellung von Kirche. Die sollten den Menschen Gutes tun und sich sonst raushalten aus Politik und Gesellschaft.
Hilde war da schon zugänglicher. Sie schaute regelmäßig die frommen Sender K-TV und Bibel-TV. Diesen betagten Fernsehpriester auf K-TV verstand man schlecht, aber der war wenigstens katholisch. Aber diese Joyce Meyer, die seine Frau so gerne guckte, die war ihm nicht ganz geheuer. Katholisch ist die nicht, da war er sich ganz sicher. Diese amerikanische „Du-darfst-du-selbst-sein-Betschwester“ ging ihm derart auf den Senkel, dass er neulich mal ein erzürntes „Diese fromme Emanze macht dich noch ganz verrückt!“ raushaute. Aber Hilde sagte dann immer milde: „Liese, des verschtohscht du id! Dia Mäsittsch büt mi üf!1“ „Was? Was fir a Mäsittsch?“ Das war dann für Alois das Signal, im Keller in seiner Werkstatt zu verschwinden oder auf dem Küchensofa schon mal ein wenig vorzuschlafen. Nach den frommen Sendungen war mit Hilde nicht mehr viel los – im Bett. Sie hatte danach immer Gesprächsbedarf, Alois nicht. Er war für Hildes tausend Fragen ein denkbar ungeeigneter Gesprächspartner. Bei den Themen Religion, Gott, Glaube, Kirche, Jesus und Maria fühlte sich Alois wie Zahnpasta in der Tube: Er wusste nicht richtig, wie er sich ausdrücken sollte.
Es war ein trockener und noch recht warmer Septemberabend. Tagsüber war diese Strecke von den „Gäschten“ hoch frequentiert, aber sobald es dunkel wurde, legte sich die Stille wie ein Tuch über alles, was sich bewegte. Die Dunkelheit des Oytals umfing ihn. Rechts leuchteten noch ein paar Fenster der letzten Häuser, dann ging es die schmale asphaltierte und von den Hufbeschlägen der Kutschpferde gestanzte Straße weiter. Links die Abhänge des Schattenberges, rechts tief unten der schäumende Oybach, der vom Überlauf des 500 Meter höher gelegenen Seealpsees und vom Stuibenfall am Ende des Oytals gespeist wurde und beim Jagerstand in die Trettach mündete. Alois kannte das Oytal von seiner Kindheit an. Sein Vater hatte ihn immer wieder auf das Bachbett hingewiesen, das mal unter wildem Wasser stand, dann wieder trocken lag, weil das Wasser in unterirdischen natürlichen Kavernen weiterfloss, um dann plötzlich wieder schäumend im Bachbett aufzutauchen. Als Kind war das alles geheimnisumwittert; heute achteten die Einheimischen gar nicht mehr darauf.
Die Viehgatter waren alle geöffnet, sodass Bachhuber zehn Minuten später am Gasthof Oytal vorbeifuhr. Der Gastwirt und seine Frau standen an der Straße vor den Pferdeställen und schauten Bachhuber im Geländewagen besorgt nach. Vor ihm rumpelte der Rettungswagen der Bergwacht mit Blaulicht über die jetzt nur noch grob geschotterte Piste. Das Martinshorn hatten sie schon am Hotel Himmelsblick abgestellt. Bachhuber liebte es unauffällig. Wenn es beim ARD-Krimi „Tatort“ überzogen turbulent wurde – mit wilden Verfolgungsjagden und anderen Kino-Effekten, dann pflegte er das mit einem vernichtenden „So a Schmarre“ zu kommentieren.
In der Gaststube der Gutenalpe saß ein Jagdhelfer mit aschfahlem Gesicht, den speckigen verschwitzten Hut in den Nacken geschoben, in der Hand eine Schnapsflasche, aus der er – zitternd am ganzen Leibe – immer wieder einen Schluck nahm. Er verströmte eine typische Hüttenduftnote aus Kuhmist an den Füßen, frisch gemähtem Grünfutter im frühen Reifestadium zur Silage und Schnaps sowie Tabak. Er war so mager und dürre, dass der Hüttenwirt ihn immer hochnahm. „Der muss wahrscheinlich beim Duschen von Strahl zu Strahl hüpfen, um überhaupt nass zu werden.“ Falls er überhaupt zu duschen pflegte. Insofern waren seine Körperausdünstungen einigermaßen erklärlich.
Dem Hüttenwirt stand blankes Entsetzen ins unrasierte Gesicht geschrieben. Er stammelte immer wieder ein verzweifeltes „Herrgottsakradi“ vor sich hin, gar nicht im Sinne eines Gebets, sondern als Ausdruck des Schreckens. Er war mit dem Radl zurück bis zum Gasthaus Oytal gefahren und hatte von dort über das Festnetz die Bergwacht informiert, weil hinten im Tal keine stabile Funkfrequenz fürs Handy zu finden war. Die Bergwacht, weil er glaubte, es handele sich um das Opfer eines Bergsturzes. Der Gleitweg von der Nebelhorn-Mittelstation über den Seealpsee hinunter ins Oytal war nur für erfahrene Bergsteiger freigegeben, aber es passierte immer wieder, dass so verrückte Flipflop-Alpinisten von der Bergwacht aus dieser Wand geholt werden mussten, besonders wenn die Wasserfälle viel Wasser führten.
Bachhuber wurde von zwei Beamten der Oberstdorfer Polizeiinspektion hinausbegleitet. Sie fuhren zweihundert Meter talwärts und stiegen aus. Im Strahl der Taschenlampe hasteten sie dann rechts dreißig Meter leicht bergauf, wo der Jagdhelfer beim Reparieren einer Futterkrippe auf den grausigen Fund gestoßen war. Die Oberstdorfer Kollegen, die zuerst vor Ort waren, hatten den Fundort mit Akkuleuchten markiert. Bachhuber würgte wieder. Ein morbid-süßlich-stechender Geruch kroch in seine Nase. Was immer er gleich zu Gesicht bekommen würde, es musste grässlich sein. Die Leiche musste schon ein paar Tage dort gelegen haben. In der prallen Herbstsonne. Hinter ihm und den Bergwachtleuten tauchte der geländegängige VW-Bus der „Spusi“ aus Kempten auf, die die Koffer zur Spurensicherung dabeihatten. Inzwischen hatte leichter Nieselregen eingesetzt. Schlecht für die Suche nach Schuhabdrücken, dachte Alois Bachhuber und schnauzte den Hüttenwirt an, er solle nicht alles platttrampeln.
Unter den rhabarberähnlichen Blättern des dichten Hangbewuchses schauten zwei bleiche Beine hervor, die in leichten Balerinas steckten. Kleine Füße, blanke Beine, offensichtlich eine jüngere Frau, die auf dem Bauch in der feuchten Erde lag. Die nackten Beine waren vom Steinadler oder Habicht angefressen. Einer der abgebrühten Typen von der Spusi meinte, dass sicher ein Fuchs zugepackt habe. Etwas pietätlos fügte er grinsend hinzu: „Der Fuchs hat doch für abgelaufene Fleischgerichte immer noch die beste Nase!“ Allerhand Ungeziefer und Gewürm war heftig unterwegs. Der mittlere Teil des schlanken Körpers war von den Knien bis zur Brust unter den Blättern verborgen, nur die Schulter und der Hinterkopf lagen frei. Die dunklen Haare der Frau waren zu einem Knoten zusammengebunden, in dem es jetzt von Ameisen nur so wimmelte. Die Schultern waren frei, die Träger der Unterwäsche schnitten in den von der Sonne verbrannten Rücken. Bachhuber hatte schon ein paar Bilder geschossen, bevor die Spurenspezialisten die Leiche und die Umgebung professionell dokumentierten.
Einer der Spurensucher drehte nach ausführlicher Fotosession die Leiche vorsichtig um. Es war so, als hätte sich der Körper am Boden festgesaugt. Das Ungeziefer lief auseinander. Die Frau musste um die Mitte bis Ende 20 gewesen sein. Das nun verdreckte leichte Sommerkleid war dunkelgrün, schulterfrei, kein Schmuck, nur eine billige Uhr. Auf keinen Fall ein Wander-Outfit, eher was zum Bummeln in der Ladenpassage des beliebten Urlaubsortes. Die Frau war vermutlich nicht zum Wandern im Oytal, sie musste hierhergetrieben worden sein. Das Kleid war im Brustbereich in Richtung Gürtel aufgerissen und bis über die Knie hochgerutscht, so als hätte sich der Körper ein wenig talwärts bewegt, nachdem er dort zum Liegen gekommen war.
Bachhuber sinnierte vor sich hin. Hatte man die Leiche der Frau dort abgelegt, sodass es wie ein Absturz von der Gleitwand aussehen sollte? Dann würde der Körper dort nicht so geordnet am Hang liegen. Wurde sie irgendwo umgebracht und tot dorthin geschleift? Er zwang sich, das Gesicht der Leiche auszublenden, es erst gar nicht in seinem Hirn zu speichern, aber der Anblick schockierte ihn dennoch. Er hatte mal zwei Wasserleichen aus dem Freibergsee hoch über der Stillach gesehen, ganz in der Nähe der Skiflugschanze, das war grausig. Aber dieses Gesicht war von den Maden, vielleicht auch vom Fuchs oder von anderen kleinen Raubtieren so verunstaltet worden, dass sich alle Beteiligten abwenden mussten. Einer der Kemptener Spezialisten murmelte was von „drei bis vier Tage in der Sonne gelegen“ in seinen Bart. Bachhuber konnte oberflächlich keine Spur von äußerer Gewalteinwirkung erkennen. Ein kleiner Wanderrucksack lag neben der Leiche. Die Spurensicherung beförderte das Ding vorsichtig in einen Kunststoffbeutel.
Kurz bevor Bachhuber den Befund in seine Stenorette diktierte, sah er aus der netzartigen Seitentasche des Rucksacks ein Kärtchen rausschauen, ein bedrucktes Stück weißen Karton im Format einer Visitenkarte oder etwas größer. Er wollte die Sicherung dieser Karte der Gerichtsmedizin in München überlassen, darum gab er der Spurensicherung den Hinweis auf dieses Detail, das womöglich Aufschluss über die Identität der Frauenleiche geben könnte.
Bachhuber gab noch ein paar Anweisungen zur Bergung der Leiche, als ihm plötzlich schwindlig wurde und er vornübergebeugt dem Brechreiz nachgab. Das halb verdaute Abendessen schoss ihm bitter aus dem Rachen, er konnte gerade noch den stinkenden Schwall ins Abseits hinter eine knorrige Fichte lenken. Einer der Oberstdorfer Kollegen lästerte rum und amüsierte sich über Bachhubers Missgeschick, aber der schaute ihn nur verächtlich an, ohne auf die Provokation einzugehen. Er stieg hinab zur Hütte und suchte den besoffenen Jagdhelfer, der inzwischen unter dem Tisch lag. Der Hüttenwirt meinte, dass aus dem Mann heute nichts Zweckdienliches mehr rauszuholen sei.
Inzwischen war tatsächlich der Brutscher Sepp mit seinem Quad angekommen. Bachhuber hasste diese dröhnenden Vehikel. Die gehörten verboten. In seiner Nachbarschaft wohnte so ein junger Bursche, der die Angewohnheit hatte, das knatternde Gefährt kurz vor der Garage noch einmal richtig hochzureißen. Dann brüllte die Maschine immer auf, aber der Fahrer schien das Vibrieren dieses Bocks und das Ohren-Inferno zu genießen. Er ließ sich nicht kritisieren, im Gegenteil: Er bestand auf seinem Recht der freien Bestimmung über die Handhabung seines Vehikels. Der Motor sei eben nun mal so laut ausgelegt.
Mit schuldbewusstem Blick trat Polizeiobermeister Brutscher seinem Chef unter die Augen, aber der begrüßte ihn nur kurz und bündig, bevor er sich wieder dem Hüttenwirt zuwendete. Der sollte ihm haarklein erzählen, wie der Jagdhelfer die Leiche gefunden hatte. Aber das war schnell berichtet. Der Jagdhelfer sollte am nächsten Tag mit nüchternem Kopf verhört werden. Brutscher übernahm die Aufsicht der Bergung der Leiche.
Als alles aufgenommen war, machte sich Bachhuber auf den Heimweg. Er war müde und ausgelaugt. Als Oberstdorf in Sichtweite kam, zeigte sein Handy das Netz an, sodass er seinem Vorgesetzten von der Polizeiinspektion Kempten Bericht erstatten konnte. Ein junger Polizeimeister rief 30 Hotels und Pensionen an, um festzustellen, ob irgendwer vermisst wurde. Aber bald war klar, dass nirgends eine Vermisstenmeldung eingegangen war. Bachhuber erschien um 22 Uhr zur eilig einberufenen Pressekonferenz in Oberstdorf und beschrieb die Leiche, freilich ohne ein Bild zu zeigen. Es waren nur ein Lokalreporter aus Sonthofen und ein freier Schreiberling aus Immenstadt da. Morgen sollte ein Phantombild im Allgäuer Anzeigenblatt, der Allgäuer Zeitung und Memminger Zeitung veröffentlicht werden.
Um Mitternacht fiel Bachhuber nach einem flüchtigen Duschbad ins gemachte Bett. Wenn Hilde wach gewesen wäre, hätte sie ihm ein gründliches Wannenbad verordnet, zumal er ziemlich durchgefroren war. Seine Gemahlin murmelte schlaftrunken vor sich hin und schnarchte weiter. Er kroch unter ihre Decke, um sich zu wärmen. „Meine Wärmflasche mit zwei Ohren“, nannte er sie scherzhaft. Nie und nimmer würde er wegen ihrer Schnarchphasen in ein anderes Zimmer ziehen. Es sei denn, sie bekäme eines Tages eine Atemmaske verordnet. Ihm war seine Schwiegermutter vor Jahren nachts auf dem Flur mit solch einer Maske begegnet, an der der Verbindungsschlauch zum Kompressor wie ein Elefantenrüssel hing. Der Schrecken war groß, als wäre es die Begegnung mit einem Außerirdischen gewesen. Aber immerhin hatte dieses Gerät der Oma 15 weitere Lebensjahre beschert. Zwölf hätten auch gereicht, frotzelte er manchmal, aber Hilde wusste mit der sarkastischen Neigung ihres Gemahls umzugehen. Als die Oma pflegebedürftig wurde, war es Alois, der dafür sorgte, dass die Omi nach Oberstdorf geholt wurde. Manchmal beschlich ihn ein peinigender Gedanke: Wer würde sich um ihn und Hilde kümmern, wenn die Demenz sich still und heimlich ins Leben schlich und sich die Brille morgens im Kühlschrank und die Wurstsemmel im Kleiderschrank finden sollte …
Nach kurzer schlafloser Phase rollte sich Bachhuber wieder aus den Kissen und schlich nach unten an den immer noch warmen Kachelofen, den Hilde in Erwartung des gemütlichen Abends angefeuert hatte. Es wurde doch abends schon etwas kühler. Er rief in München an und meldete seinen Besuch in der Gerichtsmedizin. Um zehn wollte er schon dort sein. Kurz bevor er sich wieder hinlegen wollte, fiel ihm wieder die kleine Wandergruppe ein, die wohl unterwegs zum Hotel Himmelsblick gewesen war. Sein Tablet-PC war griffbereit. Nach kurzer Internetrecherche fand er die Webseite des Hauses. Tolle Präsentation, Veranstaltungen, Themen, Referenten, Musik. Das würde er sich mal anschauen. Vielleicht. Aber nur wenn Hilde mitgehen würde. Religiöse Themen machten ihn furchtbar unsicher und religiöse Leute brachten ihn ziemlich in Verlegenheit.
Es war bereits nach eins, als der Oberkommissar in einen kurzen unruhigen Schlaf abglitt. Das Bild des angefressenen aufgedunsenen Gesichts der Leiche brannte sich wie ein Standbild auf die Festplatte in seinem Gehirn ein. Wer war diese Frau?
1 Diese Botschaft baut mich auf.
2
Lugenalpe, Oytal,Oberstdorf
Die Feuchtigkeit des kühlen Waldbodens war ihm durch die Hose und das Hemd gedrungen und hatte für ein frühzeitiges Ende des Schlafs gesorgt. Es musste so gegen drei Uhr in der Frühe sein, als er zitternd zu sich kam. Auf halber Höhe des Aufstieges zum Hahnenköpfle war er völlig erschöpft zusammengesackt und auf der Stelle eingeschlafen. Fahles Mondlicht drang durch die dichten Wipfel der Bergfichten. Mit steifen Gliedern und klebenden Klamotten auf dem verspannten Leib, der von Ameisen übersät war, krabbelte er zur Viehtränke an der Lugenalpe oberhalb des Oytalhauses. Mit bleiernen Gliedern warf er sich ein paar Hände voll eiskalten Wassers ins Gesicht, das ihm durch die Ärmel rann und den verschwitzten und zugleich doch unterkühlten Leib ein wenig erfrischte. Er tastete nach dem Rucksack und fand einen Kanten Brot und einen Schluck kalten Kaffee in der Feldflasche. Drei Tage ohne Toilette bedeutet, sich immer wieder ins hohe Gras zu hocken. Er hasste dieses primitive Provisorium. Zwischendurch hatte er in der eiskalten Viehtränke ein kurzes Bad genommen. Der Heustadel war nicht abgeschlossen, sodass er dort einigermaßen geschützt ruhen konnte.
Wie war er hierhergekommen? Wie betäubt musste er seine Gedanken sortieren, die sich langsam zu einem Horrorfilm formierten.
Er hatte alles mit dem Fernglas beobachtet. Wie der Jagdgehilfe am Wildfütterungsstand rumhämmerte und plötzlich einen gellenden Schrei ausgestoßen hatte und in Richtung Gutenalpe getorkelt war. Diesen Abschnitt konnte er allerdings nicht mehr einsehen. Dann hatte er den Hüttenwirt gesehen, wie er mit dem Rad – wie von Hunden verfolgt – zum Oytalhaus tief unter ihm gefahren war. Es hatte keine 20 Minuten gedauert, als zuerst die Bergwacht und dann ein ziviler X3 mit Blaulicht Richtung Gutenalpe gerast war. Dann die Beamten in weißen Schutzanzügen, die Beleuchtung, das gedämpfte Stimmengewirr und zuletzt das Quad, das mit lautem Knattergeräusch durch den Talkessel gebrettert war.
Zwei Stunden später war alles vorbei gewesen. Die Nacht hatte die schrecklichen Bilder aufgesaugt und ihm ein paar Stunden Schlaf geschenkt.
Er hatte drei Tage und drei Nächte hier oben zugebracht. Totenwache auf Distanz. Der Viehstall auf der Lugenalpe war schon winterfertig, sodass es höchst unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn der Bauer noch einmal hier hoch gekommen wäre. Hier war er sicher. Die Wanderroute zum Hahnenköpfle verlief 300 Meter talwärts.
In seinem Inneren tobte es heftig. Er war Zeuge eines furchtbaren Ereignisses geworden, das tonnenschwer auf seinem Gemüt lastete. Er hatte in Rufweite die Eskalation miterlebt. Er hatte Schreie und Stimmen gehört, aber die direkte Auseinandersetzung konnte er nicht beobachten. Und er war nicht dazwischengegangen. Er war schlicht und einfach abgehauen, war eine Stunde zur Lugenalpe aufgestiegen, um sich dort einen Platz zu suchen, von wo aus er das weitere Geschehen beobachten wollte. Nein, es war nicht Feigheit, die ihn in die unerklärbare Passivität geritten hatte. Es war die Ohnmacht, die schockierende Einsicht, wer da auf einmal aufeinandergetroffen war. Er war so befangen, dass er sich wie in einer Schockstarre befand. Seit diesem Augenblick fühlte er sich selbst wie ein Mörder. Er war völlig unbeteiligt, aber er war Zeuge. Der einzige! Und er kannte den Täter. Und er kannte das Opfer. Er wusste alles. Mit diesem Geheimnis hatte er drei Tage hier oben gelegen und sehnsüchtig darauf gehofft, dass irgendwer auf die Leiche stoßen würde. Er wusste, dass er sich strafbar machte, wenn er sein Wissen für sich behalten würde. Aber niemals würde er dieses Geheimnis preisgeben können. Mit diesem Sprengsatz im sensiblen Gewissen musste er irgendwann wahnsinnig werden. Es gärte und brodelte in seiner Brust, als wollte sein gequältes Herz die erdrückende Last durch die Rippen drücken.
In seinem geplagten Hirn lief der Film seines Lebens nonstop rückwärts. Die letzten drei Tage waren die Hölle gewesen. Die Hölle kann kein Ort sein, kein Raum im Nirgendwo des Universums, davon war er fest überzeugt. Wer so im Trommelfeuer quälender Selbstvorwürfe gelebt hat, der kann über die naive Vorstellung von der Hölle als eine überdimensionale Sauna – nur siebenmal heißer –, oder als ein ewig befeuerter Grill, nur bitter lachen. Die Hölle muss ein Zustand sein, ein Inferno der Selbstzerfleischung. Hölle ist kein Ort. Orte sind berechenbar und erklärbar. Hölle ist zeitlos, raumlos, ausweglos, hoffnungslos, gnadenlos, gottlos: schweigen, absolute Finsternis, ultimative Gottesferne. No exit! Hölle ist die totale Abwesenheit von Gnade. Hölle lodert nicht in der Tiefe des Erdinneren, die Hölle ist unter uns – „among us“. Nicht vertikal unter uns, sondern horizontal, neben uns, zwischen uns, hinter uns, vor uns. Und sie hat durchgehend geöffnet. Diese Hölle hatte er hinter sich gebracht. Noch schlimmer ging es eigentlich nicht mehr.
„Herr, erbarme dich meiner, Christus, erbarme dich!“, so hatte er stundenlang vor sich hin gestammelt. Als die Stimme in der heiseren Kehle verstummt war, formten seine Lippen lautlos dieses verzweifelte Gebet weiter. „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz …!“ Das Lied aus seiner Kindheit huschte ihm durch sein verseuchtes und verstricktes Gemüt. Ein reines Herz? Nie wieder würde sein Herz rein sein. Der Gott, den er seit seiner Kindheit geliebt und verehrt hatte, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater des Herrn Jesus Christus, dem er sein ganzes Leben geweiht hatte, der war nicht mehr fassbar für ihn. Alles was er gelernt und geglaubt hatte, was er von seinen Eltern übernommen hatte und was er seinen Kindern weitergeben wollte, das löste sich jetzt im brennenden Schmerz seiner geplagten Seele in nichts auf. Er würde nie heiraten, nie Kinder haben. Sein erstarrtes Schweigen in dem Augenblick, wo er hätte beherzt dazwischengehen müssen, hatte ihn zum Mittäter gemacht. Mitwisser zu sein, war schon eine erdrückende Last, aber Mittäter zu sein, den Tod nicht verhindert zu haben, das würde ihn nie wieder loslassen. Der Frieden, den sein Leben bis dahin geprägt hatte, war für immer verschwunden. Von nun an würde er auf der Flucht sein, auf einer panischen Hatz, immer die bellende Meute seiner Verfolger im Genick. Er spürte den stechenden Atem Satans, der ihn bis an sein Lebensende hetzen würde. Wenn er nicht bezeugen würde, was er gesehen und gehört hat, würde der Täter frei rumlaufen und womöglich ein Unschuldiger verdächtigt.
Bei diesem Gedanke zuckte er selbst wie vom Blitz getroffen zusammen. Man könnte ja ihn selbst verdächtigen. Die Spur führte 30 Meter vom Tatort entfernt direkt hier hoch zu seinem Wachtposten. Diese Einsicht schürte seine brennende Verzweiflung noch mehr. Er musste sofort hier weg oder er musste sich stellen.
„Noch ist Gnadenzeit“, hatte sein Großvater immer gesagt. Noch ist Zeit zur Umkehr. Noch könnte er aus der Finsternis ans Licht treten, Gnade erleben, Amnestie zugesprochen bekommen. Er bräuchte nur 400 Meter hinuntersteigen und sich dem Gastwirt vom Oytalhaus oder einem frühen Wanderer auf dem Weg zum Älpelesattel offenbaren. „Ich bin der Zeuge! Ich kenne den Täter und ich kenne das Opfer.“ Das würde der erste Schritt ins Licht sein, das Ende der Finsternis, der Sieg der Wahrheit, der Triumph der Gerechtigkeit.
In zwei Stunden würden die ersten Polizeitrupps ins Tal kommen und den ganzen Talkessel bis hoch zur Käseralpe oberhalb des Stuibenfalls absuchen. Und sie würden Hunde dabeihaben. Und sie würden Hubschrauber schicken. Und sie würden ihn vielleicht finden, wenn er jetzt nicht abhaute.
Für einen Augenblick wirkte der Gedanke erlösend und befreiend. Ach, würden sie mich bloß finden …
Er raffte in quälender Verzweiflung seine Habseligkeiten zusammen. Es war drei Uhr, als er sich im Schein seiner Stirnlampe aufmachte, über das Hahnenköpfle hinweg runter durch den wilden Steilhang in Richtung Gerstruben. Der Weg durchs Oytal wäre viel kürzer gewesen, aber er wollte nicht der Polizei in die Arme laufen. Er machte einen Umweg am Gasthof Gerstruben vorbei, der bis auf eine Hoflampe ganz im Dunkeln lag, und ging den Wanderweg hinunter, nicht den asphaltierten Weg, und überquerte die Trettach. Dann eilte er im Mondschein am Golfplatz vorbei und bog rechts ab am Moorweiher vorbei, bis er am neuen Wasserkraftwerk an der Trettachbrücke herauskam. Von dort waren es nur ein paar Meter bis zum Parkplatz an der Oybele-Festhalle, wo er seinen alten Volvo abgestellt hatte. Er war nur einem Taxi begegnet, das Wanderer zur Schwarzen Hütte brachte, der Endstation im Tal, für alle, die Hochgebirgstouren machen wollten. Von dort aus ging es nämlich hinauf zur Kemptener Hütte.
Es war gegen sechs Uhr, als er im Kreisel Richtung Sonthofen abbog und ihm drei Mannschaftswagen der Polizei entgegenkamen. Der letzte Halt auf dem „Highway to hell“, die letzte Chance für Wahrheit und Klarheit. Er bräuchte nur den Kreisverkehr zu blockieren und sich den Uniformierten zu stellen.
Aber die Angst war stärker. Angst betäubt die Vernunft, schaltet sie aus. Angst treibt in die Enge. Angst würgte seine Kehle und erstickte den Rest Lebensfreude, den er noch hatte.
Er reihte sich ein in den Morgenverkehr der neuen Schnellstraße von Sonthofen nach Kempten. In einer halben Stunde würde er schon auf der A 7 Richtung Norden sein. Mit dem unruhigen Gefühl, seine Spuren auf der Lugenalpe vielleicht doch nicht sorgfältig genug verwischt zu haben, und mit dem Vorsatz, nie wieder hierher zu kommen, verlor sich seine Spur in der Blechlawine.
So hoffte er.
Er war unterwegs in den Wahnsinn. Wie kann man mit solch einer quälenden Fracht im Gewissen jemals wieder froh werden?
Ein letzter Blick zum Grünten, dem „Wächter des Allgäus“, und schon war er auf der A 7. Beim Kreuz Hittistetten peitschte ihm eine böse Idee durch den Kopf: Einfach gegen die Fahrtrichtung unter den nächsten Lkw fahren. Dann wäre er erlöst.
3
Am nächsten Tag, Gerichtsmedizin München,Obermaiselstein, Kempten
„Haben Sie den Zettel gefunden?“
„Welchen Zettel?“, fragte die Neue in der Münchner Gerichtsmedizin.
„Na, den Zettel in der Seitentasche des Rucksacks.“ Bachhuber wirkte übernächtigt und gereizt.
Hilde war um sieben aufgestanden, um ihrem Mann einen Kaffee zu kochen. Morgens war sie ausgesprochen muffelig. In ihrem hochgeschlossenen dicken Morgenmantel sah sie wie ihre Mutter aus, dachte sich Bachhuber im Badezimmer. Hilde fror die Hälfte vom Jahr, die andere Hälfte war es ihr zu kalt. Für einen kleinen romantischen Morgenflirt war Hilde nicht zu haben. Den gab es nur in Bachhubers Fantasie. Erst Bad, dann Kaffee, dann Küsschen. Nur in dieser Reihenfolge. So war sie und so würde sie bleiben, sein geliebtes Eheweib. Hilde steckte ihm noch eine Wurstsemmel zu, als er sich auf den Weg nach München machte.