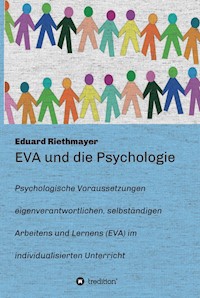
3,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Gemeinsames, längeres Lernen lässt sich nur verwirklichen, wenn die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in einem individualisierten Unterricht Beachtung finden. Für die damit notwendig Differenzierung ist das eigenverantwortliche, selbstregulierte Lernen unverzichtbar. In vielen Schulen, die sich auf den Weg machen, gemeinsames Lernen zu ermöglichen, werden pädagogische Konzepte entwickelt, die reformpädagogisch inspirierte Modelle für eigenverantwortliches Lernen als zentrale Elemente enthalten. Die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung zum "Self-Regulated-Learning" (SRL) werden dabei kaum in die Überlegungen einbezogen, weil sie selten bekannt sind. Diese Ergebnisse werden meist nur in englischsprachigen Raum publiziert. SRL hängt eng zusammen mit der Lernmotivation, den auf das Lernen bezogenen Selbstkonzepten und bestimmten Zielorientierungen. Alle diese wichtigen Faktoren werden in diesem Buch, aufeinander bezogen, dargestellt. Es gilt auch der Heterogenität der Schülerinnen und Schülern, in ihren individuellen Voraussetzungen, für das "wie" ihres Lernens Wertschätzung und Beachtung entgegen zu bringen. Sie müssen bei dieser Frage und ebenso bei der Frage nach dem "was", nach der mit welcher Bearbeitungstiefe und dem "wann" ihres Lernens mitgenommen werden. Wenn Schule für die Informations- und Wissensgesellschaft zukunftsfähig gemacht werden soll, kann dies nicht unter Negierung wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Eduard Riethmayer
EVA und die Psychologie
Psychologische Voraussetzungen eigenverantwortlichen, selbständigen Arbeitens
www.tredition.de
© 2015 Eduard Riethmayer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7323-5195-4 (e-Book)
Zweite erweiterte und korrigierte Auflage
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
Schülerinnen und Schüler sind verschieden
Welche Faktoren bestimmten die Schulleistung? Ist es die Intelligenz?
Faktoren, die dazu beitragen, dass ein vorhandenes Potenzial für gute schulische Leistungen auch realisiert wird.
Welche Faktoren haben für die Schulleistung mehr Gewicht? Intelligenz oder die Faktoren, die die Entfaltung des Intelligenzpotenzials erst möglich machen?
Intelligenz als bedeutsame Grundlage des schulischen Erfolgs
Intelligenz und Gehirn
Warum haben Menschen eine unterschiedliche Intelligenz und ist diese ein für alle Male festgelegt?
Menschen unterscheiden sich in ihren exekutiven Funktionen und damit in den Fähigkeiten zur Regulation ihres Verhaltens allgemein und ihrer Lernprozesse im Besonderen
Individuelles Lernen unter dem Einfluss menschlicher Entwicklung und den Faktoren der sozialen Umwelt
Entwicklung und Personwerdung – die Ausbildung individueller Merkmale als Basis bestimmter Motivationsformen und damit der Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen.
Der Prozess der Identitätsentwicklung und die Ausformung unterschiedlicher Identitätsprofile als Voraussetzung selbstregulierten Lernens.
Entwicklungsbedingte Veränderungen von Interessen und Einstellungen, die bei der Gestaltung der schulischen Lernangebote berücksichtigt werden sollten.
Eine Schlüsselfunktion für schulisches Lernen – und insbesondere für das selbstregulierte Lernen – nimmt die Motivation ein.
Was treibt Menschen zu ihrem Verhalten an uns was gibt diesem eine bestimmte Richtung?
Der Mensch als selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Wesen
Selbstbestimmungstheorie – Self-Determination Theory (SDT)
Die Self-Determination-Theory als Makrotheorie
Die fünf Subtheorien der Selbstbestimmungstheorie
Basic-Need-Theory (BNT) – die Theorie der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse
Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben („Need of Competence“)
Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung
Bedürfnis nach sozialer Eingebundheit („Need of Relatedness“)
Organismic Integration Theory (OIT) – Theorie der autonomen extrinsischen Motivation
Förderung der Autonomie im Unterricht Möglichkeiten und Grenzen
Cognitive Evaluation Theory CET (Kognitive Evaluationstheorie)
Goals Content Theory GCT – Ziel(inhalts)theorie
Causality Orientations Theory COT Die Subtheorie „Kausalitätsorientierung“
Der Zusammenhang zwischen Motivation und Lernumgebung
Das Engagement der Schülerinnen und Schüler im Unterricht
Implizite Theorien als Basis des Lernverhaltens und der individuellen Weiterentwicklung
Die Theorie der Leistungsziele („Achievement-Goal-Theory“)
Selbstgesteuertes Lernen Self-Regulated Learning (SRL)
Selbstregulierte Lernende und andere
Was ist selbstreguliertes Lernen und wie vollzieht es sich?
Unverzichtbar ist die Anwendung geeigneter Strategien beim Lernen
Die kognitiven Strategien
Die metakognitiven Strategien
Ressourcenstrategien
Strategien zur Regulation der Motivation
Der Einsatz von Strategien zur Regulation des eigenen Lernprozesses
Die Nutzung von Strategien in der richtigen Weise
Regulationsprozesse in verschiedenen Phasen selbstregulierten Lernens
Selbstreguliertes Lernen kann man lernen
Das Verfügen über bestimmte Strategien reicht nicht aus
Motivationale Überzeugungen als die wesentlichste Voraussetzung für Selbstregulation des Lernens
Flexible Organisation des Unterrichts als Antwort auf die Heterogenität in den individuellen psychischen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Literaturverzeichnis
Informationsquellen im Internet
Einführung
Die Forderung nach einer Reform des Bildungswesens begleitet uns schon seit Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Die damals eingeleiteten Veränderungen betrafen die Schulstruktur, aber auch die Ziele schulischen Lernens, sowie der angewandten Methoden. Curricula wurden entwickelt, die eine tiefgreifende Veränderung des Unterrichts bringen sollten. Rationalität bei der Planung und Effizienz waren die bestimmenden Merkmale. Wirklich verändert hat sich jedoch sehr wenig. Die Bildungskommission NRW von 1995 sieht die Ursache darin, dass „…der tiefgreifende Wandel in fast allen gesellschaftlichen Bereichen erst in den letzten Jahren in seiner Bedeutung für das Schulwesen wahrgenommen wurde.“
Im Konzept vom „Haus des Lernens“ fasste die Kommission ihre Vorschläge zusammen. Es ging dabei um ein umfassendes, verändertes Bild von Schule. Schule als Lern- und Lebensraum. Darin eingeschlossen war fachliches, aber auch soziales Lernen und die Anwendung des Gelernten. Der Schule wurde eindeutig eine Erziehungsaufgabe zugewiesen, zugleich sah man darin aber auch die größten Schwierigkeiten. Werte, die in der Gesellschaft nicht gelebt werden, kann in der Schule nur schwer Geltung verschafft werden. Trotzdem sollte es das Ziel sein, Wissensvermittlung und Persönlichkeitsbildung stärker aufeinander bezogen zu begreifen. In diesem Zusammenhang sprach man von einem „Erweiterten Lernbegriff“, ohne jedoch konkret zu beschreiben, wie Lernen und Lehren, in diesem Sinne methodisch „verändert“, erfolgen sollte.
Es ist also keinesfalls so, dass erst mit PISA die Erkenntnis wuchs, dass sich in unseren Schulen grundsätzlich etwas verändern muss. Was jedoch in der Folge dieser internationalen Vergleichsuntersuchungen geschah, war, dass nun der Veränderung des Unterrichts selbst mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Man konnte sich dabei auf die, sich seit dem Anfang der neunziger Jahre verbreitende, Auffassung von Lernen als individuell und aktiv zu vollziehenden Akt der Konstruktion von Wissen beziehen. Bei der Suche nach entsprechenden Unterrichtskonzepten wurde man in der traditionellen Reformpädagogik fündig, die auf diese Weise eine Renaissance erlebte, die bis heute anhält.
Was mit PISA ebenfalls verbunden wird, ist die Erkenntnis, dass Bildungschancen (besonders in Deutschland) sehr stark von der sozialen Herkunft abhängen. Auf dieses Problem kann man nur angemessen reagieren, wenn man die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und daraus Konsequenzen zieht. Individualisierung des Unterrichts wurde damit zu einer dominanten Forderung.
Dass diese nicht mit einer frühen Selektion in unterschiedliche schulische Bildungsgänge vereinbar ist, versteht sich von selbst. Man hatte allerdings bei den Gesamtschulversuchen, vom Ende der 60er bis in die 80er Jahre, auch mit dem „Streaming“, das ist die Aufteilung von Schülerinnen und Schülern auf Kurse mit unterschiedlichem Niveau, keine guten Erfahrungen gemacht, weil in den Kursen, in denen sich diejenigen mit bestimmten Defiziten befinden, kein förderliches Lernklima entsteht, das eine „Aufwärtsbewegung“ innerhalb des Kurssystems ermöglicht. Individualisierung lässt sich folglich nicht auf die Weise erreichen, dass Schülerinnen und Schülern in einem Fach einem anspruchsvolleren Niveaukurs und im anderen Fach einem weniger anspruchsvollen Kurs dauerhaft (beispielsweise für ein Schulhalbjahr) zugewiesen werden. Daraus ergibt sich die Forderung nach „längerem gemeinsamen Lernen“. Schülerinnen und Schüler sollen, so weit dies möglich ist, in einer Lerngruppe verbleiben.
Wie soll dieses nun erfolgen? Individualisierung lässt sich im Grunde nur durch Binnendifferenzierung erreichen. Für den Unterricht mit der ganzen Klasse gibt es zwar bestimmte Möglichkeiten, diese sind jedoch begrenzt. Hinzu kommt noch, dass die Schulen in Deutschland, die sich auf den Weg machen, eine Schule zu werden, in der das längere gemeinsame Lernen praktiziert wird, das dreigliedrige System in sich abbilden müssen, indem sie eine entsprechende pädagogische Konzeption entwickeln. Diese muss daher eine andere sein, als die jener Schulen in Ländern mit einem Einheitsschulsystem. Der Lehrstoff muss so vermittelt werden, dass die Niveaus der drei, parallel dazu existierenden, Schularten abgedeckt werden, um ebenfalls die entsprechenden Zertifikate vergeben zu können.
In der Praxis dieser Schulen spielt daher das eigenverantwortliche, selbstständige und selbstregulierte Lernen eine wichtige Rolle. Nur auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler zur selben Zeit und innerhalb einer Lerngruppe (teilweise unterschiedliche) Lerninhalte auf ganz verschiedenen Niveaus bearbeiten. Konkret erfolgt dies in methodischen Unterrichtsformen reformpädagogischer Vorbilder oder Abwandlungen hierzu. Dies sieht dann folgendermaßen aus: Neben dem gemeinsamen Unterricht mit der gesamten Lerngruppe gibt es Zeitfenster im Stundenplan, in denen, für bestimmte Fächer und bestimmte Inhalte, verbindlich Unterricht in Form des eigenverantwortlichen Lernens stattfindet, häufig als Wochenplanunterricht.
Hier soll untersucht werden, von welchen psychischen Voraussetzungen Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern und andere Verantwortliche, die bei einer solchen Schulentwicklung mitwirken, ausgehen sollten, um Konzepte selbstregulierten Lernens für ihre Schule zu entwickeln, die den Kindern und Jugendlichen gerecht werden.
Eine umfangreiche internationale Forschung liegt hierzu vor. Die entsprechenden Studien und Untersuchungen stammen allerdings überwiegend aus dem angelsächsischen Sprachraum oder wurden in englischsprachigen Fachzeitschriften publiziert. Dies trifft auch auf die wenigen Experten zu, die in Deutschland dazu forschen. In der Lehrerschaft sind die dabei gewonnenen Forschungsergebnisse daher weitgehend unbekannt und werden folglich auch nicht in die aktuelle Diskussion einbezogen. Weder bei Lehrerinnen und Lehrern, noch bei Eltern, noch bei den kommunal und auf Landesebene Verantwortlichen.
Die gegenwärtige Situation in unserer Gesellschaft ist nicht nur durch eine große Bereitschaft gekennzeichnet, sich dem Thema „Reform des Schulwesens“ zuzuwenden. Es ist auch eine große Offenheit für grundsätzliche und einschneidende Veränderungen vorhanden. Dies betrifft auch die Art und Weise wie unterrichtet und gelernt werden soll. Es geht um nichts anderes, als darum, das Schulwesen zukunftssicher zu machen. Es soll sich auch in einer, in Entstehung begriffenen, Informations- und Wissensgesellschaft bewähren. Es wäre seltsam, wenn man davon ausgehen würde, dieser Aufbruch könnte so erfolgen, dass man ausgerechnet das, was „Wissenschaft“ dazu zu sagen hat, einfach ignoriert. Leider hat man manchmal den Eindruck, dass genau das passiert.
Im ersten Teil geht es um die individuellen Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern, insbesondere um die Intelligenz und die exekutiven Funktionen, deren Auswirkungen auf die Schulleistungen und die diese zudem bedingenden Faktoren. Einerseits ergibt sich daraus eine Begründung dafür, dass die Forderung nach längerem, gemeinsamen Lernen unausweichlich ist. Man kann Kinder eben nicht, aufgrund einer vermuteten kognitiven Leistungsfähigkeit, mit 10 Jahren in Schularten unterschiedlichen Niveaus sortieren und darauf hoffen, dass „Begabungen“, die sich dann irgendwann vielleicht doch zeigen, auf irgendwelchen Nebenwegen doch zu einem höheren Abschluss führen. Damit überlässt man die Schülerinnen und Schüler einem schicksalhaften Zufall. Werden sie Einflüssen begegnen, die sie weiterbringen oder werden diese ihnen vorenthalten? Intelligenz entfaltet sich nicht einfach von selbst, sondern in einem (schulischen) Milieu, das Anreize dazu bietet. Schulen mit einem einheitlichen, niedrigeren Anspruchsniveau für alle, die sie besuchen, sind dazu nicht geeignet, ebensowenig Schulen, die nicht das bereithalten, was die Kinder und Jugendlichen, auf dem aktuellen Stand ihrer Entwicklung, brauchen. Die Intelligenzforschung zeigt deutlich, dass Intelligenz kein statisches, unveränderliches Merkmal ist, sondern sich weiterentwickelt, je nach den Angeboten, die in der Umwelt vorgefunden werden. Lernen „erschafft“ auch Intelligenz. Auch das selbstregulierte Lernen muss sich diesem Anspruch stellen. Weil es grundsätzlich, in seinem Anspruch auf Regulation, auf bestimmte kognitive Fähigkeiten zurückgreift und andererseits auch die idealen Voraussetzungen für deren Weiterentwicklung bereitstellt, indem es sie konsequent herausfordert (wenn es in angemessener Weise organisiert wird), ist diese Art des Lernens, im Hinblick auf die kognitive Weiterentwicklung eines Individuums, besonders bedeutsam.
Eine Schlüsselfunktion für die Selbstregulation des Verhaltens allgemein und insbesondere des Lernprozesses hat die Motivation der Lernenden. Im Laufe der Entwicklung eines Menschen bilden sich bestimmte Persönlichkeitsfaktoren heraus, die die Basis für die Ausbildung der Motivation bilden. Die Umwelt(en) (Bronfenbrenner spricht von ökologischen Systemen), in denen ein Kind oder ein Jugendlicher aufwächst haben darauf einen entscheidenden Einfluss. Welche Werte bestimmen das individuelle Verhalten? Ist ein Mensch mehr ängstlich oder traut er sich auch schwierige Aufgaben zu? All dies ist für die grundlegende Motivation nicht unerheblich.
Insbesondere die Selbstkonzepte hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit und der eigenen Intelligenz sind für das Leistungsverhalten maßgebend. Man spricht hier von unterschiedlichen „Mindsets“. Sie haben auf den Lernprozess einen entweder positiven oder einen geradezu verheerenden Einfluss und sie legen fest, in welchem Ausmaß selbstreguliertes Lernen einem Kind oder Jugendlichen überhaupt möglich ist.
Das komplexe psychologische Konstrukt „Motivation“ wird auf der Basis der Selbstbestimmungstheorie untersucht. Diese hat drei psychische Grundbedürfnisse identifiziert, nach denen unterschiedliche Formen der Motivation differenziert werden und die auch die Qualität einer (gestalteten) Lernumgebung für selbstreguliertes Lernen bestimmen. Für das schulische Lernen erweist sich dieses Motivationsmodell als sehr fruchtbar. Die Unterscheidung in extrinsische und intrinsische Motivation ist in diesem Zusammenhang viel zu simpel, weil es bei schulischem Lernen, und hier insbesondere für das eigenverantwortliche, eben auf die Qualität der Motivation ankommt und nicht nur darauf, in welchem Ausmaß Motivation vorliegt. Hier ist eine weit differenziertere Betrachtung notwendig, als jene, die durch diese Dichotomie möglich wäre.
Bestimmte Formen der Motivation sind mit bestimmten Zielen (Goals) verbunden, die die Lernenden verfolgen. Es bestehen, individuell verschieden, bestimmte Zielorientierungen, d.h. Tendenzen, sich bestimmte Ziele zu eigen zu machen. Hier gibt es wiederum, wenn man dies eingehender betrachtet, positive und negative Ausprägungen. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass die Letztgenannten ein selbstreguliertes, eigenverantwortliches Lernen nicht gerade erleichtern.
Eigenverantwortliches Lernen meint selbstreguliertes Lernen, denn wie anders könnte Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernommen werden, wenn nicht durch dessen verantwortliche Steuerung? Dieses ist aber sehr voraussetzungsreich. Es wird hier gezeigt, wie individuell ganz unterschiedlich die Schülerinnen und Schüler in diesen Voraussetzungen sind. Diese Heterogenität zu ignorieren, gefährdet das Projekt des gemeinsamen Lernens. Gelingt es nicht, hier tragfähige und wissenschaftlich begründete Konzepte zu entwickeln, die von den realen psychischen Vorbedingungen der Kinder und Jugendlichen ausgehen, dann besteht, einmal mehr, die Chance für ein Versanden von Reformbemühungen.
Wo es um die Frage der praktischen Konsequenzen geht, die aus all den hier dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse gezogen werden sollten, erfolgt in diesem Buch ein eindeutiges Plädoyer für eine Flexibilität der Organisation schulischen Lernens und Lehrens. Diese wird dadurch bestimmt nicht einfacher, aber einfacher ist das Lernen für die Schülerinnen und Schüler in einem starren System, das auf ihre unterschiedlichen Voraussetzungen keine Rücksicht nimmt, gewiss auch nicht und „Verlierer“ unter ihnen sind vorprogrammiert.
Hier bedarf es der Kreativität und dem Mut zum Experimentieren mit neuen Organisationsformen. Heterogenität zu würdigen und zu achten, nicht nur was die kognitiven Voraussetzungen, sondern auch was die Voraussetzungen für verschiedene Formen des Lernens betrifft. Darum geht es!
Faktoren, die dazu beitragen, dass ein vorhandenes Potenzial für gute schulische Leistungen auch realisiert wird.
Es gibt eine Reihe von Konzepten, die Individuen auf ihr Selbst hin bezogen ausbilden. Da ist das allgemeine Selbstkonzept4, das „Bild“, das man von sich hat, beispielsweise dies, jemand zu sein, der „eigentlich wenig zustande bringt“, ein Verlierer. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist spezieller. Es bezieht sich auf eine bestimmte Aufgabenstellung. Daher können auch durchaus positive und negative Fähigkeitsselbstkonzepte nebeneinander vorhanden sein.
Es handelt sich dabei um generalisierte Kognitionen in Bezug auf die eigene Fähigkeit. Diese beruhen unter anderem auf den verschiedenen, in der Vergangenheit vollzogenen Ursachenzuschreibungen (Kausalattributionen), die nach Erfolgen oder Misserfolgen vorgenommen wurden, sowie dem sozialen Vergleich in der Interaktion mit anderen.5 Wer als Ursache für seinen Erfolg „Glück“ ansieht und nicht das eigene Vermögen und wer im Vergleich mit anderen bei sich selbst immer nur eine Minderleistung feststellt, entwickelt nur ein sehr wenig ausgeprägtes Fähigkeitsselbstkonzept. Selbstkonzept und Fähigkeitsselbstkonzept sind allerdings psychologische Konstrukte, die nicht immer scharf abzugrenzen sind. Wer von sich selbst nicht viel hält, ist auch kaum der Meinung, dass er besonders viel kann.
Das Zutrauen zu sich selbst, die Zuversicht, eine Lernaufgabe auch erfolgreich anpacken zu können, hat, unabhängig von der gemessenen Intelligenz, einen Einfluss auf die Schulleistung.6 Es ist also durchaus denkbar, dass ein Schüler oder eine Schülerin eine hohe Intelligenz aufweist, aber das Zutrauen zu der eigenen Leistungsfähigkeit sehr gering ausfällt, weil diese Kinder und Jugendlichen nie die Erfahrung gemacht haben, dass das, was sie tun, wirklich Wertschätzung erfährt. Die Auswirkungen auf die Schulleistungen kann man sich leicht vorstellen: „Ich hatte Erfolg, weil die Aufgabe so leicht war, aber eigentlich kann ich das nicht gut.“ Ein anderer Schüler, der über eine ausgeprägte „Selbstwirksamkeitserwartung“ verfügt, wird vielleicht sagen: „Ich hatte Erfolg, also habe ich damit gezeigt, dass ich den Lernstoff gut bewältigen kann.“ Wer über ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept verfügt, hat auch nur eine geringe Erwartung von Selbstwirksamkeit7. Sie oder er glaubt, nicht fähig zu sein, eine Aufgabe zu bewältigen.
Zunächst hatte man ausschließlich kognitive Ursachen für die Ausprägung des Selbstkonzepts, beziehungsweise von Selbstwirksamkeit und Fähigkeitskonzept angenommen. Man muss sich dies so vorstellen: Durch die gemachten Erfahrungen, die erhaltenen Rückmeldungen und die Reflexion derselben gelangt ein Mensch zu der Überzeugung: „Ja, so bin ich!“ Findet das dann, in gleicher Weise, mehrfach mit demselben Resultat statt, dann verfestigt sich dies. Es kommt jedoch noch etwas hinzu. Greven8 konnte durch Vergleich von eineiigen und zweieiigen Zwillingen nachweisen, dass das Fähigkeitsselbstkonzept (SPA Self-Perceived Abilities), zumindest in dem Ausmaß auch auf genetische Ursachen zurückgeführt werden kann, wie man dies auch für die Intelligenz festgestellt hat.
4 Shavelson, Hubner & Stanton (1976)
5 Stern & Hardy (2004), S. 586
6 Greven u.a. (2009)
7 Bandura (1995)
8 Greven u.a. (2009)
Intelligenz als bedeutsame Grundlage des schulischen Erfolgs
Wenn hier von „Intelligenz“ die Rede ist, dann sind damit „kognitive Fähigkeiten“ von der Art gemeint, die sich mit einem Intelligenztest erfassen lassen. Heute wird der Begriff „Intelligenz“ auch noch in anderen Zusammenhängen, wissenschaftlich unscharf, verwendet. Man spricht von „emotionaler Intelligenz“ ‚ von „sozialer Intelligenz“ usw., wobei völlig unklar bleibt, was genau damit konkret gemeint ist und vor allem, wie man diese so genannten „Intelligenzen“ feststellen könnte. Empirisch fassbar ist das, was man in diesen Zusammenhängen als „Intelligenz“ bezeichnet, demnach nicht. Damit sind auch keine Vorhersagen über die Entwicklung und die Verhaltensweisen einer Person möglich. Wenn man aber nicht sagen kann, was man unter einem Begriff konkret zu verstehen hat und wenn es keine Möglichkeit gibt, diesen Begriff in der Weise zu verwenden, dass damit empirisch überprüfbare Aussagen formuliert werden können, taugt er höchstens zu nebulösen, allgemeinen Vermutungen.
Als Grundlage einer seriösen Beratung ist so etwas nicht dienlich. Es ist vielmehr die Gefahr damit verbunden, über Personen Aussagen zu machen, die nicht objektiv sind und deren Entwicklung letztlich in eine Richtung lenken, die für die Ratsuchenden schädlich ist. Zudem wird das Werkzeug „Intelligenztest“ (bezogen auf die kognitiven Fähigkeiten) möglicherweise „stumpf“, weil die damit getroffenen Aussagen relativiert werden, beispielsweise so: „Die kognitive Intelligenz des Schülers ist zwar vielversprechend, aber die soziale, emotionale und kreative Intelligenz lassen für die gewählte berufliche Richtung nur ein negative Prognose zu.“ So könnte es in einem Gutachten dann heißen. Die messbare Intelligenz, die die Fähigkeit zum logischen, zum schlussfolgernden (induktiven) Denken oder die Fähigkeit zur räumlichen Vorstellung umfasst22, ist die Größe, die eine begründete Aussage in einem Beratungsgespräch möglich macht, wenn man dabei auch die anderen, für die Schulleistung wirksamen, Faktoren bedenken sollte. Ein Beratungsergebnis sollte immer nur Anlass zu weiterem Nachdenken sein. Kann man bei Schülerinnen und Schülern davon ausgehen, dass diese Faktoren die Nutzung des Intelligenzpotenzials auch zukünftig ermöglichen werden, so gilt: „Insgesamt gehören die für den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulerfolg berichteten Korrelationen zu den höchsten, die man in den empirischen Sozialwissenschaften überhaupt findet.“23
Die subjektive Einschätzung von Begabungen oder Talenten, die potenzielle, mutmaßliche Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen ausdrückt, ist weit weniger geeignet, um Aussagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu machen. Sie ist Beeinflussungen durch Voreingenommenheit, persönliche Sympathie und individuellen Überzeugungen der Berater ausgesetzt. Ein standardisierter Intelligenztest gibt hier doch mehr Sicherheit und ein Stück weit mehr Objektivität, aber letztlich, trotz allem, keine unbedingte Gewissheit. Dessen muss man sich bewusst sein! Für eine individuelle psychologische Beratung ist dies eine geeignete und verantwortliche Vorgehensweise. Für ein kollektiv angewandtes Verfahren der Zuweisung von 10-jährigen zu bestimmten Schularten jedoch keineswegs. Die dafür einschränkenden Gründe wurden bereits oben beschrieben.
Intelligenz ist nicht direkt beobachtbar und auch nicht als individuelle Größe messbar. Der Intelligenzquotient wird daher, aus den bei einem entsprechenden Test ermittelten Ergebnissen, im Vergleich zu den Ergebnissen vieler anderer Personen aus derselben Lebensaltersgruppe und demselben kulturellen Umfeld ermittelt. Zur Bestimmung der Intelligenz bedarf es also immer einer Vergleichsgröße. Die 1596 geborene Indianerin Pocahontas war an den englischen Hof gebracht worden. Sie wurde als sehr klug geschildert. Ihren Intelligenzquotienten hätte man aber, aus dem genannten Grund, nicht ermitteln können.
Der durchschnittlichen Leistung einer Altersgruppe bei einem für diese geeigneten und standardisierten Intelligenztest wird der IQ Wert 100 zugeordnet. Daraus folgert, dass für jede Altersgruppe ein anderer Test entwickelt werden muss. Flynn24 stellte fest, dass kulturelle Einflüsse auf den gemessenen IQ einwirken. Zudem sind innerhalb von 30 Jahren die IQ Werte in den industrialisierten Ländern von Generation zu Generation angestiegen.
Dies dürfte den besseren Lebensbedingungen und dem erleichterten Zugang zu vielfältigen Bildungsmöglichkeiten zu verdanken sein. Eine Nachjustierung der vordem verwendeten Intelligenztests erfordert dies alle Mal. Würde man mit einem Intelligenztest, der für heutige 20-jährige entworfen wurde, mit einer „Zeitmaschine“ in die Vergangenheit reisen und dort diesen dann mit 20-jährigen durchführen, so wären die IQ-Werte heutiger 20-jähriger insgesamt besser.
Stellt man, innerhalb einer bestimmten Lebensaltersgruppe, die Häufigkeit der erreichten IQ Werte fest, so ergibt sich, falls man eine sehr große Anzahl von Menschen untersucht hat, eine Normalverteilung, die die folgende Abbildung zeigt.
Abbildung 6: Verteilung der IQ-Wert in einer bestimmten Lebensaltersgruppe bei einer sehr großen Anzahl von Personen.
Die meisten Personen (68 %) verfügen über eine Intelligenz, die in unmittelbarer Nähe des durchschnittlichen Wertes (IQ 100) dieser Lebensaltersgruppe liegt. In diesem mittleren Bereich liegen die Intelligenzwerte sehr vieler Menschen dicht beieinander. Der Unterschied zwischen ihnen ist minimal. Es ist sogar so, dass zwischen den IQ Werten 70 und IQ 130 ungefähr 95 % der IQ Werte der untersuchten Personen dieser Gruppe liegen. Menschen mit einem IQ über 130 werden als „hochbegabt“ bezeichnet. Ob sich „Hochbegabung“ aber nicht nur auf die kognitiven Fähigkeiten bezieht, sondern auch „besonders kreativ“ bedeutet, ist keineswegs klar.25
Wenn sehr viele Schülerinnen und Schüler aus der vierten Grundschulklasse ins Gymnasium wechseln (in manchen Städten sind das über 50 %), so ist die logische Schlussfolgerung: Unter diesen sind keineswegs nur diejenigen mit einem hohen IQ Wert (rechter Teil der Abbildung), sondern es sind darunter viele aus dem mittleren Bereich (den 68 %). Wie innerhalb dieses Bereichs die Auftrennung in Gymnasiasten und Nicht-Gymnasiasten erfolgt, ist von allen möglichen anderen Faktoren abhängig, weil die IQ-Werte der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, aus diesem IQ Bereich, so dicht beieinander liegen, dass hier keine eindeutige Grenze vorhanden ist. Weil dies nun nicht nur einige wenige Schülerinnen und Schüler betrifft, sondern, bei der genannten Übergangsquote ins Gymnasium, sehr viele, ist nachfolgend, bei der Untersuchung der Zusammensetzung der fünften Klassen, deutlich das Folgende, hinsichtlich des Intelligenzquotienten, festzustellen: Die Verteilung der IQ Werte in den fünften Klassen, der verschiedenen Schularten, zeigt deutliche Überlappungen.
1904 hat Charles Spaerman eine „Zwei-Faktoren-Theorie“ der Intelligenz vorgestellt, die für die Intelligenzforschung bestimmend wurde. Eine allgemeine Intelligenz (general mental ability „g“) wird durch einen spezifischen Anteil (s) ergänzt, der den besonderen Anforderungen des angewandten Intelligenztests entspricht. Diesem Modell liegt die inzwischen empirisch gut gesicherte Feststellung zugrunde, dass eine höhere Leistung in einem Teilbereich eines Intelligenztests (beispielsweise in der visuell-räumlichen Wahrnehmung) mit einer ebenfalls höheren Leistung in einem anderen Teilbereich (beispielsweise im verbalen) zusammenhängt. Catell26 hat später noch eine weitere, statistisch begründete, Unterteilung vorgeschlagen: Die in eine fluide Intelligenz und in eine kristalline Intelligenz.
Unter der kristallinen Intelligenz versteht man die Fähigkeit, das erworbene Wissen auf Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen zur Lösung von Problemen anzuwenden. Kristalline Intelligenz ist auf das Vorhandensein einer ausgebauten Wissensstruktur angewiesen. Wer über eine hohe fluide Intelligenz verfügt kann, ausgehend von bereits Bekanntem, Probleme in völlig neuen, bisher noch niemals zuvor bearbeiteten, Bereichen lösen.
„Fluid intelligence (Gf) refers to the ability to reason and to solve new problems independently of previously acquired knowledge. Gf is critical for a wide variety of cognitive tasks, and it is considered one of the most important factors in learning. Moreover, Gf is closely related to professional and educational success, especially in complex and demanding environments.27
Susanne M. Jaeggi u.a. weisen empirisch nach, dass das Training des Arbeitsgedächtnisses zu einer Verbesserung der fluiden Intelligenz führt. Ist also Intelligenz auch im Erwachsenenalter noch veränderlich? Die Entwicklung der fluiden und kristallinen Intelligenz ist sehr umstritten. Auch die Abgrenzung zwischen beiden ist sehr schwierig. Eigentlich sind kristalline wie auch fluide Intelligenz letzten Endes auf Wissen angewiesen. Was ist, wenn Menschen mit zunehmendem Alter immer bequemer und träger werden und zunehmend geistige Herausforderungen meiden?
Was ist, wenn sich im Berufsleben Arbeitsroutinen etablieren, sodass auch hier „Dazulernen“ nicht mehr notwendig ist? Was ist, wenn im Verhalten Älterer genau das Gegenteil der Fall ist? Ob ein lebenslanges Lernen, eine freudige Annahme von Herausforderungen, nicht doch zu einem langfristigen Intelligenzzuwachs führt – was manche Forscher vehement bestreiten – könnte erst eine Längsschnittuntersuchung von Menschen beweisen, die diese beschriebenen Eigenschaften zeigen. Es herrscht in dieser Frage eine große Unsicherheit.
Aufbauend auf der Arbeit von Spearman und Catell hat Carroll28, basierend auf 450 Datensätzen von Forschungsarbeiten zur Intelligenz, die folgende Struktur (Abbildung 7) menschlicher Intelligenz vorgestellt, die deren verschiedene Teilbereiche zueinander in Beziehung setzt.29
Abbildung 7: Hierarchisches Modell der Intelligenz nach Caroll (1993). Auch das Drei-Ebenen-Modell der Intelligenz genannt.
Auf der dritten Ebene (rechts) stehen Beispiele für die spezifischen Fähigkeiten. Insgesamt nennt Carroll 70 verschiedene. Auf der mittleren, der zweiten Ebene stehen die verschiedenen Fähigkeitsbereiche und in Ebene 1, allen anderen Ebenen vorgeordnet, Spearman’s allgemeine Intelligenz „g“. Der Zusammenhang dieser mit der schulischen Leistung ist, nach Spinath30, sehr hoch, entsprechend der Untersuchung von Deary31, die bereits beschrieben wurde. Die Daten von Spinath beziehen sich aber ebenfalls auf GCSE Examen in Großbritannien. Auf die damit verbundenen Probleme, und die sich daraus ergebenden Einschränkungen, wurde bereits eingegangen. Eine Übertragung auf schulische Leistungen, die innerhalb des deutschen oder eines vergleichbaren Schulsystems erbracht werden, ist nicht möglich.
22 Stern & Neubauer (2013), S. 47
23 a.a.O. S. 183
24 Flynn (1987)
25 Roth, G. (2011)
26 Catell (1963)
27 Jaeggi, S.M. (2008)
28 Carroll (1993)
29 Nach Neubauer & Fink, 2006
30 Spinath (2010)
31 Deary, I. u.a.(2007)
Intelligenz und Gehirn
Identisch sind 96 % der Erbanlagen des Menschen und der Schimpansen, hier vor allem der Bonobos32. Der Unterschied zwischen uns und den Menschenaffen beträgt also nur 4-5 %, was die Gene angeht. Menschen gleichen sich somit weitgehend in ihren Genen, also jenem Anteil, der das spezifisch „Menschliche“ ausmacht. Nur 0,1 % der Erbanlagen sind für die individuellen Unterschiede verantwortlich, folglich auch für den unterschiedlichen Bau des Gehirns. Darin findet man etwa 100 Milliarden Neuronen (Nervenzellen). Feine Verästelungen, die Dendriten, empfangen elektrische Impulse, die die Neuronen dann durch lange Fortsätze, die Axone, weiterleiten. Über Synapsen wird die Verbindung zu den Dendriten nachfolgender Nervenzellen, Muskelzellen, Zellen des Drüsengewebes etc. hergestellt.
Sind die Neuronen mit einer isolierenden, fettreichen Schicht, dem Myelin, umgeben, so erfolgt die Leitung der Impulse mit höherer Geschwindigkeit. Lernvorgänge bewirken die Ausbildung und Verstärkung synaptischer Verbindungen zwischen verschiedenen Neuronen (wobei auch „hemmende“ Verbindungen eine Rolle spielen). Durch diese Vorgänge entsteht ein spezifisches Netzwerk neuronaler Verknüpfungen mit einer ganz bestimmten Struktur. Lernen hat also – im zellulären Bereich – durchaus auch anatomisch feststellbare Folgen. Man hat festgestellt, dass Gehirnbereiche, die durch Lernen lange Zeit intensiv beansprucht werden, angewachsen sind. Es wird angenommen, dass es in diesen Bereichen zu einer Vermehrung von Neuronen kam (adulte Neurogenese). Das Gehirn ist ein hochflexibles Organ und bleibt dies lebenslänglich!
Den empirischen Nachweis lieferte eine Gruppe Londoner Wissenschaftler33, die Taxifahrer aus dieser Stadt untersuchten. Sie stellten bei diesen eine Vergrößerung des Hippocampus fest. Dies ist ein Bereich des Gehirns, der für die räumliche Orientierung von Bedeutung ist. Von Londoner Taxifahrer, die sich im historisch gewachsenen Gewirr von Straßen und Gassen dieser Stadt zurecht finden müssen, wird diese Fähigkeit in besonderer Weise gefordert. Dieses „Wachstum“ vollzieht sich folgendermaßen: Um so mehr Verbindungen über Dendriten und über Synapsen entstehen, um so größer ist der nachweisbare „graue Bereich“. Das sind die Zellkörper der Neuronen und damit eben jene Teile, aus denen diese bestehen. Erstaunlich ist, dass man bei frühem Sprachenlernen eine Abnahme der grauen Substanz findet.34 Es ist wohl so, dass bei diesem frühem Lernen Nervenzellen besonders effektiv miteinander verbunden werden. Wenn nur wenige Neuronen an dem dadurch entstehenden Netzwerk beteiligt sind, arbeitet dieses wesentlich effektiver und mit geringerem Energieaufwand. Was nicht gebraucht wird, verschwindet dann.
Zwischen dem kognitiven Lernen und dem motorischen Lernen gibt es einen wichtigen Unterschied: Bei kognitivem Lernen kommt es zu dauerhaften Veränderungen in der Großhirnrinde. Diejenigen, die man in der der grauen Substanz beobachtet, sind also nach einiger gewissen Zeit nicht einfach wieder verschwunden. Das läuft grundsätzlich so und nicht anders ab. Die Behauptung Lernen, als neuronaler Veränderungsprozess aufgefasst, würde mit fortschreitendem Alter weniger gut funktionieren, ältere Menschen könnten also nicht mehr effektiv lernen, ist schlichtweg falsch.35 Es ist zwar wirklich so, dass ungefähr ab dem 65 Lebensjahr die Myelinisierung, womit man die Umhüllung der Axone mit fetthaltigem Myelin meint, zurückgeht und dadurch die Leitungsgeschwindigkeit vermindert wird. Lernen erfolgt dadurch langsamer. Dem entspricht eine Abnahme der fluiden, aber nicht der kristallinen Intelligenz. Auf die Probleme der Abgrenzung zwischen beiden wurde bereits eingegangen. Aber damit ist keineswegs ausgeschlossen, dass neue oder veränderte neuronale Netzwerke aufgebaut werden können. Es dauert eben länger und manchen älteren Menschen scheint die Geduld und die Motivation dafür zu fehlen, dem Zeit zu geben.
Insgesamt lässt sich sagen: Intelligente Menschen nutzen ihr Gehirn wesentlich effektiver als weniger intelligente. Richard J. Haier36 wies nach, dass Gehirne intelligenterer Menschen weniger der Energie liefernden Glucose umsetzen, als diejenigen von weniger intelligenten. Bei ersteren ist zudem der Cortex (die Großhirnrinde) insgesamt während des Lernens weniger aktiv. Erklärt werden kann dies dadurch, dass die häufiger stattfindende Arbeit an anspruchsvollen Aufgaben dazu führt, dass das dazu notwendige Wissen in einem gut organisierten Netzwerk leichter abrufbar ist. Diese „gute Organisation“ erfolgt durch Bildung von „Chunks“.
Das sind sinnvolle Wissenseinheiten. Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Schülern helfen „Chunks“ zu bilden, bewahren sie davor, völlig ineffektiv eine Vielzahl von Einzelheiten abspeichern zu müssen. Allgemeine Regeln, Gesetzmäßigkeiten und grundlegende Prinzipien eines Fachgebiet sind die Inhalte solcher „Chunks“. Beispiel: “All dies nennt man ‚physikalische Kräfte‘, was sich durch die folgenden Eigenschaften auszeichnet: Kann einen Körper verformen und seine Bewegung bzw. Bewegungsrichtung verändern.“ oder: „Alle Stoffe mit einer Dichte unter 1,0 g/cm3 schwimmen im Wasser.“ Man muss sich also keine langen Listen schwimmender Stoffe einprägen. Was durch diese „Chunks“ erreicht wird, ist „neuronale Effizienz“.
Untersucht man Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten, so zeigt sich, dass von diesen eine gut organisierte Wissensbasis erworben wurde. Das macht ihre Expertise aus. Intelligenzunterschiede sind zur Erklärung von Leistungsunterschieden zwischen diesen Experten nicht mehr sehr bedeutsam. Was zählt, ist das bereichsspezifische Wissen. Sicher ist es so, dass man für eine herausragende Leistung in einem Fachgebiet über ein höheres Maß an Intelligenz verfügen sollte. Man wird sich ohne diese das notwendige grundlegende Wissen gar nicht erarbeiten können.
Aber jenseits dieser Grundvoraussetzung ist eine gute Vernetzung und Strukturierung dieses Wissens viel wichtiger. Auf Schülerinnen und Schüler bezogen heißt das dann: Es ist durchaus möglich, dass diejenigen mit etwas geringerer Intelligenz eine gut fundierte Wissensbasis in einem Fach erwerben, was dann zu höheren Schulleistungen führt. Wichtig ist nur, dass das von ihnen, durch fleißiges Bemühen, erworbene bereichsspezifische Wissen gut vernetzt ist. Das geht über die bloße Kenntnis von Regeln, Fachbegriffen und grundlegenden Konzepten hinaus. Zusammenhänge müssen erkannt und verstanden werden. Lernen muss „Tiefenverarbeitung“ des Lernstoffs sein, um dahin zu gelangen. Die häufige Anwendung dieses grundlegenden Wissens in Übungen kann dann zur Expertise führen. Gute Schulleistungen sind dementsprechend eher durch das bereichsspezifische Wissen bestimmt, als allein durch die fluide Intelligenz.
Solches Wissen kann eine geringere fluide Intelligenz ausgleichen, aber eine hohe fluide Intelligenz kann keinesfalls eine fehlende Wissensbasis ersetzen37 Sicherlich ist anzunehmen, dass Schüler mit einer höheren Intelligenz sich diese Wissensstruktur in viel kürzer Zeit und wesentlich effektiver erarbeiten können, als die mit geringerer. Auch selbstgesteuertes Lernen muss das möglich machen. Bei höherer Intelligenz ist es wahrscheinlich, dass die bewusste und effektive Anwendung bestimmter Strategien besser gelingt. Aber jene Schüler, die über eine geringere fluide Intelligenz verfügen, können durch einen entsprechenden höheren Zeitaufwand und durch Ausdauer auch zu diesem Ergebnis gelangen. In einer Lernumgebung, in der sie eigenverantwortlich lernen sollen, muss ihnen diese Zeit zur Verügung stehen. Sich darauf zu berufen, dass man über weniger Intelligenz verfügt, ist keine Ausrede dafür, sich einer Aufgabe erst gar nicht zu stellen.
Was bei intelligenten Menschen häufig festzustellen ist, ist ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis.38





























