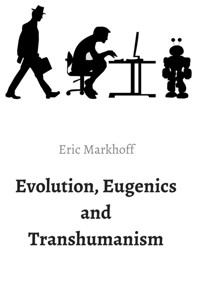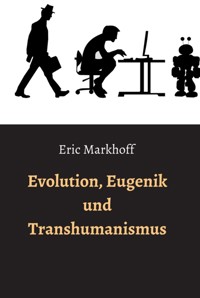
11,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In der fast 4 Milliarden Jahre alten Geschichte des Lebens auf der Erde waren die Mechanismen der Evolution an natürliche Selektion und an organisches Leben gebunden. Mit der Schaffung künstlicher Intelligenz könnten die Menschen die natürliche Selektion tatsächlich durch intelligentes Design ersetzen. Der sich anbahnende Transhumanismus, das erneut erwachende Monster der Eugenik und die Gestaltung der Schnittstelle zwischen Menschen- und Maschinenwelt darf nicht den Allmachtsphantasien weniger Superreicher und Mächtiger überlassen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© 2021 Eric Markhoff
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-30441-3
Hardcover:
978-3-347-30442-0
e-Book:
978-3-347-30443-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Evolution, Eugenik und Transhumanismus – Ein Sachbuch
Eric Markhoff
Evolution, Eugenik
und
Transhumanismus
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
Selektionsprozesse in Wirtschaft und Handel
2. Grundlagen der Evolution der Arten
Darwinismus und Lamarckismus
Was heist eigentlich erfolgreich in der Evolution?
3. Ganz von Anfang an
Vom Stein zum Sein - Der Beginn des Lebens
Stabile, sich reproduzierende Molekülstrukturen
Erste Spuren von Leben auf der Erde
Entstehung vielzelligen Lebens
Die kambrische Explosion des Lebens
Exkurs: Die präkambrische Explosion des Lebens
Der Stamm der Chordatiere
Wasser und Landtiere
Die „Erfindung“ des Eis (Amnioten)
Exkurs: Wie entwickelten sich die Erdkontinente zwischen der „Erfindung“ des Eis (vor 350 Mio. Jahren) und dem Aussterben der Dinosaurier (vor 66 Mio. Jahren)
Der Aufstieg der Säugetiere
Exkurs: Paläozän-Eozän-Temperaturmaximums (PETM) (vor 56 Millionen Jahren)
Alt- und Neuweltaffen
4. Evolutionsgeschichte des Menschen
Wie Wissen über die Evolutionsgeschichte des Menschen ensteht
Das (wenig nützliche) „Missing Link“ Konzept
Spalter und Zusammenfasser
Der letzte gemeinsame Vorfahre (von Mensch und Schimpanse)
Exkurs: Vormenschen (vor den Australopithecinen)
Graecopithecus freybergi (Alter 7,2 Mio. Jahre, Fundort Griechenland)
Sahelanthropus tchadensis (6-7 Mio. Jahre, Fundort Tschad)
Ororin tugenensis (6 Mio. Jahre, Fundort Kenia)
Ardipithecus kadabba (5,6 Mio. Jahre, Fundort: Afar Senke, Äthiopien)
Ardipithecus ramidus (4,4 Mio. Jahre, Fundort: Afar Dreieck, Äthiopien)
Australopithecinen: Die Südlichen Affen (oder doch Menschen?)
Die Paranthropus Gattung
Australopithecus anamensis (4,2-3,9 Mio. Jahre, Fundorte: Ostafrika)
Australopithecus afarensis (3,8-2,9 Mio. Jahre, Fundorte: Ostafrika)
Australopithecus africanus (3,0-2,1 Mio. Jahre, Fundorte: Südafrika)
Australopithecus garhi (um 2,5 Mio. Jahre, Fundort: Äthiopien)
Australopithecus sediba (1,95-1,78 Mio. Jahre, Fundort: Südafrika)
Australopithecus bahrelghazali (3,5-3,0 Mio. Jahre, Fundort Tschad)
Die Gattung Homo
Exkurs: Arten der Gattung Homo, die keine Zeitgenossen des Homo sapiens waren (Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster)
Homo rudolfensis (2,5-1,5 Mio. Jahre, Fundorte: Kenia, Äthiopien, Malawi)
Homo habilis (2,1-1,5 Mio. Jahre, Fundorte: Tansania, Kenia, Äthiopien, Südafrika)
Homo ergaster (1,9-1,4 Mio. Jahre)
Homo erectus (1,9 Mio. – 70.000 Jahre)
Homo naledi (0,3 Mio. Jahre)
Homo heidelbergensis (0,7-0,2 Mio. Jahre)
Homo antecessor (780.000 Jahre)
Die Zeitgenossen des modernen Menschen
Homo floresiensis („Hobbit“)
Homo neanderthalensis (300.000-30.000 Jahre)
Was führte zum Verschwinden des Neandertalers?
Zwölf spekulative Erklärungsversuch für das Aussterben des Neandertalers
1. Homo sapiens verdrängte Homo neanderthalensis gewaltsam (Völkermord, Art-Mord)
2. Vulkanausbrüche
3. Homo sapiens domestizierte Tiere und kooperierte bei der Jagd mit Wölfen
4. Homo sapiens könnten bessere Jäger gewesen sein
5. Homo sapiens könnte durch Arbeitsteilung zwischen Geschlechtern und Altersgruppen besser organisierte Übelebensgruppen gebildet haben als die Neandertaler
6. Neandertaler könnten geringere kognitive Fähigkeiten gehabt haben
7. Homo sapiens könnte durch kollektiven Glauben an nichtgegenständliche Entitäten bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele überlegen gewesen sein
9. Wetter und Klimaveränderungen in den Lebensräumen der Neanderthaler
10. Neandertaler könnten Seuchen zum Opfer gefallen sein
11. Inzucht war bei Neandertalern normal und beeinträchtigte die Fertilität
12. Neandertaler assimilierten sich mit dem H. sapiens
Denisova-Menschen
5. Mechanismen der Evolution und deren Wirkung auf den Homo sapiens
Unterschiedliche Anreizsysteme für promiskuitives Verhalten bei Männern und Frauen
Mechanismen sexueller Anziehung
Neurobiologische Grundlagen
Beispiele der Sexualität zu Grunde liegender neurobiologischer Mechanismen
Beispiel 1: Steuerung der mechanischen Komponente des Sexualakts
Beispiel 2: Sicherstellung der intrinsischen Motivation zu sexueller Aktivität
Beispiel 3: Bedeutung der Riechsinnesreize bei der sexuellen Affinität
Hormone
Soziokulturelle Grundlagen restriktiver Sexualität
Verknappung der sexuellen Ressource als ökonomische und evolutionäre Strategie
Dichtestress als Gefahr für den Eros?
6. Die Evolution von Hierarchien
Die Hummer Debatte
Menschliche Hierarchien in Evolution und Geschichte
Ein Beispiel einer komplexen mittelalterlichen Gesellschaft mit Hierarchien
7. Evolution von Technologien
Die Sesshaftwerdung des Menschen (Neolithische Revolution)
Die Domestizierung von Pflanzen (Kultivierung)
Die Domestizierung von Tieren
Folgen geographisch unterschiedlicher Vorraussetzungen für Ackerbau und Viehzucht
Die Industrielle Revolution
Globaler „The winner takes it all“ Kapitalismus
Die Verbrennung fossiler Brennstoffe
Feuer
Das Zeitalter der fossilen Brenstoffe (seit Mitte des 18. Jahrhunderts)
8. Künstliche Intelligenz und simulierte Realitäten
Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das Alltagsleben des Menschen
Richtige falsche (Mensch) und falsche richtige Entscheidungen (KI)
Und wenn wir doch in einer Simulation leben?
9. Evolutionäre Entwicklung von Kompetenzen, Geist und Intelligenz
Die 4 Kategorien des Kompetenzerwerbs (Lernen) nach Daniel Dennett
Versuche, Begabungen zu messen
Idiokratisierung durch Technisierung
Eine Idiokratisierung erfolgt im Zusammenspiel von „Nature“ and „Nurture“
10. Von der Evolutionstheorie zur Eugenik
Alexander von Humboldt (1769-1859) – der Naturgeograph
Charles Darwin (1809-1882) – der Begründer der Evolutionstheorie
Alfred Russel Wallace (1823-1913) – Darwins Ideenverwandter
Herbert Spencer (1820-1903) – Der liberale Sozialdarwinist
Francis Galton (1822-1911) – der Universalgelehrte
Charles Davenport (1866-1944) – Kopf der amerikanischen Eugeniker
Margaret Sanger (1879-1966) – die Feministin
Thomas Henry Huxley (1825-1895) – Darwins Bulldogge
Julian Huxley (1887-1975) –Humanist und erster UNESCO-Generalsekretär
Aldous Huxley (1894-1963) – der visionäre Schriftsteller (Schöne Neue Welt)
Ernst Haeckel (1834-1919)
11. Eugenik in Amerika und im Nationalsozialistischen Deutschland
Die Nationalsozialisten
Mein Kampf
Nürnberger Rassengesetze
Wannseekonferenz
Aktion T4 – Vernichtung unwerten Lebens
Der Lebensbrunnen
Waren die Deutschen meiner Großelterngeneration „schlechte Menschen“?
Das Hume’s Paradox: Warum können so wenige so viele unterwerfen?
Wie die menschliche Evolution Machtmissbrauch und Unterwerfung fördert
Die wohlmeinenden Absichten, die der Eugenik zu Grunde lagen
12. Selektierende Eugenik und Eugenik durch gentechnische Optimierung
Negativ selektierende Eugenik (Eugenik durch Mord)
Positiv selektierende Eugenik (Eugenik durch Fortpflanzungsförderung)
Eugenik durch direkte gentechnische Optimierung des menschlichen Genoms
13. Gentechnische Veränderungen höherer Lebewesen
Klonales Wachstum
DNS und RNS Stränge schneiden und wieder zusammenfügen
Die CRISPR/Cas9 Methode
Zwillingsschwestern mit einem gezielt veränderten CCR5-Rezeptorgen
Dolly (1996-2003)
Risiken der Genomveränderung für das Individuum
Risiken für das Individuum bei somatischen, also nichtkeimbahnwirksamen genetischen Modifikationen
14. Zugang zur Ressource genetische Optimierung
Kopplung an Staatsangehörigkeit
Kopplung an rassistische Kriterien
Unsterblichkeit – Ray Kurzweil
Geburtenkontrolle im 21. Jahrhundert
Verwendung menschenmanipulierender Methoden für militärische Zwecke
15. Demographie und Aussterben
Über das Aussterben des Homo sapiens
Kann die Menschheit würdevoll und für den Einzelnen erträglich aussterben?
16. Lässt sich Eugenik 2.0 verhindern oder kontrollieren?
Wie ließe sich Eugenik 2.0 regulieren?
Könnten die Vereinten Nationen gentechnische Eingriffe am Menschen verbieten?
Eugenik zur Anpassung an eine sich schnell ändernden Biosphäre
17. Transhumanismus - der Status Quo im Jahr 2020
Die Verdrängung realer sozialer Räume (durch virtuelle)
18. The Great Reset – der große Neustart
Warum interessiert sich das Weltwirtschaftsforum für den Philosophen Harari?
Eugenischer Transhumanismus als gerechtes Menschheitsprojekt?
19. Epilog
20. Referenzliste
Notizen
1.
Prolog
Zu Beginn des im Jahre 2006 gedrehten, nicht sonderlich erfolgreichen amerikanischen Films “Idiocracy” stellen Trevor und Carol, ein Paar hochintelligenter Akademiker zu Beginn des 21. Jahrhunderts fest, dass die Entscheidung, Kinder zu haben, eine derart wichtige Entscheidung sei, und dass man hierbei nichts überstürzen dürfe. Man müsse den richtigen Moment abpassen, der gerade nicht da sei.
Diese beiden Musterakademiker werden in den folgenden Szenen mit Clevon verglichen, dessen Frau Trish gerade feststellt, dass sie schon wieder schwanger ist, worauf Clevon fluchend die Bierdose auf den Tisch knallt. Er habe schon zu viele verdammte Kinder und habe gedacht, Trish nehme doch die Pille, aber wahrscheinlich habe er sie wohl mit Britney verwechselt. Trish wirft in wütender Eifersucht eine Pfanne nach ihm. In der Ecke wird Clevon’s Stammbaum gezeigt, in dem er schon 4 Kinder mit Trish und eins mit Britney hat.
Szenewechsel zu Trevor und Carol, die, wenig älter als zuvor, wieder ruhig auf dem gepflegten Wohnzimmersofa sitzen und nur kopfschüttelnd feststellen, dass sie derzeit keine Kinder haben könnten, nicht bei der derzeitigen Marktlage. Clevon’s Frau Trish hat unterdessen einen handfesten Streit mit der schwangeren Nachbarin, bei dem Bierflaschen fliegen, während um sie herum das laute Chaos der ungeordneten Unterschichtsgroßfamilie herscht.
In der nächsten Szene, wieder auf dem gepflegten Wohnzimmersofa, wieder etwas älter, stellt Carol, fest, dass man nun plane, Kinder zu haben, dies jedoch nicht gut funktioniere, was wohl an der mangelhaften Spermienqualität Trevors liege. Dieser versucht hilflos apolegetisch etwas zu erwidern, stellt dann aber nur fest, dass diese Bemerkung Carols nicht hilfreich sei. Die deutlich gealterte Carol hat schließlich noch einen traurigen Solo Auftritt, in dem sie verkündet, dass Trevor an einer Herzattacke gestorben sei, die er beim Masturbieren, um Spermien für eine künstliche Befruchtung zu gewinnen, erlitten habe. Aber immerhin habe sie ein paar Eier eingefroren, auf die sie zurückgreifen werde, sobald der richtige Mann daherkomme. Der Stammbaum der Nachfahren Clevons füllt inzwischen die ganze Kinoleinwand.
Diese 2-minütige Anfangssequenz des Films soll illustrieren, dass die menschliche Evolution nicht automatisch Intelligenz belohne. Ohne natürliche Bedrohung belohne die Evolution einfach diejenigen, die sich am meisten fortpflanzen, wodurch die Intelligenten zu einer bedrohten Art werden. Nach den monströsen Verbrechen, zu denen Sozialdarwinismus und Eugenik im 20. Jahrhundert geführt haben, ist es jedoch äußerst heikel darauf hinzuweisen, dass die Mechanismen der natürlichen Selektion auch auf den Homo sapiens wirken. Ein Ausschalten der natürlichen Selektion, bzw. eine Modifikation der Selektionskriterien, im Falle Idiocracy mit einer Begünstigung reduzierter kognitiver Leistungen, die mit einer deutlich höheren Reproduktivität einhergehen, bleibt möglicherweise über einige Generationen hinweg nicht folgenlos. Sollte der Mensch also doch versuchen in die eigene Evolution einzugreifen?
Selektionsprozesse in Wirtschaft und Handel
Den Mechanismen der natürlichen Selektion in der Evolutionsbiologie entspricht in der Wirtschaft theoretisch die konkurrenzbedingte Auslese. Einzelen Akteure in einem konkurrenzbasierten Wirtschaftssystem tragen ein hohes Risiko zu scheitern, wodurch jedoch diese Gefahr für den gesamten Wirtschaftszweig reduziert wird. Nassim Taleb hat für Systeme, die wenig fragil sind, das Wort „antifragil“ geprägt. Für einen antifragilen Wirtschaftszweig sei die Gastronomie ein gutes Beispiel. Einzelne Restaurants sind fragil und können, wenn die Kundschaft ausbleibt, nach kurzer Zeit wieder eingehen. Gleichzeitig gibt es in Städten wie Hamburg ein gutes Angebot an Restaurants. Diese konkurrieren miteinander, wodurch dem Besucher eine breite Auswahl an Restaurants mit vielen verschiedenen Angeboten zur Verfügung steht. Obwohl also das einzelne Restaurant durchaus fragil ist, stellt sich die Gesamtheit der Restaurants, das „Restaurantsystem“, als sehr antifragil dar (1).
Märkte und Marktmechanismen mit den dazugehörigen Selektionsprozessen sind also ein fester Bestandteil menschlicher Handelsinteraktionen. Allerdings sind vollkommen freie Märkte (entfesselte Märkte) auch frei von jeglicher ethisch-moralischen Wertung. Wenn zwei Akteure am Markt agieren und konkurieren, wird sich der Akteur durchsetzen, der mehr Profit macht. Ob das hierfür verkaufte Produkt für die Gesellschaft gut oder schlecht ist, spielt hierfür zunächst mal keine Rolle. Mathias Broeckers gibt hierfür ein anschauliches Beispiel, indem er 2 Geschäftsleute im Amerika Ende der 1940er Jahre vergleicht. Beide stehen in Erwartung einer Warenlieferung an den Docks von New Orleans. Sam handelt mit Zucker aus Lateinamerika, den er rafiniert und mit 30% Profit an einen Großhändler verkauft. Nach Abzug der Kosten für Anbau, Transport und Weiterverarbeitung macht Sam etwa 10% Gewinn. Dave arbeitet mit einem anderen Agrarprodukt, für das er auch Rohstoffe importiert, veredelt und an einen Großhändler weiterverkauft. Allerdings bekommt Dave 50-mal mehr für sein veredeltes Produkt, Kokain. Natürlich hat auch Dave Kosten für Anbau, Transport, Bestechungsgelder und Radargeräte zur Umgehung der Küstenwache. Nach Aufrechnung von Kosten und Gewinn verdient Dave mit jeder angelieferten Fracht etwa 100-mal mehr als Sam.
Um ein Gefühl für die Implikationen der Gewinnunterschiede zu bekommen, muß man sich eigentlich nur die folgenden Fragen mit gesundem Menschenverstand beantworten:
Wer ist besser im Geschäft? Sam oder Dave?
Wer ist bei den lokalen Banken beliebter? Sam oder Dave?
Wer spendet mehr für Politiker und Wohlfahrt? Sam oder Dave?
Wer kann sich die besseren Anwälte leisten? Sam oder Dave?
Wer könnte irgendwann die Firma des Anderen kaufen? Sam oder Dave?
Wer könnte bei der Übernahme mit Unterstützung von Bankern und Politikern rechnen? Sam oder Dave?
Wer bezahlt wohl eher die Gehälter der Experten- oder der Medienschaffenden? Sam oder Dave?
Welches Geschäft wird, wenn solche Entwicklungen über einen längeren Zeitraum von Jahrzehnten mit Wirkung von Zins und Zinseszins erfolgen, mehr gesellschaftlichen Einfluss gewinnen? Die Ökonomin Catherine Austin Fitts, die dieses Beispiel erdacht hat, ruft ausdrücklich dazu auf, zur Beantwortung dieser Fragen nicht auf Expertenmeinungen oder Medien zu hören, auch nicht auf sie (Fitts) solle man hören, sondern nur auf seine eigne Intutition (2).
Über die Motivation, die Staaten haben, Drogen zu verbieten, ließe sich ebenfalls eine Diskussion eröffnen, jedoch würde diese uns etwas zu weit vom eigentlichen Thema dieses Buches wegführen. Hier sei nur exemplarisch auf die Rolle, die Opium bei der kolonialen Unterwerfung Chinas durch die britische Krone bzw, die britische East India Company spielte hingewiesen. In Bengalen (Indien) wurde durch Sklavenarbeit großflächig Opium angebaut, welches von den Engländern nach China exportiert wurde um dort Chinesische Seide, Gewürze und Tee mit Opium zu bezahlen. Solange Opium nur ein Zahlungsmittel bzw. ein normales Tauschhandelsgut war, bewegten sich die Opiumpreise auf einem recht stabilen Niveau. Das Opium trieb viele Chinesen in die Drogenabhängigkeit und die Chinesen wollten sich vor dem kolonialen Opium schützen und deshalb erhoben sie Zölle. Schließlich verbot der Kaiser von China die Einfuhr von Opium und der chinesische Zoll vernichtete ankommende Opiumlieferungen. Daraufhin stiegen die Opiumimporte, die durch das kaiserlische Verbot besonders gewinnbringend waren an. Die Mohnpflanze selbst aber war nicht wertvoller geworden. Erst das Verbot hatte die Preise ansteigen lassen. Schließlich schickten die Briten Kanonenboote nach China um 1830 einen Krieg (Opiumkrieg) vom Zaun zu brechen. Nach mehreren Kriegsjahren gaben die Chinesen klein bei.
Nun könnte man hier einwenden, dass Drogenhandel per se nicht unmoralisch oder unethisch sein muss und dass auch Zucker inzwischen in viel zu hohen Mengen konsumiert wird und entsprechend gesundheitsbeeinträchtigend wirkt. Der Drogenhandel wurde nur durch die Tatsache, dass der Gesetzgeber Verbote gegen entsprechende bewustseinsverändernde Substanzen, aber nicht gegen (die Droge?) Zucker verhängt hat zu einem kriminellen Geschäft. Auch wären die Gewinmargen im Drogenhandel nicht so hoch, wenn er legal wäre. Aber stellen wir uns einfach vor, Dave wäre ein Waffenhändler, der durch seine Waffenlieferungen mörderische Kriege anfeuerte und dabei reich und mächtig wird.
Offenbar ist bei vollkommen entfesseltem Wettbewerb Skrupellosigkeit ein Wettbewerbsvorteil. Wenn sich also, wie in Idiocracy Menschen mit niedrigen Intelligenzmarkern deutlich stärker fortpflanzen als intelligente Menschen und sich im Wirtschaftsleben rücksichtsloses Verhalten durchsetzt, dann wird die Menschheit auf lange Sicht aus mehrheitlich sehr einfach strukturierten Menschen bestehen mit rücksichtlos-skrupellosen Wohlhabenden in den einflussreichen Oberschichten. Keine sonderlich erfreulichen Aussichten.
Die evolutionären Selektionsmechanismen des freien Marktes führen zu einer Effizienzsteigerung hinsichtlich der Kapitalakkumulation. Effiziente Prozesse implizieren einen optimalen „Return of Investment“ also möglichst hohe Gewinne bei möglichst niedrigem Aufwand. Lieferketten werden aufeinander abgestimmt, so dass ein Bauteil erst dann geliefert wird, wenn es verbaut wird, wodurch der Bedarf an Lagerraum, Lagerzeit und Lagerkosten möglichst gering wird („Just in time Kapitalismus“). Alles was unnötige Kosten verursacht wird wegoptimiert. Dies trifft auch für die Personalplanung zu. Eine Wirtschaft, die für Unternehmen selektiert, die möglichst wenig Aufwand betreiben, um Gewinne zu erzielen hat allerdings immer weniger Reserven. Im Gesundheitswesen kommt dieser Mangel an Reserven bei Epidemien mit erhöhtem Patientenaufkommen zum Vorschein. Durch Abbau von Überkapazitäten und das Zusammenlegen von Krankenhausstandorten haben private Krankenhauskonzerne den Betrieb von Krankenhäusern zu einem gewinnträchtigen Unterfangen gemacht. Im Normalbetrieb gewährleisten sie hiermit die Versorgung und streichen dabei Gewinne ein (im Gegensatz zu den öffentlichen Krankenhäusern, die nach Versorgungskriterien geplant, gebaut und betrieben wurden). Wenn sich durch eine Epidemie der Bedarf and Krankenhauskapazitäten plötzlich erhöht, zeigt sich der Nachteil eines Effizienzoptimierten Gesundheitssystems: Kaum Reserven, da diese im Normalbetrieb ineffizient sind und nur Kosten verursachen. Allerdings sollte man denken, dass die Kostzeneffizienz aus Sicht der Krankenhausbetreiber auch im Epidemiegeschehen erhalten bleibt, ja gar noch etwas optimiert wird, da nun endlich die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Maximalnutzung der Beatmungskapazitäten eintritt. Ironischerweise führte aber das Bereitstellen von Intensivkapazitäten in Erwartung der Pandemiewelle in vielen Ländern zur Reduzierung der Normalversorgung auf das Nötigste und führte zu entsprechenden Verlusten durch Bettenleerstand, sowie Kollateralmorbidität, z.B. aufgrund verschobener medizinischer Eingriffe. Durch die im Rahmen der Covid-19 Pandemie weltweit verhängten Ausgangssperren und Freiheitsbeschränkungen haben mittelständische Unternehmen und Kleinbetriebe, die als Rückgrat einer gesunden, der Gesellschaft dienenden Ökonomie gelten, besonders große Einbußen in Kauf nehmen müssen, während internationale Großkonzerne und Monopolisten weiter an Marktmacht gewonnen haben. Zudem gibt es immer weniger wirtschaftliche und gesellschaftliche Transaktionen, die jenseits digitaler Schnittstellen stattfinden. Bei bargeldlosen Zahlungsvorgängen besteht eine Schnittstelle zwischen der zwischenmenschlichen und der digitalen Sphäre. Durch Lieferdienste rückt auch bei der Warenübergabe, bzw. Annahme die digitale Sphäre zwischen die in Handelsinteraktion tretenden Menschen. Dennoch besteht bei solchen Prozessen noch eine klare Trennung zwischen Menschen und Maschine. Auch die Bedenken hinsichtlich der durch die Schnittstellen zur digitalen Sphäre entstehenden Datenspuren, beziehen sich (noch) auf die Instrumentalisierung durch Menschen, bzw. Netzwerke von Menschen. Solange der Macht- und Machtmißbrauchszweck durch Menschen über Menschen erfolgt werden die Maschinen Mittel zum Zweck bleiben. Ein Paradigmenwechsel besteht, wenn Maschinen aus eigenem Antrieb eigene Zwecke entwickeln und verfolgen.
2.
Grundlagen der Evolution der Arten
Als wichtigstes Grundlagenwerk der Evolutionsbiologie gilt Darwins „On the Origin of Species“ (Über die Entstehung der Arten), welches 1859 veröffentlicht wurde. Evolution braucht Zeit. Entscheidend für Darwins Einsichten war eine Zeitausdehnung hinsichtlich der Vorstellungen über die Erdvergangenheit. Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde das Alter der Erde auf religiösen Schriften beruhend nur auf Tausende von Jahren geschätzt. Der Naturforscher Edmund Halley schloss aus dem Salzgehalt von Flüssen und Meeren, dass die Erde deutlich älter sein müsse als 6.000 Jahre, begnügte sich aber im 18 Jahrhundert mit dieser Feststellung, ohne dass er selbst eine Zahl angab (3). Zu Darwins Zeiten war also das Alter der Erde noch unbekannt. Unabhängig von externen Lehrmeinungen hatte wohl aber Darwin selbst schon erkannt, dass die auf der Erde existierenden Arten wesentlich länger als 6.000 Jahre Zeit gehabt haben mußten, wenn seine Evolutionstheorie plausibel sein sollte. In „On the Origin of Species“ schätzte Darwin das Alter der Erde auf 300 Millionen Jahre. Vor 300 Millionen Jahren war die Übergangszeit zwischen Perm und Karbon. Die reiche Wald- und Sumpfflora der Karbonzeit bildet die Grundlage heutiger Kohlelagerstätten. Im Tierreich entwickelten sich immer mehr Amphibien, die mehr und mehr vom Wasser unabhängig wurden. Heute wird das Alter unseres Planeten auf etwa 4,6 Milliarden Jahre geschätzt.
Darwinismus und Lamarckismus
Der französische Naturforscher Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) formulierte bereits die Idee der Höherentwicklung von Arten. Darwins Ideen lagen somit gewissermaßen in der Luft. Alfred Russel Wallace (1823-1913) hätte wohl die in „Origin of Species“ von Darwin formulierten Konzepte ebenfalls entwickelt, wenn es Darwin nicht gegeben hätte. Zweifellos gibt es auch viele Übereinstimmungen mit Darwin in den Ansichten Lamarcks, weshalb, wenn vom Lamarckismus die Rede ist, im Wesentlichen die Unterschiede betont werden. So wird im Lamarckismus die Vererbung erworbener Eigenschaften betont. Solch eine Vererbung erworbener Eigenschaften wäre prinzipiell auch in kürzeren Zeitspannen denkbar als die durch natürliche Selektion erfolgende, sich über viele Generationen erstreckende Evolution.
Ein Musterbeispiel, um die Unterschiede zwischen Darwins und Lamarcks Theorie zu illustrieren, ist die Giraffe: Ihr langer Hals ermöglicht es ihr, das Laub in Baumhöhen zu fressen, an die keine anderen Pflanzenfresser der Prärie herankommen. Nach Lamarck hätten Giraffen vergangener Generationen sich immer wieder nach oben gestreckt und den Hals lang gemacht, wodurch dieser zu Lebzeiten allmählich länger wurde. Die durch das Verhalten im Leben ausgelöste Verlängerung würde demnach an die nächste Generation weitergegeben worden sein. Nach der darwinistischen Sicht entstand der lange Giraffenhals jedoch nicht durch Weitergabe eines antrainierten langen Halses an die nächste Generation. Vielmehr haben Giraffen mit langem Hals bessere Überlebens- und Reproduktionschancen und vererben somit häufiger ihre Eigenschaften an die nächste Generation als Giraffen mit kurzem Hals. Lamarck postulierte also, dass die Weitergabe erworbener, antrainierter Eigenschaften an die nächste Generation die Triebkraft der Evolution sei. Darwin hingegen postulierte, dass unterschiedliche Reproduktionswahrscheinlichkeiten von Individuen mit bestehenden Eigenschaften entscheidend seien.
Was heist eigentlich erfolgreich in der Evolution?
Die der Evolution zu Grunde liegende natürliche Selektion auf „Survival of the Fittest“ zu reduzieren greift zu kurz. Im Sozialdarwinismus wurde hieraus schlimmstenfalls ein natürliches Recht des Stärkeren abgeleitet. Dieses wurde z.B. von den Nationalsozialisten ideologisch instrumentalisiert und führte zu grässlichen, rassistisch mit vermeintlicher Überlegenheit der eigenen Rasse gerechtfertigten Greueltaten. Natürliche Selektion bedeutet lediglich, dass es Eigenschaften gibt, die es wahrscheinlicher machen, dass das Genom eines Organismus vollständig (asexuelle Vermehrung) oder zu 50% (sexuelle Vermehrung) an die nächste Generation weitergegeben wird. Diese Eigenschaften müssen nicht unbedingt solche sein, die wir gemeinhin als vorteilhaft ansehen (z.B. Stärke, Intelligenz). Massgeblich für „evolutionären Erfolg“ ist lediglich die Weitergabe des Genoms an die nächste Generation. Zuweilen hört man, dass sich in der Evolution die Eigenschaften durchsetzten, welche die Überlebenschancen erhöhten. Dies mag oftmals der Fall sein, insbesondere, wenn die Überlebenszeit mit der Zahl der Nachkommen assoziiert ist. (Ein Saisonbrüter der jedes Jahr Nachkommen hat ist evolutionär erfolgreicher, wenn er länger lebt). In einigen Fällen kann Verhalten das Überleben des Individuums verlängern, jedoch auf Kosten der Reproduktionsmöglichkeiten. Für Bienendrohnen ist die Paarung mit der Bienenkönigin tödlich, da das die Samen enthaltenden Geschlechtsorgan in der Bienenkönigin verbleibt und beim Paarungsakt der Hinterleib der Drohne tödlich verletzt wird. Drohnen, die sich nicht paaren, leben also länger (bis zum nächsten Herbst). Sie vermehren sich aber nicht.
Entscheidend für evolutionären Erfolg sind also Eigenschaften, die die Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöhen. Demnach wäre „Generation-persitance of the reproductively successful“ treffender gewesen als „Survival of the Fittest“. Der Begriff „Survival of t he Fittest“ wurde von dem englischen Sozialphilosophen Herbert Spencer (1820-1903) geprägt. Spencer war wohl einer der ersten, der Darwins Erkenntnisse gezielt auf menschliche Gesellschaften anwendete und somit den Sozialdarwinismus entscheidend mitbegründete.
3.
Ganz von Anfang an
Evolution durch natürliche Selektion braucht Zeit. Deshalb soll noch einmal der Zeitrahmen, in dem sich die Evolution abspielt, gesetzt werden. Die Frage, was vor dem Urknall war und was außerhalb des Universums ist, können wir getrost den Physikern überlassen. (Man kann an dieser Stelle einwenden, dass die Frage, was vor dem Urknall gewesen war sinnlos sei, da es vor dem Urknall noch keine Zeit gab).
Der Urknall fand vor etwa 13,8 Milliarden Jahren statt und seitdem dehnt sich das Universum aus. Unser Sonnensystem mit der Erde ist vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Die ersten Lebensformen entstanden vor etwa 3 Milliarden Jahren im Wasser. Die Hälfte der seitdem bis heute vergangenen Zeit blieb dieses Leben einzellig; erst vor etwa 1,5 Milliarden Jahren schluckte ein einzelliges Lebewesen ein anderes, welches jedoch nicht verdaut wurde, sondern in dem aufnehmenden Lebewesen endosymbiontisch weiterlebte und Teilfunktionen des kombinierten Organismus übernahm. Solche „Eukaryotenzellen“ bilden auch die Bausteine vielzelliger Organismen, wobei die einzelne Zelle in komplexen vielzelligen Organismen nicht mehr autonom sondern immer stärker funktionell spezialisiert ist (Organzellen).
Seitdem hat sich zunehmend vielzelliges Leben weiterentwickelt. Die etwa 4 cm langen Pikaia, die vor 525 Millionen Jahren im Wasser lebten, waren die ersten uns bekannten Vertreter im Stamm der Chordatiere (zu denen wir auch gehören). Chordatiere haben einen am Rücken über dem Darm und unter dem Neuralrohr liegenden Stützstaab (die Chorda) gemeinsam. Der Schritt an Land wurde von den ersten Amphibien vor etwa 300 Millionen Jahren unternommen. Das Zeitalter der Dinosaurier begann vor etwa 235 Millionen Jahren, dauerte etwa 150 Millionen Jahre und endete vor 66 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag, dessen 180 km durchmessender Krater in den 1990er Jahren vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan entdeckt wurde (der daraus abgeleitete Durchmesser des eingeschlagenen Kometen wird auf mindestens 10 km geschätzt). Um ein Gefühl für evolutionäre Zeitmaßstäbe zu bekommen wird gerne ein fiktiver Tag oder ein fiktives Jahr bemüht, da diese für uns sinnlich erfassbare Zeiteinheiten darstellen. In Tabelle 1 werden ein paar Meilensteine der Evolution in Verhältnis zu einem fiktiven Jahr gesetzt.
Tabelle 1: Einordnung von Meilensteinen der Erdgeschichte in einem fiktiven Jahr unter Aufschlüsselung des letzten Tages in Stunden und Minuten
Evolutionärer Meilenstein
Wann vor unserer Zeit?
Datum unseres fiktiven Jahres
Entstehung der Erde
4,5 Milliarden Jahre
Neujahr
Erstes Leben
3,0 Milliarden Jahre
2. Mai
Beginn Vielzelligen Lebens
1,5 Milliarden Jahre
31. August
Chordatiere
525 Millionen Jahre
18. November
Erste Dinosaurier
235 Millionen Jahre
12. Dezember
Aussterben der Dinosaurier
66 Millionen Jahre
25. Dezember
Anbruch des letzten Tages unseres fiktiven Jahres (31. Dezember)
Wann vor unserer Zeit?
Uhrzeit des letzten Tages
Letzter gemeinsamer Vorfahre Schimpanse – Mensch
6 Millionen Jahre
12:19 Uhr
Homo erectus
2 Millionen Jahre
20:06 Uhr
Homo sapiens
300.000 Jahre
23:25 Uhr
Neolithische Revolution
12.000 Jahre
23:58:36 Uhr
Öl- und Plastikzeitalter
250 Jahre
23:58:58 Uhr
Als Kind hat mich die französische Zeichentrickserie „Es war einmal der Mensch“ unheimlich beeindruckt. In der deutschen Fassung wurde die Titelmusik und die Abspannmusik von dem 2014 verstorbenen Musiker und Komponisten Udo Jürgens gesungen. Dieses kleine Musikstück hat bei mir eine unheimlich starke, nicht nur inhaltliche, sondern auch emotionale Erinnerung hinterlassen. Das flüsternd gesungene „Was ist Zeit“, dass auf „Tausend Jahre sind ein Tag“ folgte, löst heute allein in der Erinnerung noch Gänsehaut aus. Deshalb möchte ich auch noch diesen Masstab betrachten: Wenn 1000 Jahre einem Tag entsprächen, wären die Dinosaurier vor 66.000 Tagen (66 Mio. Jahren) ausgestorben, der letzte gemeinsame Vorfahre von Schimpanse und Mensch hätte vor 6.000 (6 Millionen Jahren) Tagen gelebt und der Homo sapiens wäre gerade mal seit 300 Tagen (300.000 Jahren) auf der Erde unterwegs, die meiste Zeit davon als Jäger und Sammler bis sich vor 12 Tagen (12.000 Jahren) die ersten Menschen zum Feldbau niedergelassen hatten. Öl zur Energieerzeugung würde der Mensch erst seit 6 Stunden (250 Jahren) verbrennen und erst seit etwa 5 Stunden (um 1804) läge die Weltbevölkerung über 1 Milliarde Menschen, seit weniger als einer Fussballspiellänge (um 1960) über 3 Milliarden und seit 13 Minuten (2011) bei über 7 Milliarden Homo sapiens.
Vom Stein zum Sein - Der Beginn des Lebens
Prozesse der Selektion spielen natürlich auch in der Astrophysik eine Rolle, jedoch wollen wir uns hier auf die Evolution des Lebens beschränken. Richard Dawkins im Jahr 1976 erschienenes Buch „The Selfish Gene“ kann wohl inzwischen auch als Grundlagenwerk der Evolutionstheorie gewertet werden (4).
Stabile, sich reproduzierende Molekülstrukturen
Vorraussetzung für die Entstehung des Lebens war die Entstehung stabiler Strukturen, die sich reproduzieren konnten, also mehr oder weniger identische (oder reziproke) Kopien von sich selbst herstellen konnten. Wenn Atome immer wieder aufeinandertreffen und hierbei stabile Wechselwirkungen eingehen, die in stabile Strukturen übergehen, nennen wir die entstehenden stabilen komplexen Gebilde Moleküle. Stabilität über die Zeit kann einerseits durch langfristiges Bestehen über die Zeit erreicht werden, oder durch Replikation bzw. Reproduktion, also das wiederholte Entstehen eines „Molekülmodells“. Das lange Bestehen über die Zeit ist zumindest in unserer Welt eher in unbelebter Materie zu finden. Das Bestehen über die Zeit durch Entstehen und Vergehen bzw. durch Replikation ist ein grundlegendes Merkmal des Lebens. Ein lebendes Sein ist dauerhafter, wenn es nicht von der Dauer des einzelnen Seienden abhängt, sondern als Konzept besteht, welches sich durch Replikation über die Zeit fortsetzen kann. Auf molekularer Ebene spielen sich ständig chemische Reaktionen ab, durch die Moleküle entstehen und vergehen. Dennoch würde man hier wohl nicht von Leben sprechen.
Wasser ist ein Beispiel einer aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffatomen bestehenden Molekülstruktur, die sich bewährt hat und immer wieder entsteht und vergeht. Nun ist Wasser (H2O) mit seinen zwei Wasserstoff- und dem einzelnen Sauerstoffatom recht einfach gebaut und kommt wohl durch die zufällige Affinität zwischen Wasser- und Sauerstoff zustande, die dazu führte, dass diese Atome unendlich oft, ewig und immer wieder zusammenfinden und sich an Stellen verbinden, die einfach sehr gut zueinander passen. Einen in den Molekülen angelegten Bauplan braucht es dafür nicht. Längere komplexere Moleküle werden in der organischen Chemie abgehandelt. Ihnen liegt die Tendenz von Kohlenwasserstoffverbindungen, Ketten auszubilden, zu Grunde. Diese können Atome wie Sauerstoff, Stickstoff oder Phopshor mit an Bord nehmen und durch Faltungen und Verzweigungen komplexe räumliche Strukturen ausbilden. Auch für die meisten organischen Moleküle braucht es keinen eingebauten Bauplan, da sie einfach durch „trial and error“ immer wieder unzählige Konstellationen und Verbindungen ausbilden, von denen halt manche sehr oft entstehen und andere seltener. Komplexe Kohlenstoffverbindungen werden in unserer heutigen Welt durch Lebensformen vom Bakterium bis zum Elefanten aufgenommen und verstoffwechselt. Auf der Erde vor 4 Milliarden Jahren gab es aber noch kein Leben, so dass entstehende Atom- und Molekülkonglomerate ungestört in allen möglichen und unmöglichen Kombinationen entstanden und vergangen. Vielfach gleiche Moleküle können also auch durch stochastisch angelegte affinitätsbedingte Kombinationshäufungen entstehen. Bei Kristallinem Wachstum ordnen sich solche vielfach gleichen Moleküle aneinander. Kristalline Strukturen liegen z.B. Metallen, Zucker, Salz und Schnee zu Grunde.
Mit zunehmender Komplexität kann man jedoch immer weniger erwarten, dass sich ein entsprechend komplexes Gebilde durch reinen Zufall immer wieder mit denselben Bausteinen in der immer wieder selben Konstellation ausbildet, ohne dass die Struktur der zukünftigen Kopie im bestehenden Molekül als eingebauter Bauplan angelegt ist. Auf molekularer Ebene muss es also durch Zufall zu Molekülen gekommen sein, die ihre eigene Struktur replizieren konnten und dabei einen in sich eingebauten „Bauplan“ abarbeiten. Richard Dawkins bezeichnete in „The selfish gene“ ein zufällig entstandenes Molekül mit der eingebetteten Fähigkeit, sich zu replizieren als „Replikator“. Vor 3-4 Mrd Jahren waren die Bausteine in der den Replikator umgebenden Brühe vorhanden und zeichneten sich durch bestimmte Affinitäten zu anderen Bausteinen des Replikators aus. Einige Affinitäten waren stärker, so dass besonders oft Kopien von Replikatoren entstanden, deren in direkter Nachbarschaft zueinander bestehende Bausteine eine besonders hohe Affinität zueinander hatten.
Um tatsächlich von der Umsetzung eines im Replikator strukturell angelegten Bauplans sprechen zu können, muss es zu Ablesemechanismen kommen, die z.B. die Reihenfolge von Molekülen im Replikator in Information zum Zusammenbau des Duplikatmoleküls verwandeln. Prinzipiell kann die im Replikator angelegte Information genutzt werden, um ein identisches Molekül mit identischen Bausteinen zu bauen. Stellen wir uns aber die Form eines Einzelbausteins vor, dann wird klar, dass eine identische Kopie dieser Form in den meisten Fällen kaum Bindungsmöglichkeiten zum Ausgangsgegenstück hat: Zwei Kugeln lassen sich nicht stabil verschränken. Eine Kugel liegt hingegen stabil in einer Kuhle. Zwei Schlüssel bilden keine stabile Verbindung aus, jedoch steckt ein Schlüssel stabil in einem passenden Schloss. Entsprechend hat sich für das Leben das Prinzip der negativen Abbilder durchgesetzt, wobei ein Molekül als Negativ aus nicht identischen Bausteinen, deren Anordnung und Reihenfolge durch die Positiv-Ausgangsbausteine im Replikator angelegt ist, entsteht. Vom Positiv wird also ein Negativabdruck gemacht, von dem wiederum ein Positivabdruck gemacht wird von dem wiederum ein Negativabdruck gemacht wird, ….usw.
Letzteres Positiv-Negativ-Replikationsprinzip hat sich im genetischen Code der Desoxyribo- und Ribo-Nukleinsäuren (DNS und RNS) durchgesetzt: Die Reihenfolge von 4 Nukleinsäuren, Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Uracil (U) stellen die Buchstaben des RNS Alphabets dar. In der DNS steht anstelle des U das Thymin (T).
Die durch Wasserstoffbrücken vermittelte Positiv-Negativ Affinität im genetischen Code besteht in der DNS zwischen G - C und A - T (bzw. C - G und T - A).
Die durch Wasserstoffbrücken vermittelte Positiv-Negativ Affinität im genetischen Code besteht in der RNS zwischen G - C und A - U (bzw. C - G und U - A).
Mit der DNS und der RNS entstanden also die Informationsträger, auf denen die Informationen des Lebens als genetischer Code verschlüsselt gespeichert werden. Für die Entstehung von Proteinen z.B. wird von der DNS eine RNS Kopie, die sogenannte mRNS (m=“messenger“; englisch für Bote) gebildet. Diese mRNS Abschrift wird dann zurechtgeschnitten (Splicen), so dass auf der proteincodierenden RNS nur noch die Informationen, die für die Produktion des entsprechenden Proteins notwendig sind, in der richtigen Reihenfolge codiert sind, wobei jeweils drei RNS-Basen für eine Aminosäure codieren. Die Proteinproduktion wird dann von Ribosomen vorgenommen, die an der mRNS Triplet für Triplet entlangwandern und dabei die Aminosäuren aneinanderreihen.
Wie kam es aber über die Jahrmillionen zu immer komplexeren Lebensformen? Nach den gängigen Definitionen von Leben, die man in Biologiebüchern findet, sind sich selbst replizierende Moleküle (DNS) noch nicht als Lebensform zu betrachten. Selbst Viren, die ja schon eine recht hohe Komplexität aufweisen können, wurden in meinem Biologieschulbuch in den späten 1980er Jahren als nicht lebend klassifiziert. Wenn man Stoffwechsel, Fortpflanzung und Evolution als Kriterium für „Lebewesen“ anlegt, so kann man konstatieren, dass Viren evolutionären Prozessen unterliegen, aber keinen eigenen Stoffwechsel haben. Zur Fortpflanzung sind Viren auf Replikationsapparate des infizierten Wirtsorganismus angewiesen, z.B. zur RNS-, bzw. DNS- Replikation und zur Synthese von Virusstrukturen wie einfachen Enzymen oder Strukturproteinen. Wenn Viren aber Wirtsorganismen mit höherer Komplexität benötigen wäre die Entwicklung komplexer Viren auf die Entwicklung komplexer (lebender?) Wirtsorganismen angewiesen, um das nackte (zukünftige) Virusgenom in Strukturen zu verpacken, die aus dem nackten Erbgut erst ein Virus machen. Viren können durch Freisetzung endogener viraler Erbgutsequenzen im Verband mit „entführten“ Strukturelementen aus komplexen Organismen entstehen (5). Gab es also Viren bevor es lebende Organismen gab oder sind Viren erst aus lebenden Organsimen entwichen? Dieses scheinbare Henne Ei Problem läßt sich überwinden, wenn man einfach von der binären Unterscheidung Leben vs. Nichtleben abkommt. Dem Virus ist es egal, ob seine Strukturen von etwas Lebenden oder Nicht-Lebenden repliziert wurden (natürlich kann einem Virus mangels Willen nichts egal aber auch nichts nicht egal sein, ein Virus kann nur sein).
Bakterien gelten als Lebewesen. Rein zahlen- (und massen-) mäßig sind Bakterien gar die dominanten Lebensformen auf der Erde. Allein im Darm eines Menschen leben gemäß Ed Yongs Buch „I contain multitudes“ schätzungsweise 100 Billionen (1014) Bakterien. Somit wären in meinen Darm etwa eine Millionen mal mehr mehr Bakterien als Sterne in unserer Galaxie (Milchstraße), deren Zahl auf 100 (108)-400 Millionen geschätzt wird (6).
Bakterien im Zusammenspiel mit Archaebakterien bildeten die Grundlage zur Entwicklung komplexen Lebens. Nach Aufnahme eines Bakteriums durch ein Archaeon (beides Prokaryoten, also Einzeller ohne Zellkern) entstand eine symbiotische Lebensform, aus der sich die Eukaryoten entwickelten (gemäß der Endobiontensynthesetheorie (7)). Eukarotenzellen haben einen Zellkern, der das Erbgut des Organismus enthält, sind kompartiert mit Organellen, welche verschiedene Stoffwechselaufgaben erfüllen und stellen somit wesentlich komplexere Zellen dar, die auch etwa 100-10.000-mal größer sind als Bakterien oder Archaen. Eukaryoten können einzellig sein (z.B. Amöben, Malariaparasiten), jedoch im Gegensatz zu den Bakterien auch vielzellige Lebensformen bilden. Pflanzen, Pilze und Tiere sind aus Eukaryotenzellen aufgebaut.
Erste Spuren von Leben auf der Erde
Die ersten (umstrittenen) Anzeichen für Leben auf der Erde gab es vor etwa 3,8 Mrd. Jahren. Anomalien in Kohlenstoffisotopen und Röhrchenbildung in Gesteinsproben aus Grönland wurden als Anzeichen für Oxidationsprozesse in einer hydrothermalen Umgebung interpretiert, die den Spuren ähneln, die Stoffwechselprozesse heutiger eisenoxidierender Bakterien im Gestein hinterlassen (8).
Etwas sicherer ist man sich bei der Bewertung von Schieferproben aus dem Gunflint-Massiv in Kanada. Die hier gefundenen Spuren einzelliger lebender Organsimen wurden als Spuren 1,9 Milliarden Jahre alter Cyanobakterien (Blaualgen) interpretiert. Cyanobakterien zeichnen sich im Gegensatz zu anderen Bakterien durch oxydierende Photosynthese aus. Ihnen wird deshalb eine wichtige Rolle beim Umbau der Erdatmosphäre von einer sauerstoffarmen zu einer sauerstoffreichen Atmosphäre, die vor etwa 3 Mrd. Jahren stattgefunden hat, zugeschrieben. (Demnach müssten die Cyanobakterien schon eine Milliarde Jahre länger auf der Erde gewesen sein, als es die Gunflint-Spuren bezeugen).
Die Sauerstoffanreicherung der Atmosphäre und in den Ozeanen machte den damals existierenden anaeroben Organismen den Garaus. Das entstehende Sauerstoffangebot öffnete der Evolution vollkommen neue Wege. Durch stufenweise Oxidation energiereicher Moleküle ermöglichte der entstandene Sauerstoff effizientere Möglichkeiten der Energiegewinnung für Leben und Lebensentstehung. Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf vielzellige Organismen, die ich zuweilen „komplexe Organismen“ nenne. Die einzelligen Prokaryoten möchte ich dennoch als wichtigen Bestandteil der Evolution anerkennen, auch wenn sie im Folgenden nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen werden wie die komplexeren vielzelligen Lebewesen.
Entstehung vielzelligen Lebens
Vielzelliges Leben entstand vor etwa 1,5 Mrd. Jahren: gemäß der Endosymbiontentheorie durch phagozytotische Aufnahme von Bakterien durch andere einzellige Organismen, wohl Archaebakterien, wobei die aufgenommenen Bakterien zu Organellen wie Mitochondrien wurden (bzw. zu Chloroplasten bei photosynthetisch aktiven Pflanzen und Algen) (9).
Wenn wir Evolutionsprozesse beschreiben haben wir oft nur die Tierwelt (Fauna) im Kopf, obwohl die Pflanzen aus physikochemischer Sicht bemerkenswerter sind. Denn sie entwickelten die Fähigkeit, die Sonnenenergie direkt umzusetzen. Einer der entstandenen biochemischen Prozesse, die von den Chloroplasten bewerkstelligte Photosynthese, ist heute für das gesamte Leben auf der Erde und auch für das Weltklima von zentraler Bedeutung. Pflanzen nutzen die Sonnenenergie zur Synthese komplexer Moleküle. Bei der oxygenen Photosynthese wird Kohlendioxid gebunden und Sauerstoff gebildet, der zum wichtigsten Reaktanten bei der Energiebereitstellung tierischen Lebens geworden ist und nach Umbau zu Ozon die Grundlage für die Ausbildung der Ozonschicht wurde. Tiere können keine Photosynthese betreiben, obgleich das von Tieren ausgeatmete CO2 wie oben beschrieben von den Pflanzen zur oxygenen Photosynthese genutzt wird (10). Tierische Stoffwechselprodukte können also auch die Zusammensetzung der Atmosphäre beeinträchtigen, wobei Nutztiere, insbesondere Rinder, neben CO2 in großen Mengen Methan produzieren, dem als potentes Treibhausgas eine Mitschuld am Klimawandel zugeschrieben wird.
Die kambrische Explosion des Lebens
Lange blieb das Leben einzellig und klein, bis in den Meeren des Kambriums eine regelrechte Explosion komplexen vielzelligen Lebens stattfand: In den 56 Millionen Jahren des Kambriums (vor etwa 541–485 Millionen Jahren) entstanden die Gründerorganismen der meisten noch heute erhaltenen Stämme vielzelliger Tier- und Pflanzenstämme (Phyla), wie zum Beispiel die Chordatiere, deren Unterstamm die Wirbeltiere bilden. Was zu dieser Explosion des Lebens geführt hat, lädt zu Spekulationen ein. Ein Anstieg des atmosphärischen Sauerstoffs in den Jahrmillionen vor dem Kambrium mag die Grundlage für die Entwicklung energieintensiverer Daseinsformen geschaffen haben. Die Mechanismen der natürlichen Selektion wurden raffinierter und es entstanden Jäger-Beute Interaktionen, was wiederum auf Seite der Jäger als auch der Beute zur Herausbildung effektiverer Sinnesorgane führte. Jäger, die ihre Beute besser detektieren konnten (z.B. durch optische Wahrnehmung -Augen) gewannen hierdurch einen Selektionsvorteil, ebenso wie Beutelebewesen, die Bedrohungen besser erkennen und abwehren konnten. So bildeten sich ökologische Nischen mit komplexen Interaktionen zwischen den Lebewesen aus. Aber auch innerhalb der Lebewesen kam es zusehends zu Spezialisierungen von Organen und Körperteilen sowie deren Zellen.
Die Trilobiten, die eine sehr erfolgreiche Klasse im Arthropodenstamm (Gliederfüßer) waren und etwa 250 Millionen Jahre lang in allen Meeren der Welt lebten, entstanden im Kambrium. Anhand der Trilobiten läßt sich die Spezialisierungstendenz mit Entwicklung spezialisierter Organe und Körperteile aufzeigen. Trilobiten hatten Beine zur Fortbewegung, Augen zur Lichtwahrnehmung und somit auch Nervensystemstrukturen zur Prozessierung der mit optischen Wellen einhergehenden Informationen aus der Meeresumwelt. Die Umwandlung von Energie war nicht mehr nur ein rein biochemischer Prozess, sondern wurde durch verschiedene, spezialisierte Organe bewerkstelligt. Für die Aufnahme von Nahrung(senergie) hatten Trilobiten Mundöffnungen von denen aus die Nahrung (z.B. Würmer und Seegurken) in ein Verdauungssystem gelangte, wo sie aufgespalten, brauchbare Nahrungsbestandteilen aufgenommen und der Rest ausgeschieden wurde. Zudem hatten Trilobiten ein Exoskelett, das dem Organismus Stabilität, aber auch Schutz bot. Trilobiten gehörten zum Stamm der Arthropoden, wie heutige Insekten, Krebse, Tausendfüßer und Spinnentiere. Die Trilobiten dominierten die Kambrischen Meere, aber auch die Meere der folgenden Erdzeitalter weltweit, bis Sie vor etwa 250 Millionen Jahren dem größten Massenaussterben komplexen Lebens zum Opfer fielen. Auf Abbildungen, die basierend auf reichhaltigen Fossilienfunden gezeichnet wurden, erinnern Trilobiten im Aussehen am Ehesten an heutzutage lebende Asseln.
Exkurs: Die präkambrische Explosion des Lebens