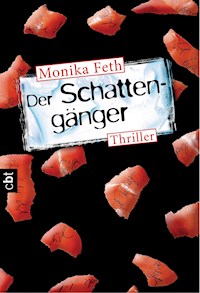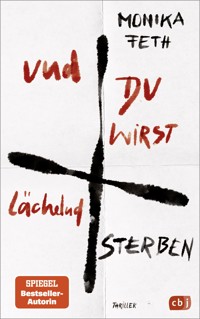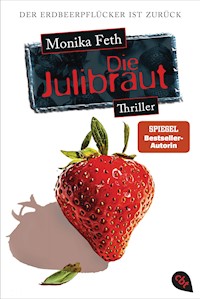9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Nachdem wir ausschließlich über die unerträglichen Leute geredet haben, die sich dem Leistungszwang beugen, nachdem wir uns über dieses Problem bis zur Empörung erhitzt haben, verabschiedet er sich, weil er Magenschmerzen vor Gewissensbissen hat, drei Stunden lang nicht an seinem Schreibtisch gesessen zu haben.» Vor einer Prüfung zu stehen heißt, sich in einer Ausnahmesituation zu befinden. Monika Feth gelingt es, in erzählten Momentaufnahmen jene gefährlich hellsichtige, erkenntnisträchtige Empfindsamkeit zu erfassen, die fast jeder einmal erlebt – und hastig wieder ablegt, zusammen mit der Prüfung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Monika Feth
Examen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Nachdem wir ausschließlich über die unerträglichen Leute geredet haben, die sich dem Leistungszwang beugen, nachdem wir uns über dieses Problem bis zur Empörung erhitzt haben, verabschiedet er sich, weil er Magenschmerzen vor Gewissensbissen hat, drei Stunden lang nicht an seinem Schreibtisch gesessen zu haben.» Vor einer Prüfung zu stehen heißt, sich in einer Ausnahmesituation zu befinden. Monika Feth gelingt es, in erzählten Momentaufnahmen jene gefährlich hellsichtige, erkenntnisträchtige Empfindsamkeit zu erfassen, die fast jeder einmal erlebt – und hastig wieder ablegt, zusammen mit der Prüfung.
Über Monika Feth
Monika Feth, 1951 in Hagen geboren, hat in Bonn Germanistik und Anglistik studiert und im Feuilleton einer Tageszeitung gearbeitet. «Examen» war ihre erste Buchveröffentlichung.
Inhaltsübersicht
Wir leben auf einem laufenden
Band, und es gibt keine Hoffnung,
daß wir uns selber nachholen und
einen Augenblick unseres Lebens
verbessern können. Wir sind das
Damals, auch wenn wir es verwerfen,
nicht minder als das Heute –
Die Zeit verwandelt uns nicht.
Sie entfaltet uns nur.
Max Frisch
Oktober
Ich lebe in einer Ausnahmesituation. Jeder sagt das von sich. Was daran liegen mag, daß es andere Situationen überhaupt nicht gibt.
Nach Tagen des vollkommenen Alleinseins kein Gespür mehr für die Gegenstände, geschwächte Wahrnehmungskraft, Scheu vor Gesprächen, Angst, dem Gegenüber in die Augen zu sehen.
Und Stunde um Stunde gleitet mir, während ich über den Büchern sitze, der Maßstab für die Dinge ein Stück weiter aus den Händen.
Traumblütler nachts. Die Arbeit, die Phantasien tötet, setzt neue Phantasien frei. Nicht, solange der Tag dauert. Da schale ich mich in den Prüfungsvorbereitungen ein, die mich in Atem halten. Aber in den Nächten, die ohne Bewußtsein sind. Da fallen die Schranken, die sich tagsüber aufrichten, zu Boden, und ich erlebe alles, was erlebbar ist. Ich muß aufpassen, daß ich mich nicht darauf einlasse, ein nächtliches Ersatzleben zu führen.
Morgen kommt M., der für einige Tage bei Freunden zu Besuch gewesen ist, zurück. Damit wird die gefährliche Versuchung aufhören, der Arbeitswut nachzugeben.
Ich bemerke an mir eine verstärkte Tendenz, mich an Vergangenes zu erinnern, möglicherweise, um die Gegenwart wirklicher zu machen. Es fallen mir Begebenheiten ein, oft Kleinigkeiten, an die ich jahrelang nicht gedacht habe, und sie befallen mich mit einer Deutlichkeit, als sei es vorgestern gewesen, daß ich sie erlebte. Das einzige Bild, das ich von Onkel K. besitze, habe ich auf meinen Schreibtisch gestellt, sozusagen meine Vor-Vergangenheit. Als hielte ich mich am Damals fest, um erwachsen sein zu können.
In der Stadt habe ich einen Bekannten getroffen, der vor kurzem Examen gemacht hat. Er erzählte mir, immer noch aufgebracht, man habe ihm in der mündlichen Prüfung die Frage gestellt, welches Kleistsche Drama denn wohl mit dem Wort ach ende. Einen Freund von ihm habe man aufgefordert, die Werke Schillers in chronologischer Reihenfolge zu nennen. Bei einer anderen Prüfung habe der Prüfer eine Literaturgeschichte aufgeschlagen und, mit dem Zeigefinger wahllos über den Seiten kreisend und schließlich auf einen gefundenen Punkt stechend, ausführliche Stichproben durch die Jahrhunderte gemacht. In dieser Art und Weise seien alle Prüfungen abgehalten worden, von denen er gehört habe. Und soundsoviele (ich habe die Zahl, die er nannte, vergessen, aber es war eine sehr hohe) seien durchgefallen, weil sie mit diesen Fragestellungen nichts anzufangen gewußt hätten.
Das kann nicht sein. Vielleicht redet er nur deshalb so, weil er schlecht abgeschnitten hat. Er erwähnte allerdings auch den Vorfall mit dem Mathematikstudenten, der im Verlauf seiner Prüfung den Beisitzer gefragt haben soll, ob er sich in einem Quiz oder im Examen befinde, und das hatte ich schon von mehreren Seiten gehört.
Ich erfinde Geschichten gegen mein Heute, das mich bedrückt. An diesen Geschichten möchte ich mich satt essen, um mit vollem Bauch mich wieder in mir zurücklehnen zu können.
Die alte Frau reicht der Schalterbeamtin ein kleines Bündel zerknüllter, mit einem Gummiband zusammengehaltener Geldscheine. Auf die Frage der Beamtin, was sie damit solle, erklärt die Frau, sie wolle das Geld umgewechselt haben in frische, glatte, schöne Scheine, denn auf den abgenutzten könne man ja die Bilder nicht mehr erkennen. Als ihr Wunsch erfüllt worden ist, verpackt sie die neuen Geldscheine mit umständlicher Sorgfalt, genau darauf achtend, daß sie keinen verknickt, und geht lächelnd weg.
Der alte Mann in Prag, der mich auf der Straße ansprach und mir anbot, mich durch das wirkliche, das unfrisierte Prag zu führen. Die bittere Genugtuung dieses Mannes, der gegen die Kälte geflickte, verschiedenfarbige Fäustlinge trug und keinen Schal besaß, über mein Erschrecken, mein Unwissen. Zwei Tage lang hielt ich mich von der Reisegesellschaft entfernt, um ihm zu folgen. Dabei das Bewußtsein, einen Menschen auf Anhieb zu lieben.
Ich kannte ein Mädchen, das in bestimmten Augenblicken Angst vor dem eigenen Spiegelbild bekam.
Das Unverzeihliche an der Schulzeit ist, daß sie einem Goethe derart verhaßt machen, daß man Jahre braucht, ihn wiederzufinden.
Kaum habe ich mich ihm zögernd genähert, da muß ich ihn mir auch schon aufs neue verleiden, indem ich ihn als eines der Prüfungsgebiete aussuche. Über Schriftsteller, die man für sich behalten möchte, sollte man nicht arbeiten.
Mein Großvater: «Mach ein Hobby nie zu deinem Beruf, Kind, die goldenste aller Lebensregeln, glaub mir.» Ich sehe ihn noch deutlich, wie er mit erdverschmutzten Händen und aufgekrempelten Ärmeln vor mir in seinem Garten stand und einen weiten Bogen wies. «Ich wollte immer Gärtner werden, das wäre mein größter Wunsch gewesen. Aber da hätte sich die Begeisterung an diesem allen nicht gehalten.» Er blieb in der Fabrik. So konnte er die Arbeit verächtlich geringschätzen und sich die Freude aufbewahren.
Als sie mit dem zweiten Kind schwanger war, verspürte sie fortwährend Hunger auf Waschpulver. Man versteckte es vor ihr, weil man ihrer Selbstbeherrschung nicht traute und um das Leben des Kindes fürchtete.
Sich selbst als Fiktion begreifen – Dialog mit dem Füllfederhalter.
Die Trennung zwischen mir und der schreibenden Hand. Manchmal führt sie die Gedanken aus, oft ist sie ihnen voraus.
Etwas Niedergeschriebenes lebt plötzlich neben mir und ganz für sich allein.
Auf weichem Holz möchte ich schreiben, statt auf Papier, und dabei den Waldgeruch in der Nase haben.
Eine ähnliche Sucht nach Natürlichkeit ist der Grund für den immer frischen Blumenstrauß, der auf meinem Schreibtisch steht, wie um die Arbeit auf eine vorgestellte Wiese zu verlegen.
Die kühle Vertraulichkeit beim Essen an Tischen, die mit knirschenden Wachstuchdecken überzogen sind. Der Finger, der ein Muster darauf zeichnen will, bleibt stecken mitten in der Fahrt.
Oft in letzter Zeit der Wunsch, eine Schwangerschaft zu erleben. Die Koketterie mit dem dicken Bauch. Unvorstellbares als möglich erfahren – nur – das Kind will ich nicht haben.
Ich habe mich in möblierten Zimmern immer wohl gefühlt. Ich lebte in ihnen in festem Abstand zu den Gegenständen, in der Gewißheit, jederzeit die Koffer packen zu können, um wieder wegzuziehen. Seit ich in einer Wohnung lebe, habe ich Freundschaft mit den Möbeln und Wänden geschlossen. Ich besitze wenig, aber gerade genug, um es nicht mehr in Koffer verstauen zu können. Wahrscheinlich sitze ich nun fest und kann mich nicht mehr ohne Bedauern trennen. Es ist hier alles viel zu sehr mit mir verwurzelt.
Bei der Besprechung der Buddenbrooks fragt die Lehrerin die Schüler, welche der handelnden Figuren am lebensnahesten getroffen sei und erhält von einem der Schüler die Antwort: Hanno.
Heute lese ich zerrissen, zerfahren, ohne Konzentration. Zwischendurch habe ich zum erstenmal alle Möbel mit der Politur abgerieben, die meine Mutter neulich mitgebracht hatte, weil sie der Anblick unserer glanzlosen Stücke erbarmte. Jetzt stinkt die ganze Wohnung, und mein Kopf brummt. Außerdem hat mich diese Ausflucht nur noch weiter von der Arbeit vertrieben.
Ich hatte ihn für einige Tage besucht. Eine Stunde nach meiner Ankunft sagte er mir, er freue sich auf den Augenblick, in dem meine in seiner Wohnung verstreuten Sachen ihm das Gefühl von Zweisamkeit vermittelten. «Meine Wohnung ist erst in dem Moment bewohnt, in dem du sie dir zu eigen machst.» Ich war neidisch auf seine Empfindung, weil ich sie nie hatte, wenn er mich besuchen kam. Im Gegenteil – mein Zimmer wurde mir durch seine unzerteilte, durch nichts zu unterbrechende Anwesenheit unerträglich.
Und so machte er aus mir eine Belebung seiner toten Existenz, die Wirklichkeit seiner Hoffnungen.
Er gönnte mir nur die notwendigsten Augenblicke des Alleinseins – zum Beispiel wenn ich auf die Toilette ging, und ich bin sicher, daß er sich selbst dadurch von mir bestohlen fühlte.
Seine Vitalität erdrückte mich und tötete jedes Verlangen in mir ab.
Eines Abends las er mir aus seinem neuen Roman vor. Ich erkannte mich in Bildern wieder, die ich ihm vorwarf. Seine Wahrnehmungen meiner Person waren so weit von meinem Wesen entfernt, daß mir Scham das Atmen schwermachte. Ich war zum literarischen Objekt seiner abstrusen Neigungen geworden.
Der Tod unserer Beziehung lag in der auf wenige Sekunden begrenzten Wahrnehmung seiner Art des Essens. Die Augen halb geschlossen, mit fliegenden Blicken nach links und rechts, gehetzt von etwas Unsichtbarem, verschlang er das Essen wie ein Tier, das fürchtet, um die Speise betrogen zu werden.
Niemand begriff diesen Grund unserer Trennung. Nun finde ich eine nachträgliche Rechtfertigung bei Canetti: «Alles, was gegessen wird, ist Gegenstand der Macht.» Ich weiß, warum ich ihn verlassen habe.
Die Angewohnheit, mit der Zunge zu schnalzen, wenn ihm etwas gefiel – selbst beim Lesen besonders gelungener Stellen eines Romans. Der Ekel ballte sich in der Magengegend zusammen, wanderte von dort in den Hals und machte mir übel.
Sein kommst du ins Bett? am Abend erschien mir anmaßend und erdrückend. Ich sagte es ihm, und selbstverständlich begriff er es nicht. Er lag da, schaute trübsinnig und wie ein Kind, schielte aus den Augenwinkeln, wie um Verzeihung bittend, und erreichte es jedesmal, daß ich mich durch Zärtlichkeit freikaufte vom schlechten Geschmack meiner Schuld.
Übrigens wiederholte sich dieses Spiel jeden Abend.
Er schrieb damals an einer Arbeit, die sehr umfangreich zu werden versprach. Jedes einzelne beschriebene Blatt zwängte er in eine Klarsichthülle und heftete diese wiederum in einen großen Ordner. Ich sagte ihm «du tötest deine Arbeit, und stückweise heftest du dich selbst ab», er antwortete «wie seltsam du empfindest.»
Seine Bemerkung nach einem Abend mit seinen Freunden, er sei stolz auf mich, legte sich auf mich wie eine ungeheure Beleidigung. Als ich das spürte, nahm ich ihn in die Arme, ganz fest, und sagte, daß mich das freue. Von da an wuchs mein Schuldbewußtsein.
Eine Zeitlang dachte ich mir nichts dabei, mich immer so weiterzuspielen.
Ich bin dutzendmal gestorben in dieser Zeit, und er nahm keinen meiner Tode wahr, glaubte vielmehr, mich aufwecken zu können für das, was er Schönheit nannte, dabei war Schönheit der letzte meiner Tode.
Es gelingt mir nicht, mich an die Stunden zu erinnern, die mich aufhoben. Ich glaube, der Beginn meiner Liebe zu ihm war der Augenblick, in dem ich in seinen Augen zum erstenmal die Erkenntnis sah, daß ich litt. Er fügte sich in meine trostlose Zeit ein. Traurigkeit, Verzweiflung und Todessucht – er nahm den Wechsel in mir hin, ohne mich von der Würde des Lebens überzeugen zu wollen. Damals …
Erinnerungen – sie entfernen mich von meiner neuen Wirklichkeit und bringen mich ihr näher. Oft ein Erschrecken: war das ich, die diese Erlebnisse hatte? War ich es wirklich? Oder war ich es damals und bin heute nicht mehr das, was ich mich selbst zu nennen gewohnt bin? Ich merke deutlich, daß ich so nicht weiterkomme. Innerlich gerate ich mir von Tag zu Tag mehr abhanden.
Den Gedanken Raum geben und Luft. Sie nicht beschneiden, bewerten, aussortieren. Mich öffnen und offenhalten für die gedankliche Willkür und das Gedachte, so wie es kommt, gegen die mathematische Ordnung meines Tagesablaufs setzen.
Das gehört mit zu den Dingen, die ich mir für das Examensjahr vorgenommen habe. Ich will Obacht geben auf mich. Die unersättliche Situation nicht über die Ufer treten lassen. Einen hohen Deich bauen gegen die Ängste, die nicht ausbleiben werden. Nicht ganz abrutschen von dem Leben, das ich gewohnt bin. Die Täglichkeiten beibehalten. Weiter an meinen Texten schreiben. Eigene Worte suchen, um ein Gegengewicht zu schaffen, an das ich mich anlehnen kann, wenn es notwendig wird.
Nur einmal dachte ich nicht nur an Selbstmord, sondern bereitete ich ihn vor. Ich begann damit, meine Verhältnisse zu ordnen und versuchte, einen Abschiedsbrief an die Eltern zu schreiben. Nach wenigen Zeilen, in denen ich mich von der Theatralik solcher Wendungen wie «ich kann nicht anders … verzeiht mir» hemmen ließ, beschloß ich, die Selbstmordabsichten erst noch einmal zu überschlafen. Am nächsten Morgen war ich fähig, darüber zu lachen. Diese ironische Haltung meiner Stimmung gegenüber werfe ich mir noch heute mit einiger Beschämung vor.
Ich beneide die Leute um die Sicherheit, mit der sie ihr Gefühl füreinander Liebe nennen. Max Frisch sagt, lese ich gerade, Liebe sei der Zustand, in dem man sich kein Bild vom anderen mache.
Ich konnte sie alle beschreiben, deutlich und sehr präzise. Niemand erschien mir unbegreiflich oder unfaßbar. Die ersten Tage waren immer so etwas wie eine schwindelerregende Ausnahmezeit, in der ich Glück ahnte. Aber sobald ich mich näher mit ihnen befaßte, verschwand das Reizvolle an ihnen. Sie wurden mir ganz rasch gefährlich vertraut. Jedesmal bin ich in der Ahnung des Großen (und was sonst als Größe sollte ich erwarten, nach allem, was darüber geredet wurde) steckengeblieben. Der Faden, der mich hätte weiterführen sollen, riß immer an einer bestimmten Stelle. Solange das Verhältnis dauerte, bewegte ich mich innerhalb des Knotens am Ende des Fadens, und dieser Knoten, der geheimnisvoll verschlungen war, entwirrte sich allmählich und auf enttäuschende Weise.
… sagt er, sagte auch der andere und der davor.
Mit zwei linken Schuhen durch düstere Straßen laufen, um wieder leichtfüßig zu werden.
Einmal war ich ein paar Jahre lang mit einem Mann zusammen, der allen Pessimismus der Welt in sich zusammenlaufen ließ. Trotz des wenigen Geldes, das wir besaßen, reisten wir soviel wie möglich. Sobald wir in irgendeiner fremden Stadt ankamen, überfiel ihn die Enttäuschung, weil kein Ortswechsel ihn über seinen desolaten Zustand hinwegtäuschen konnte. Alle Menschen sind überall dieselben. Mit dieser Feststellung, die er jedesmal mit neuer Betonung traf, erledigte sich für ihn jede unbekannte Stadt, jedes erstgesehene Land. Er lebte die einzelnen Städte rasch ab, und ich hatte Mühe aufzupassen, daß mir meine Begeisterung nicht in den Händen zerschmolz.
Er kam für ein paar Tage. Weil mein Zimmer sehr klein war, und weil es in dem überquellenden Schrank keinen Platz mehr gab, mußte ich seine Reisetasche in der Nische des Waschbeckens unterstellen, wo sie sich grünspeckig und ausgebeult den Füßen entgegenblähte. Bald nach der Begrüßung arbeitete er geschäftig daran, seine Waschutensilien gleichmäßig unter meine zu verteilen. Erst nachdem er überall seine Spuren eingedrückt hatte, kam er zur Ruhe.
Sein Rasierapparat saß wie eine fette Schnecke neben meinem Kamm, seine Zahnbürste lehnte sich mit unverfrorener Selbstverständlichkeit an meine an, und sein Rasierwasser thronte in quadratischer Behäbigkeit über allem. Mein Zimmer geriet in Atemnot. Es verlor seinen Geruch und nahm widerstandslos seinen an, bis ich es nicht mehr erkannte.
Er dehnte sich in einer unüberschaubaren Großflächigkeit aus, durch mein Zimmer hindurch und über mich hinweg und drängte sich überscharf meinen Sinnen auf. Nichts entging mir an ihm, nicht die übertrieben ausladenden Gesten, nicht sein schnappender Stimmfall, nicht die weißgrauen Schuppen, die ihm wie Pilze auf den Schultern wuchsen, nicht das Räuspern, das den einen Satz zum anderen führte, nicht das morastige Kaugeräusch, wenn er etwas aß, und er aß ohne Unterbrechung irgendwelche Dinge, ebensowenig die zuckenden Schluckbewegungen seines muskulösen Halses. Jede seiner Bewegungen, die zu großartig waren für das winzige Zimmer, schmerzte, und nach wenigen Stunden bereits war mein Mund trocken vor Anstrengung.
Ich neidete ihm den Platz in meinem Bett, geriet in faserige Ungeduld bei seinen unwillkürlichen Schlafgeräuschen. So weit wie möglich rückte ich von ihm ab, versuchte, Fremdheit zwischen uns zu legen, um meinem Körper wieder nahezukommen. Seine Hand hörte auch mitten im Schlaf nicht auf, nach mir zu suchen und fiel auf mir nieder, wenn sie mich fand.
Kaum aber waren seine Sachen und er wieder fort, zerplatzte das Engegefühl, und Betretenheit vor dem Alleinsein ließ mich die Abwehr, für die ich mich schämte, gegen die ich aber doch nichts tun konnte, bereuen.
Der Mann, um den es geht, ist austauschbar.
Für diese Erlebnisse hielt meine Mutter den Mythos von dem Richtigen bereit.
Das Teelicht im Stöfchen erlosch langsam, und ganz unvermittelt hatte ich das Gefühl: so muß es sein, wenn man vom einen auf den anderen Augen-Blick erblindet.
Manchmal, wenn ich mich fürchte weiterzuleben, erkenne ich die Ausweglosigkeit, denn die Furcht zu sterben ist noch größer.
Heute habe ich mir rote Tinte gekauft, um das Schreiben intensiver zu machen. Gerade habe ich mich gefragt, warum ich einen roten Tintenklecks nicht mit Blut in Verbindung bringe.
Im Zimmer unter mir dröhnt ein Staubsauger. Das scheppernde Pfeifgeräusch dringt durch die Decke bis herauf zu mir und läßt mich ungehalten werden wie früher, wenn meine Mutter bei weit geöffneten Fenstern und zur Seite gerückten Möbeln Hausputz machte. Sie saugte immer mit wütender Besessenheit, als wolle sie alles in den Räumen fortwirbeln, auch mich. Und es gab keine Stelle, die sie verschonte, keinen Platz, an den ich mich hätte zurückziehen können.
Mein schönstes Erlebnis in dieser Woche war das Vertrauen der Bäckersfrau unten in dem kleinen Laden, als sie mir die eingekauften Sachen mitgab, obwohl ich das Geld vergessen hatte. Sie fragte nicht einmal nach meinem Namen und kennt auch meine Adresse nicht, weiß nur, daß es irgendwo in der Nähe sein muß, weil ich oft bei ihr einkaufe. Der Vorsatz, ihr gleich am nächsten Tag das Geld vorbeizubringen.
Seit ich mich an regelmäßiges Arbeiten gewöhnt habe, betrachte ich einen Tag, an dem ich nicht wenigstens einmal in ein Buch hineingeschaut habe, als verloren, und das erscheint mir bedrohlich. Dabei trenne ich scharf zwischen Literatur und Fachliteratur. Das eine ist mir Notwendigkeit, das andere Zwang.
«Ich kann mich nicht mit dem Studentsein identifizieren» – das ist der Satz, den ich während des Studiums am häufigsten gehört habe. Dabei drückt gerade er aus, daß der Prozeß der Anpassung bereits vollzogen ist. Und dennoch laufen sie weiterhin unter diesem Baldachin daher.
Warum kann mir die Arbeit, die ich zu tun gezwungen bin, nichts geben? Warum quält sie mich so?
Die Demonstrationen, an denen ich mich beteiligt habe, habe ich nicht gezählt, ebensowenig die Flugblätter, unter die ich einen dicken Namenszug setzte. Ich habe mit einer Frau zusammengelebt, die einer radikalen (?) Vereinigung angehörte, und ich saß unter den Zuschauern bei den Prozessen, in die sie verwickelt war. Bald sollte ich daran denken, mir Rechtfertigungen zurechtzulegen, denn nach dem Examen werde ich sie brauchen.
Ihre Akten-Laufbahn begann ganz unscheinbar mit einer Hörsaalbesetzung. Die Alteingesessenen entwischten der Polizei geübt, sie aber, träge wie sie ist, brauchte zu lange, um die Situation zu durchschauen. Als sie endlich begriff, um was es ging, und der Tür zudrängte, war es auch schon zu spät, und sie sah sich eingekeilt.
Um ihre Strafen bezahlen zu können, arbeitete sie in den Semesterferien als Übersetzerin. Dabei ist sie dann geblieben, die Schullaufbahn hatte sich wie von selbst erledigt.
Politik bedeutete für sie ein Mittel zur Verständigung. Heute schweigt sie.
Das Fragezeichen ist die mir gemäße Ausdrucksform. Ich bestehe nur zu einem geringen Teil aus Aussagen.
E. hat es noch nie länger als wenige Minuten in einer Kirche ausgehalten, weil er das Leiden, das vom Kreuz symbolisiert wird, nicht ertragen kann. Der einzige unter meinen Freunden, der Symbole nicht anerkennt.
Ich erinnere mich an die gewundenen Erklärungen eines Geistlichen, der uns Schülern die Vorgänge bei der Geburt Christi nahebringen wollte, ohne den Mythos der Jungfräulichkeit Marias zu verletzen. Das Kind, meinte er, sei im entscheidenden Augenblick transparent geworden.
Weil ich lachen mußte, bekam ich eine Strafe.
Bewunderung für Schriftsteller, die es fertigbringen, an einem bestimmten Punkt ihres Lebens ihre gesamten Manuskripte zu vernichten.
Auf einer Parkbank in meiner Heimatstadt fand man neulich die Leiche eines Studenten, der sich erschossen hatte. In der Brusttasche seines Mantels steckte ein Zettel mit nur einem Satz: «Seit ich Schopenhauer gelesen habe, ist mein Leben sinnlos.»
Die Nachbarin meiner Eltern: «Sagen Sie, ist das nicht furchtbar? Kann man das überhaupt begreifen, daß ein blühender junger Mensch sein Leben für ein Buch wegwirft?»
Ich rauche, weil es mir schlechtgeht, und es geht mir schlecht, weil ich rauche.
Das Sympathische an Thomas Mann: daß er bisweilen nur aß, um wieder Lust auf eine Zigarette zu bekommen.
Nur rauchende Schriftsteller scheinen dem Rauchen in ihren Werken ein Denkmal zu setzen. Den Zauberberg las ich zu einer Zeit, in der ich mir das Rauchen abgewöhnen wollte. Nachdem ich das Buch zur Hälfte gelesen hatte, konnte ich der Versuchung nicht mehr widerstehen und kaufte mir ein Päckchen Zigaretten.
Der Traum einer Freundin, die über Shaw arbeitet und am Tag zuvor gelesen hatte, daß Shaw Vegetarier, Antialkoholiker, Nichtraucher und Gegner der Vivisektion gewesen ist: sie führte, gemeinsam mit ihm und inmitten einer rauschhaften Orgie, eine Vivisektion durch.
In letzter Zeit gibt es auch bei mir Träume, die häufig wiederkehren: ich sitze in einer Klausur und soll einen mittelhochdeutschen Text übersetzen. Man legt mir statt dessen eine mathematische Formel vor, besteht jedoch darauf, es handle sich um eine mittelhochdeutsche Textstelle. Selbstverständlich komme ich zu keinem Ergebnis. Anschließend erklärt mir der Mann, der die Aufsicht führt, bedauernd, es handle sich um einen Irrtum. Wie er festgestellt habe, sei ich ja erst beim nächsten Termin an der Reihe.
Es ist üblich, sich vor den Sprechstunden in der Uni in eine Liste einzutragen. Augenblicklich werde ich zu der Nummer, die man mir zuteilt.
Vor dem Sprechzimmer unterhält man sich.
«Ich bin Nummer vier, und du?»
«Ich bin erst Nummer zwölf.»
«Na, dann bin ich ja vor dir an der Reihe. Aber wer ist denn Nummer drei?»
«Ich.»
«Ja, dann komme ich gleich nach dir.»
Und immer wieder die Verwunderung, daß der Professor mich mit meinem Namen begrüßt, obwohl ich erwarte, mit meiner Nummer angesprochen zu werden.
Im Augenblick arbeite ich in der Küche, weil vor dem einen Fenster die Straße aufgerissen wird und man vor dem anderen ein Grundstück ausbaggert. Hier in der Küche stört mich das regelmäßige Surren des Kühlschranks. So empfindlich war ich noch nie. Die arglosesten Tagesgeräusche, sonst wie gar nicht vorhanden, zerstechen mir mit einemmal das Trommelfell. Der Versuch, über sie hinwegzuhören, scheitert, treibt die Stimmen der Dinge erst recht an.
Es klingelt, und ich mache nicht auf, weil ich mich gerade so gut und wohl mit mir allein fühle. Anschließend überfällt mich bei dem Gedanken daran, daß es vielleicht jemand war, den ich gern gesehen hätte, eine böse Unruhe. Ich denke solange das Klingeln dauert natürlich an etwas Unangenehmes, Störendes. Möglicherweise war es ein Freund, kommt es mir später. Immerhin hat er den Weg bis heraus zu mir auf sich genommen. Eigentlich habe ich damit schon wieder jemanden enttäuscht.
Das gleiche Gefühl von Verrat habe ich, wenn das Telefon läutet und ich nicht abheben will. Ich halte mir die Ohren zu, was nichts hilft gegen das jämmerliche Wissen, Unrecht zu tun.
Aber wann bin ich in diesen Wochen schon einmal eins mit mir und den Gegenständen um mich herum? Da will ich mich so bald nicht wieder teilen lassen.
Erst wenn ich den Mut aufbringe, jedermann ins Gesicht zu sagen, daß er lügt, wenn er mir die Hand hinstreckt mit der Frage wie geht es dir, ohne die Antwort darauf abzuwarten, erst dann habe ich einen Anfang gemacht.
Reminiszenzen an die Klosterschulenzeit: wir sagten damals Nonnen ertränken statt Schiffe versenken.
Sie sitzt uns gegenüber in dem gegen den bleichen Nachmittagslichtfall abgedunkelten Erinnerungsrefugium, das vormals Wohnzimmer war und nun, im Laufe der letzten Jahre besonders, zu einer Walhalla ihrer verlorenen Lebensgefährten und Freunde geworden ist, von ihr selbst bisweilen mit leisem Spott ihre Lebenssakristei genannt. «Vielleicht siehst du sie heute zum letztenmal», hatte meine Mutter am Telefon gesagt, «ihre Kraft läßt nach.»
Sie kauert klein in der Ecke des Sofas, in der sie, soweit ich zurückdenken kann, immer am liebsten saß, legt sich eine Wolldecke über die abgemagerten Knie und sinkt in sich zurück. Die Standuhr tickt verhalten gegen die Stille an, gegen die kalte Unruhe auch, die die Worte meiner Mutter in mich gepflanzt haben.
Auch heute, sogar heute findet sie über sich selbst die wenigsten Worte, hört wieder zu, als spiele unser Alltag die größere Rolle. M. beugt sich zu ihr hin und erzählt leise, spricht unverdächtig über mein fassungsloses Schweigen hinweg. Sie lächelt zu seinen Worten mit zur Seite geneigtem Kopf, streicht ab und zu nicht vorhandene Falten in der Wolldecke glatt, um dann die langen, abgezehrten Finger wieder ineinander zu verschränken.
Ihr Gesicht ist dünnhäutig und fadenscheinig. Die Haut spannt sich blaß über die Backenknochen, die stärker noch als früher hervortreten, und das energische Kinn. Ihre Augen sind geweitet und feucht wie die eines Kindes. Das Gesicht hat seine Ähnlichkeit und sein Gewicht abgeworfen, wendet sich uns alterslos und mit tiefer Ruhe entgegen. Nur diese riesigen Augen, viel dunkler als sonst und weit tiefer sich in die Höhlen zurückziehend, zählen noch, bewegen sich noch, sprechen noch.
Um die Schultern hat sie die Stola geschlungen, die ich ihr einmal geschenkt habe, und damit beunruhigt sie mich weit mehr als mit ihrer furchtbaren Ruhe, weil sie für gewöhnlich keine Zeichen setzt, für niemanden. Ihre Schultern sind schmal geworden wie die Handgelenke, die derart fremd gar nicht mehr in ihre Gesten passen.
Meine Tante, die sich aufopfernd ihr Erbe ernachtwacht, selbst während der Pflegezeit mit Schmuck beladen, um auch weiterhin von sich abzulenken, bringt Tee und Gebäck für drei, nimmt kräftig von beidem, scherzt, im Sessel zurückgelehnt mit übereinandergeschlagenen Beinen, jovial und lauthals über die seit ihrem Erscheinen noch tiefer verstummte Kranke hinweg, bis nur noch sie zu existieren scheint.
«Eßt tüchtig», sagt Oma, «in eurem Alter muß man vor allem essen», und sie beobachtet, wie wir uns zu schlucken bemühen.
Sie ist müde geworden, will wieder zurück ins Bett. Um von den Todesgedanken abzulenken, sage ich ihr, daß sie uns besuchen kommen muß, sobald sie sich wieder besser fühlt. Wir möchten es glauben, erzwingen notfalls, trauen uns nicht heran an das Unerhörte. Und Oma, die den Tod neben sich hat, lächelt und gibt vor, auch daran zu glauben, jemals wieder Besuche machen zu können. Aber in Wirklichkeit weiß sie es besser. Ihre Augen verraten sie.
Ich küsse ihren weichen Mund und lasse meine Großmutter, die sich auf einmal fremd ausnimmt in ihrer Sakristei, kaum mehr mit ihrem Leben zu tun hat und sich vorbereitet auf das Loslassen, zurück in der schweren Stille.
Draußen in der Helligkeit, die in den Augen brennt, schiebe ich die Erinnerung an ihre Einsamkeit feige von mir. Ein Kindergesicht mit Milchzahnlücken spiegelt sich in einer Schaufensterscheibe. Erleichtert bewegen wir uns darauf zu.
Noch immer belügen sie die Kranke über ihren Zustand. Sie habe Magengeschwüre. Dabei wissen wir alle, daß sie vom Krebs zerstückelt wird. Der Arzt legte meinem Vater nahe, einer müsse ihr die Wahrheit sagen, um ihren verzweifelten Lebenswillen zu brechen.
Weder das eine noch das andere aber hat Notwendigkeit, denn sie war wohl die erste, die genau wußte, wie es um sie steht. Heute, wo sie den Kampf um Zeit aufgegeben hat, sollten wir sie nicht allein lassen vor dem Sterben. Wie spricht man aber vom Tod, wenn er sich schon mit dem befaßt, mit dem man darüber reden will?
Und dies geschieht neben den Examens-Wahngebilden und ist Wirklichkeit.
Über das Telefon bekomme ich mit, wie schon heute über die zu erwartende Hinterlassenschaft gestritten und verfügt wird. Sie vermuten, daß kein Testament existieren wird. Und das wäre der letzte ironische Akt meiner Großmutter, so, wie ich sie kenne und liebhabe: ihre Familie sich selbst zum Fraß vorzuwerfen.
Seit Tagen setze ich die Arbeit zwischen mich und ihr Sterben.
Ganz sicher will ich meine Angst nicht zu Markte tragen. Ich möchte nur die Möglichkeit haben, mich in ihr zugeben zu können. Allerdings ist das heute schon beinahe der gute Ton. Man ist ja kein Mensch mehr, wenn man seine Angst nicht proklamiert. Seht her – ich bin ein Mensch – ich ängstige mich. Diese progressive Sensibilitätsneurose ersetzt die wirkliche Angst durch eine Maske, denn die Angst, die man ungestraft zeigen darf, darf man noch lange nicht leben.
Das schlechte Gewissen beim Schreiben wächst neuerdings. Neben meinen Aufzeichnungen wächst der babylonische Turm von Büchern und Uni-Skripten immer weiter hinauf. Arrogant und selbstsicher wie er da steht, erinnert er mich unübersehbar daran, daß das augenblicklich Wichtigste die Klausurenvorbereitungen zu sein haben.
Meine Gedanken sind mir nur nahe, wenn ich allein bin. Im Zusammenleben verbrauchen sie sich. Allein fühle ich mich zu meinem Körper gehörig, lebe ich mit jemandem zusammen, dann existiere ich als Körper, Geist oder Gefühl, je nachdem, was man mir gerade abverlangt.
Zukunftsbilder bauen sich um mich herum auf. Manchmal, ganz selten, glaube ich, daß ich mein Ziel erreichen werde, mit mir selbst und meiner Umgebung in Übereinstimmung zu kommen. Meistens jedoch spüre ich, wie sich alles in mir zusammendrängt und darauf wartet, abgetötet zu werden.
Der Mensch, den ich am heftigsten und ohne Vorbehalt geliebt habe, ist seit vielen Jahren tot. Die Liebe zu ihm bestimmt seit der Zeit die Liebeserwartung an andere.
Man erlaubte mir nicht, bei seiner Beerdigung dabeizusein, weil man befürchtete, ich könne durch eine Szene den wohldurchdachten Tagesplan durcheinanderbringen. «Das Kind soll den Leuten kein Schauspiel bieten.»
Sie haben mich dann unter einem Vorwand zu Nachbarn gebracht, mich dagelassen und ihr Stück allein gespielt.
Sein Tod war mir lange Zeit nicht wirklich, weil ich aus dem Leben mit ihm ohne Besinnung in das Leben ohne ihn hineingeriet. Einen Abschied hatte es ja nicht gegeben.
Sie erzählten mir sein Sterben wie eine Geschichte, die nicht wahr sein mußte.