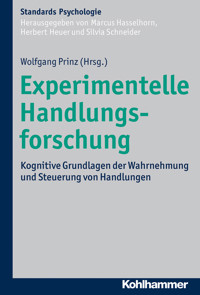
Experimentelle Handlungsforschung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Struktur menschlichen Handelns ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten erneut zu einem zentralen Thema psychologischer Forschung geworden. Lange Zeit davor galt Psychologie als Wissenschaft vom Denken, Fühlen und Wollen, und Handeln kam, wenn überhaupt, nur am Rande vor. Einen zentralen Anteil an der Renaissance des Handelns hat die moderne Kognitionspsychologie, die im Mittelpunkt des Buchs steht. Sie untersucht die repräsentationalen Grundlagen von Handlungen - die Lernprozesse, in denen Handlungswissen entsteht, und die Kontrollprozesse, in denen es in Handlungen umgesetzt wird. Das Buch führt in den ideomotorischen Ansatz ein, der der kognitiven Handlungsforschung entscheidende Impulse gegeben hat. Es gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung aus drei unterschiedlichen Perspektiven: der individuellen Perspektive der Allgemeinen Psychologie, der interindividuellen Perspektive der Sozialpsychologie und der ontogenetischen Perspektive der Entwicklungspsychologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kohlhammer Standards Psychologie
Begründet von
Theo W. Herrmann (†)
Werner H. Tack
Frank E. Weinert (†)
Herausgegeben von
Marcus Hasselhorn
Herbert Heuer
Silvia Schneider
Wolfgang Prinz (Hrsg.)
Experimentelle Handlungsforschung
Kognitive Grundlagen der Wahrnehmung und Steuerung von Handlungen
Mit Beiträgen von Gisa Aschersleben, Moritz M. Daum, Arvid Herwig, Esther Kuehn, Wolfgang Prinz und Simone Schütz-Bosbach
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-022270-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-024994-3
epub: ISBN 978-3-17-024995-0
mobi: ISBN 978-3-17-024996-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
1
Kognitionspsychologische Handlungsforschung: Der Ideomotorische Ansatz
Wolfgang Prinz
1.1
Kognitionspsychologische Handlungsforschung – was ist das?
1.1.1 Viel Kognition, wenig Handlung
Historische Gründe
Systematische Gründe
1.1.2 Kognitionspsychologische Handlungsforschung
Systematischer Ort
Historische Entwicklung
1.1.3 Unangenehme Probleme
Zwecke und Mittel
Wille und Tat
1.2
Handlungen verstehen – was heißt das?
1.2.1 Handlungen beschreiben
Segmente im Verhaltensstrom
Pläne und Ziele
1.2.2 Handlungen erklären
Mentalismus: Bewusstes Wollen
Behaviorismus: Prozedurale Verhaltensroutinen
Kognitivismus: Deklarative Ereignisrepräsentationen
1.3
Kognitive Handlungstheorie
1.3.1 Grundlage
1.3.2 Leitideen
Lernen: Wie Handlungswissen entsteht
Kontrolle: Wie Handlungswissen genutzt wird
1.3.3 Implikationen
Voraussetzungen
Konsequenzen
1.4
Experimentelle Handlungsforschung
1.4.1 Experimente und Theorien
Abhängigkeiten
Unabhängigkeiten
1.4.2 Handlungsexperimente
Verlust: Dekontextualisierung
Gewinn: Experimentelle Kontrolle
Leitparadigmen
1.4.3 Übersicht
Literaturverzeichnis
2
Experimentelle Handlungsforschung: Die individuelle Perspektive
Arvid Herwig
2.1
Ideomotorisches Lernen: Erwerb von Handlungswissen
2.1.1 Experimentelle Paradigmen
Wahlreaktionszeit-Aufgaben
Serielle Reaktionszeit-Aufgaben
2.1.2 Basisphänomene
Generalisierung und Kontextualisierung
Kontiguität und Kontingenz
2.1.3 Modellvorstellungen
2-Stufen-Modell
Antizipatives Lernmodell
ABC-Modell
2.1.4 Zusammenfassung ideomotorisches Lernen
2.2
Ideomotorische Kontrolle: Nutzung von Handlungswissen
2.2.1 Handlungssteuerung
Nachweis endogener Effektantizipation
Beschaffenheit antizipierter Effekte
Zeitpunkt der Effektantizipation
2.2.2 Handlungsüberwachung
Verarbeitung antizipierter Effekte
Verarbeitung nicht-antizipierter Effekte
2.2.3 Zusammenfassung ideomotorische Kontrolle
2.3
Wahrnehmung und Handlung: Repräsentation von Handlungswissen
2.3.1 Einfluss von Wahrnehmung auf Handlung
Handlungsinterferenz
Handlungsinduktion
Imitation
Handlungskoordination
2.3.2 Einfluss von Handlung auf Wahrnehmung
Kontrast
Assimilation
Mechanismen
2.3.3 Zusammenfassung Wahrnehmung und Handlung
Literaturverzeichnis
3
Experimentelle Handlungsforschung: Die soziale Perspektive
Simone Schütz-Bosbach & Esther Kuehn
3.1
Fremde Handlungen beobachten und verstehen
3.1.1 Wahrnehmung und Identifikation sozialer Akteure
Die visuelle Verarbeitung von Gesichtern
Die visuelle Verarbeitung von Körpern
Die visuelle Verarbeitung von Bewegungen biologischen Ursprungs
3.1.2 Die Repräsentation von beobachteten Handlungen: Motorische Resonanz
Induktionseffekte und Interferenzeffekte
3.1.3 Die Repräsentation von beobachteten Handlungen: Perzeptuelle Resonanz
Der Einfluss von motorischem Lernen
Der Einfluss von motorischer Beeinträchtigung
Der spezifische Fall der Selbstbeobachtung
3.1.4 Neuronale Implementierung: Das Spiegelneuronen-System
Die Entdeckung der Spiegelneuronen beim Affen
Das Spiegelneuronensystem beim Menschen
Die Einbettung des Spiegelneuronensystems in ein neuronales Netzwerk
Die psychologische Relevanz des Spiegelneuronensystems
3.1.5 Funktionale Implikation der Aktivierung motorischer Strukturen: Handlungssimulation und -prädiktion
Handlungssimulation
Handlungsprädiktion
Kritische Einwände und offene Fragen
3.2
Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd
3.2.1 Handlungsbewusstsein
Das »Alien-Hand«-Paradigma
Neuronale Grundlagen von Handlungsbewusstsein
Intention und Kontrolle über Handlungen
Willenshandlungen und intentionale Bindung
3.2.2 Handlungsurheberschaft und Handlungsattribution
Informationsquellen für die Selbst-Identifikation
Experimentelle Untersuchungen zur Selbst-Fremd-Unterscheidung
3.2.3 Das Komparator-Modell zur Erklärung der Handlungsattribution
Empirische Überprüfung des Komparator-Modells
3.3
Gemeinsames Handeln: Kooperation und Koordination
3.3.1 Repräsentationen teilen
3.3.2 Handlungen anderer vorhersagen
3.3.3 Eigene und fremde Handlungseffekte integrieren
Literaturverzeichnis
4
Experimentelle Handlungsforschung: Die ontogenetische Perspektive
Moritz M. Daum & Gisa Aschersleben
4.1
Einleitung
4.2
Soziale Akteure verstehen
4.2.1 Eingrenzung
4.2.2 Die Identifikation sozialer Akteure
Die frühe Wahrnehmung von Gesichtern
Der menschliche Körper – Struktur und (biologische) Bewegung
4.2.3 Handlungen als zielgerichtet wahrnehmen
4.3
Entwicklung von Imitation und Handlungskontrolle
4.3.1 Einführung
4.3.2 Theorien der Imitation
Instinkttheorien
Lerntheorien
Kognitive Theorien
4.3.3 Neuere Befunde zur Imitation von Handlungen
4.3.4 Einflussfaktoren auf die Imitation
4.3.5 Entwicklung der intentionalen Handlungskontrolle
4.4
Der Zusammenhang von Handlungsverständnis und Handlungsproduktion in der Entwicklung
4.4.1 Ausgangslage
4.4.2 Entwicklung des Zusammenhangs von Wahrnehmung und Handlung
Hypothese I – Handlung zuerst
Hypothese II – Wahrnehmung zuerst
Hypothese III – Gleichzeitige Entwicklung von Wahrnehmung und Handlung
4.4.3 Integration der Befunde
4.4.4 Zusammenfassung
4.5
Gemeinsame Aufmerksamkeit, gemeinsames Handeln
4.5.1 Ausgangslage
4.5.2 Die Entwicklung der gemeinsamen Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit teilen und soziales Referenzieren (sharing attention und social referencing)
Aufmerksamkeit folgen (following attention)
Aufmerksamkeit lenken (guiding attention)
4.5.3 Die Entwicklung des gemeinsamen Handelns
Helfen
Synchronisation
Kooperation
4.5.4 Zusammenfassung
4.6
Die Entwicklung des Selbst
4.6.1 Ausgangslage
4.6.2 Die Entwicklung des Selbst
4.6.3 Die Entwicklung des Selbst in der frühen Kindheit
Literaturverzeichnis
Die Autorinnen und Autoren
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Boxenverzeichnis
Box 1.1
Empirische Psychologie des 18. Jahrhunderts: Wie die Seele auf den Körper wirkt
Box 1.2
Experimentelle Willenspsychologie des frühen 20. Jahrhunderts: Die Determinationsexperimente von Narziß Ach
Box 1.3
Was man alles gleichzeitig machen kann
Box 1.4
Über Ziele und Zielbegriffe
Box 1.5
Verantwortung, Autonomie, Willensfreiheit
Box 1.6
Wie Regler Ziele erreichen
Box 1.7
Handlungen erklären: Drei Konzepte im Vergleich
Box 2.1
Welche Rolle spielen Intentionen beim Erwerb von Handlungswissen?
Box 2.2
Zielabhängige Nutzung von Handlungswissen
Box 2.3
Wessen Absichten steuern ideomotorische Handlungen?
Box 3.1
Johanssons Point-light-Technik
Box 3.2
Das menschliche Gehirn in Aktion – Methoden der Kognitiven Neurowissenschaften
Box 3.3
Spiegelneuronen: Angeboren oder erworben?
Box 3.4
Spiegelneuronen und Empathie
Box 3.5
Die These der direkten sozialen Wahrnehmung
Box 3.6
Das Libet-Experiment und die Willensfreiheit
Box 3.7
Willensstörungen
Box 3.8
Imitation versus Komplementarität
Box 4.1
Maße für die frühkindliche Handlungswahrnehmung: Blickzeiten und antizipatorische Augenbewegungen
Box 4.2
Still-Face-Paradigma
Box 4.3
Theoretische Aspekte des Selbst
Box 4.4
Selbsterkennen im Spiegel
1 Kognitionspsychologische Handlungsforschung: Der Ideomotorische Ansatz
Wolfgang Prinz
In diesem Buch geht es um Handlungen. Was heißt das? Was meinen wir, wenn wir von Handlungen sprechen? Was sind eigentlich Handlungen und wie kommen sie zustande? Auf Fragen, die so allgemein sind wie diese, gibt es meist mehrere richtige Antworten. Welche Antwort man gibt, hängt davon ab, aus welcher Perspektive man auf den in Frage stehenden Gegenstand blickt.
Die Perspektive, die wir hier einnehmen, ist die der experimentellen Kognitionspsychologie. Die Perspektive ist also – erstens – psychologisch, nicht philosophisch, historisch, ethnologisch, soziologisch, theologisch, historisch etc. Das bedeutet, dass wir Handlungen auf der Ebene des agierenden Individuums betrachten und die (natürlich ebenso legitimen) Ebenen der sozialen Systeme und der normativen Regularien, in die sie eingebettet sind, ausblenden. Die Perspektive ist – zweitens – kognitionspsychologisch, nicht motivations- oder sozialpsychologisch. Das bedeutet, dass wir uns auf die kognitiven Prozesse und Mechanismen konzentrieren, die Handlungen zugrunde liegen, und die (natürlich ebenso wichtigen) motivationalen und sozialen Bedingungen weitgehend ausklammern. Und schließlich ist die Perspektive – drittens – experimentalpsychologisch. Das bedeutet, dass wir die empirische Verankerung dieser theoretischen Vorstellungen in experimentellen Aufgaben und Versuchsanordnungen suchen.
Noch vor 20 Jahren hätte ein Buch, das sich diesem thematischen Zuschnitt verschreibt, kaum etwas zu berichten gehabt. In den letzten zwei Jahrzehnten ist aber zweierlei geschehen, das die Situation grundlegend verändert hat. Auf theoretischem Gebiet haben wir die Wiederbelebung und Weiterentwicklung von Konzepten und Ansätzen gesehen, die ein neues Verständnis der schwierigen Beziehung zwischen Kognition und Handlung begründen. Hierzu zählt vor allem der ideomotorische Ansatz, dessen Leitideen ein neues Forschungsprogramm inspiriert haben. Parallel dazu hat die Umsetzung dieses Programms auf methodischem Gebiet eine Reihe neuer experimenteller Paradigmen hervorgebracht, die diese Leitideen auf eine empirische Grundlage stellen.
Das Einleitungskapitel stellt diese neuen Entwicklungen vor. Vor allem versucht es, die historischen und systematischen Hintergründe verständlich zu machen, in die sie eingebettet sind. Bevor wir also die Leitideen der ideomotorischen Theorie und der experimentellen Handlungsforschung vorstellen (Abschn. 1.3 und Abschn. 1.4), werfen wir einen Blick auf die historischen und systematischen Kontexte, aus denen diese Leitideen hervorgegangen sind. Zunächst fragen wir, was psychologische und speziell kognitionspsychologische Handlungsforschung ausmacht (Abschn. 1.1). Anschließend untersuchen wir, was es überhaupt heißt, Handlungen zu verstehen (Abschn. 1.2).
1.1 Kognitionspsychologische Handlungsforschung – was ist das?
1.1.1 Viel Kognition, wenig Handlung
Im Verständnis des Laienpublikums beschäftigt sich Psychologie mit den Gedanken und Gefühlen, die Menschen durch den Kopf gehen. Wenn das so ist, ist klar, dass kognitive Prozesse zu den zentralen Gegenständen dieser Wissenschaft gehören. Psychologie soll klären, wie Gedanken entstehen und aufeinander folgen, wie Wissen und Erinnerung entstehen und wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und verstehen.
Weniger im Fokus ist demgegenüber, was Menschen tun. Was sie tun, folgt zwar manchmal aus dem, was ihnen zuvor durch den Kopf gegangen ist, gehört aber selbst nicht zu dem, was ihnen durch den Kopf geht. Handlungen können nach diesem Verständnis das Ergebnis von kognitiven Prozessen sein, scheinen aber einen anderen Status zu haben als diese Prozesse selbst. Wenn z. B. jemand nachdenkt, was sie in einer bestimmten Situation tun soll, gelten die kognitiven Prozesse, die zur Handlungsentscheidung führen, als psychologisch interessant. Wenn sie dann aber tut, was sie sich überlegt hat, gilt die Handlung selbst nur noch als mehr oder weniger triviales Ergebnis dieser Prozesse. Wie es danach scheint, endet die Zuständigkeit der Psychologie, wenn die Handlung beginnt.
Dass Kognition und Handlung unterschiedliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, gilt aber nicht nur für die Laienperspektive, sondern auch für die Geschichte und Systematik der wissenschaftlichen Psychologie. Auch hier steht Kognitionsforschung im Vordergrund, während Handlungsforschung nur ein randständiges Dasein führt. Dass das so ist (und sich so schnell wohl auch kaum grundlegend ändern wird), hat historische und systematische Gründe, die sich gegenseitig verstärken.
Historische Gründe
Zu den historischen Gründen rechnet die Tatsache, dass die moderne Psychologie ihre Entstehung ganz wesentlich einer Verbindung von philosophischer Erkenntnistheorie und naturwissenschaftlicher Sinnesphysiologie verdankt. Diese Verbindung bahnte sich im 19. Jahrhundert an und wurde von Autoren wie Helmholtz, Weber, Fechner und Wundt gestiftet. Der Ursprung der modernen Psychologie lag ganz und gar auf der Seite von Empfindung und Wahrnehmung, der Inputseite des kognitiven Systems also. Fragen, die die Outputseite betrafen, spielten zunächst nur eine unter- und nachgeordnete Rolle. Wenn Handlungen überhaupt erwähnt wurden, traten sie überwiegend als Wirkungen von Empfindungs- und Wahrnehmungsprozessen in Erscheinung, nicht aber als Vorgänge, die aus eigenem Recht wissenschaftliches Interesse beanspruchen.
Die Handlungsblindheit der modernen Psychologie hat eine lange Vorgeschichte. So lässt sich z. B. die Doktrin, dass Handlungen als Wirkungen von Wahrnehmungsprozessen anzusehen sind, auf den französischen Aufklärungsphilosophen René Descartes zurückführen (Descartes, 1664/1969). Den Wahrnehmungsprozess stellte er sich so vor, dass Reize, die auf Sinnesorgane treffen, dort kleine Fäden in Bewegung versetzen, die zwischen den Sinnesorganen und dem Gehirn aufgespannt sind. Durch die Mechanik dieser Fäden werden die Sinnesreize an die Zirbeldrüse weitergegeben – denjenigen Ort im Gehirn, von dem Descartes annahm, dass dort der Übergang von Wahrnehmung zu Handlung erfolgt. Die Steuerung von Körperbewegungen stellte er sich dann so vor, dass die Zirbeldrüse aufgrund der von den Wahrnehmungen ausgehenden Reize in Bewegung gerät und dadurch Nervenflüssigkeit freisetzt, die dann über ein hydraulisches System die Muskulatur der Körperperipherie aktiviert.
Die Metaphorik, mit der Descartes die Tätigkeit des Gehirns beschreibt, hat in der Physiologie und Psychologie der nachfolgenden Jahrhunderte lange nachgewirkt. Eine der nicht besonders glücklichen Nachwirkungen betrifft die Implikationen seiner Lehre für das Verständnis von Bewegung und Handlung. Körperbewegungen kommen danach nämlich nur als Wirkungen von Wahrnehmungsprozessen zustande, d. h. sie werden eigentlich nur als Reaktionen auf die Wahrnehmung von äußeren Ereignissen in Gang gesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Theorie keinen Raum bietet für Handlungen, die auf andere Weise entstehen und sich nicht als Reaktionen auf die Wahrnehmung von Ereignissen verstehen lassen.
Bis auf den heutigen Tag hat diese Vorstellung das Denken von Physiologie und Psychologie geprägt. In der Physiologie ist es auch heute noch weitgehend üblich, Bewegung und Handlung als die Endstrecke des sogenannten sensomotorischen Bogens zu betrachten – d. h. als das natürliche Schlussglied einer Kette von Ereignissen, die am Sinnesorgan beginnt und am Muskel endet. Ein Beispiel ist die von Donders (1868) vorgelegte Analyse von Reaktionszeiten, auf die die moderne Forschung sich gern als ihren methodischen und theoretischen Ausgangspunkt bezieht. Donders schlug vor, den gesamten Vorgang, der sich zwischen Reiz und Reaktion abspielt, in zwölf aufeinanderfolgende Teilprozesse zu zerlegen – derart, dass die ersten sechs Teilprozesse den afferenten und die übrigen sechs den efferenten Zweig des sensomotorischen Bogens bilden.
Die linearen Stufentheorien der Informationsverarbeitung, die die moderne Kognitionspsychologie in Anlehnung an Donders entwickelt hat, haben daran nichts Wesentliches geändert. Ihr Forschungsprogramm beruht auf dem Verständnis, dass die Analyse kognitiver Prozesse nur von der Reiz- und Wahrnehmungsseite her in Angriff genommen werden kann. So verkündete bereits Neisser (1967) in seinem programmatischen Manifest der damals neuen Kognitiven Psychologie, dass ihre zentrale Aufgabe darin besteht, zu untersuchen, wie das kognitive System die Information verarbeitet, die es in seiner Umgebung vorfindet. Von Handlungen war in diesem Ansatz nicht die Rede. Handlungen kamen allenfalls als Reaktionen vor – nämlich als messbare Indikatoren für die Informationsverarbeitungsprozesse, die selbst nicht messbar sind. Handlungen selbst waren ohne Interesse.
Systematische Gründe
Hinzu kommen systematische Gründe, die die unterschiedliche wissenschaftliche Aufmerksamkeit für Kognition und Handlung verstärken. Sie ergeben sich aus der Logik der experimentellen Methode und den unterschiedlichen Voraussetzungen für ihren Einsatz im Bereich von Erkenntnis- und Handlungsfunktionen.
Im Bereich von Wahrnehmungs- und Erkenntnisfunktionen ist die methodische Situation relativ übersichtlich. Untersucht wird zum Beispiel, wie Wahrnehmungsleistungen oder Wahrnehmungsinhalte einer Versuchsperson von den Eigenschaften des Reizmaterials abhängen, die vom Versuchsleiter manipuliert werden. In dieser Situation besteht eine enge kausale Verknüpfung zwischen den unabhängigen Variablen, die der Experimentator kontrolliert, und den abhängigen Variablen, die auf Seite der teilnehmenden Probanden gemessen werden.
Anders liegen die Dinge dagegen, wenn es um Handlungen geht. Als abhängige Variablen werden hier Merkmale von Handlungen der Probanden registriert, und zwar gleichfalls in Abhängigkeit von Reiz- und Situationseigenschaften, die der Versuchsleiter kontrolliert. Allerdings besteht ein entscheidender Unterschied. Denn im Gegensatz zu Wahrnehmungs- und Erkenntnisleistungen, die durch die kontrollierten unabhängigen Variablen weitgehend determiniert sind, lassen sich die Eigenschaften von Handlungen durch diese Variablen nur zu einem kleinen Teil kontrollieren. Was eine Person in einer bestimmten Situation wahrnimmt, ist relativ weitgehend durch Merkmale der aktuellen Reizsituation bestimmt. Was sie dagegen tut, ist kaum jemals durch die aktuelle Reizsituation allein bestimmt.
Daraus folgt, dass das experimentelle Vorgehen auf der Handlungsseite komplexer sein muss als auf der Wahrnehmungsseite. Für die Untersuchung von Handlungen reicht es nicht aus, lediglich die aktuellen Reiz- und Situationseigenschaften zu kontrollieren. Daneben müssen auch die aktuellen Handlungsdispositionen der Person manipuliert oder zumindest kontrolliert werden, d. h. die Absichten und Ziele, die sie verfolgt und die sie durch ihre Handlungen realisieren will. In Handlungsexperimenten geschieht dies dadurch, dass den Versuchsteilnehmern Aufgaben gestellt werden, die festlegen, unter welchen Bedingungen welche Handlungen auszuführen sind. Deshalb spielen die Instruktionen, die diese Aufgaben beschreiben und spezifizieren, hier eine wesentlich wichtigere Rolle als in Experimenten zur Analyse von Erkenntnisfunktionen.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass wir es hier nicht nur mit einem methodischen Problem zu tun haben. Hinter dem methodischen steckt vielmehr ein theoretisches Problem, nämlich die Frage, wie Handlungsdispositionen (Pläne, Absichten, Ziele) repräsentiert sind und wie sie an der Steuerung von Handlungen mitwirken. Dass sie daran mitwirken, daran besteht kein Zweifel. Wie dies aber geschieht – das ist eine der zentralen Fragen, die eine Theorie der kognitiven Grundlagen von Handlungen beantworten muss.
Historische und systematische Gründe verstärken sich gegenseitig. Das Ergebnis ist eine einfache Diagnose: Psychologie weiß viel über Kognition, wenig über Handlung und noch weniger über den Zusammenhang zwischen Kognition und Handlung. Das ist die Diagnose, für die kognitionspsychologische Handlungsforschung die Therapie sein will.
1.1.2 Kognitionspsychologische Handlungsforschung
Wie kommen Handlungen zustande? Wie kommt es, dass Menschen tun, was sie tun? Das sind Beispiele für Fragen, die psychologische Handlungsforschung beantworten muss. Handlungsbezogene Forschung gibt es seit jeher in verschiedenen Bereichen der Psychologie – trotz der historischen und systematischen Hypotheken, mit denen sie belastet sein mag. Einige Spielarten solcher Forschung sind jedenfalls schon seit langer Zeit erfolgreich etabliert. Kognitionspsychologische Handlungsforschung gehört allerdings nicht dazu. Sie ist eine neue Spielart, die sich erst kürzlich etabliert hat. Wir werfen einen Blick auf den systematischen Ort, den sie im Konzert ihrer Nachbarn einnimmt, und auf die historische Entwicklung, die dazu geführt hat, dass sie sich seit einiger Zeit an diesem Konzert beteiligt.
Systematischer Ort
Wie kommen Handlungen zustande? Wie kommt es, dass Menschen tun, was sie tun? Wenn wir solche Fragen verfolgen, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, in welchen Teilbereichen der Psychologie wir überhaupt Antworten suchen können. Auf den ersten Blick wird man an Bereiche wie Motivation, Volition und Motorik denken, weniger an Kognition. Das, was wir psychologische Handlungsforschung nennen, muss sich aus der Integration von Perspektiven dieser Bereiche ergeben. Wie können wir die Beiträge dieser Bereiche näher bestimmen – und welche Rolle fällt vor allem dem Bereich der Kognition zu, den wir in den Mittelpunkt stellen wollen?
Die allgemeine Leitfrage, wie es kommt, dass Menschen tun, was sie tun, schließt zwei unterschiedliche Arten von Einzelfragen ein: Was-Fragen und Wie-Fragen. Was-Fragen richten sich auf die inhaltliche Seite des Handelns: Wie kommt es, dass Menschen in gegebenen Situationen genau das tun, was sie tun (und nicht irgendetwas anderes)? Anders gefragt: Wie müssen wir die Prozesse verstehen, die darüber entscheiden, welche Handlungsziele Menschen überhaupt verfolgen und welche Handlungen sie ausführen? Wie-Fragen richten sich dagegen auf die prozedurale Seite des Handelns: Wie kommt es, dass Menschen das, was sie tun wollen, auch wirklich zur Ausführung bringen? Welche Mechanismen sind dafür verantwortlich, dass ausgewählte Ziele und Handlungen durch die Ausführung entsprechender Körperbewegungen realisiert werden?
Nach gängiger Lehrbuchsystematik gehören Was-Fragen in den Bereich der Motivationspsychologie (Heckhausen & Heckhausen, 2006). Motivationspsychologische Forschung untersucht, wie abstrakte Handlungsdispositionen unter aktuellen Situationsbedingungen in konkrete Handlungsziele umgesetzt werden und wie gegebene Ziele sich gegenüber konkurrierenden Zielen durchsetzen.
Wenn die Was-Frage entschieden ist, wird die Wie-Frage akut: Wie kommt die Realisierung von ausgewählten Handlungen zustande? Welche Beiträge liefern Volition, Kognition und Motorik? Zunächst steht fest, dass im Zuge der Realisierung Körperbewegungen zustande kommen, die ihrerseits wiederum eine Reihe von Effekten in der Umwelt erzeugen können: Jemand drückt auf einen Knopf, darauf ertönt eine Klingel, und eine Tür wird geöffnet. Jemand kauft ein Bahnticket und fährt damit von Berlin nach München, um dort seiner Erbtante eine Aufwartung zu machen. Jemand schreibt sich an der Sorbonne ein und nimmt ein Studium der Islamistik auf, das er Jahre später mit einer Promotion abschließt. Wie diese Beispiele deutlich machen, ist die motorische Komponente der Handlungsausführung ein unerlässliches Glied in der Kette von Ereignissen, die wir betrachten müssen, aber im Verhältnis zu dem, was die gesamte Handlung und ihre mentale Repräsentation ausmacht, ist sie oft nur ein verschwindend kleines und manchmal auch triviales Glied.
Nachdem wir Motivation und Motorik ihre Plätze am Anfang und am Ende der Prozesse zugewiesen haben, die eine Handlung ausmachen, ergibt sich der Ort von Kognition und Volition von selbst: in den vermittelnden Prozessen zwischen Auswahl und Ausführung, die sicherstellen, dass ausgewählte Handlungsziele in der je aktuellen Situation angemessen realisiert werden.
Wenn wir diese Prozesse charakterisieren wollen, ist es nützlich, zwischen ihrer Mechanik und Dynamik zu unterscheiden. Dabei steht Handlungsmechanik für die kognitive Seite der Realisierungsprozesse: für die ›kühle‹ Mechanik der repräsentationalen Prozesse, die zwischen Auswahl und Ausführung vermitteln. Demgegenüber steht Handlungsdynamik für die volitionale Seite dieser Prozesse: für die ›heiße‹ Dynamik des Kräftespiels, das an der Realisierung und Durchsetzung der Handlung beteiligt ist. In einer inzwischen fast ausgestorbenen Sprache könnte man auch von der Mechanik und Dynamik des Willens sprechen: Kognitive Mechanismen erklären die Mechanik von Willensprozessen, volitionale Mechanismen ihre Dynamik.
Nach diesem Verständnis beziehen sich jedenfalls ›Kognition‹ und ›Volition‹ nicht auf zwei getrennte Segmente der Handlungskette, sondern auf zwei unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen Segments: des Abschnitts der Handlungsrealisierung. Im Schwerpunkt unserer Untersuchung liegt im Folgenden die kognitive Mechanik der Prozesse, die die Realisierung ausgewählter Handlungen sicherstellen. Dazu nehmen wir an, dass der Realisierung von Handlungen ein motivationaler Auswahlprozess vorausgeht (den wir zwar voraussetzen, aber selbst nicht näher in Augenschein nehmen) und dass ihr ein motorischer Ausführungsprozess folgt (für den das Gleiche gilt).
Box 1.1
Empirische Psychologie des 18. Jahrhunderts: Wie die Seele auf den Körper wirkt
Abb. 1.1: Titelblatt der Anweisungen zum regelmäßigen Studium der Empirischen Psychologie für die Candidaten der Philosophie zu Münster (Ueberwasser, 1787)
Die Empirische Psychologie des 18. und 19. Jahrhunderts verstand sich als Erfahrungsseelenlehre. Sie sah ihre Aufgabe darin, das Leben der Seele zu beschreiben und inventarisieren und auf eine begrenzte Zahl von seelischen Grundvermögen zurückzuführen. So unterschied zum Beispiel der Münsteraner Philosophieprofessor Ferdinand Ueberwasser fünf Grundvermögen der Seele: Empfindungsvermögen, Einbildungskraft, Erinnerungsvermögen, Dichtungsvermögen und Mitgefühl (Ueberwasser, 1787).
Bei der Behandlung der Einbildungskraft und des Mitgefühls erörtert der Autor neben den betreffenden seelischen Vorgängen selbst auch die Wirkungen, die sie auf den Körper haben. Die Erörterung der körperlichen Wirkungen der Einbildungskraft findet sich in den §§ 162 und 163. Wie üblich beginnt sie mit der Aufzählung von (teilweise skurrilen und absonderlichen) Erfahrungen und endet mit der Formulierung eines theoretischen Prinzips. Entsprechendes gilt für das Mitgefühl (§§ 264, 279).
Ein Teil der Beispiele, die Ueberwasser ins Feld führt, lassen sich in der Rückschau als frühe Vorläufer der Idee lesen, dass Vorstellungen von Körperbewegungen und Handlungen dazu neigen, die betreffenden Bewegungen und Handlungen selbst hervorzurufen (Einbildungskraft), und dass die Beobachtung von Handlungen, die wir andere ausführen sehen, ähnliche Handlungen in uns selbst hervorrufen (Mitgefühl). Hier sind also Haupt- und Seitenlinie des modernen ideomotorischen Ansatzes bereits im Kern angelegt: die intraindividuelle Hauptlinie, die erklärt, wie handlungsbezogene Repräsentationen Handlungen hervorbringen, und die interindividuelle Seitenlinie, die erklärt, wie die Wahrnehmung fremder Handlungen eigene Handlungen induziert.
Abb. 1.2: Textausschnitt aus Ueberwasser (1787, §§ 162, 163, 264 und 279)
Historische Entwicklung
Die kognitionspsychologische Perspektive auf Handlungen blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück (Stock, 2004). Während sich erste Vorläufer der einschlägigen Ideen bereits in Lehrbüchern der Empirischen Psychologie des 18. Jahrhunderts finden (Box 1.1), setzt eine systematische Diskussion erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Bemerkenswert ist die Geschichte dieser Diskussion nicht zuletzt deshalb, weil sie in zwei Wellen verlaufen ist, die durch eine Pause von nahezu 80 Jahren voneinander getrennt sind.
Die erste Welle fällt in die Gründerzeit der modernen Psychologie. Wie wir schon sahen, standen bei der Etablierung der neuen Wissenschaft, die sich im 19. Jahrhundert allmählich zwischen Philosophie und Sinnesphysiologie entwickelte, Wahrnehmungs- und Erkenntnisfunktionen im Mittelpunkt. Dementsprechend etablierte sich die experimentelle Forschung, die damals entstand, als empirische Psychophysik und subjektive Sinnesphysiologie.
Anders lagen die Dinge dagegen in der theoretischen Systematik und Programmatik. Hier gab es einflussreiche Autoren, die in ihren theoretischen Grundlagenwerken neben einer Wahrnehmungs- und Erkenntnislehre auch eine Willens- und Handlungslehre abhandelten. Nicht zuletzt war es Wilhelm Wundt, der Gründungsvater der modernen Psychologie, der dem Willen immer breiteren Raum in seinem Forschungsprogramm einräumte. Nachdem er sich zunächst fast ausschließlich auf Sinnes- und Erkenntnisfunktionen konzentriert hatte, behandelte er später den Willen immer ausführlicher – nicht nur in philosophischen Schriften, sondern auch in psychologischen Untersuchungen. Wundts Willenspsychologie war, wie wir heute sagen würden, durchaus schon kognitionspsychologisch unterlegt. Denn es waren im Prinzip die gleichen Assoziations-, Apperzeptions- und Assimilationsprozesse, die sowohl für das kognitive als auch für das volitionale Geschehen verantwortlich sein sollten (vgl. z. B. Wundt, 1903). Unter seinen unmittelbaren Schülern war es dann vor allem Hugo Münsterberg (1888), der die Willenspsychologie weiterentwickelte.
Allerdings gingen von diesen Ansätzen keine besonderen theoretischen Inspirationen aus, denen bleibender Wert beschieden sein sollte. Solche Inspirationen setzten andere: Rudolf Hermann Lotze (1852), William James (1890) und nicht zuletzt Narziß Kaspar Ach (1905). Besondere Berühmtheit hat James’ brillante Diskussion der kognitiven Grundlagen des Willens erlangt, die er im 26. Kapitel seiner Principles of Psychology vorgelegt hat (James, 1890). Ein entscheidender Vordenker der dort entwickelten Ideen war zuvor Lotze gewesen – von James beiläufig erwähnt, aber nicht als Quelle seiner Theorie kenntlich gemacht.
Kern der Lotze/James -Theorie der kognitiven Grundlagen von Willenserscheinungen ist das Ideomotorische Prinzip. Das Ideomotorische Prinzip behauptet, dass Wahrnehmungen oder Vorstellungen, die sich auf Ereignisse beziehen, von denen wir gelernt haben, dass wir sie durch eigene Handlungen hervorbringen oder verändern können, dazu tendieren, eben diese mit ihnen verbundenen Handlungen hervorzurufen. Die Lotze/James-Theorie, auf die wir noch ausführlich zurückkommen, war damals (und ist noch heute) ein Meilenstein auf dem Weg zur Entmystifizierung des Rätsels, wie Gedanken zu Handlungen führen können, d. h. wie es möglich ist, dass Psychisches Physisches hervorbringen kann.
Ach (1905) war es schließlich, der die Willenspsychologie von der theoretischen Kopflastigkeit befreite, die sie bis dahin auszeichnete, und sie auf solide experimentelle Füße stellte (Box 1.2). Danach hätte die Forschung eigentlich richtig loslegen können, weil beides zur Verfügung stand: Bausteine für eine kognitive Handlungstheorie und experimentelle Methoden zu ihrer Untermauerung. Aber sonderbarerweise brach alles ab und es geschah nichts weiter. Zwar hat man sich noch über Generationen hinweg an Lotzes und vor allem an James’ Ausführungen über den Willen sprachästhetisch delektiert, und man hat Ach als Pionier gewürdigt, dem es erstmals gelungen ist, den schwierigen Willen experimentell zu bändigen. Aber für die Sache selbst hat sich niemand mehr interessiert. Wille war »out« und Handlung sowieso.
Wie kam das? Die Gründe lagen wohl darin, dass andere Strömungen und andere Themen tonangebend wurden – unterschiedlich zwar auf beiden Seiten des Atlantiks, aber doch vereint darin, dass sie mit dem willentlichen Handeln nichts mehr zu schaffen hatten und haben wollten. In Europa, besonders im deutschen Sprachraum,
zog sich die Psychologie wieder auf das zurück, was sie ihrem Ursprung nach immer schon gewesen war: Wahrnehmungs- und Erkenntnislehre, die sich für die Grundlagen des Handelns kaum interessierte. Katalysator hierfür war vor allem die gestalttheoretische Bewegung, in der das Handeln nur einen randständigen Platz einnahm und der Wille als gesonderte systematische Kategorie überhaupt nicht vorkam. Westlich des Atlantiks verschwand zwar nicht das Handeln selbst, aber das Interesse an seinen kognitiven Grundlagen. Man redete nicht mehr von Handlungen, sondern von Reaktionen. Handlungen wurden als Reaktionen verstanden, die durch Reize ausgelöst und kontrolliert werden – und sonst nichts. Katalysator war hier die behavioristische Bewegung, in deren Ansatz zwar Raum für die Analyse von Muskeltätigkeit und Körperbewegung und die Beziehung zwischen Reizen und Reaktionen war, nicht aber für die kognitiven Grundlagen dieser Vorgänge.
Mit anderen Worten: Die kognitionspsychologische Perspektive auf das Handeln verschwand für einige Zeit von der wissenschaftlichen Bildfläche. Wie wir bereits gesehen haben, hat auch die Entstehung der modernen Kognitionspsychologie an dieser Situation nichts Grundlegendes geändert. Für lange Zeit kam das Handeln in der neuen Kognitionspsychologie so gut wie überhaupt nicht vor.
Die zweite Welle kognitionspsychologisch fundierter Handlungsforschung ist in den letzten 20 Jahren entstanden und hat die Forschung hervorgebracht, die in den folgenden Kapiteln dokumentiert ist. Da diese Welle noch andauert, ist eine distanzierte historische Einordnung noch nicht möglich. Deshalb beschränken wir uns darauf, einige Ideen und Motive zu nennen, die an ihrer Entstehung beteiligt waren und ihre weitere Entwicklung getragen haben.
Evolutionspsychologie: Betrachtet man kognitive Systeme aus evolutionspsychologischer Perspektive, muss man sich eigentlich über die weitgehende Fokussierung auf Wahrnehmungs- und Erkenntnisfunktionen wundern, die für große Teile kognitionspsychologischer Forschung charakteristisch ist. Denn aus evolutionstheoretischer Sicht kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Selektionskriterien, die zur Ausbildung und Optimierung kognitiver Systeme führen, nicht an der Wahrheit der Erkenntnisse ansetzen, die diese Systeme ihren Trägern liefern, sondern an der Klugheit der Handlungen, die sie ihnen ermöglichen. Mit anderen Worten: Umgebungsgerechtes Handeln ist die entscheidende Leistung kognitiver Systeme, die die fitness ihrer Träger bestimmt. Deshalb haben wir allen Grund anzunehmen, dass kognitive Systeme für diese Leistung optimiert sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur angebracht, sondern geradezu notwendig, kognitive Prozesse unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zur Steuerung von Handlungen zu untersuchen.
Neurophysiologie: Die neurophysiologische Forschung der letzten 20 Jahre hat die klassische Unterscheidung zwischen afferenten Prozessen (die Reizinformation verarbeiten) und efferenten Prozessen (die Bewegungen kontrollieren) zunehmend in Frage gestellt und sie durch Vorstellungen ersetzt, die gemeinsame neuronale Grundlagen für afferente und efferente Prozesse betonen (insbesondere sogenannte Spiegelneuronen und Spiegelsysteme; Rizzolatti & Sinigaglia, 2008). Parallel dazu haben zahlreiche Studien gezeigt, dass kognitive Prozesse oft mit latenten Handlungen verbunden sind, ebenso wie Handlungen oft mit latenten kognitiven Prozessen (Jeannerod, 1997, 2006; Kiefer & Barsalou, 2013; Viviani, 2002). Zusammengenommen weisen diese Forschungslinien darauf hin, dass die klassische Unterscheidung zwischen Wahrnehmung, Kognition und Handlung durch ein stärker integriertes Bild abgelöst werden muss.
Kognitionspsychologie: Mit der Wiederaufnahme des Ideomotorischen Prinzips hat die kognitionspsychologische Theoriebildung eine neue Grundlage für die funktionale Integration von Wahrnehmung, Kognition und Handlung geschaffen (Hommel, Müsseler, Aschersleben & Prinz, 2001). Zugleich hat die experimentelle Forschung der letzten 20 Jahre eine Vielzahl neuer Paradigmen hervorgebracht, die es erlauben, diese Vorstellungen näher zu konkretisieren. Von beidem – der Theorie und den von ihr inspirierten Experimenten – wird in diesem und den folgenden Kapiteln ausführlich die Rede sein.
1.1.3 Unangenehme Probleme
Wie wir gesehen haben, ist die erste Welle kognitionspsychologischer Handlungsforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Bildfläche verschwunden. Das mag zum einen daran gelegen haben, dass sie von anderen theoretischen und methodischen Strömungen verdrängt wurde. Es gibt aber auch Gründe, die im Gegenstand dieser Forschung selbst liegen. Die Erforschung des Wollens und Handelns hat sich nämlich mit zwei unangenehmen theoretischen Fragen herumzuschlagen, für die es keine einfachen und offensichtlichen Antworten gibt. Solche Antworten gibt es jedenfalls dann nicht, wenn man, wie es damals üblich war, die kognitiven Grundlagen von Handlungen in den Bewusstseinsinhalten sucht, die Handlungen vorausgehen und sie begleiten. Die erste Frage richtet sich darauf, wie Ziele oder Zwecke überhaupt möglich sind; die zweite wundert sich über den Übergang vom Willen zur Tat.
Zwecke und Mittel
Die erste Welle kognitionspsychologischer Handlungsforschung fällt in die Zeit des sogenannten Vitalismus-Streits. Ausgangspunkt der Debatte war die Faszination, die von der raffinierten Zweckmäßigkeit aller Lebenserscheinungen ausgeht – zum Beispiel der zweckmäßigen Einrichtung und Arbeitsteilung der Organe im Körper, der zweckmäßigen Anpassung der Lebewesen an ihre jeweilige Umgebung und nicht zuletzt auch den zielgerichteten Bewegungen, durch die sie in ihrer Umwelt navigieren und mit ihr interagieren. Für die Erklärung solch raffinierter Zweckmäßigkeit standen zwei Denkansätze bereit, die miteinander rivalisierten: Mechanismus und Vitalismus. Das mechanistische Lager glaubte und postulierte, dass zweckmäßige Anpassungserscheinungen durch Naturgesetze erklärt werden können, die dem Prinzip von Ursache und Wirkung gehorchen. Die zweckmäßigen Erscheinungen, die wir beobachten, werden als Ergebnis von Prozessen verstanden, in denen Zwecke und Ziele keine kausale Rolle spielen. Nach Auffassung des mechanistischen Lagers liefert die Evolutionsmechanik von Variation und Selektion, wie Darwin sie konzipiert hatte, die entscheidende Blaupause für die Erklärung der Zweckmäßigkeit der Naturerscheinungen.
Auf der Gegenseite standen Schöpfungslehre und Vitalismus. Die Schöpfungslehre postulierte – damals wie heute – die Tätigkeit eines göttlichen Schöpfers, der die Erscheinungen der Welt durch zielgerichtete Akte seines Willens hervorbringt. Der Schöpfer setzt Zwecke und Ziele, die er dann durch sein schöpferisches Handeln realisiert. Der Vitalismus war gleichsam eine wissenschaftliche – nämlich »gottlose« – Variante des Schöpferglaubens. An die Stelle des göttlichen Schöpfers setzte er verborgene Kräfte der Natur, die nicht nur kausal wirken sollen, sondern auch final – d. h. nicht nur vorwärtsgerichtet von Ursachen zu Wirkungen, sondern auch rückwärtsgerichtet von Zwecken zu Mitteln.
Der Streit zwischen Mechanisten und Vitalisten war ebenso tiefgehend wie hartnäckig. Vordergründig hatten Autoren wie Lotze, James und Ach mit diesem weltanschaulichen Streit überhaupt nichts zu schaffen. Wie wir noch sehen werden, plädierten die theoretischen Ideen, die sie propagierten, für eine kausale Mechanik von Willenshandlungen, die darin besteht, dass Zielvorstellungen vorwärts wirken – und keineswegs für eine finale Dynamik, die darin besteht, dass Ziele rückwärts wirken. Aber trotz dieser unübersehbaren Parteinahme für mechanistische Erklärungen galt die Beschäftigung mit Willenshandlungen als wissenschaftlich obsolet und stand unter Vitalismus-Verdacht. Denn wer von Willenshandlungen redet, kommt nicht daran vorbei, davon zu reden, wie Ziele und Zielvorstellungen auf die Auswahl der Mittel zu ihrer Realisierung einwirken. Das klingt so, als würden die Zwecke die Mittel herbeiführen.
Der vitalistische Beigeschmack, der dem Reden über Willenshandlungen anhaftet, mag einer der Gründe sein, warum vor hundert Jahren das willentliche Handeln von der Tagesordnung der psychologischen Forschung abgesetzt wurde. Natürlich dauert das tief verwurzelte Misstrauen, das Wissenschaften gegenüber finalen Erklärungen hegen, auch heute noch an, nachdem der Vitalismus-Streit längst vergessen ist. Rückwärtsgerichtete Wirkungserklärungen sind inakzeptabel. Wenn wir das Wollen und Handeln wissenschaftlich erklären wollen, müssen wir uns auf vorwärtsgerichtete Wirkungserklärungen beschränken – so wie Lotze, James und Ach es uns vorgemacht haben.
Wille und Tat
Eine andere unangenehme Frage betrifft die delikate Beziehung zwischen subjektivem Wollen und objektivem Tun. Kognitionspsychologische Forschung fragt danach, wie Handlungen zustande kommen und welche Faktoren sie bestimmen. Sobald wir dann versuchen, diese Faktoren näher zu bestimmen, stoßen wir auf das unangenehme Problem, dass es sich dabei nicht um objektiv messbare Größen handelt, sondern um subjektive Größen, die zunächst ausschließlich im Erleben der Akteure auftreten. Wenn wir nämlich davon reden, dass unser Handeln u. a. von Plänen, Absichten oder Zielen bestimmt wird, bringen wir die Überzeugung zum Ausdruck, dass unsere subjektiven Willenserscheinungen ursächlich für unser objektives Handeln sind oder – mit einer altmodischen Floskel gesagt – dass es der Wille ist, der die Tat hervorbringt. Diese Überzeugung ist ein selbstverständlicher und unverrückbarer Bestandteil der Alltagspsychologie, mit der wir unser tägliches Leben bestreiten. Aber wie können wir wissenschaftlich mit ihr umgehen?
Wir stoßen hier auf ein Problem, das so alt ist wie die Psychologie selbst: das Problem der psychischen Kausalität. Kann es angesichts der kategorialen Verschiedenheit von Erleben und Verhalten überhaupt denkbar sein, dass subjektiven Sachverhalten wie Plänen, Absichten oder Zielen eine kausale Rolle für die Erklärung von objektiven Handlungen zugewiesen wird? Wie soll das gehen?
In der Tat geraten wir in doppelte Verlegenheit, wenn wir in die Erklärung einer objektiven Verhaltensleistung (in der z. B. von der Aktivität gewisser Hirnareale, Zellverbände und Neurone die Rede sein muss) auch ein subjektives Glied einbauen wollen. Erstens wissen wir nicht, wo wir dieses subjektive Glied installieren sollen. Und zweitens wissen wir noch viel weniger, wie man sich die kausale Wirkung dieses subjektiven Gliedes auf die nachfolgenden objektiven Glieder der Kette vorstellen soll. Dass die Aktivität von Neuronen, Zellverbänden und Hirnarealen bestimmte Körperbewegungen hervorbringen kann, können wir uns im Prinzip vorstellen. Nicht vorstellen können wir uns dagegen, was in dieser physiologischen Wirkungskette eine bewusste Absicht verloren hätte und was sie dort kausal ausrichten könnte.
Wir müssen also zugestehen, dass die Idee der psychischen Kausalität, die in unseren alltagspsychologischen Intuitionen ein völlig selbstverständliches und unbekümmertes Dasein führt, uns vor unangenehme Probleme stellt, wenn wir versuchen, sie wörtlich zu nehmen und konkret auszubuchstabieren. Denn zwischen subjektiv beschreibbaren Erlebnistatbeständen und neurobiologisch beschreibbaren Verhaltensgrundlagen liegt eine kategoriale Kluft, die wir nicht überbrücken können – jedenfalls nicht mit den überkommenen Vorstellungen von kausalen Zusammenhängen. Theorien, die den (subjektiven) Willen in die Erklärung der (objektiven) Tat einbauen, laufen Gefahr, die Anschlussfähigkeit der Psychologie an die Neurobiologie infrage zu stellen – ganz zu schweigen davon, dass sie sich in ernste metaphysische Probleme verstricken. Sie müssen sich vorhalten lassen, dass sie Erklärungsbegriffe verwenden, mit denen die Neurobiologie nichts anfangen kann und die die Philosophie in Verlegenheit bringen.
Der frühen kognitionspsychologischen Handlungsforschung ist es nicht gelungen, das Problem der Beziehung von Wille und Tat zu lösen oder aufzulösen. In der Rückschau können wir verstehen, woran das gelegen hat. Die klassische Willenspsychologie kannte nur zweierlei: subjektive Bewusstseinstatsachen (wie Absichten, Pläne oder Zielvorstellungen) und objektive Bewegungen. Der Wille war immer der bewusst erlebte Wille; Willensprozesse waren ohne Bewusstsein nicht denkbar. Deshalb war die Beziehung zwischen Wille und Tat kontaminiert mit der schwierigen Beziehung zwischen psychischen und physischen Prozessen. Erst die zweite Welle kognitionspsychologischer Handlungsforschung hat diesen Knoten aufgelöst. Wie wir noch sehen werden, redet sie nicht mehr davon, dass Handlungen durch bewusste Willensvorstellungen bewirkt werden, sondern durch handlungsbezogene Ereignisrepräsentationen, die selbst weder bewusst noch unbewusst sind. Das Problem der Beziehung zwischen Wille und Tat wird damit in das Problem zwischen Repräsentation und Handlung transformiert – ein immer noch schwieriges, aber lösbares Problem.
1.2 Handlungen verstehen – was heißt das?
Bisher haben wir hauptsächlich über Handlungsforschung gesprochen und die Gegenstände, die sie betrachtet, nur beiläufig charakterisiert. Wir haben uns darauf verlassen, dass man schon weiß, was gemeint ist, wenn von Handlungen die Rede ist. In diesem Abschnitt wollen wir dieses implizite Verständnis genauer explizieren. Was verstehen wir eigentlich unter Handlungen? Wie können wir sie beschreiben und was brauchen wir, um sie zu erklären? Und wie können wir in unseren Beschreibungen und Erklärungen dem Zwittercharakter von Handlungen gerecht werden, der sich aus der Verbindung von physischen mit psychischen Prozessen ergibt?
Wenn wir uns auf die Suche nach Antworten machen, die die wissenschaftliche Psychologie zu diesen Fragen anzubieten hat, kommen wir nicht umhin, uns mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass der Common Sense unserer alltagspsychologischen Intuitionen solche Antworten längst bereithält. Ob das zu unserem Glück ist, weil der Common Sense die Antworten der Wissenschaft vorwegnimmt, oder zu unserem Unglück, weil er die Wissenschaft in die Irre führt, lassen wir zunächst dahingestellt. Jedenfalls sind wir (hier wie in anderen Bereichen der Psychologie) gut beraten, wenn wir uns über die alltagspsychologischen Intuitionen, die unser wissenschaftliches Denken prägen, Rechenschaft ablegen und wenn wir die wissenschaftlichen Antworten, nach denen wir suchen, in Abgrenzung von diesen Intuitionen entwickeln. Deshalb sprechen wir in diesem Abschnitt nicht nur über das wissenschaftliche Beschreiben und Erklären von Handlungen, sondern auch über den schwierigen Umgang mit Begriffen der Alltagssprache, die sich oft der Unterscheidung zwischen Beschreiben und Erklären verweigern.
1.2.1 Handlungen beschreiben
Wir wissen im Grunde, was Handlungen sind, aber trotzdem ist es nicht einfach, genau zu charakterisieren, was alles zu einer Handlung gehört. Denn die Handlungen, die jemand ausführt, liegen nicht als säuberlich abgegrenzte Vorgänge vor unseren Augen. Wir als Beobachter sind es vielmehr, die aus dem Strom der kontinuierlichen Tätigkeit, die wir beobachten, bestimmte Segmente herauslösen und als Handlungen zusammenfassen und individuieren. Ein anderer Grund, der die Beschreibung schwierig macht, hängt damit zusammen, dass die (äußeren) Tätigkeitssegmente, die wir auf diese Weise zusammenfassen, auf eigentümliche Weise mit (inneren) Plänen und Zielen verbunden sind, die die handelnde Person verfolgt und, wenn sie Glück hat, schließlich auch erreicht. Die äußere Seite von Handlungen können wir direkt beobachten, die innere Seite dagegen nur erschließen.
Segmente im Verhaltensstrom
Solange wir wach sind, sind wir eigentlich ständig damit beschäftigt, irgendetwas zu tun. Fragt man Personen, was sie gerade tun, bekommt man in der Regel plausible Antworten. Die Personen sind ohne weiteres in der Lage, die Handlungen, die sie gerade ausführen, zu identifizieren: Sie pfeifen eine Melodie, sie lesen Zeitung, sie erledigen einen Einkauf oder dergleichen (Vallacher & Wegner, 1985, 1989). Die Antworten markieren bestimmte Segmente im Tätigkeitsstrom der betreffenden Person – Abschnitte, deren Anfang und Ende mehr oder weniger klar definierbar sind.
In vielen Situationen gibt es mehr – oft wesentlich mehr – als eine zutreffende Antwort. Zum einen kann es vorkommen, dass mehrere Handlungen parallel laufen: Man kann ein Lied pfeifen, während man einkauft, und vielleicht liest man dabei sogar noch Zeitung. Aber auch da, wo es auf den ersten Blick nur eine Antwort gibt, können auf gezielte Nachfrage weitere Antworten nachgeliefert werden, die alle gleichermaßen zutreffend sind. Personen sind nämlich in der Lage, auch ihre Tätigkeit auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu beschreiben – von kurzfristigen Bewegungen, die sie gerade ausführen bis hin zu langfristigen Lebensplänen, die sie verfolgen (Box 1.3).
Box 1.3
Was man alles gleichzeitig machen kann
Dass Personen ihre Tätigkeit auf mehreren Ebenen gleichzeitig beschreiben können, wird deutlich, wenn man die Eingangsfrage »Was machst du gerade?« durch weitere Nachfragen ergänzt. Hakt man zum Beispiel nach: »Was machst du denn gerade genau?«, wird der Einkäufer sagen, dass er gerade nach Milch und Butter sucht, und die Zeitungsleserin wird antworten, dass sie einen Artikel über den Konflikt zwischen Iran und Israel liest. Fragt man noch weiter im Detail, bekommt man weitere Auskünfte: über den Griff zur Milchflasche, den man gerade macht, das politische Argument, das man gerade liest oder sogar die Worte, in denen es formuliert ist. Man kann aber genauso gut in die umgekehrte Richtung fragen – nach den größeren Handlungszusammenhängen, in die die aktuellen Handlungen eingebettet sind. Auf Fragen wie »Und was machst du überhaupt so?« kann man Antworten bekommen, die Zusammenhänge ansprechen, die sich über Stunden, Tage, Monate und Jahre erstrecken: dass man dabei ist, ein Referat zu schreiben oder seine Freundin zu besuchen; dass man eine Reise nach Australien oder ein Zweitstudium der Mathematik plant usw.
Bemerkenswert ist, dass all diese Antworten gleichzeitig zutreffend sein können. Einerseits können wir die Handlungen, die wir ausführen, durch immer kürzere Teilhandlungen konkretisieren (Einkaufen im Supermarkt (→ nach Milch und Butter suchen (→ nach der Milchflasche greifen usw.). Zugleich verstehen wir die gleichen Handlungen aber auch als Bestandteile längerer und umfassenderer Zusammenhänge (Einkaufen für das Wochenende (→ um in Ruhe ein Referat schreiben zu können (→ das zur Vorbereitung des geplanten Zweitstudiums dient usw.).
Bemerkenswert ist außerdem, dass die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Handlungen und Handlungsebenen uns mühelos gegenwärtig sind und dass wir uns leicht zwischen ihnen hin- und herbewegen können. Das gilt z. B. auch dann, wenn wir eine Handlung unterbrechen, um zwischendurch etwas anderes zu erledigen, oder wenn wir alternierend zwischen zwei Handlungen hin- und herwechseln (wie z. B. Kuchen backen und Zeitung lesen). Dass beide Handlungsstränge in einem solchen Fall aus lauter zeitlich getrennten Stücken bestehen, stört unsere Übersicht über das, was wir tun, nicht im Geringsten. Unsere Übersicht ist an der Identität der Handlungen orientiert; sie richtet sich nach ihrem Sinn und Zweck, und nicht nach der zeitlichen Abfolge, in der sie im Strom unserer Tätigkeit manifest werden.
Aus alldem folgt: Die spontane Antwort, die eine Person auf die Frage gibt, was sie gerade tut, ist eine von mehreren möglichen Antworten. Welche sie als erste auswählt, wird durch den Kontext bestimmt, in dem die Frage gestellt wird, und sie kann auf Nachfrage weitere Antworten nachlegen. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass der wache Anteil unserer Lebenstätigkeit aus lauter Handlungen unterschiedlicher zeitlicher Erstreckung besteht, die ineinander verschachtelt sind. Aus der Sicht des Akteurs sind diese Handlungen wohldefinierte Abschnitte seiner Tätigkeit. Er weiß genau, wann sie anfangen und enden, wann sie unterbrochen und wiederaufgenommen werden, egal, ob sie sich über einige Sekunden erstrecken (nach der Milchflasche greifen) oder über einige Wochen (in Urlaub fahren).
Wir können diese Beobachtungen in einer abstrakteren Sprache auch wie folgt zusammenfassen: Wir haben es hier mit Hierarchien von Tätigkeitssegmenten zu tun, die wir als Handlungshierarchien bezeichnen können. An der Spitze solcher Hierarchien stehen langfristige Segmente – wie ein Zweitstudium aufnehmen oder in Urlaub fahren. Auf den darunterliegenden Ebenen folgen dann zunehmend kurzfristige Segmente, die in den langfristigen Segmenten enthalten sind.
Während diese Beobachtungen die Idee nahelegen, dass menschliches Tun und Lassen aus lauter diskreten Elementen besteht, die ineinander verschachtelt sind, zeichnen andere Beobachtungen ein wesentlich kontinuierlicheres Bild menschlicher Tätigkeit. Wenn wir nämlich unvoreingenommen beobachten, was andere tun, sehen wir – jedenfalls auf den ersten Blick – keine diskreten Segmente, ganz zu schweigen von hierarchischen Systemen solcher Segmente. Was wir sehen, ist vielmehr ein mehr oder weniger kontinuierlicher Verhaltensstrom. In diesem Strom können wir zwar zwischen Phasen hoher und geringer Veränderungsdichte unterscheiden, bis hin zu Extremfällen wie stationärem Stillstand oder ständigem abruptem Wechsel. Aber sinnvolle diskrete Segmente mit wohldefiniertem Anfang und Ende sehen wir nicht – weder auf kurzfristigen Zeitskalen, und schon gar nicht auf längerfristigen Skalen. Allenfalls können wir solche Segmente dann erkennen, wenn unser Blick dadurch geschärft wird, dass die Person, die wir beobachten, ihr Handeln kommentiert und erläutert.
Kontinuierlicher Strom oder diskrete Segmente – was soll gelten? Können wir einen Weg finden, beiden Beschreibungen gerecht zu werden? Eine produktive Verbindung beider Perspektiven liefert eine einfache Idee, die wir als Repräsentationshypothese bezeichnen können. Sie besagt, dass menschliche Akteure das, was sie tun und tun wollen, als diskrete Segmente repräsentieren – genauer: als hierarchisch organisierte Systeme von Tätigkeitssegmenten unterschiedlicher zeitlicher Erstreckung.
Die Repräsentationshypothese kann eng oder weit gelesen werden. Die enge Lesart sieht ihre Gültigkeit auf die Wahrnehmung und Interpretation von Handlungen beschränkt, die jemand ausführt. Sie besagt, dass Akteure ihr Tun und Lassen als Abfolge diskreter Tätigkeitssegmente verstehen (egal, wie es tatsächlich zustande kommt). Demgegenüber wendet die weite Lesart die Repräsentationshypothese nicht nur auf die Wahrnehmung und Interpretation, sondern auch auf die Produktion und Steuerung von Handlungen an. Sie besagt, dass Akteure ihre Tätigkeit als Abfolge diskreter Tätigkeitssegmente planen (und sie deshalb auch so verstehen).
Mit der Repräsentationshypothese haben wir die Ebene der Beschreibung bereits hinter uns gelassen. In der Tat bildet die weite Lesart der Repräsentationshypothese den theoretischen Ausgangspunkt kognitionspsychologischer Handlungsforschung. Forschungsprogramme in diesem Bereich sind darauf angelegt, die Natur der Repräsentationen zu charakterisieren, die an der Wahrnehmung und Produktion von Handlungen beteiligt sind. Im Prinzip haben solche Programme zwei Aufgaben, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden. Der anspruchsvolle, komplexe Zweig verfolgt das Ziel, die repräsentationalen Grundlagen von Handlungshierarchien aufzuklären. Der weniger anspruchsvolle und komplexe Zweig konzentriert sich dagegen auf die Aufklärung der repräsentationalen Grundlagen der einzelnen Handlungen, die die Elemente dieser Hierarchien ausmachen. Die erste – anspruchsvolle – Aufgabe hat die Forschung bisher noch kaum in Angriff genommen. Die zweite Aufgabe steht dagegen im Mittelpunkt der kognitiven Handlungsforschung der vergangenen 20 Jahre.
Pläne und Ziele
Wenn die Repräsentationshypothese zutrifft, haben Handlungen ihren Ursprung im Kopf des Akteurs. Der Akteur ist es, der seine Tätigkeit in Handlungen gliedert. Wie macht er das? Was definiert für ihn eine Handlung? Wo beginnt sie und wo endet sie? Und wie unterscheiden sich Handlungen von Ereignissen, die keine Handlungen sind?
Im Vergleich zu uns, die wir seine Tätigkeit von außen beobachten, hat er einen entscheidenden Vorsprung. Er ist nämlich nicht auf Beobachtung und nachträgliche Interpretation seiner Tätigkeit angewiesen. Er verfügt vielmehr über den privilegierten Zugang der Ersten Person – nämlich zu den inneren, gleichsam privaten Planungsprozessen, die seiner äußeren und öffentlich beobachtbaren Tätigkeit vorausgehen. Diese Planungsprozesse sind es offenbar, die die Grundlagen für die Segmentierung seiner Tätigkeit in einzelne Handlungen liefern.
Wir müssen Handlungen demnach als Elemente prospektiver Planung von Tätigkeit verstehen und beschreiben, nicht als Elemente retrospektiver Wahrnehmung. So gesehen sollten wir die Antworten auf die Frage, was man gerade tut, auch nicht als Auskünfte darüber verstehen, welche Handlungen man gerade ausführt, sondern welche Handlungen man gerade plant. Deshalb besteht auch kein Widerspruch darin, dass, während man einkauft und gerade nach einer Milchflasche greift, auch damit beschäftigt sein kann, ein Lied zu pfeifen – und dass der Einkauf stattfindet, während man bei einem Freund zu Besuch ist. Was man gerade tut, ist das, was man gerade in Planung hat, und diese Planungen können sich auf ganz unterschiedliche Handlungsebenen beziehen.
Mit der prospektiven Planungsperspektive auf Handlungen rückt eine Kategorie in den Vordergrund, die in der retrospektiven Interpretationsperspektive nur eine untergeordnete Rolle spielt: die Kategorie des Ziels. Ziele sind für Handlungen von zentraler Bedeutung. Die einzelnen Handlungen, in die Personen ihre Tätigkeit gliedern, werden durch Handlungsziele definiert, konstituiert und individuiert. Zu einer Handlung gehören alle Tätigkeitssegmente, die auf ein gemeinsames Ziel konvergieren und die durch dieses Ziel zusammengebunden sind. Handlungen sind also Elementarprozesse zielgerichteten Verhaltens.
Die Idee, dass unser Handeln durch Ziele bestimmt wird, ist tief in unseren alltagspsychologischen Vorstellungen verwurzelt. Wir handeln, weil wir etwas Bestimmtes erreichen wollen, und das, was wir erreichen wollen, macht unser Handlungsziel aus. Manchmal kommt es vor, dass uns das, was wir erreichen wollen, explizit bewusst ist. Für einen Architekten, der ein Haus entwirft und plant, wird in der Regel gelten, dass er ein mehr oder weniger deutliches Bild des fertigen Hauses vor Augen hat. Bei den meisten Alltagshandlungen, die unser tägliches Leben ausfüllen, sind die Ziele, die ihnen zugrunde liegen, nicht immer explizit und bewusst repräsentiert, aber stets implizit mitbewusst. Wer sich die Zähne putzt, Milch und Butter einkauft oder die Tageszeitung liest, weiß genau, warum er das tut und was er mit diesen Aktivitäten erreichen will. Er handelt zielgerichtet, ohne darauf angewiesen zu sein, sich die Ziele, die er verfolgt, explizit und bewusst vor Augen zu führen.
Aus diesen Überlegungen folgt: Wenn wir unsere Handlungen beschreiben, charakterisieren wir die Pläne, die wir verfolgen, und wenn wir unsere Pläne charakterisieren, beschreiben wir die Ziele, die ihnen zugrunde liegen. Die Ziele, die wir verfolgen, und die Pläne, durch die wir sie realisieren, legen fest, was zu einer Handlung gehört: wann sie anfängt, wann sie endet und was dazugehört und was nicht.
Das wirft die Frage auf, was für Handlungsziele es gibt und wie wir sie einteilen können. Eine umfassende Systematik von Handlungszielen kann es ebenso wenig geben wie eine Systematik von Handlungen. Denn wie Handlungen können auch Handlungsziele nach Belieben individuiert werden.
Das muss aber nicht heißen, dass die Suche nach systematischen Ordnungsgesichtspunkten völlig aussichtslos ist. Einteilen lassen sich Handlungsziele beispielsweise nach Merkmalen, die den Prozess der Handlungsrealisierung betreffen, also die Umsetzung von Zielen in Handlungen. Unterschiedliche Anforderungen an die Handlungsrealisierung bestehen beispielsweise für abstrakte vs. konkrete Handlungsziele – wie etwa »eine Weltreise unternehmen« vs. »den Eiffelturm besteigen«. Abstrakte Ziele sind meist so gefasst, dass sie sich auf einen zeitlich weit erstreckten Handlungszusammenhang beziehen (Weltreise), während konkrete Ziele sich durch kurzfristige Handlungen realisieren lassen (Eiffelturm). Je abstrakter Ziele sind, desto mehrdeutiger und indirekter (nämlich durch konkretere Unterziele vermittelt) muss man sich ihre Ankopplung an zielführende Handlungen vorstellen. Je konkreter sie sind, desto eindeutiger und direkter fällt diese Ankopplung aus.
Die enge funktionale Verbindung zwischen Zielen und Handlungsplänen legt die Vorstellung nahe, dass Handlungsziele – ebenso wie Handlungen und Handlungspläne selbst – in Hierarchien organisiert sind. An der Spitze solcher Hierarchien sind abstrakte und weit umspannende Lebensziele angesiedelt, wie etwa ein selbstbestimmtes Leben führen, oder kaum weniger abstrakte Lebensabschnittziele, wie beispielsweise in einem Beruf erfolgreich zu werden oder in einer Partnerschaft Erfüllung zu finden. Derart allgemeine Ziele können dann konkretere Ziele hervorbringen, die Handlungstendenzen begünstigen, die auf die Realisierung der dahinter stehenden hochstufigen Lebensziele ausgerichtet sind. Von solchen sehr allgemeinen Zielen, die man als überdauernde Handlungsdispositionen von Personen ansehen kann (traits), lassen sich Handlungsziele im engeren Sinne abgrenzen, die nur temporär aktiv sind – so lange wie der betreffende Handlungszusammenhang andauert (states). Diese Ziele sind ihrerseits wiederum hierarchisch organisiert, mit abstrakten Zielen, die zeitlich weit erstreckten Handlungen zugrunde liegen, an der Spitze (Weltreise) und konkreten Zielen, die wohlumschriebenen Handlungen zugrunde liegen, an der Basis (Eiffelturm).
1.2.2 Handlungen erklären
Inzwischen haben wir die Grenze zwischen Beschreibung und Erklärung schon mehrfach überschritten. Wir haben sie überschritten, weil die alltagspsychologischen Begriffe, die wir verwenden, uns keine andere Wahl lassen. Denn die Trennung zwischen Beschreibung und Erklärung, die für den wissenschaftlichen Diskurs unentbehrlich ist, ist dem alltagspsychologischen Diskurs fremd. Der Alltagsdiskurs verwendet Begriffe wie Handlungen, Handlungspläne und Handlungsziele nicht nur deskriptiv, sondern auch explikativ. Ziele dienen nicht nur dazu, Handlungen zu charakterisieren, sondern auch dazu, sie zu erklären. Pläne beschreiben nicht nur Handlungsverläufe, sondern erklären sie auch. Und Handlungen beschreiben nicht nur elementare Tätigkeitssegmente, sondern erklären auch die Entstehung der Körperbewegungen, durch die sie realisiert werden. Für all diese Begriffe gilt, dass der Übergang zwischen ihrer beschreibenden und erklärenden Verwendung fließend ist (Box 1.4).
Wenn wir Handlungen erklären wollen, müssen wir daher den alltagspsychologischen Diskurs hinter uns lassen und die Erklärungen, nach denen wir suchen, in einer Sprache formulieren, die sich klar unterscheidet von der Sprache, in der wir Beschreibungen formulieren. An dieser Stelle treffen wir auf zwei grundlegend verschiedene Optionen für die Wahl einer angemessenen theoretischen Sprache – Optionen, die beide in Denktraditionen des 19. Jahrhunderts wurzeln. Sie teilen die Auffassung, dass wir durch Handlungen Ziele erreichen. Sie unterscheiden sich aber grundlegend in ihren Vorstellungen über die Prozesse, die das Erreichen von Zielen sicherstellen. Die behavioristische Option betrachtet das Erreichen von Zielen als emergente Eigenschaft von
Box 1.4
Über Ziele und Zielbegriffe
Der Begriff des Ziels ist besonders gut geeignet, die Schwierigkeiten, die sich aus der Vermischung von Beschreibung und Erklärung ergeben, exemplarisch vorzuführen. Er ist ein besonders prägnantes Beispiel für die vielen schillernden Konzepte, die die Wissenschaftssprache der Psychologie mit der Alltagssprache teilt.
Schon die Alltagssprache selbst bietet ein erstaunliches Allerlei von Zielen und Zielbegriffen. Erstaunlich ist diese Vielfalt deshalb, weil sie im gewöhnlichen Sprachgebrauch völlig unbemerkt bleibt. Was in kommunikativer Praxis problemlos funktioniert, erweist sich aber bei näherer wissenschaftlicher Betrachtung als mehrdeutig und verwirrend. Mehrdeutigkeiten entstehen vor allem durch die unklare Vermengung von beschreibender und erklärender Verwendung des Begriffs.
Betrachten wir zunächst die beschreibende Verwendung von Zielen und Zielbegriffen. Ziele finden wir in der Außenwelt, im Verhalten und im Erleben vor.
Ziele in der Welt: Zunächst können mit Zielen Sachverhalte in der Welt gemeint sein. Ziele können nämlich Orte, Dinge oder Ereignisse in der Welt sein – und zwar solche, deren Erreichen, Herstellen, Besitzen etc. irgendein Mensch, ein Tier oder auch ein technisches System anstrebt. Zielcharakter schreiben wir diesen Sachverhalten deshalb zu, weil es Lebewesen oder Systeme gibt, deren Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, sie herbeizuführen. In diesem Sinne ist etwa der Heimatschlag das Ziel der Brieftaube, und die Marathonstrecke endet an einer Ziellinie, über der sogar oft ein Band errichtet ist, das die Inschrift »Ziel« trägt.
Ziele im Verhalten: Von Systemen, deren Tätigkeit auf das Erreichen bestimmter Zielzustände (in der Welt) ausgerichtet ist, sagen wir, dass sie sich zielgerichtet verhalten. Im weiteren Sinne schreiben wir zielgerichtetes Verhalten aber nicht nur Brieftauben und Marathonläufern zu, sondern auch Pflanzen, die zum Licht hin wachsen, oder sogar Klimaanlagen, die die Raumtemperatur konstant halten. Der Zielbegriff, den wir dabei verwenden, dient einerseits der Verhaltensbeschreibung. Er hilft uns, das Verhalten dieser Systeme ökonomisch zu beschreiben. Zielgerichtetes Verhalten diagnostizieren wir immer dann, wenn wir beobachten, dass Systeme verschiedene Optionen aus dem Repertoire ihrer Verhaltensmöglichkeiten so lange durchspielen, bis ein bestimmter Zustand eintritt. Zielgerichtetes Verhalten ist also gewissermaßen am Ende der Verhaltenssequenz verankert. Die anfänglichen Glieder verstehen wir als Mittel, die auf das Erreichen eines am Ende stehenden Ziels hin organisiert sind.
Solche Vorgänge können wir nur schwer in einer Sprache beschreiben, die eine erklärende Verwendung des Zielbegriffs vermeidet. Zum Beispiel können wir das Verhalten einer Katze, die in einem Käfig eingesperrt ist, kaum anders beschreiben, als dass wir davon sprechen, dass sie versucht, dem Käfig zu entkommen, und dass sie alles Mögliche unternimmt, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel, das sie verfolgt, erklärt, was sie tut – mit dem Ergebnis, dass sie das verfolgte Ziel schließlich erreicht. Würde man mehrere Katzen in der gleichen Situation beobachten, würde man sehen, dass das Ziel, das sie am Ende erreichen, immer das gleiche ist, während die Mittel, die sie ausprobieren, ganz unterschiedlich sein können. Zielgerichtete Verhaltenssequenzen sind also dadurch charakterisiert, dass die Variabilität in frühen Abschnitten größer ist als in finalen Abschnitten: Flexibilität in den Mitteln, Konstanz im Ziel.
Ziele im Erleben: Über Ziele reden wir aber nicht nur in dem Vokabular, das uns zur Beschreibung des Verhaltens von Systemen, Lebewesen und anderen Personen zur Verfügung steht, sondern auch in dem intentionalen Vokabular, mit dem wir unsere eigenen mentalen Prozesse beschreiben – also nicht nur aus der Perspektive der Dritten Person, sondern auch aus der Perspektive der Ersten Person. Das ist der deskriptive Zielbegriff, den wir im vorausgehenden Abschnitt für die Beschreibung von Handlungen verwendet haben: Personen haben Ziele, verfolgen sie mit ihren Plänen und realisieren sie durch ihre Handlungen. Die Ziele, die sie verfolgen, sind ihre eigenen, persönlichen Ziele. Selbst wenn sie nicht immer bewusst und explizit repräsentiert sind, sind sie als mentale Inhalte in ihr Selbst integriert.





























