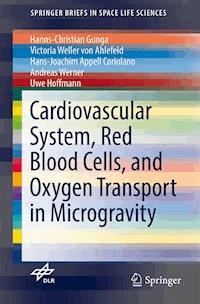19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Weltraummediziner und Physiologe Hanns-Christian Gunga beobachtet den menschlichen Körper unter physischen und psychischen Extrembelastungen – und erklärt, warum die Wissenschaft längst noch nicht alle Geheimnisse gelüftet hat: Wie wirkt sich Isolation auf unseren Körper aus? Was machen die Arbeit unter Tage, monatelange Schwerelosigkeit oder Flüssigkeitsmangel mit uns? Und wie ist es möglich, dass Körpertemperatur, Blutdruck und Pulsfrequenz auch unter so extremen Bedingungen nur minimal variieren? Eine Reise in unbekannte Tiefen, schwindelerregende Höhen und tief hinein ins menschliche Innenohr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hanns-Christian Gunga
Extrem
Was unser Körper zu leisten vermag
Über dieses Buch
Der Weltraummediziner und Physiologe Hanns-Christian Gunga beobachtet den menschlichen Körper unter physischen und psychischen Extrembelastungen – und erklärt, warum die Wissenschaft längst noch nicht alle Geheimnisse gelüftet hat:
Wie wirkt sich Isolation auf unseren Körper aus? Was machen die Arbeit unter Tage, monatelange Schwerelosigkeit oder Flüssigkeitsmangel mit uns? Und wie ist es möglich, dass Körpertemperatur, Blutdruck und Pulsfrequenz auch unter so extremen Bedingungen nur minimal variieren?
Eine Reise in unbekannte Tiefen, schwindelerregende Höhen und tief hinein ins menschliche Innenohr.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Hanns-Christian Gunga, geboren 1954, ist Geologe-Paläontologe und Facharzt für Physiologie sowie Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité in Berlin. Er hat Studien in ghanaischen Goldminen, auf der chilenischen Hochebene und auf der Raumstation ISS geleitet. In seinem neuen Buch erzählt er von den Abenteuern, den überraschenden Erkenntnissen und den neuen Fragen, vor die ihn seine Forschung gestellt hat – eine Reise in den menschlichen Körper unter extremen Bedingungen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hißmann, Hamburg
Coverabbildung: istockphotos
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491196-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort von Alexander Gerst
Vorbemerkung
Haarstrang oder Sein ist Gewordensein
Urknall oder Das Universum in uns
Olduvai oder Die Wiege der Menschheit
Whitehorse oder Die Grenztester
Hamar Laghdad oder Die Hitzegefahr
Blaueis oder Wenn der Berg ruft
Gateway oder Die ultimative Reise
Danksagung
Ausgewählte Literatur
Film
Internet
Für Luise.
Sie denkt. Sie lenkt. Sie schenkt.
Vorwort von Alexander Gerst
Dieses Buch handelt von Menschen in extremen Umgebungen und den Grenzen ihrer Belastung. Ich habe als Astronaut bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA nahezu ein Jahr in einer sehr extremen Umgebung zugebracht – dem All. Ohne technische Hilfsmittel ist hier ein Leben nicht möglich – und ohne permanente Unterstützung eines hochqualifizierten Teams sowohl am Boden als auch auf der Raumstation ebenfalls nicht. Eine umfassende theoretische und praktische Vorbereitung für einen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS ist unabdingbar, genauso wie die Bereitschaft, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Ein intensives Training hilft, sich gerade in den ersten Wochen in dieser neuen Umwelt zurechtzufinden. Auf der ISS, aus der Perspektive eines sehr entlegenen »Lebensraumes«, ist mir erst richtig bewusst geworden, welch enormer technischer und logistischer Aufwand nötig ist, um ein lebensfähiges Habitat für den Menschen außerhalb der Erde zu schaffen. Umso mehr habe ich – gerade als Geowissenschaftler – die natürlichen Ressourcen unseres Planeten Erde zu schätzen gelernt. Das wird spätestens beim ersten Blick aus dem Fenster eines Raumschiffes klar. Dort unten stehen Sauerstoff, Wasser, Nahrungsmittel »einfach so« zur Verfügung – noch. Aber diese Verfügbarkeit wird zunehmend bedroht durch den Menschen selbst. Nicht nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Umweltverschmutzung und der durch den Menschen beschleunigte Klimawandel verringern rasant den natürlichen Lebensraum des Menschen. Die zunehmende Ausdehnung von Wüsten ist hierfür nur ein Beispiel, wodurch die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen in Afrika, Asien und Australien jetzt schon zerstört wird. Die wichtigste Grundlage dafür, um diesen Entwicklungen entgegentreten zu können, ist das bessere Verständnis unserer Umwelt und eine unabhängige Perspektive auf uns selbst – von außen. Dies wird nicht nur durch die astronautische Weltraumforschung ermöglicht, sondern auch durch die Erforschung entlegener Regionen unseres Planeten, seien es die Polargebiete, Hochgebirge oder die Tiefsee. Als Humanphysiologe hat Hanns-Christian Gunga in derartigen Regionen gearbeitet und für seine Feldforschungen zum Teil eigene, neuartige Methoden entwickelt. Eine von diesen zur kontinuierlichen Erfassung der Körpertemperatur kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut, denn ich war selbst Teil einer von ihm initiierten mehrjährigen Untersuchungsreihe auf der ISS, die die täglichen Schwankungen der Körpertemperatur in der Schwerelosigkeit untersuchte. Hanns-Christian Gunga beschreibt in diesem Buch aber nicht nur, welche Belastungen Menschen ertragen können, sondern zeigt gleichzeitig auf, wann diese Grenzen für den menschlichen Organismus überschritten werden, und gibt Beispiele, wie andere Organismen in solch extremen Umwelten überleben können. Dieser evolutionäre Blickwinkel eines Humanmediziners ist besonders interessant und dürfte auf seine zusätzliche Perspektive durch das Studium von Geologie und Paläontologie zurückzuführen sein. Was dieses Buch aber wirklich bemerkenswert für mich macht, ist die Verknüpfung von Biographischem und Naturwissenschaftlichem, von Geplantem und scheinbar Zufälligem, was sich erst in der Rückschau zu einem Gesamtbild zusammenfügt. So macht das Buch auch anderen Menschen Mut, ihren ganz eigenen Weg zu suchen.
ESA-Astronaut Dr. Alexander Gerst auf der Raumstation ISS bei der Durchführung eines Experimentes zur kontinuierlichen Erfassung der Körpertemperatur (Quelle: European Space Agency, ESA)
Vorbemerkung
Wie reagiert der Körper auf monatelange Schwerelosigkeit, auf den arktischen Winter, auf sauerstoffarme Höhenluft, auf große Hitze oder Flüssigkeitsmangel? Wie ist es möglich, dass etwa Körpertemperatur, Blutdruck oder Pulsfrequenz auch unter extrem unterschiedlichen Bedingungen nur vergleichsweise minimal variieren? Die Wissenschaft hat noch längst nicht alle Geheimnisse des Lebens gelüftet.
Was Menschen zu leisten vermögen, über welche enorme Anpassungsfähigkeit der menschliche Körper verfügt, gibt auch der Medizin immer wieder Rätsel auf. Trotz aller Fortschritte in der medizinischen Forschung, trotz aller diagnostischen und therapeutischen Erfolge, wirft das Leben bis heute Fragen auf, die wir noch nicht beantworten können – deren Beantwortung aber sowohl für die Prävention als auch für die Therapie von Krankheiten ungeheuer wichtig wäre. Nehmen wir zum Beispiel die neuesten Erkenntnisse der Bluthochdruckforschung: Bei Isolationsstudien im Vorfeld zu Langzeitmissionen ins All hat sich überraschend gezeigt, dass die Haut offensichtlich als ein beachtlicher Speicher für Kochsalz im Körper dient. Wer diesen Speicher etwa aus genetischen Gründen nicht aktivieren kann, wird eher unter Bluthochdruck leiden. Nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft Pharmakologen ein neues Medikament entwickeln, dass zur Blutdruckregulation therapeutisch in diesen Salzhaushalt der Haut eingreift. Sollten dann Wissenschaftler alle Details dieses physiologischen Phänomens verstanden und ein entsprechend wirksames Medikament entwickelt haben, könnte dies durchaus nobelpreiswürdig sein. Ferner haben neue molekularbiologische Erkenntnisse gezeigt, dass in der menschlichen DNA virale Erbsubstanz – und nicht zu knapp – zu finden ist. Vielleicht mag man das in Zeiten von Covid-19 nicht gern hören: Aber auch wir sind viral! Immerhin beinahe ein Zehntel des menschlichen Erbguts stammt von Erregern viralen Ursprungs ab, die einst in der Entwicklungsgeschichte unsere entfernten Vorfahren infiziert und im Genom des Menschen Spuren hinterlassen haben. Manche diese ursprünglich viralen Gensequenzen übernehmen heute wichtige Funktionen in unserem Immunsystems zur Abwehr von Erregern. Eine wirklich erstaunliche Wandlung vom einstigen Eindringling zum Schutzpatron des Menschen. Ob auch andere Bruchstücke viralen Ursprungs in der menschlichen DNA bestimmte Funktionen haben, ist noch weitgehend unbekannt – und ein spannendes Forschungsfeld. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Genomsequenzen unter Umständen auch bei pathophysiologischen Veränderungen im Organismus eine Rolle spielen, so etwa beim Auftreten von bestimmten Krebserkrankungen. Sicher ist inzwischen, dass derartige virale Genschnipsel eine tragende Rolle bei der Entwicklung der Säugetiere innehatten, denn nur mit ihrer Hilfe kam es zur Reifung eines funktionsfähigen Plazentagewebes, was die Voraussetzung zur Einnistung des befruchteten Eis und zur ungestörten Weiterentwicklung des Embryos schuf.
Mittlerweile tritt die evolutionsbiologische Forschung insgesamt mehr und mehr in das Blickfeld der biologischen, physiologischen und medizinischen Forschung. So haben beispielsweise aktuelle Genforschungen Hinweise darauf gefunden, dass heutige Träger eines bestimmten Gens, das man schon bei den Neandertalern nachweisen kann, ein bis zu drei Mal höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Das könnte erklären, warum manche Regionen auf unserem Planeten weniger stark von dieser Infektion betroffen sind als andere. Populationen, die evolutionsbedingt größere Gemeinsamkeiten mit dem Neandertaler aufweisen wie die in Nord- und Osteuropa, könnten demnach statistisch gesehen anfälliger für Covid-19 sein. Warum das so ist, konnte allerdings bisher noch nicht geklärt werden.
Gerade Extremsituationen, zum Beispiel solche Ereignisse wie Pandemien, Hungersnöte, Hitzewellen oder die vollkommene Isolation eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen offenbaren oftmals überraschende Zusammenhänge, die uns in Demut erkennen lassen, dass der Mensch in Teilen immer noch ein »unbekanntes Wesen« ist. Die extreme physische und psychische Belastung kann dabei unwillentlich erfolgen, etwa im Rahmen einer Naturkatastrophe, oder willentlich aus beruflichen, sportlichen oder touristischen Gründen. Die medizinische Erforschung des Lebens in solchen extremen Umwelten, von denen der Weltraum zweifellos die lebensfeindlichste darstellt, ist deshalb alles andere als ein medizinisches Orchideenfach; sie motiviert uns, die Grenzen unseres Wissens zu überschreiten, um neue Erkenntnisse zu erlangen.
Von solcher Forschung, die unter teils abenteuerlichen Umständen stattfindet, werde ich in diesem Buch berichten. Wir werden erstaunliche Anpassungsleistungen von Menschen und Tieren kennenlernen, die das Überleben in Arktis und Antarktis, in Wüste oder Hochgebirge möglich machen und deren physiologische Grundlagen ich jeweils so »allgemeinverständlich« wie möglich zu beschreiben versuche, soweit sie bisher überhaupt bekannt sind. Denn entgegen der Annahme, die Wissenschaft habe nahezu alles Grundlegende in der Biologie und Medizin erforscht, tappt sie bei vielen Fragen nach wie vor im Dunkeln. Solche Fragen sind es, die mich als Physiologen umtreiben.
»Das ist ja schön und gut«, mögen Sie, verehrte Leserin, lieber Leser, nun einwenden. Aber was genau heißt das? Was, im Namen des Hippokrates, ist und macht ein Physiologe? Jeder weiß, womit sich ein Kardiologe, ein Orthopäde, ein Augen- oder Hautarzt beschäftigt. Viele wissen, was ein Onkologe oder ein HNO-Arzt beruflich so treibt, auch Pneumologen, Visceralchirurgen und – aufgrund ihrer aktuellen Medienpräsenz – Virologen mag man vielleicht noch kennen. Aber einen »Facharzt für Physiologie« wird wohl noch kaum jemand konsultiert haben. Entsprechend wurde ich schon als Physiotherapeut, Physiker, Psychologe oder Philologe eingeordnet, und freundliche Menschen machten mir Bücher über Astronomie, Astrologie und Demenz zum Geschenk. Aber dass die Berufsbezeichnung derart unbekannt ist, liegt gewissermaßen in der Natur der Sache. Wenn man so will, bin ich ein Arzt für Gesunde – etwa für die ja vergleichsweise topfitten Astronauten auf der Raumstation ISS. Und das ist durchaus nicht widersinnig. Es geht dabei um mehr als Krankheit oder Gesundheit im herkömmlichen Sinne. Es geht um Wohlbefinden unter den verschiedensten Bedingungen: physisch, psychisch und sozial. Und das erfordert einen ausgesprochen weiten Blick. Denn was für den einen Menschen untragbar ist, mag der andere geradezu suchen, um sich wohl zu fühlen.
Wie aber erklärt sich bei allen biologisch-physiologischen Gemeinsamkeiten solche Unterschiedlichkeit? Und welche Lehren lassen sich daraus ziehen? Geht man diesen Fragen auf den Grund, wird schnell deutlich, dass die Antworten nicht allein von Medizin, Biologie oder Physiologie gefunden werden können. Um das »unbekannte Wesen« Mensch besser zu verstehen, ist tatsächlich ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der viele andere Wissensgebiete, von der Geologie bis zur Astronomie, von der Paläontologie bis zur Psychologie, einschließt, der aber bei den deshalb erforderlichen »Ausflügen« in andere Wissenschaften stets den Körper des Menschen in den Mittelpunkt stellt. (»Das stimmt ja gar nicht«, würde meine Frau an dieser Stelle einwenden, »es werden ja meistens nur Männer untersucht!« Sie hat, mindestens was die Vergangenheit angeht, nicht unrecht.) Inwiefern also die eine oder andere »medizinfremde« Erkenntnis oder Beobachtung zum Verständnis unseres »Soseins« beiträgt, wird vielleicht nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich – und erfordert hin und wieder ein gewisses Durchhaltevermögen. Manchmal fügen sich die Dinge – Was hat unser Herz-Kreislauf-System, unsere Temperaturregulation oder unser Flüssigkeitshaushalt mit dem Urknall zu tun? – eben nur in der Zusammenschau. Das hat sich auch mir erst nach und nach erschlossen, wovon ich im ersten Kapitel erzählen möchte.
Das Verb »erzählen« ist mit Bedacht gewählt. Zwar werde ich auf manche Fachausdrücke nicht verzichten können. Mein Anliegen hier ist aber kein primär wissenschaftliches. Und meine Adressaten sind nicht in erster Linie die geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sondern im Grunde jede und jeder an den Wundern des Lebens Interessierte. Rätselhafte Phänomene aufzuklären ist eine spannende, häufig anstrengende und nicht selten abenteuerliche Aufgabe. Wenn es mir gelingt, dies im Folgenden hinreichend anschaulich machen zu können und damit einen bescheidenen Beitrag zum besseren Verständnis des Menschen, im Grunde alles Lebendigen, zu leisten – was zu beurteilen jeder Leserin und jedem Leser vorbehalten bleibt –, würde ich mich glücklich schätzen.
Hanns-Christian Gunga, im Juni 2021
Haarstrang oder Sein ist Gewordensein
Mein Weg zur Physiologie
Wie kommt der Sohn einer evangelischen Pfarrersfamilie dazu, Geologe, Mediziner und Physiologe zu werden? Und was hat die Physiologie, die Wissenschaft von den Funktionen und Abläufen in den Zellen und Organen aller Lebewesen, mit der Entstehung und Entwicklung des Universums, unseres Sonnensystems und unseres Planeten zu tun? Ein persönlicher Rückblick.
Ich bin in einem protestantischen Pfarrhaus in einer katholischen Gegend im Münsterland aufgewachsen. Mein Vater war Pfarrer und meine Mutter Psychiaterin in einem Krankenhaus für psychisch Erkrankte. Eine eigenwillige Mischung, die prägt. Der Alltag meiner Eltern war gekennzeichnet durch Arbeit. Von uns Kindern, meinen beiden Geschwistern und mir, wurden gute Leistungen in der Schule und ein für einen Pastorenhaushalt angemessenes, störungsfreies Verhalten in der Gemeinde erwartet. Bei monatlich stattfindenden Pfarrkränzchen mit Kollegen meines Vaters sangen wir zu Beginn gemeinsam Lieder von Paul Gerhardt und beteten. Alle waren in Schwarz gekleidet. Nur meine Mutter trug Weiß. Anschließend blieben wir Pfarrerskinder unter uns. Waren alle Gäste wieder abgereist, wurde es in der Regel anstrengend: Die Eltern besprachen dann beim Abendessen, was in den anderen Pfarrfamilien offensichtlich nicht so gut lief. Schul- und Drogenprobleme, Pubertätszumutungen und sexuelle Aktivitäten des Nachwuchses waren das Thema. Indirekt sollte meinen Geschwistern und mir damit klargemacht werden, wo die Grenzen verliefen und wovon wir tunlichst die Finger lassen sollten.
Ich hatte der Biologielehrerin einmal im Unterricht von meiner Begeisterung für das Fossiliensuchen erzählt. Da war ich ungefähr zwölf. Kurz darauf rief der Schulrektor bei uns an. Vermutlich eine Schrecksekunde für meine Eltern, denn nicht nur der Mathelehrer hatte bei mir schon des Öfteren einen ausprägten Hang zur Saisonarbeit diagnostiziert. Der Rektor führte allerdings keine Beschwerde, sondern äußerte den Wunsch, mich bei der Fossiliensuche begleiten zu dürfen. Dazu würde er mit mir sogar in einen weiter entfernt liegenden Steinbruch fahren. Bis dahin hatte ich nur in der Nachbarschaft in den Uferböschungen der Lippe gesucht. Diese waren zur Begradigung von Flussläufen, was in den sechziger Jahren mit Vorliebe geschah, mit Kalksteinmaterial aus der Region aufgefüllt worden, und das enthielt zum Teil reiches fossiles Material aus der späten Kreidezeit, der »Oberkreide« von vor etwa 100 bis 66 Millionen Jahren.
Pfarrkränzchen im elterlichen Pfarrhaus ca. 1966
Mit Feldbuch, Hammer, Meißeln und der Lokalzeitung im Rucksack – »Der Patriot« eignete sich hervorragend zum Einwickeln der Fundstücke; das war gutes, kräftiges und saugfähiges Papier, dessen Druckerschwärze allerdings so manches Mal die Hände färbte – fuhren wir mit dem Fahrrad nach Klieve. Es war ein warmer, sonniger Tag, der Himmel strahlend blau. Die Sommergerste stand schon im Feld, die Fahrradtour mit dem Rektor muss also im Juli gewesen sein. Damals waren die Getreidefelder noch durchsetzt mit leuchtend blauen Kornblumen und mit Klatschmohn, so rot, dass selbst ich, ein Rot-Grün-Farbsinn-Gestörter, die Farbe erkennen konnte. So radelten wir beschaulich durch eine leicht hügelige, ruhige westfälische Landschaft, und am Horizont kam der von Westen nach Osten verlaufende Höhenzug des Haarstrangs immer näher, die südliche Begrenzung der Westfälischen Bucht mit Gesteinen aus dem Turon (vor etwa 90 bis 94 Mill. Jahren) und dem Cenoman (vor etwa 94 bis 100 Mill. Jahren). Am Steinbruch angekommen, säumten zunächst zwanzig Meter hohe Schutthalden den unbefestigten Pfad in die tiefste Sohle des Steinbruchs. Ein feucht-kühler, kalkig riechender Luftzug begleitete uns, stärker werdend, je tiefer wir in die im Schatten liegende Sohle eindrangen. Hier ließ mich der Rektor über die Stratigraphie, über Erdzeitalter, Leitfossilien, die fossilreichen und -armen Schichten, die verschiedenen Qualitäten des Gesteins berichten und fasste den Plan, eine ganze Schulklasse an diesen Ort zu führen. Ich sollte den Unterricht im Steinbruch übernehmen, was in der Tat einige Wochen später geschah. Er hat seine Aufgabe als Pädagoge sehr ernst genommen. Mir gehen die Gedanken an den sommerlichen Ausflug und den Beginn meiner »Lehrtätigkeit« in der Talsohle am Haarstrang nahe. Ich bin dem Rektor noch heute dankbar. Ich glaube, ich habe es ihm nie gesagt.
Einem anderen, weniger direkten Mentor bin ich ebenfalls dankbar. Es muss in der Mitte der sechziger Jahre gewesen sein – zu Zeiten, in denen das Fernsehen noch schwarzweiß war. Emma Peel jagte in der Krimiserie Mit Schirm, Charme und Melone in fabelhaften Overalls als Agentin Verbrecher, das Raumschiff Orion plante den Rücksturz zur Erde, im Westdeutschen Rundfunk wurde die Sendung zur Entstehung der Arten gezeigt, und im ZDF lief die Fernsehreihe Unser blauer Planet. Ein weißhaariger Physiker mit eigenwilliger Intonation berichtete aus einem kargen Studio über die Naturgeschichte der Erde. Meistens saß er hinter einem Schreibtisch, die Kamera direkt auf ihn gerichtet, auf einem Drehstuhl, der ihm geringe, aber pointierte Änderungen der Blickrichtung zum Zuschauer ermöglichte, wenn es ihm notwendig erschien, die Aufmerksamkeit besonders zu fördern. Sein Sprachfluss war minimal verlangsamt. Er behielt die Zeit genau im Auge und trug stets eine ans innere Handgelenk gedrehte Armbanduhr, auf die er zwischendurch einen flüchtigen Blick werfen konnte. Alles sehr kontrolliert. Im Hintergrund standen im Studio vereinzelt Pinnwände mit Bildern auf Pappkarton, eine Tafel, vielleicht auch mal ein Globus, aber stets vor ihm auf seinem Schreibtisch: ein schneeweißer DIN-A1-Block mit dicken Kohlestiften. Hierauf skizzierte der Moderator, Heinz Haber, anschaulich komplizierte Planetenbahnen und erläuterte physikalische Gesetze. Nur ausnahmsweise verließ er den Platz hinter dem Schreibtisch und schrieb das Erklärte zusätzlich mit Kreide an die Tafel oder nahm den Globus zu Hilfe.
Was war das Faszinierende, das Besondere an ihm? Er hat kosmologisches und astronomisches mit geologischem Wissen der Erdgeschichte verknüpft. Das war neu. Diese Einbeziehung der Erde hat die entferntesten Galaxien, die Strahlung im All und von der Sonne nah an den Zuschauer herangebracht. Er sprach über Themen, die im schulischen Lehrplan so gut wie keine Berücksichtigung fanden. Was Haber berichtete, evozierte Staunen und Erstaunen, indem er die wunderlichsten Dinge so erklärte, dass man glaubte, in tiefe Geheimnisse eingeweiht zu werden. Er hat das Komplizierte scheinbar einfach gemacht, ohne es zu trivialisieren. In Wahrheit blieb natürlich auch bei ihm vieles rätselhaft, aber gerade das (noch) nicht Enträtselte machte seine Sendung oft spannend wie einen Krimi, und die Kargheit des Studios lenkte das Interesse auf das Wesentliche.
Was ich damals noch nicht wusste: Haber hatte über Jahre hinweg eng mit dem renommierten Physiologen Otto Gauer (1910–1979) zusammengearbeitet. Der hatte das Physiologische Institut an der Freien Universität Berlin in den sechziger Jahren mit aufgebaut und zu einem Zentrum medizinisch-physiologischer Forschung von überregionaler Bedeutung gemacht. Otto Gauer war Kreislaufphysiologe und interessierte sich für die Auswirkungen von Gravitationskräften auf das Herz-Kreislauf-System des Menschen, insbesondere auf die Durchblutung des Gehirns. Durch seine Experimente kam er zu dem (richtigen) Schluss, dass die plötzlich eintretende Bewusstlosigkeit von Piloten, die gefürchteten »Blackouts« bei raschen Richtungsänderungen, auf eine Minderversorgung des Gehirns mit Blut zurückführen ist. Heinz Haber beschrieb mit mathematisch-physikalischem Verständnis die Vorgänge, die beispielsweise bei Flugmanövern eine Rolle spielten.
Direkt nach dem Krieg war Gauer, mit Haber und anderen führenden Luft- und Raumfahrtwissenschaftlern, in den Gebäuden des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts in Heidelberg von den Amerikanern interniert worden, auch um sicherzustellen, dass diese Experten nicht in die Hände der Sowjets fielen. Gemeinsam arbeiteten die beiden während der Internierung in Heidelberg an dem Buch German Aviation in World War II und an einer theoretischen Arbeit mit dem Titel Man under gravity-free conditions – der weltweit ersten Publikation, die sich mit den möglichen Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper beschäftigte. Anfang der 1950er Jahre wurde Otto Gauer mit über 60 anderen Wissenschaftlern und Technikern in einer geheimen, von den Amerikanern durchgeführten Aktion namens »Operation Paperclip« über Mexiko in die Vereinigten Staaten gebracht. Dort hatten sie die Aufgabe, den Auf- und Ausbau des amerikanischen Luft- und Raumfahrtprogramms der NASA zu unterstützen. Erst 1960 kehrte Gauer aus den USA nach Deutschland zurück – gemeinsam mit Heinz Haber.
Dessen gleichnamiges Taschenbuch zur Sendung Der blaue Planet war das erste wissenschaftlich ausgerichtete Buch, das ich in einem Zug durchgelesen habe. Die darin behandelten Themen faszinierten mich, machten mich sowohl neugierig als auch mitteilungsbedürftig. Ich verfasste Wettbewerbsartikel über meine Voraussagen für die nächsten 50 Jahre und schrieb Beiträge zur Geologie des Tals der Pöppelsche, eines Baches im Kreis Soest am Haarstrang, in der Schülerzeitung Iris des Gymnasiums Kolleg Schloss Overhagen. Ein Organ, das sich in dieser Zeit ganz überwiegend mit Che Guevara, Fidel Castro, Rudi Dutschke, Black Power, den Ostermärschen oder prügelnden Polizisten auseinandersetzte und die neuesten Musikstücke von den Beatles oder Procol Harum feierte. Ich besorgte mir weitere Bücher zur Geologie-Paläontologie und Astronomie.
Nicht allzu überraschend fand alsbald ein kleines Teleskop seinen Weg in den elterlichen Garten. In den Wintermonaten gestattete unser Grundstück nach Süden hin einen ausgezeichneten Blick auf Orion, seinen Nebel und die Planeten hoch am Himmel. Unter den paläontologischen Büchern nahm Herbert Wendts Ehe die Sintflut kam sicherlich eine besondere Stellung ein, sonst hätte ich es mir nicht antiquarisch Jahrzehnte später wieder besorgt, dieses bibeldicke Buch mit zwei Seelilien aus dem Jura auf dem gelb-weißen Umschlag – Seelilien, die aus der Sammlung des Urwelt-Museums Hauff stammten. Die Geschichten und Erzählungen zur Paläontologie, das verstehe ich heute, waren offensichtlich eine willkommene Flucht aus der Enge des elterlichen Pfarrhauses – und weckten meinen Wunsch, Paläontologie zu studieren. Physiologie als Fachgebiet war mir damals so dunkel und weit weg wie das Präkambrium.
Es begann also mit Tagträumen beim Fossiliensuchen am Haarstrang und in kalten, klaren Winternächten am Teleskop im Garten. Damals standen der Mensch und sein Körper, seine Physiologie, für mich noch nicht im Mittelpunkt. Erst später kristallisierte sich hier der Wunsch heraus, zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen – der Körper, die Welt und der Kosmos. Ich habe mich manchmal gefragt, warum dieses Interesse nicht schon in der Jugend einsetzte. Vielleicht hing es mit dem Pfarrhaus, genauer gesagt, mit dem Protestantismus zusammen. Körperlichem und Genussvollem zu entsagen ist bekanntlich im Protestantismus eine besondere Tugend, eine Charakterstärke. Man legte Wert auf ein geradezu aristokratisches Bewusstsein von Freiheit, basierend auf einer geordneten, innengeleiteten Lebensführung, und war dadurch zu allem und jedem auf ein wenig Distanz bedacht. Geist und Geistvolles standen im Mittelpunkt, nicht der Körper.
Gleichwohl war unser Zuhause ein offenes Haus. Betrat man es, hing dort im Windfang, der durch eine Pendeltür vom Innenraum des Hauses abgetrennt war, ein kleines, wirklich bescheidenes, einfaches Kreuz und daneben eine farbige geologische Karte des Sauerlands im Maßstab 1:200000. Mit farbigen Stecknadeln waren darauf Fundorte für Fossilien und Mineralien in der Umgebung markiert. Der eine oder andere Besucher verweilte ein wenig irritiert davor, bis die Erklärung folgte, dass dies das Hobby eines der Kinder sei. Die Besucher traten, derart aufgeklärt, dann ins Pfarrhaus ein und wurden ins große »Herrenzimmer« linker Hand geführt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit konnte dies passieren. Pfarrhaus, Pfarrer, Pfarrfamilie und Gemeinde wurden als eine Einheit gesehen. Die Familie hatte deshalb in Fragen der weltlichen und christlichen Lebensführung gegenüber der Gemeinde stets eine Vorbildfunktion. Das bedeutete für uns, meinen Bruder, meine Schwester und mich: Wir waren unter ständiger Beobachtung. Mein Vater nahm manches »Missverhalten« wahr, sagte aber mit einer gewissen Bauernschläue nichts, sondern wartete zunächst die Kommentare der Mutter ab, um sich dann von ihr auffordern zu lassen, sich doch bitte in das Gespräch oder die Konflikte einzuschalten. Religiöse Dinge vermittelte er erfrischend unmissionarisch, und frömmelnde Lebensweisen waren ihm – Gott sei Dank – zutiefst suspekt; ein Haupt voll Blut und Wunden wollte er sich nicht zu eigen machen. Für allerlei knifflige Fragen des täglichen Lebens fand er erstaunlich praktische Lösungen, die er mit seinem Gewissen mühelos in Einklang bringen konnte. Martin Greiffenhagens Verweltlichung der Heilsbotschaft, als ein Charakteristikum des evangelischen Pfarrhauses, hatte er voll verinnerlicht. Seine Predigten verfasste er meistens am Samstagabend im besagten Herrenzimmer. Kleine, lose DIN-A5-Blätter in gestochen scharfer, sehr individueller Schrift beschrieben. Gedanken, an einem viel zu kleinen Schreibtisch verfasst, dessen Schublade ein Sammelsurium aus mehreren Tintenfässern in unterschiedlichstem Blau – den Etiketten nach aus mehreren Jahrzehnten –, verschiedenen Füllern, Klebstoff, Tauf- und Heiratsurkunden beherbergte. Bei dieser Tätigkeit war er sehr konzentriert. Auf der Kanzel löste er sich dann aber in der Regel von den Manuskriptseiten und »verkündigte das Wort« in einfachen Sätzen mit kräftiger, eindringlicher Stimme, und »um das Gemüt zu stärken«, wie er sagte, wurde mit Unterstützung des Organisten Ufer, der alle Register der kleinen Orgel zog, ausgiebig im Gottesdienst gesungen. Für seinen Religionsunterricht am Gymnasium Schloss Overhagen war er berühmt, denn dieser erfolgte in der Kapelle des Schlosses. Er parkte seinen kleinen weißen BMW 2002 direkt vor der Kapelle und packte Projektor, Lautsprecher, Leinwand und Filmrollen aus der Kreisfilmbildstelle aus. Vor dem Altar zog er dann die Leinwand hoch, nahm die Filmrollen aus den großen Aluminiumdosen und spannte die volle Filmrolle vorne und die leere hinten ein. Jetzt musste nur noch das Einfädeln des Zelluloids gelingen, und schon ratterte ein Film in der Kapelle los: 12 Uhr mittags von Fred Zinnemann oder Erica Andersons Albert Schweitzer. Ein Western? Das mutet doch ein wenig befremdlich an, Albert Schweitzer kann man ja noch nachvollziehen. Was er uns im Religionsunterricht damit näherbringen wollte, war einmal mehr Haltung, Gewissen, Berufung, das Sich-Bekennen zu etwas. Seine Haltung, seine unkonventionelle Unterrichtsform brachte ihm nicht nur Anerkennung evangelischer Schüler ein, sondern auch einiger katholischer, die diesem Religionsunterricht lieber beiwohnten – das rührte ihn. Er war immer mehr Seelsorger als Pfarrer.
Wenn es die weitere Gemeindearbeit in der Woche zuließ, fuhr er mich zu Veranstaltungen in verschiedenen Volkshochschulen in der Region, so dass ich mehr über die Geologie unserer Umgebung erfahren konnte. Ich würde heute zu gern wissen, was er sich damals dabei gedacht hat, als er sich mit mir in ein Auditorium setzte und einem Vortrag zuhörte, der sich mit den Korallen des Devons und der Kreidezeit im Sauerland beschäftigte, gehalten von einem Paläontologie-Professor der Universität Münster in tiefstem österreichischem Dialekt. Wen interessiert das denn? Wie auch immer – beide Eltern zeigten jedenfalls Interesse an dem, was mich interessierte, und dies ist wohl entscheidend, weil es bestärkt.
Mutter war intellektuell, schnell, schlagfertig, scharfsinnig, und ihrer Beobachtungsgabe entging nichts. Sie besaß eine kolossale Empathie für geistig und körperlich Behinderte, baute allerdings in der Familie einen starken Bindungsdruck auf, dem ich mich irgendwie entziehen konnte – oder sie ließ dieses Sich-Entziehen bei mir aus irgendeinem Grund eher zu; meinen Geschwistern gelang dies nach eigenen Angaben nur bedingt, um es ein wenig euphemistisch ausdrücken. Sie achtete penibel darauf, dass die Vorbildfunktion des Pfarrhauses nicht angekratzt wurde. Ein aufschlussreiches Beispiel hierfür stellt ein banaler Möbeltransport dar. Ich hatte bei dem Bundeswettbewerb »Reporter der Wissenschaft« den Sonderpreis des Rundfunks gewonnen und mir von dem Preisgeld bei einem Trödler in Lippstadt einen Schreibtisch aus Eiche mit zahlreichen Schubfächern und einem hübschen Furnier gekauft. Als es um den Transport des Objekts nach Münster ging, bat ich einen Studienfreund darum, mir seinen geräumigen Mercedes Kombi dafür zu leihen, was dieser auch tat. So fuhr ich von Münster nach Hause und parkte den Wagen direkt vor dem Elternhaus. Nun ja, zugegebenermaßen, war es kein »normaler« Kombi, sondern ein weitgehend entkernter, schwarzer Kombi, dem man durchaus noch ansah, dass früher darin andere Möbel aus Eiche bewegt wurden. Meinen Vater amüsierte das, Mutter war schier entsetzt: Was sollen denn die Leute denken – schaff das Ding weg! Ja, das war ihr immer sehr wichtig, dass die draußen in der Gemeinde nichts anderes dachten als das, was man von einem Pfarrhaus gemeinhin zu denken pflegt. Mein Vater war da wesentlich entspannter. So verwundert es auch nicht, dass er beim jährlichen Schützenfest in Benninghausen mit anlegte, um den Holzvogel runterzuholen, während Mutter hingegen alle Daumen drückte, dass der Vogel doch bitte bei seinem Schuss noch oben bleibt. Sie konnte da gar nicht hinsehen.
Zum Leben war zu Hause immer genug da. Die Eltern waren Stolz darauf, zu sagen, dass jeder von uns 20 Semester studieren könne – nur Achtung, auch hier wurde engmaschig kontrolliert; Arbeiten, Scheine, Examina, alles war vorzuweisen, nicht erst auf Nachfrage. Brauchte man zusätzlich Büchergeld, auch kein Problem, aber bitte nur gegen Quittung. Und wir? Wir hatten auch kein Problem, diese Vorgabe von 20 Semestern umzusetzen. Überlappend studierte mein Bruder erst Theologie, dann Medizin, meine Schwester zunächst Psychologie und wechselte dann vor dem Abschluss in die Theologie, und ich begann zunächst mit dem Geologie-Paläontologie-Studium, dann in den höheren Semestern kam die Medizin hinzu.
In das Medizinstudium bin ich tatsächlich eher beiläufig geraten, im Anschluss an ein Gespräch mit einer Kommilitonin in der Mensa am Aasee in Münster. Sie hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass noch am gleichen Tag um 24 Uhr die Bewerbungsfrist für das Medizinstudium im nächsten Semester abläuft und in diesem Jahr noch zurückliegende Studiensemester als Wartezeit dafür angerechnet würden. Das gab mir zu denken. Ich verließ umgehend die Mensa, suchte die notwendigen Unterlagen zusammen, machte mich nach Dortmund auf, reichte exakt eine Viertelstunde vor Abgabeschluss um Mitternacht meine Bewerbungsunterlagen bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) ein und erhielt dann tatsächlich einen Studienplatz – auch noch in Münster. Lag diesem spontanen Handeln ein Plan zugrunde? Nein. Hatte ich etwas zu verlieren? Nein. Vielleicht war ich einfach nur neugierig, wohin das führt, und beobachtete die weiteren Entwicklungen einfach. Viel konnte ich auch gar nicht machen, denn inzwischen hatte ich eine Halbtagsstelle – dies Detail wird noch wichtig sein – im Geologischen Institut angenommen und studierte – ganz im Ernst! – die Rückseite des Mondes; ich komme darauf zurück.
Die ganze Angelegenheit mit dem Studienplatz behielt ich für mich. Es gab damals allzu viele Studenten, die sich eigentlich nur in das Geologie-Studium einschrieben, um Grundlagenfächer wie Biologie, Chemie und Physik belegen zu können. Nach dem Erwerb dieser Scheine bestand für sie die Möglichkeit, sich dann in höhere Semester für das Medizinstudium einzuklagen. Das wurde verständlicherweise am Geologie-Institut nicht so gern gesehen, und mit jenen Studenten wollte ich mich nicht gemein machen. Allerdings profitierte auch ich davon, dass mir in der Tat viele Scheine für das Medizinstudium sofort anerkannt wurden. So kam es, dass ich mich in den ersten Semestern nur auf ein paar Pflichtveranstaltungen konzentrieren musste, um im Medizinstudium weiter voranzukommen: morgens Präparationskurs an der Leiche im Anatomischen Institut, nachmittags Erkundungen auf der Rückseite des Mondes, so sah mein Studienalltag aus.
Von den optionalen Veranstaltungen, die ich in dieser Zeit belegte, blieb mir besonders der Kurs zur Darstellung von Wissenschaft in Film und anderen Medien in Erinnerung. Dieses spezielle Interesse verdankte sich nicht nur meiner jugendlichen Begeisterung für die Sendungen von und mit Heinz Haber, sondern es rührte auch daher, dass ich in den siebziger Jahren mit dem Dokumentarfilmer Martin Schliessler aus Baden-Baden Kontakt aufgenommen hatte. Seine interessanten Berichte über riskante Expeditionen – vornehmlich zu Ostern und Weihnachten im Fernsehen gesendet – hatten mein Interesse geweckt. Er folgte in seinen Dokumentarfilmen Alexander von Humboldt den Orinoco hinauf oder bestieg auf seinen Spuren den Chimborasso. Er verdiente sein Geld mit solchen Reportagen und Vorträgen, die ihn in die entlegensten Orte auf diesem Planeten brachten. Das gefiel mir.
Der Kontakt mit Schliessler half mir, meine eigenen Reiseberichte für Zeitungen, Zeitschriften und Vortragsabende über Marokko zu professionalisieren. Ein Land, das gut in ein paar Tagen zu erreichen war und zudem – aus damaliger Sicht – für viele Bundesbürger noch als relativ exotisch galt. Seit den ersten Semestern im Geologie-Paläontologie-Studium war ich jährlich in den Semesterferien zur Fossiliensuche dorthin aufgebrochen, komplettierte so meine nordafrikanische Ortskenntnis, zog im Anschluss als Redner des Document-Vortragsrings (München) mit Diaprojektor, Leinwand und Mitbringsel in die einsamsten Volkshochschulen Deutschlands und hielt Vorträge in Kneipen, Jugendherbergen, Werkshallen, der Urania und später auf Kreuzfahrtschiffen. So gelang es mir, neben dem Studium, über diese »Expeditionen« jeweils genug Geld für die nächste Tour zu beschaffen.
Als nach sechs Semestern die Geländearbeit für die geologische Diplomarbeit näher rückte, entschied ich mich naheliegend für eine Arbeit im Antiatlas Marokkos. Alle Vorbereitungen und Genehmigungen des Ministère de Mines in Rabat lagen vor, da brach im Frühjahr 1976 endgültig der schwelende Westsaharakonflikt aus. Marokko führte Krieg gegen die Frente Polisario, die Freiheitskämpfer der Sahrauis, der Bevölkerung in dieser Region an der Atlantikküste Nordwestafrikas. Sie hatten nach dem Abzug der ehemaligen Kolonialmacht Spanien ein Jahr zuvor die Demokratische Arabische Republik Sahara ausgerufen und damit das Königreich Marokko herausgefordert. Diese politischen Entwicklungen machten alle meine Planungen zunichte, und ich war gezwungen, eine Alternative zu suchen.
Zusammen mit Stephan, einem Freund aus Jugendtagen, übernahm ich daraufhin eine geologische Kartierung der Montes de Toledo in Zentralspanien. Für mehrere Wochen schlugen wir in Porzuna, einem winzigen Dorf in der La Mancha, unser Lager auf. Dies bestand aus einem schon damals uralten VW-Bus mit getrennter Windschutzscheibe und klapprigen seitlichen Flügeltüren, die schon mal bei der Fahrt aufsprangen, und einem trapezartigen, geräumigen Zelt, dem das Innenzelt fehlte, das dafür aber Tische, Stühle, einen Gaskocher, eine Gaslampe und die Vorräte, allerlei Konserven und Trockensuppen, beherbergte. Am Abend unter freiem Himmel erzeugte die Gaslampe eine besonders behagliche Lagerstimmung. Die Fundstücke des Tages, Gesteine und Fossilien, wurden auf einem Tapeziertisch ausgebreitet, näher gesichtet und beschriftet. Danach erfolgte die Übertragung der Aufzeichnungen ins Feldbuch, samt Hinweisen über die Fundorte oder die räumliche Lage der Gesteinsschichten sowie das von Geologen so genannte »Streichen der Gesteine«. Dieses Streichen der Gesteinsschichten wird mit Hilfe eines geologischen Kompasses ermittelt, neben dem Hammer, Bleistift und Feldbuch das wohl unbestritten wichtigste Instrument eines Geologen im Gelände. Bei dem Geologenkompass sind interessanterweise West und Ost vertauscht und die 360° Einteilung verläuft linkssinnig, also gegen den Uhrzeigersinn. Dies erfolgt aus praktischen Gründen, da beim Hantieren mit dem Geologenkompass beim Anlegen an die Gesteinsschichten die Kompassnadel immer Richtung Norden verbleibt. Um zusätzlich die Lage des Kompasses zu kontrollierten, verfügt dieses Standardwerkzeug eines Geologen über eine kleine, eingebaute Wasserwaage und ein Pendelklinometer, mit dem der Einfallswinkel der Gesteinsschichten bestimmt wird. Die Messergebnisse wurden dann in eine topographische Karte übertragen. So fügte sich Stück für Stück das Bild einer geologischen Karte der Montes de Toledo zusammen. Als besonders hilfreich erwiesen sich dabei Schwarzweiß-Luftaufnahmen, die wir uns vor der Abreise aus Münster in Luftbildarchiven besorgt hatten. Mit einem einjustierten Feldstereoskop, das ganz ähnlich funktioniert wie ein Viewmaster, dessen dreidimensionale Bilderscheiben mich schon in Kindertagen in Erstaunen setzten, konnten wir auf unserem Tapeziertisch in Porzuna ein überhöhtes, dreidimensionales Bild unseres Kartierungsgebietes erzeugen. Was für ein wunderbares Werkzeug! So konnte manche nochmalige Begehung des Geländes vermieden werden, besonders solcher Areale, die sich durch überdimensional große Zecken und unterschiedlich kolorierte Schlangen im Gelände auszeichneten.
Und natürlich ließ sich am Tapeziertisch nicht nur gut arbeiten, sondern auch prächtig tafeln – die Dorfjugend nahm daran begeistert teil, und mancher Abend endete später in der einzigen Bar des Dorfes an der Plaza Central bei Los Hermanos. Wir schienen eine willkommene Abwechslung zu sein. Die örtlichen Vertreter der Guardia Civil mit ihrem für uns komisch anmutenden Tricornio, lackierten Dreispitz-Hüten mit einem trapezförmigen Hutaufschlag am Hinterkopf, interessierte eher die Arbeitserlaubnis für unser seltsames Treiben in Porzuna. Aber hierauf waren wir gut vorbreitet gewesen. Ein entsprechend voluminös abgestempeltes Schreiben auf Spanisch aus Münster und Madrid hatten wir griffbereit.
Geebnet hatte den Weg für diese Untersuchungen der deutsche Geologe Franz Lotze. Er hatte seit Jahrzehnten in Spanien und Marokko geforscht, dort enge Kontakte bis in die Ministerien aufgebaut und war von 1948 bis 1968 Direktor des Geologisch-Paläontologischen Institutes der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gewesen. Einer seiner zahlreichen Schüler, Lutz Bischoff, führte die Studien in Spanien fort und spezialisierte sich auf Luftbildgeologie, ein Spezialgebiet, das ich als Geologiestudent zunehmend interessant fand. So wurden die neuen Möglichkeiten der Luftbildgeologie zum Thema meiner Diplomarbeit im engeren Sinne und führten mich zur Auswertung von Daten, die der LANDSAT-2-Satellit über Zentralspanien ermittelt hatte. Hierzu reiste ich zur Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. (DVLR) nach Oberpfaffenhofen, die damals unter dem Kosenamen Konsonantenverein firmierte.
Nach Erhalt des Diploms wurde mir dann die besagte Halbtagsstelle im Geologischen Institut angeboten, um dabei mitzuhelfen, hochauflösende Aufnahmen der APOLLO-15-, -16- und -17-Missionen fotogeologisch auszuwerten. Die Arbeit war eingebunden in den Sonderforschungsbereich (SFB) Planetologie »Erde-Mond-System« an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Der SFB untersuchte die Frage, ob der Mond am Anfang seiner Entwicklungsgeschichte vollständig geschmolzen war oder sich aus kalten, umherirrenden Trümmerteilen in der Frühphase des Planetensystems gebildet hat. Wie aktuell diese wissenschaftliche Frage noch heute ist, mag man daran erkennen, dass die chinesische Mondsonde »Chang’e 5« im November/Dezember 2020 bei ihren wissenschaftlichen Missionszielen unter anderem exakt dieser Fragestellung nachging. Unsere damaligen Berechnungen zur Abkühlungsrate der Masse des Mondes ließen den Schluss zu, dass, wenn der Mond am Anfang vollständig geschmolzen war, sich heute Verwerfungen nachweisen lassen müssten, insbesondere auf der Rückseite, dem Hochland des Mondes. Die Rückseite des Mondes, im Gegensatz zur Vorderseite, ist durch keine großen Einschläge gestört worden und damit in weiten Teilen älter als die Vorderseite, die ausgedehnte Maria-Gebiete, die sogenannten »Mondmeere«, aufweist. Diese Maria nehmen insgesamt 16,9 Prozent der Mondoberfläche ein. Ihre auffällige Gruppierung auf der erdnahen Seite führt zur Ausbildung des eigentümlichen »Mondgesichts«. Entstanden sind die Maria durch erstarrte Lavaüberflutungen im Anschluss an große Einschläge vor etwa 3,1 bis 3,8 Milliarden Jahren. Die angesprochenen Verwerfungen im Hochland auf der Rückseite des Mondes mussten laut unseren Berechnungen geologisch gesehen sehr viel jüngeren Datums sein – kaum älter als circa 200 Millionen Jahre. Man kann sich das so vorstellen, dass der Mond durch die langsame Abkühlung über Milliarden Jahre schrumpft wie ein liegengelassener Apfel auf dem Tisch. Tatsächlich konnten wir diese sehr zarten Strukturen nach intensiver Suche anhand der APOLLO-Aufnahmen nachweisen.
Für diese Arbeit wurden wir zunächst heftig kritisiert, als allgemein akzeptierte Lehrmeinung galt, dass der Mond kalt ist und immer kalt war. Dreißig Jahre später – im Jahr 2010 – sitze ich im Café de Normandie in der Kantstraße und lese im Wissenschaftsteil des Tagesspiegel die Nachricht aus dem Fachjournal Science, wonach eine amerikanische Forschungsgruppe nun eindeutige Hinweise darauf gefunden habe, dass der Mond am Anfang gänzlich geschmolzen gewesen sein muss. So, so. Wissenschaftlich erfuhren die Arbeiten der Forschergruppe Planetologie im Nachhinein dadurch eine gewisse Anerkennung – immerhin. Anderseits war ich damals buchstäblich auf der Rückseite des Mondes gelandet und hatte mich dort irgendwie verirrt, den Boden verloren. Vielleicht war ich zu jenem Zeitpunkt einfach ein wenig zu weit hinausgeschwommen und hatte Gegenströmungen nicht wahrgenommen. Kurzum, mein amerikanischer Doktorvater war »not amused«, als ich ihm mein Medizinstudium offenbarte, und es kam – wenig überraschend – zum Bruch. Der Arbeitsvertrag wurde nicht verlängert, und ein Promotionsstipendium, dass ich bei der Deutschen Studienstiftung angestrebt hatte, wurde abgelehnt. Punkt.
Ich nahm daraufhin für einige Monate eine noch offene Assistentenstelle im Paläontologischen Institut an und grub für ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Sauerland Iguanodonten – schlicht gesagt: Dinosaurierknochen – aus der Kreidezeit aus, die zur Rekonstruktion einer ungewöhnlichen Fossillagerstätte bei Brilon führten. Eine nüchterne Analyse der eigenen Situation ergab: Ambitionen auf eine Promotion in Münster kannst du getrost vergessen, was auch hieß: Schließ mit der Geologie-Paläontologie ab und konzentriere dich auf das Studium der Humanmedizin. Ich rang mit mir und hatte eine ganze Weile an der Angelegenheit zu knabbern. Meine Mutter fand diesen verstörenden Prozess, der sich über ein halbes Jahr hinzog, erstaunlicherweise eher gut, wobei mir nicht ganz klar war: Fand sie es gut, weil ich mich mit mir selbst eingehender auseinandersetzen musste oder weil mir jemand einfach Grenzen aufgezeigt hatte? Wie auch immer, sie machte kaum Aufhebens daraus, und gab mir mit der Bemerkung »Das könnte dich doch auch interessieren« einen Beitrag aus dem Deutschen Ärzteblatt. Der Artikel behandelte die Deutsche Raumfahrtmission Spacelab-1 und die medizinische Forschung des Dr. Ulf Merbold an Bord des Space Shuttle im All. Das klang in der Tat interessant. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass eine der Untersuchungen auf dem Raumflug auf den Arbeiten des Physiologen Otto Gauer beruhte. Sein Experiment zur Erforschung der Veränderungen des zentralen Venendrucks in der Schwerelosigkeit hatte er noch kurz vor seinem Tod bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA eingereicht; die Versuche wurden von seinem Schüler Prof. Karl Kirsch fortgeführt.
Um aus der persönlich misslichen Lage in Münster herauszukommen, schien mir zunächst ein Studienplatz-, genauer: ein Ortswechsel angebracht, im heutigen »Beratersprech« eine Disruption, möglichst schnell, möglichst weit weg – von Münster. Klingt einfach, war und ist aber auch heute im Medizinstudium nicht so leicht zu arrangieren, denn man muss einen Tauschpartner finden. Ich fand ihn, genauer gesagt sie, 1984 in Berlin. Ich war zuvor nur einmal, kurz vor meinem Abitur 1973, in tristen, nebligen, kalten Januartagen mit der Abiturklasse für ein paar Tage dort gewesen. Schon vier Jahre früher hätte ich die Gelegenheit haben können, die geteilte Stadt zu besuchen. Bei einem Aufsatzwettbewerb der katholischen Jugend Nordrhein-Westfalens hatte ich für den Beitrag »Meine Voraussagen für die nächsten 30 Jahre« den ersten Preis gewonnen: eine Reise nach Berlin. Ein schöner Preis. Leider konnte ich ihn nicht einlösen, denn ich war noch nicht sechzehn. So gab es ein Preisgeld, das ich für ein nagelneues Mofa verwenden konnte, was meinen Radius zur Fossiliensuche im Sauerland erheblich erweiterte. Dem Mofa verpasste ich den Namen »Dino« – mit silberner Farbe –, was meine Eltern mit Zurückhaltung tolerierten, einige Klassenkameraden sonderbar fanden und im günstigsten Fall belächelten. Meine Voraussagen für den Zeitraum von 1970 bis zum Jahr 2000 sind im Übrigen überwiegend nicht eingetreten; wir haben in der Zwischenzeit weder Mond noch Mars besiedelt, noch die Bildung von Nervenzellen durch Gabe künstlicher Botenstoffe vermehren können. Beides aber rückt jetzt für die nächste oder übernächste Dekade näher.
In einem Ringtauschverfahren, an dem vier Universitäten beteiligt waren, gelangte ich also zu einem Studienplatz in Berlin. Die Medizinstudentin mit dem Nachnamen Glück, die sich in Berlin und insbesondere in Neukölln, wo sie lebte, überhaupt nicht glücklich fühlte, konnte ihr Glück gar nicht fassen, dass tatsächlich jemand mit ihr den Studienplatz tauschen wollte. Sie überließ mir ausgesprochen gern ihren Medizinstudienplatz an der Freien Universität und ging zurück nach Westdeutschland. Ich hingegen