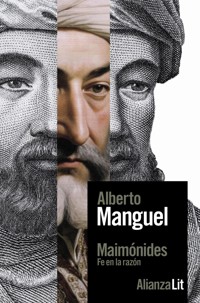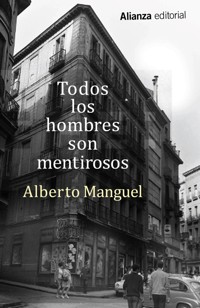21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Sindbad der Seefahrer, Superman, Don Juan oder Alice im Wunderland: Literarische Heldinnen und Helden haben zahlreiche Abenteuer zu bestehen, die sie klug und welterfahren machen. Sie werden damit zu inspirierenden Begleiter:innen, die uns immer wieder neue Antworten geben auf die großen Fragen des Lebens. Dank Alberto Manguel entdecken wir die Weltliteratur neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alberto Manguel
Fabelhafte Wesen
Dracula, Alice, Superman und andere literarische Freunde
Aus dem Englischen von Achim Stanislawski
Mit Zeichnungen des Autors
Diogenes
Für die Prinzessinnen liebende Amelia
und für Olivia, die Drachen bevorzugt
Vorwort
»Was ist – denn – das?«, sagte das Einhorn schließlich.
»Ein Kind!,« erwiderte Hasa eifrig und trat dabei vor Alice hin, um sie vorzuführen, wobei er beide Hände in einer germanischen Urstellung gegen sie ausstreckte. »Erst heute gefunden! In natürlicher Größe, und zweimal so echt!«
»Ich dachte immer, das seien Fabelwesen!«, sagte das Einhorn. »Lebt es noch?«
»Es kann noch sprechen«, sagte Hasa ernst.
Das Einhorn sah Alice träumerisch an und sagte: »Sprich, Kind!«
Da musste Alice nun doch unwillkürlich lächeln, und sie sagte: »Also weißt du, ich dachte immer, Einhörner seien Fabelwesen! Ich habe noch nie eins lebendig gesehen.«
»Na, jedenfalls haben wir uns jetzt gesehen«, sagte das Einhorn, »und wenn du an mich glaubst, glaube ich auch an dich. Einverstanden?«
Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln
Touristenführer bieten Touren auf den Spuren von Odysseus und Don Quijote an. Von so manchen zerfallenem Gemäuer heißt es, es habe dereinst Desdemonas Schlafzimmer oder Julias Balkon beherbergt. Ein kolumbianisches Dorf behauptet, es sei höchstpersönlich das Macondo des Aureliano Buendía aus Hundert Jahre Einsamkeit, und das kleine Eiland Juan Fernández rühmt sich gar, dereinst jenen ungewöhnlichen Kolonisator namens Robinson Crusoe aufgenommen zu haben. Die Britische Post hatte Jahr um Jahr mit Wagenladungen von Briefen zu kämpfen, die an einen gewissen Sherlock Holmes, Esq., in 221B Baker Street verschickt wurden, während gleichzeitig ein gewisser Charles Dickens einen nicht enden wollenden Strom an Beschwerdebriefen zugestellt bekam, in denen sich seine Leser bitterlich über den Tod der kleinen Nelly in Der Raritätenladen beklagten. Die Wissenschaft erklärt uns, dass wir von Geschöpfen aus Fleisch und Blut abstammen, doch insgeheim wissen wir, dass wir Söhne und Töchter von Phantasmen aus Papier und Tinte sind. Vor langer Zeit schrieb der spanische Dichter Luis de Góngora:
Mit seinen Traumgestalten
auf seiner luft’gen Bühne
zeigt der Traum
Schatten von schönem Wuchs
Der Ausdruck »Fiktion« stammt, etymologischen Wörterbüchern zufolge, von lateinisch »fingere« ab, was so viel wie »kneten« oder »aus Ton formen« bedeutet. Die Fiktion ist so etwas wie ein aus Worten statt aus Staub nach unserem Abbild geformter Adam, dem sein Schöpfer Leben einhaucht. Ja, erfundene Figuren sind oft sogar – wenn sie nur gut genug erträumt sind – wandelbarer als unsere Freunde aus Fleisch und Blut. Anstatt sich brav an den Ablauf der Handlung zu halten, ändern sie bei jeder neuen Lektüre ein wenig ihre Gestalt, lassen bestimmte Szenen heller erstrahlen und andere in den Hintergrund treten. Plötzlich kommt eine überraschende Episode zutage, die wir mysteriöserweise völlig vergessen hatten, oder ein neues Detail tritt hervor, das wir bislang überlesen hatten. Heraklits berühmter Ausspruch bewahrheitet sich einmal mehr: Man kann nicht zweimal in dasselbe Buch steigen. Wir Leser aber sind es gewohnt, dass sich uns die Welt auf Buchseiten offenbart.
Als Alice in Hinter den Spiegeln den gefährlich auf einer Mauer balancierenden Humpty Dumpty (auf Deutsch Goggelmoggel genannt) trifft, fragte sie ihn besorgt, ob er nicht meine, er sei sicherer unten auf dem Boden.
»Natürlich meine ich das nicht. Denn wenn ich wirklich herunterfiele – davon kann freilich keine Rede sein – aber angenommen –«, und nun schürzte er die Lippen und sah so feierlich und gewichtig drein, dass Alice sich kaum mehr das Lachen verbeißen konnte, »– angenommen, ich fiele herunter«, fuhr er fort, »so hat der König versprochen – ganz recht, du kannst ruhig erbleichen! Darauf warst du nicht gefasst, wie? Der König hat mir versprochen – in eigener Person – er will mir – will mir –«
»All seine Reiter senden«, fiel Alice ihm etwas vorwitzig ins Wort.
»Da hört sich doch alles auf«, rief Goggelmoggel mit plötzlichem Zorn. »Du hast spioniert und gelauscht – hinter Türen – unterm Gebüsch – und im Schlot – sonst hättest du das nicht gewusst!«
»Aber nicht doch!«, sagte Alice mit großer Sanftmut. »Das kommt in einem Buch vor.«
Kein passionierter Leser findet die Erklärung von Alice befremdlich.
Shakespeare und Cervantes werden auf der ganzen Welt verehrt – wir wissen dank Porträts auch in etwa, wie sie ausgesehen haben –, und doch sind sie uns viel weniger vertraut als ihre unsterblichen Figuren. König Lear, Lady Macbeth, Don Quijote und Dulcinea sind feste Größen, selbst für jene, die die Bücher nie gelesen haben. Wir wissen mehr über das komplizierte Seelenleben von Dido und Don Juan als über das Privatleben eines Vergil oder Molière, und das wenige abermals durch Werke, die andere Autoren über sie geschrieben haben, wie zum Beispiel Hermann Broch und Michail Bulgakow. Wir Leser wissen, dass Träume der Stoff sind, aus dem die Welt gemacht ist.
Auch Dante war sich darüber im Klaren. Im vierten Gesang des Infernos – nachdem sie das schreckliche Höllentor mit der Warnung, alle Hoffnung fahren zu lassen, durchschritten haben – führt Vergil Dante zu jenem herrschaftlichen Schloss, in dem die rechtschaffenen, aber vor der Ankunft Christi geborenen Seelen ausharren. Unter den Männern und Frauen mit ruhigen und ernsten Augen bemerkt Dante auch den von Vergil besungenen Helden Aeneas, bedenkt ihn aber nur mit zwei Worten: ed Enea. Da er Vergil zu einer seiner drei Hauptpersonen erkoren hat, darf dessen eigene Erfindung (Aeneas) sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen. Aeneas ist in der Göttlichen Komödie nur so etwas wie ein flüchtiger Schatten, damit sich stattdessen die aus Dantes Feder stammende Figur des Vergil in der Vorstellungskraft der Leser festsetzt. Vergil ist nicht mehr nur der bloße Autor der Aeneis, sondern wird zum treuen Begleiter Dantes auf dessen Weg durch die Hölle.
Dank eines etwas schrulligen Lehrers kam ich schon während meiner Schulzeit mit den Schriften von Edmund Husserl in Berührung, die unsere jugendlich-idealistischen Geister elektrisierten. Während ein Großteil der Erwachsenenwelt darauf bestand, dass nur Handfestes Beachtung verdiente, betonte Husserl, dass auch zu vermeintlich nicht existenten Dingen eine tiefe Bindung bestehen kann. Soweit wir wissen, existieren Meerjungfrauen und Einhörner nicht als normale Lebewesen – obwohl mittelalterliche chinesische Bestiarien sagen, sie seien einfach nur sehr scheu, darum bekomme man sie nicht zu Gesicht. Und doch entwickeln wir, indem wir uns mit ihnen beschäftigen, auch zu imaginären Wesen ein Verhältnis, etwas, das Husserl höchst unpoetisch als »dyadische Beziehung« beschreibt. Über die Jahre bin ich Hunderte von solchen Beziehungen eingegangen.
Nicht jede Figur wird ein enger Freund, nur die heiß geliebten begleiten uns über viele Jahre hinweg. Ich für meinen Teil kann der zweifellos herzergreifenden Geschichte von Renzo und Lucia in den Promessi Sposi oder von Mathilde de la Mole und Julien Sorel in Rot und Schwarz ebenso wenig abgewinnen wie der Geschichte der statusbewussten Familie Bennet aus Stolz und Vorurteil. Ich fühle mich dem rächenden Zorn eines Grafen von Monte Christo näher, dem unerschütterlichen Selbstvertrauen einer Jane Eyre und der Melancholie des klugen Monsieur Teste von Valéry. Meine engen Freunde sind Legion: Chestertons Der Mann, der Donnerstag war hilft mir, mit den Absurditäten des Alltags klarzukommen. Priamus lehrt mich, den Tod jüngerer Freunde zu betrauern, und Achill, die geliebten Alten zu beweinen. Rotkäppchen und Dante geleiten mich durch die dunklen Wälder auf meinem Lebensweg. Sanchos Nachbar Ricote, den man vertrieben hat, bringt mir etwas über die niederträchtige Natur von Vorurteilen bei. Und es gibt noch so viele mehr!
Das vielleicht größte Faszinosum an literarischen Figuren ist ihr Facettenreichtum. Kaum je bleiben sie zwischen den Deckeln eines Buchs eingesperrt, egal wie breit oder schmal der ihnen dort zugedachte Platz ausfällt. Hamlet ward unter den Blendarkaden von Schloss Helsingör als ein kleiner Erwachsener geboren und starb, immer noch jung, inmitten von Leichen in dessen Speisesaal. Und doch blieb folgenden Generationen die freudianische Konstellation in seiner Kindheit nah, die sich zwischen den Zeilen erahnen lässt, und machte er postum politisch Karriere. Während des Dritten Reichs wurde Hamlet gar zur populärsten Figur auf deutschen Bühnen. Auch andere Figuren gingen mit der Zeit. Der Däumling ist zu fast normaler Größe herangewachsen, Helena ist mittlerweile eine runzlige Alte, Balzacs Rastignac arbeitet für den IWF, Odysseus wird als Schiffsbrüchiger an die Küste Lampedusas angespült, Kim vom britischen Außenministerium angeheuert, Pinocchio schmachtet mit anderen Kindern in einem Auffanglager an der texanischen Grenze, und die Prinzessin von Kleve gelangt in ein Marseiller Problemviertel. Anders als ihre Leser, die altern und nie wieder jung sein werden, sind literarische Figuren gleichzeitig jung und alt, bleiben so, wie wir sie beim ersten Lesen kennengelernt haben, und sind gleichzeitig das, wozu sie durch unser späteres Wiederlesen geworden sind. Damit ähneln sie allesamt der Meeresgottheit Proteus, dem Poseidon die Fähigkeit verliehen hatte, sich in jede beliebige Gestalt zu verwandeln.
»Ich weiß, wer ich bin«, antwortet Don Quijote in einem seiner frühesten Abenteuer, nachdem ein Nachbar versucht hat, ihn davon zu überzeugen, dass er keineswegs eine imaginäre Person aus einem seiner geliebten Ritterromane sei, »und weiß auch, dass ich nicht nur, was ich sagte, sein kann, sondern auch alle zwölf Pairs von Frankreich und noch dazu alle neun Helden; denn alle ihre Taten, die sie alle zusammen und jeder einzeln für sich getan haben, vergleichen sich nicht mit den meinigen.« Don Quijote beansprucht die Taten aller Helden, von denen er gelesen hat, für sich selbst.
Und das kommt so: Die Wörter »Sympathie« und »Empathie« haben die griechische Wurzel »pathos« gemeinsam, was »ertragen oder durchmachen« bedeutet. (Das Wort »empathes«, was so viel wie »stark betroffen« bedeutet, taucht nur sporadisch im griechischen Korpus auf. Aristoteles zum Beispiel benutzt den Begriff nur ein einziges Mal im sechsten Buch seiner Schrift Über den Schlaf, um die intensive Furcht zu bezeichnen, die ein Feigling empfindet, wenn er im Traum seine Feinde nahen sieht.) Erst im modernen Sprachgebrauch ist das Wort Empathie geläufiger. In Umlauf gebracht wurde es vom Psychologen Edward Bradford Titchner von der Cornell University, der 1909 den Begriff als englische Übersetzung für das deutsche Wort »Einfühlung« vorschlug. Nach Titchner handelt es sich bei diesem emotionalen Vorgang des »sich Einfühlens« um eine Strategie, die wir anwenden, um in Dingen und Umständen außerhalb unseres Selbst (zum Beispiel im Traum des Feiglings bei Aristoteles) Lösungen für unsere inneren Konflikte zu finden. Empathie, schreibt Titchner, trage zur Heilung des Selbst bei.
David Hume hat dies schon ein wenig früher erkannt. In seinem 1738 erschienenen Traktat über die menschliche Natur beobachtet er: »Es ist bekannt, dass wenn wir mit den Meinungen und Leidenschaften anderer sympathisieren, diese Bewegungen in unserer Seele anfänglich bloße Begriffe sind, und dass wir sie uns ebenso als einem anderen angehörig vorstellen, wie jede andere äußere Begebenheit. Es ist also offenbar, dass die Begriffe von den Leidenschaften anderer wirklich in die Impressionen, auf welche sie sich anfänglich bloß beziehen, verwandelt werden, und dass die Leidenschaften den Bildern gemäß entstehen, die wir uns von ihnen machen.« Husserl würde wohl ergänzen, dass diese anderen nicht zwangsläufig aus Fleisch und Blut sein müssen.
Meine eigene Lebenserfahrung ist husserlianisch. Wir können unseren Lebensweg auf verschiedene Weise beschreiben: durch die Orte, wo wir gelebt haben, durch die Träume, die wir einst hatten oder an die wir uns noch erinnern können, durch besondere Begegnungen mit uns wichtigen Personen oder einfach durch einen chronologischen Abriss. Ich verstehe mein Leben als ein unablässiges Lesen in den Seiten vieler Bücher. Meine Lektüren sind mein innerer Kompass, sie machen fast die Gesamtheit meiner Erfahrungen aus, und ich kann so gut wie alles, was ich über die wesentlichen Dinge weiß und glaube, auf einen bestimmten Paragrafen oder sogar eine einzelne Zeile in einem meiner Bücher zurückführen.
Großartigerweise spiegeln die von fernen Zeiten und Orten berichtenden Seiten oft auch unsere heutigen Erfahrungen wider. In unserer eigenen, notleidenden Zeit wird uns der umherirrende Odysseus gegenwärtig angesichts erzwungener Flucht, der unermüdlich hoffenden Flüchtlinge und der an Europas Küsten angespülten Asylsuchenden. Für eine 1992 von der Universität Guadaljara in Mexiko durchgeführte Studie beschrieb einer der Migranten den Versuch, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, so: »Der Norden ist wie das Meer … Wer als Illegaler reist, wird mitgeschleppt, als Schwanz eines Tieres, als Abfall. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie die See den Abfall an den Strand spült, und sagte mir, es ist genauso, als wäre ich auf dem Ozean und würde hin und her geworfen von den Wellen.« Dieselbe Erfahrung beschreibt Odysseus, nachdem er in einem neuen Versuch, Ithaka zu erreichen, Kalypso verlassen hat und nun fürchten muss, ein schmachvolles Ende zu finden. »Also sprach er; da schlug die entsetzliche Woge von oben / Hochherdrohend herab, dass im Wirbel der Floß sich herumriss / Weithin warf ihn der Schwung des erschütterten Floßes und raubte / Ihm aus den Händen das Steur; und mit Einmal stürzte der Mastbaum / Krachend hinab vor der Wut der fürchterlich sausenden Windsbraut. / Weithin flog in die Wogen die Stang’ und das flatternde Segel. / Lange blieb er untergetaucht, und strebte vergebens, / Unter der ungestüm rollenden Flut sich empor zu schwingen; / Denn ihn beschwerten die Kleider, die ihm Kalypso geschenket. / Endlich strebt’ er empor und spie aus dem Munde das bittre / Wasser des Meers, das strömend von seinem Scheitel herabtroff. / Dennoch vergaß er des Floßes auch selbst in der schrecklichsten Angst nicht, / Sondern schwang sich ihm nach durch reißende Fluten, ergiff ihn, / Setzte sich wieder hinein und entfloh dem Todesverhängnis. / Hiehin und dorthin trieben den Floß die Ströme des Meeres. / Also treibt im Herbst der Nord die verdorrten Disteln / Durch die Gefilde dahin […]«
Liebe, Tod, Freundschaft, Verlust, Dankbarkeit, Bestürzung, Leid und Angst, über all diese Emotionen und sogar über meine eigene, sich wandelnde Identität habe ich durch meine Leseerfahrungen viel mehr gelernt als von meinem Schatten im Spiegel oder meinem plötzlich in den Augen eines anderen gewahrten Spiegelbild. George Eliot liefert hierzu diese Zeilen in Das öde Land:
Und ich werde dir etwas zeigen, das anders ist als
Der Schatten, der dir morgens nachläuft,
Und als der Schatten, der dich abends einholt;
Ich zeige dir die Angst in einer Handvoll Staub
Genau so empfinde ich es auch.
Die früheste »Handvoll Staub«, die mir beibrachte, was Angst ist, war der attraktive Bräutigam in Grimms Märchen, dessen versprochene Braut heimlich zu seinem Haus schleicht und dabei entdeckt, dass er der Hauptmann einer Räuberbande ist. Hinter einem großen Fass versteckt sieht sie, wie ihr Bräutigam und seine Bande eine schreiende und weinende Jungfrau in das Haus schleppen. »Sie gaben ihr Wein zu trinken, drei Glas voll, ein Glas weißen, ein Glas rothen, und ein Glas gelben, davon zersprang ihr das Herz. Darauf rissen sie ihr die feinen Kleider ab, legten sie auf den Tisch, zerhackten ihren schönen Leib in Stück und streuten Salz darauf.« Selbstredend endet die Geschichte mit der Bestrafung der Räuber für ihre schändlichen Taten. Für mich jedoch war es damit nicht zu Ende. Stevenson schreibt von einem wiederkehrenden Albtraum von einem gewissen Braunton, dem er am Tag keine Bedeutung zumaß, der ihn jedoch im Schlaf unsagbar peinigte und in Angst versetzte. Ich für meinen Teil wurde endlose Nächte von den drei Farben des Weins verfolgt, die ihr prismatisches Licht auf die zerstückelten Glieder der unglücklichen Jungfrau warfen.
Weil mein Vater Diplomat war, verbrachte ich einen Großteil meiner Kindheit auf Reisen. Der Raum, in dem ich schlief, die Sprache, die draußen auf der Straße gesprochen wurde, die Landschaft um mich herum wechselten ständig. Einzig meine kleine Bibliothek blieb gleich. Ich erinnere mich lebhaft an die große Erleichterung, wenn ich – wieder einmal in ein unvertrautes Bett gesteckt – eines meiner Bücher aufschlug und an der vertrauten Stelle die gleiche Geschichte und dieselben Illustrationen wiederfand. Zuhause, das war ein Ort in meinen Geschichten, zwischen den Buchdeckeln, mit seinen Buchstaben darin. Als der Maulwurf im englischen Kinderbuchklassiker Der Wind in den Weiden nach manchen Abenteuern in der großen weiten Welt in sein kleines Zuhause zurückkehrt, bemerkt er mit einem Blick in die Runde verwundert, wie einfach und schlicht es ist und wie viel es ihm dennoch bedeutet. Ich erinnere mich, wie eifersüchtig ich auf die Gewissheit des Maulwurfs war, solch ein Daheim zu haben: »Und doch war es schön zu wissen, dass er nach all den Abenteuern in der oberen Welt jederzeit wieder in seine kleine Welt hier unten zurückkehren konnte. Hier fühlte er sich geborgen und zu Hause.«
Als ich acht wurde und wir nach Buenos Aires zurückkehrten, entdeckte ich die Liebe. Dort bekam ich ein eigenes Zimmer, wo ich meine Bücher um mich haben konnte. Die Liebe kam – und mit ihr die Angst – in Form eines Grimmschen Märchens. Die wahre Braut ist eine subtilere Version der Aschenputtelgeschichte, in der die Liebenden von Anfang an wissen, dass sie füreinander bestimmt sind, und nachdem ihre Liebe durch mancherlei Hindernis auf die Probe gestellt wird, schließlich glücklich zusammenleben. Da wusste ich, dass irgendwo meine noch unbekannte Liebe auch auf mich wartete. Später in meinen Jugendjahren, als ich die ersten Stiche des erotischen Verlangens spürte, fürchtete ich mich schrecklich, meine Gefühle zu offenbaren, aus Furcht, meine Direktheit könnte als zu offensiv und abschreckend interpretiert werden. Julias unsterbliche Worte aber warnten mich gleichzeitig vor übertriebener Schüchternheit: »Doch dächtest du, ich sei / Zu schnell besiegt, so will ich finster blicken, / Will widerspenstig sein und Nein dir sagen; / So du dann werben willst: sonst nicht um alles!« Ich folgte ihrem Rat mit gemischtem Ergebnis.
Als ich mich schließlich zum ersten Mal ernsthaft verliebte und versuchte, diesen Gefühlstaumel aus Verwirrung, Seligkeit und Triumph zu verarbeiten, half mir dabei die letzte Zeile in Kiplings Roman Kim: »Er kreuzte die Hände in seinem Schoß und lächelte, wie ein Mensch lächeln mag, der Erlösung gewonnen hat für sich und die, die er liebt.« Für meine kopflose Hingabe fand ich ein Echo in den Worten des im wortwörtlichen Sinne kopflosen Ling aus Marguerite Yourcenars orientalischem Märchen Wie Wang Fo gerettet wurde. Als Wang Fo den Geist seines Schülers Ling sieht, sagt er: »Ich glaubte dich tot?« Woraufhin der über den Tod ergebene Ling antwortet: »Wie hätte ich sterben können, da Ihr am Leben seid?« Ja, wie könnte er.
In Die blinde Eule versichert uns Sadegh Hedayat, dass unser ganzes Leben lang der Finger des Todes auf uns deutet. Dank Büchern wie der Blinden Eule habe ich das Gefühl, zumindest eine Ahnung von jener mit dem Finger auf uns zeigenden Gestalt zu haben, was mir helfen könnte, wenn es so weit ist. Zum Beispiel weiß ich, dass etwas mit uns geschieht, es nicht einfach ein anderer Zustand ist. Als der Erzähler in André Malrauxs Roman Der Königsweg seinen Freund beim Sterben begleitet, flüstert dieser plötzlich: »Es gibt keinen … Tod … Es gibt nur … mich … mich … der sterben wird.«
Tolstois Iwan Iljitsch lieferte mir eine der schönsten Beschreibungen, wie es sich anfühlen mag, wenn der Tod kommt: »Ihn überkam ein Gefühl, wie er es im Eisenbahnwagen gehabt hatte, wenn man glaubt vorwärts zu fahren, in Wahrheit aber rückwärts fährt und plötzlich die wahre Richtung erkennt.« Ich glaube, ich weiß genau, was Iwan Iljitsch meint. Doch wenn ich mir einen Tod aussuchen könnte, dann wäre es der des Schriftstellers Bergotte in Prousts Monumentalwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: »Er wurde begraben, aber während der ganzen Trauernacht wachten in den beleuchteten Schaufenstern seine jeweils zu dreien angeordneten Bücher wie Engel mit gefalteten Flügeln und schienen ein Symbol der Auferstehung dessen, der nicht mehr war.«
In Momenten der Ungewissheit, des Zweifels und Kummers war mir der gute Rat der Vogelscheuche für Dorothy, als sie den Dunklen Wald betreten, stets lehrreich: »Wenn die Straße in den Wald hineinführt, muss sie auch wieder aus ihm herausführen. Und weil die Smaragdene Stadt am Ende der Straße liegt, müssen wir der Straße folgen, egal, wie sie verläuft.« In der Tat. Und wenn unsere Begleiter nicht so ermutigend wie die Vogelscheuche sind, denke ich an den alten Vater in Juan Rulfos Geschichte Hörst du die Hunde nicht bellen?, der seinen verwundeten Sohn Ignacio auf dem Rücken ins nächste Dorf zum Arzt tragen muss. Ignacio versteht nicht, dass er seinen erschöpften Vater ermutigen könnte, indem er ihm vorlügt, er könne die Hunde des Nachbardorfes schon hören. »Und du hast sie nicht gehört, Ignacio?«, sagte der Vater, als sie endlich angekommen sind. »Hast mir nicht einmal damit helfen können, nicht einmal mit dieser Hoffnung!«
Freundschaft, Liebe und Fürsorge kann manchmal bedeuten, auf etwas zu lauschen, was noch nicht da ist – und es möglicherweise nie sein wird. Virginia Woolf gibt ganz zu Beginn ihres Buchs Zum Leuchtturm ein schönes Bild dieser frustrierten Hoffnung. Mrs. Ramsey verspricht ihrem sechsjährigen Sohn John dort einen Ausflug zum Leuchtturm, »wenn es morgen schön ist«. – »Bloß«, sagte sein Vater, als er vor der Fenstertür des Salons stehen blieb, »wird es nicht schön sein.« Woolf schreibt weiter: »Wäre eine Axt greifbar gewesen, ein Schürhaken oder sonst irgendeine Waffe, die ein Loch in die Brust seines Vaters gerissen und ihn auf der Stelle getötet hätte, James hätte sie ergriffen.« Auch ich fühle oft solche rachsüchtigen Impulse wie James und will mich an der betont sachlichen, paternalistischen Welt rächen, vor Wut sprachlos wie König Lear: »Ich will mir nehmen solche Rach an euch, / Dass alle Welt – will solche Dinge tun – / Was, weiß ich selbst noch nicht; doch solln sie werden / Das Graun der Welt.«
Meine literarischen Freunde helfen und beraten mich nicht nur in Sachen Liebe, Tod und Rache. Auch beim Schreiben können sie hilfreich sein. Der beste Ratschlag bei akuter Schreibblockade wurde mir von Harriet Vane gegeben, einer Autorin von Detektivgeschichten aus Dorothy L. Sayers Roman Aufruhr in Oxford. Der aristokratische Schnüffler Lord Peter Wimsey hat Vane in einer vorherigen Geschichte vor dem Galgen bewahrt und will sie nun heiraten. Aber wie kann sie eine Beziehung zu jemandem eingehen, dem sie ihr Leben verdankt? In Aufruhr in Oxford versucht Harriet einen Brief an Wimsey über einen delikaten Sachverhalt bezüglich seines Neffen zu schreiben, kann aber nicht die richtigen Worte finden. Nachdem sie wieder und wieder an der Schreibaufgabe gescheitert ist, sagt sie zu sich: »Was ist denn nur um Himmels willen mit mir los? Seit wann kann ich ein vorgegebenes Thema nicht mehr ganz normal abhandeln?« Und dann setzt sie sich hin und schreibt den Brief. Diese kleine Selbstermahnung hat mir öfter, als ich zählen kann, geholfen, eine Arbeit endlich zu erledigen.
So fabelhaft der Ratschlag ist, manchmal schaffe ich es einfach nicht, mich daran zu halten. Wie wenn der König in Alice im Wunderland zum weißen Kaninchen sagt: Fang an beim Anfang, und mach weiter, bis du ans Ende kommst; dann höre auf. Schaffe nicht, es Jo in Little Women gleichzutun, die sich in ihrem Raum einschließt, ihren »Schreibanzug« anzieht, »in einen Wörterwirbel« verfällt, wie sie das nennt, und mit Herz und Seele drauflosschreibt, »denn bevor sie nicht fertig war, konnte sie keine Ruhe finden«. Mir gelingt es nur selten, auf einen Schlag so viel kreative Energie aufzubringen.
Zu einem Grundstein meiner Überzeugung, wahrer als wahr – und sogar noch mehr mit den Jahren –, sind für mich die Worte geworden, die Abbot zu dem Buchmaler in Kiplings Geschichte The Eye of Allah sagt: »Für die Seelenschmerzen gibt es, außer Gottes Segen, nur eine Linderung und das ist des Menschen Handwerk, Wissen oder andere dem Geist hilfreichen Antriebe.« Für mich sind meine literarischen Freunde solche »hilfreichen Antriebe«.
Edmund Gosse erzählt in seiner hinreißenden Autobiografie Vater und Sohn, dass es im streng calvinistischen Haushalt seiner Eltern keinerlei erfundene Geschichten gab. »Während meiner ganzen Kindheit hörte ich von niemandem die verheißungsvollen Worte ›Es war einmal‹. Man erzählte mir von Missionaren, nicht aber von Seeräubern; Kolibris waren mir bekannt, von Feen hatte ich nie etwas gehört. Jack der Riesenjäger, Rumpelstilzchen und Robin Hood gehörten nicht zu meiner Bekanntschaft, und obwohl ich etwas über Wölfe wusste, kannte ich Rotkäppchen nicht einmal dem Namen nach. Nachträglich glaube ich doch, meine Eltern taten nicht gut daran, alle Fantasien so ganz aus meiner Welt auszuschließen. Sie wollten mich zur Wahrheit erziehen, machten aber aus mir einen positivistischen Skeptiker. Hätten sie mich in den weichen Faltenwurf übernatürlicher Einbildung gehüllt, mein Geist wäre vielleicht länger zufrieden und ohne zu fragen ihren Spuren gefolgt.«
Ich hingegen wurde in meiner schon etwas zurückliegenden Kindheit in ebenjenen weichen Faltenwurf der Einbildung gehüllt. Die Spielgefährten meiner Generation waren Pippi Langstrumpf, Pinocchio, Sandokan der Pirat und der Magier Mandra. Die der heutigen Kindergeneration sind wohl Harry Potter und seine Freunde und Maurice Sendaks Wilden Kerle. Alle diese fabelhaften Wesen sind uns bedingungslos treu, unsere vielen Schwächen und Fehler können sie davon nicht abbringen. Selbst wenn sich heute meine alten Knochen bemerkbar machen, sowie ich ins unterste Regalbrett greifen will, ruft mich weiterhin von dort Sandokan zu den Waffen, nimmt Mandra mich mit auf seinen Rachefeldzug gegen Verbrecher und andere Narren, erklärt mir Pippi mit großer Geduld wieder und wieder, dass ich mich nicht um Konventionen scheren, sondern meiner eigenen Nase folgen soll, und Pinocchio fragt mich ein ums andere Mal, warum es nicht ausreicht, ehrlich und gut zu sein, um glücklich zu werden – selbst wenn die Fee mit den dunkelblauen Haaren das behauptet. Und wie in den längst vergangenen Tagen unserer ersten Begegnung versuche ich vergeblich, die richtige Antwort für ihn zu finden.
Monsieur Bovary
Er spielt die zweite Geige, ist von den beiden der Nüchterne, der weniger Impulsive, fällt eher durch seine vornehme Zurückgezogenheit auf. Er ist derjenige, mit dem sich Flaubert nicht identifiziert. Er liefert Emma den Vorwand für ihre Untreue, auch wenn er nie Treue von ihr verlangt hat. Er führt ein ehrbares, geregeltes, von harter Arbeit geprägtes Leben, nichts erwartend als ein wenig stille Zufriedenheit und ein Leben ohne Überraschungen. Es stimmt wohl, es fehlt ihm an Charme. Kein Mensch hat je eine alles verzehrende Leidenschaft für ihn empfunden. Man kann sich nicht vorstellen, wie er des Nachts über den Balkon bei einer Geliebten einsteigt oder ein Duell auf einer schneebedeckten Lichtung ausficht. Und doch ist Monsieur Bovary eine absolut notwendige Gestalt. Nicht zufällig beginnt und endet das Buch mit ihm und nicht mit Emma. Ohne ihn würde es Emma an Bedeutung fehlen, ohne ihn wäre sie nie zu jener romantischen Heldin geworden, hätte weder wahres Verlangen noch ekstatische Verzückung gekostet. Seien wir ehrlich: Monsieur Bovary ist allein dazu da, dass Madame ihr tragisches Schicksal erfüllt.
In Tat und Wahrheit fehlt es Charles Bovary an Vorstellungskraft. Sein lethargisches Verhalten ist das Ergebnis eines farblosen Lebens in Schwarzweiß. Schon als Junge ist er eher ein Sonderling. Auf den ersten Seiten des Buchs beschreibt ihn Flaubert als einen tapsigen und verschüchterten Heranwachsenden, der, vom Lehrer aufgefordert, kaum seinen Namen herausbringt. Er erweckt weder Vertrauen noch Zuneigung. Bereits an seinem ersten Tag im Gymnasium verdonnert der Lehrer ihn dazu, den Satz »ridiculus sum« zwanzigmal abzuschreiben. Der Junge beschwert sich nicht über diese Strafaufgabe. Später beschließt der Vater, dass er Medizin studieren soll, während die Mutter das Haus auswählt, in dem er fortan lebt. Charles, der nun Monsieur Bovary heißt, lässt andere über sich entscheiden.
Auch die Wahrheit der Kunst ist ihm unzugänglich. Die romantisch-verträumten Romane – er nennt sie »Damenliteratur« –, in denen Emma ihre Vorbilder findet, bleiben für ihn ein Schloss mit sieben Siegeln. In Monsieur Bovarys Welt ist einfach kein Platz für Fiktion. Einmal besucht er zusammen mit Emma eine Aufführung der Lucia di Lammermoor. Angesichts der wilden Leidenschaft, mit der Edgar auf der Bühne seine Liebe zu der Titelheldin deklamiert, fragt er verwundert: »Warum verfolgt sie denn dieser Edelmann?« »Aber nein«, antwortet Emma ungeduldig, »es ist doch ihr Geliebter.« Doch Charles kann der Handlung nicht folgen, woraufhin Emma ihn mit einem ungeduldigen »Sei still!« zum Schweigen bringen will. Charles versteht nicht, was er falsch gemacht hat, und verteidigt sich, er wolle einfach gerne verstehen, was vor sich geht. Emma kann ihm nicht begreiflich machen, dass diese tiefe Leidenschaft, die man in der Oper vorgeführt bekommt, auch im wahren Leben nicht erklärt werden kann. Man kann sie entweder in sich selbst finden oder wird sie nie verstehen. In solchen Belangen bleibt Monsieur Bovary ein Außenstehender.
Lucias tragische Geschichte und die Musik von Donizetti wecken in Emma Erinnerungen an ihren Hochzeitstag. Verglichen mit der auf der Bühne ausagierten, ekstatischen Leidenschaft scheint ihr das Glück jener längst vergangenen Stunden »nichts als eine Lüge, ausgedacht als unerreichbares Vorbild für das Verlangen«. Was für ein eigentümlicher Gedanke. Für Emma entsteht die Kunst nicht aus unseren Leidenschaften, sondern, um einem Mangel an Verlangen abzuhelfen. Was verrät uns das über Flaubert, der ein Leben lang sich seine erotischen Fantasien erfüllte oder zu erfüllen suchte? Wenn er selbst an das glaubte, was er Emma glauben lässt, woran sollen dann wir, seine Leser, glauben? An das Verlangen oder an die Kunst? Schließlich lautet das wohl bekannteste Zitat Flauberts: »Madame Bovary, c’est moi!«
Nicht alle berühmten Ehepartner in der Literatur sind derart zurückhaltend wie Monsieur Bovary. Andromache, Klytämnestra und Lady Macbeth sind ihren Gatten ebenbürtig oder nur etwas bedeutender. Andere wie Acerbas (der Mann der Dido), Donna Ximena (Frau des El Cid) und Alexei Alexandrowitsch Karenin (Annas Ehemann) fallen etwas blasser aus. Aber kaum jemand steht so diskret im Hintergrund und ist gleichzeitig so unbedingt nötig wie Charles Bovary.
An Leidenschaft und Fantasie, an Originalität und Charme mag es Monsieur Bovary mangeln, nicht jedoch an Liebe. Denn Monsieur Bovary liebt seine Frau. Nach ihrem Tod bemüht er sich, sie nicht zu vergessen, und doch entgleitet ihr geliebtes Bild ihm Tag für Tag ein bisschen mehr, was den armen Mann zur Verzweiflung treibt. Nur in seinen Träumen sieht er sie noch genau so, wie sie war. Jede Nacht erscheint sie ihm, er geht auf Emma zu, doch sobald er sie in die Arme schließt, zerfällt sie zu einem Haufen verwesenden Fleischs.
Kurze Zeit später stirbt Monsieur Bovary in einem grandiosen Beispiel ausgleichender literarischer Gerechtigkeit auf derselben Gartenbank, auf der Emmas Affäre begann. Doch bevor er stirbt, vergibt er dem Liebhaber seiner Frau, versichert ihm, dass er keinen Groll hege, und ruft aus: »Das Schicksal ist daran schuld.« Es sind seine letzten Worte in dem Roman. So legt der maliziöse Flaubert dem armen Mann als eine Art postume Beleidigung dieses abgedroschene Klischee in den Mund, das gar nicht zu ihm zu passen scheint.
Wäre da nicht die Ironie der Geschichte. Die von Emma heiß geliebte trivial-romantische Literatur, die Flaubert von Herzen verachtete und welche zu Emmas Unglück nicht unwesentlich beigetragen hat, inspiriert Monsieur Bovary zu einem stimmigen Epitaph für sie. Für ihren Grabstein wählt er den grotesken Allgemeinplatz: Amabilem conjugem calcas, was so viel bedeutet wie: ›Du trampelst auf das Grab einer geliebten Ehefrau.‹ Es ist zwar zweifellos ein Klischee zu behaupten, allein das Schicksal sei für unser tragisch oder glücklich verbrachtes Leben verantwortlich. Und doch ist Charles Bovarys Liebesbeteuerung eine ewige, dichterische Wahrheit und darum beeindruckend.
Rotkäppchen
Die Namen literarischer Figuren können etwas verraten über ihre Hautfarbe (Schneewittchen), ihre Fähigkeiten (Zorro) oder ihre Größe (Däumeling). Bei anderen ist das Kleid vielsagend. Ein blutroter Überwurf verlieh jenem abenteuerlustigen Mädchen den Namen, das Charles Perrault gegen Ende des 17. Jahrhunderts erfand. Rotkäppchens zugleich höfliches und nassforsches Wesen verleiht ihr die Aura einer arglosen Verführerin und eine subtil attraktive Ausstrahlung. Kaum verwunderlich, dass Charles Dickens sie als seine erste Liebe bezeichnete und meinte, wenn er das Rotkäppchen doch hätte heiraten können, dann hätte er höchstes Glück gefunden.
Die Geschichte von Perrault ähnelt der späteren Version in den Märchen der Brüder Grimm: Rotkäppchens Mutter schickt sie los, damit sie der kranken Großmutter Brotkuchen und ein Buttertöpfchen bringe. Auf dem Weg dorthin trifft das Bauernmädchen auf den verschlagenen Wolf. Dieser lenkt sie vom rechten Weg ab – sie geht Haselnüsse sammeln und jagt Schmetterlingen hinterher. Wohlbekannt ist auch das tragische Schicksal der Großmutter (das an Jona und den Wal sowie an den Pinocchio erschaffenden Geppetto erinnert) und die Befragung des sich als harmlose Großmutter ausgebenden Wolfs durch das Mädchen, dessen Antworten ihn als Schurken offenbaren (ein in vielen Märchen verwendetes Motiv).
In den altisländischen Göttergeschichten der Prosa-Edda findet sich ein Vorläufer dieser Geschichte. Dort muss der Trickster-Gott Loki dem Riesen Thrym erklären, warum die ihm versprochene Verlobte (die niemand anders als der verkleidete Donnergott Thor ist) einen so ausgesprochen undamenhaften Appetit an den Tag legt.
»Wo sahst du Bräute gieriger beißen? Ich sah nie Bräute breiter beißen, noch mehr Met ein Mädchen trinken«, sagt der verdutzte Thrym, nachdem er mitangesehen hat, wie die angebliche Dame acht große Lachse und einen ganzen Ochsen verschlungen hat.
Das, antwortet Loki, sei bloß der Vorfreude geschuldet. »Nicht aß sie acht Nächte, so begierig war sie auf Riesenheim.«
»Und warum sind erschreckend ihre Augen?«, fragt Thrym weiter, als er die grimmig blinkenden Augen hinter dem Schleier sieht.
Das sei, weil sie vor lauter Vorfreude, antwortet Loki wieder, »acht lange Nächte nicht schlief, so begierig war sie auf Riesenheim«.