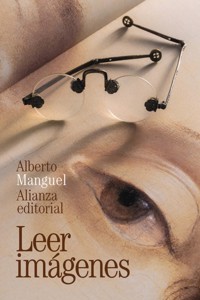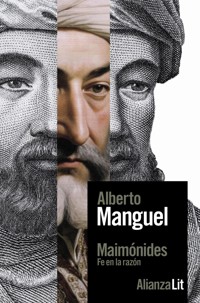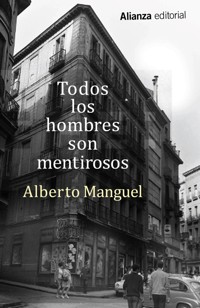Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Man hat ihn »König der Leser« genannt, »Don Juan der Bibliotheken«, »Monsieur Lecture«. Mit vier Jahren »entdeckte« Alberto Manguel, dass er lesen konnte, als Sechzehnjähriger war er Vorleser des erblindenden Dichters Jorge Luis Borges, von 2016 bis 2018 Direktor der argentinischen Nationalbibliothek. Mit seinem Bestseller Geschichte des Lesens, in 35 Sprachen erschienen, wurde er weltberühmt. Als Sieglinde Geisel ihn fragt, wer er sei, antwortet Manguel: »Ich bin ein Leser.« Abgesehen davon sei seine Identität fluide: als gebürtiger Argentinier, der unter anderem in Israel, Tahiti und New York gelebt hat und heute die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt; als dreifacher Vater, der sich eines Tages in einen Mann verliebte; als Jude, aufgezogen von einer deutsch-tschechischen Nanny, die ihm die deutsche Kultur und Literatur nahebrachte. Wie in seinen Büchern schöpft Manguel auch im Gespräch auf charmante und inspirierende Weise aus seinem unermesslichen Wissen, erzählt vom Umzug seiner rund 40 000 Bände umfassenden Privatbibliothek, von seinem Schlaganfall, nach dem er wieder neu sprechen lernen musste, von seiner Liebe zu Dante und seinem Hobby, dem Puppenmachen. Und er verrät, wie es dazu kam, dass jedes seiner Kinder während der Frankfurter Buchmesse geboren wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Ein geträumtes Leben
Ein Gespräch mit Sieglinde Geisel
Kampa
Alice lachte. »Ich brauche es gar nicht zu versuchen«, sagte sie; »etwas Unmögliches kann man nicht glauben.«
»Du wirst darin eben noch nicht die rechte Übung haben«, sagte die Königin. »In deinem Alter habe ich täglich eine halbe Stunde darauf verwendet. Zuzeiten habe ich vor dem Frühstück bereits bis zu sechs unmögliche Dinge geglaubt.«
Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln
Vorwort
»Alberto Manguel? Das ist doch der Autor, der ausschließlich Bücher über Bücher schreibt«, sagt der Buchhändler des Saint George Bookshop im Prenzlauer Berg, als ich Bücher von Alberto Manguel bestelle. Seit seinem Buch Eine Geschichte des Lesens war mir Alberto Manguel ein Begriff. Ich hatte es sofort gelesen, als es 1996 erschien, und mir war, als hätte ich auf ein solches Buch über das Lesen gewartet. Ich war nicht die Einzige: Eine Geschichte des Lesens machte den aus Argentinien stammenden Kanadier und Weltbürger Alberto Manguel über Nacht berühmt, das Buch wurde ein Bestseller und erschien in 35 Sprachen.
Alberto Manguel ist vielleicht der »produktivste« Leser der Welt: Seit er 1980 mit Gianni Guadalupi The Dictionary of Imaginary Places herausgab – einen Reiseführer der phantastischen Literatur –, hat er Dutzende von Anthologien zusammengestellt; dazu kommen noch einmal so viele Bücher über die Literatur und das Lesen sowie fünf Romane. Viele seiner Bücher erzählen von der Begegnung mit Büchern, sei es sein Buch über den Verlust seiner Bibliothek (Packing My Library, 2018), über Dantes Göttliche Komödie (Curiosity, 2015) oder über die Metaphern des Lesens (The Traveler, the Tower, and the Worm: the Reader as Metaphor,2013).
Mit der oft theorielastigen literaturwissenschaftlichen Sekundärliteratur haben Alberto Manguels Bücher nichts gemein, vielmehr sind sie ein fortgesetztes Gespräch mit Büchern, oft über Jahrzehnte hinweg. Von 2016 bis 2017 war Alberto Manguel Direktor der Argentinischen Nationalbibliothek – ein Posten, den Jahrzehnte zuvor Jorge Luis Borges innehatte, zu dessen Vorlesern Manguel in den 1960er Jahren gehörte.
Ursprünglich hätte ich Alberto Manguel für die Gespräche zu diesem Band im Mai 2020 in Zürich treffen sollen, doch die Coronapandemie machte alle Reisepläne zunichte, und so führten wir die Gespräche ab April über den Bildschirm. Alberto saß um 9 Uhr in New York an seinem Schreibtisch, ich um 15 Uhr in Berlin. Während der Entstehung dieses Gesprächsbands zog Alberto zwei Mal um: New York wurde für ihn zu gefährlich, denn aufgrund seiner Vorerkrankungen wäre ein Krankenhausbesuch zu riskant gewesen. Im Sommer zogen er und sein Partner Craig Stephenson nach Montreal, im September nach Lissabon. Der Bürgermeister von Lissabon bietet Alberto Manguels legendärer Bibliothek eine neue Heimat: Die 40000 Bände waren seit 2015 in Montreal eingelagert, nun ziehen sie ein in einen Palast in der Altstadt, dort bilden sie das Herzstück eines »Center for the Study of the History of Reading«.
Wären unsere Gespräche anders verlaufen, wenn wir am selben Tisch gesessen hätten? »Virtuelle Präsenz ist nicht gleichzusetzen mit physischer Präsenz«, sagt Alberto Manguel. »Das erkennt Dante in der Göttlichen Komödie, als er versucht, die Seelen zu umarmen.« Wir sind uns noch nie physisch begegnet, und doch hat sich in unserer Gesprächsroutine am Bildschirm eine überraschende Vertrautheit eingestellt.
Niemand kann wissen, ob ich andere Fragen gestellt und Alberto andere Antworten gegeben hätte, wenn wir uns physisch gegenübergesessen hätten. In einer Sache aber bin ich mir sicher: Durch die erzwungene Entschleunigung hatten wir mehr Zeit und Ruhe für unseren Austausch, als es uns in einer notdürftig erzwungenen Pause in der Hektik des Herumreisens möglich gewesen wäre.
Zwei Bemerkungen zur schriftlichen Gestalt des Texts:
Alberto Manguel hat von seiner Kinderfrau Ellin Deutsch als erste Sprache gelernt. In unserem auf Englisch geführten Gespräch verwendete er ab und zu deutsche Begriffe und Sprichwörter. Diese mache ich jeweils durch Anführungszeichen kenntlich.
Was das Gendern angeht, verwende ich in manchen Passagen, in denen exemplarisch vom Leser, Schriftsteller etc. die Rede ist, zugunsten der Lesbarkeit das generische Maskulinum. Selbstverständlich beziehen sich diese Aussagen immer auf alle Geschlechter. Alberto Manguel wechselte im Englischen bei »writer« und »author« jeweils zwischen den Pronomen »he« und »she« ab. Leider ist diese diskrete Art des Genderns im Deutschen nicht immer möglich.
Eine klösterliche Zeit
Guten Morgen, Alberto! Ich würde jetzt gern fragen, wie es Ihnen geht. Es ist Mitte April 2020, und in der Pandemie hat die Frage »Wie geht es Ihnen?« ihre Unschuld verloren. Trotzdem: Wie geht es Ihnen?
In meinem Leben hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen ich gesagt habe: Es muss sich etwas ändern, es muss etwas geschehen, was mich auf einen anderen Weg bringt. Ich fürchte mich immer ein wenig, wenn diese Gedanken auftauchen, denn ich habe keinen Einfluss auf das, was dann geschieht. Während der letzten zwei Jahre wollte ich, dass sich etwas ändert, seit meiner Rückkehr aus Argentinien. Die Zeit als Direktor der Nationalbibliothek war für mich eine außerordentliche Erfahrung, und nach dem intensiven gesellschaftlichen Leben in Buenos Aires hatte ich auf ein ruhigeres Leben in unserer kleinen Wohnung in Manhattan gehofft. Aber man kann mit Büchern nun einmal seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, wenn man nicht Stephen King ist oder Elena Ferrante, und so begann ich, Vorträge zu halten und Seminare zu geben.
Ich bin noch nie in meinem Leben so viel gereist wie in den vergangenen zwei Jahren! Allein im April hätte ich in Portugal, Paris, Kiew, Mailand und Turin Auftritte gehabt. Ich hatte Flughäfen so satt: das ewige Warten, die Unbequemlichkeiten im Flugzeug! Carl Gustav Jung erzählt eine Geschichte aus seiner Kindheit. Ein Onkel hielt ihn auf der Straße an und fragte ihn: »Weißt du, wie der Teufel die Seelen in der Hölle quält?« Jung schüttelte den Kopf. »Er lässt sie warten«, sagte der Onkel und ging seiner Wege. Und so dachte ich: Das ist meine Strafe, man lässt mich warten.
Und so hofften Sie, dass sich etwas ändert …
Als ich in einem dieser Flughäfen wartete, dachte ich: Ich wünschte, ich wäre zu Hause bei meinen Büchern. Ich hatte eine Biographie von Maimonides zu schreiben, das war ein Auftrag, den ich bereits angenommen hatte, bevor ich nach Argentinien ging. Außerdem schreibe ich an einem Text, den ich »Katabasis« nenne. Ein Abstieg in das Totenreich, wo ich mit meinen Toten Gespräche führe: den Menschen, die in meinem Leben wichtig waren und die nicht mehr da sind. Und ich habe ein geheimes Laster: Ich mache Puppen.
Ich wollte zu Hause sein, um all diese Dinge zu tun, doch es war unmöglich. Und auf einmal kommt diese Coronapandemie. Ich war in Paris für einen Vortrag am Collège de France, ein Auftrag, auf den ich sehr stolz war. Doch als ich hörte, dass die Vereinigten Staaten ihre Flughäfen für Reisende aus Europa schließen, nahm ich das nächste Flugzeug und kam zurück.
Wie hat sich Ihr Leben verändert?
Paradoxerweise ist es einerseits ruhiger geworden, doch andererseits habe ich mehr zu tun als zuvor. Wegen meiner Reisen musste ich meine Projekte stets verschieben, und nun kann ich auf einmal an meinen Büchern arbeiten – aber ich habe nicht genug Zeit! Ich stehe morgens um fünf Uhr auf, doch am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich hätte nichts geschafft.
Dabei ist Ihr Wunsch doch in Erfüllung gegangen: Sie sind zu Hause!
Um endlich Ihre Frage zu beantworten, wie es mir geht: Ich wage es nicht zuzugeben, denn ich bin mir des enormen Leids und der Zerstörung bewusst, die das Virus über die Welt gebracht hat. Doch obwohl ich die Angst und die Verzweiflung um mich herum sehe, muss ich sagen: Ich bin glücklich. Auf eine egoistische Weise glücklich, könnte man sagen. Ich bin gern zu Hause. Wir leben zwei Straßen vom Hudson River entfernt, ich pflegte am Fluss spazieren zu gehen, aber seit einiger Zeit tue ich nicht einmal mehr das. Es ist zu riskant, denn ich habe Asthma, Diabetes und ein paar andere Dinge. Seit meinem Geburtstag habe ich die Wohnung nicht mehr verlassen, und das war am 13. März. Ich bin dankbar für jeden Tag, der mir gewährt wird.
Ich muss gestehen, dass ich ebenfalls einen Gedanken habe, den ich mich kaum laut zu sagen traue: Wenn die Pandemie vorbei ist, wünschte ich mir, dass wir einmal im Monat ein paar Tage »Corona-Zeit« hätten, um zwischendurch zur Ruhe zu kommen.
Nennen wir es nicht »Corona-Zeit«. Nennen wir es eine klösterliche Zeit: Es ist eine Zeit, in der man einfach zu Hause bleibt und nicht ausgeht.
Eine Geschichte des Lesens erzählen
Sie wurden in den 1990er Jahren berühmt mit Eine Geschichte des Lesens. Wie kam es zu diesem Buch?
Im Jahr 1987 bat mich die New York Times um einen Essay, und da ich bereits einige Anthologien herausgegeben hatte, schrieb ich einen Text über Anthologien. Das gefiel ihnen, und so gaben sie einen weiteren Essay in Auftrag. Da ich mich immer in erster Linie als Leser verstanden habe und nicht als Autor, fragte ich mich: Was mache ich eigentlich als Leser? Ich begriff rasch, dass drei Seiten Essay für dieses Thema nicht genügen würden, ich brauchte mindestens dreihundert Seiten. Was geschieht in meinem Gehirn, wenn ich lese? Was ist die Beziehung zwischen Lesen und dem Gedächtnis? Warum lesen wir stumm? Es gab Tausende von Fragen. Als das Buch 1996 erschien, war es ein internationaler Erfolg. Es ist mein einziges Buch, das ein Beststeller wurde.
Sie waren der Erste, der über das Lesen schrieb.
In den frühen 1990er Jahren, als ich mit der Arbeit an dem Buch begann, gab es viel Literatur über die Geschichte des Buchs, aber kaum etwas aus der Perspektive des Lesers, abgesehen von einer Anthologie von Roger Chartier mit wissenschaftlichen Aufsätzen über die Geschichte des Lesens.
Als ich mit meinen Recherchen begann, erkannte ich, dass ich überhaupt nichts darüber wusste, was ich als Leser tue. Ich begann mit dem Kapitel über das stumme Lesen. In den Bekenntnissen von Augustinus hatte ich das klassische Beispiel dafür gefunden. Er beschreibt, wie er den Heiligen Ambrosius lesend in seinem Studierzimmer antraf, »ohne dass ein Ton aus seinem Mund kam«: Ambrosius’ Lippen bewegten sich nicht beim Lesen. Aus Augustinus’ Verwunderung können wir schließen, dass das stumme Lesen damals nicht üblich war.
Aber die Frage ist komplizierter, denn man findet andere Beispiele, etwa von Julius Cäsar, der einen Brief stumm las. Im alten Griechenland und in Rom gab es keine Satzzeichen, alles wurde in Großbuchstaben geschrieben, ohne Abstände zwischen den Wörtern, daher war es leichter, einen Satz zu entziffern, wenn man laut las. Das ist eine Theorie, weshalb das stumme Lesen nicht üblich war.
Wie gingen Sie bei der Recherche vor? Damals gab es ja noch kein Internet.
Ich benutzte nicht einmal einen Computer. Als ich begann, über Augustinus zu schreiben, fiel mir auf, dass ich nicht wusste, wie Augustinus aussah. Wenn man schreibt, braucht man diese Details, ich wollte Illustrationen für das Buch. Mein Partner und ich suchten in Bibliotheken und auf Flohmärkten nach Bildern, wir kopierten Bilder und stöberten nach Quellen. Der Zufall ist dabei ein wunderbarer Mitarbeiter. So besuchten wir etwa in einem französischen Museum eine Ausstellung mit Meisterwerken aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, und dort entdeckte ich Gustav Adolph Hennigs Porträt des lesenden Mädchens vor dem grünen Hintergrund. Ich wusste sofort, dass dies das Umschlagsbild sein würde.
Was haben Sie über den Vorgang des Lesens herausgefunden?
Als menschliche Aktivität reicht das Lesen weit über das bloße Lesen von Wörtern hinaus. Es gibt viele Definitionen: Wir lesen ja auch Bilder, eine Landschaft, den Gesichtsausdruck anderer Menschen, wir lesen unsere Intuitionen. Wenn wir den Begriff auf das Lesen von Wörtern einengen, wird es zu einem geradezu alchemistischen Prozess einer fortwährenden Verwandlung: Wir lesen Zeichen, die bestimmte Klänge darstellen, die wiederum bestimmte Ideen darstellen. Man kann den Vorgang umkehren: Ideen werden mit gewissen Klängen ausgedrückt, und die Zeichen wiederum drücken diese Klänge aus.
Der Vorgang ist komplex. Wenn ich schreiben möchte: »Ich lese«, dann schreibe ich die Buchstaben mit einem bestimmten Klang im Kopf. Aber wenn Sie lesen: »Ich lese«, kann es sein, dass Sie an etwas ganz anderes denken als das, woran ich dachte, als ich schrieb: »Ich lese.« Sie stellen sich den Moment vor, wie Sie gemütlich zu Hause im Sessel sitzen mit einem Buch in der Hand, doch ich dachte über den abstrakten Vorgang des Lesens nach, der definiert, wer ich bin.
Es gibt eine erkenntnistheoretische Lücke zwischen dem, der die Zeichen niederschreibt, und dem, der sie empfängt. Der Autor, der die Zeichen geschrieben hat, verschwindet, sobald er mit dem Schreiben fertig ist. Ich schaue Ihnen nicht über die Schulter, wenn Sie lesen, die Wörter bleiben in einem Schwebezustand auf der Seite.
Was geschieht in unserem Gehirn, wenn wir lesen?
Es ist ein physiologischer Prozess: In unserem Gehirn sprühen Bündel von Neuronen Funken und stellen Verbindungen her. Aber diese Verbindungen betreffen so viele verschiedene Bereiche des Gehirns, dass man sie nicht mehr klar zurückverfolgen kann. Die Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf hat in einem Aufsatz im Guardian beschrieben, was im Gehirn von Kindern geschieht, die nur noch am Bildschirm lesen, und während der Pandemie lesen Kinder viel mehr am Bildschirm als zuvor. Offenbar verändert sich dabei das Gehirn. Das muss nicht grundsätzlich von Nachteil sein, denn unser Gehirn verändert sich die ganze Zeit, aber es ist von Nachteil in der Hinsicht, dass gewisse Zonen ihre Funktion einbüßen. Das Lesen am Bildschirm ist mit neurologischen Pfaden verbunden, die eher beim Lesen von Bildern aktiviert werden als beim Lesen von Worten. Wir entwickeln also ein ikonographisches neurologisches Netzwerk, auf Kosten des verbal-intellektuellen neurologischen Netzwerks.
Im letzten Kapitel von Eine Geschichte des Lesens sagen Sie, das Buch bleibe unvollendet.
Als ich alle Kapitel fertig geschrieben hatte, blieben noch so viele Dinge übrig, die ich auch noch hätte schreiben wollen. Damals kamen die elektronischen Medien auf, und alles veränderte sich so schnell: Wenn ich am Morgen etwas schrieb, war es am Nachmittag schon wieder überholt. Deshalb sage ich im letzten Kapitel: »Ich mag eine Geschichte des Lesens geschrieben haben, aber die Geschichte des Lesens ist noch nicht geschrieben.«
Es ist ein sehr zugängliches Buch.
Als ich das Manuskript meinem Freund Stan Persky schickte, einem kanadischen Philosophen, sagte er mir, das Buch sei interessant, aber es fehle etwas. Er sagte: »Deine Stimme ist nicht da, all die Anekdoten, die du mir erzählt hast, zum Beispiel wie du Borges kennengelernt hast. Ich kann zu dem Buch keine Beziehung herstellen, wenn du mir nicht erzählst, wie du als Kind gelesen hast, sodass ich es vergleichen kann mit mir selbst als Kind. Du musst dich selbst in das Buch einbringen.«
Die erste Person Singular hatte mir widerstrebt, aber nun ging ich noch einmal durch das ganze Buch und brachte mich ins Spiel – und so wurde es, was es ist.
Warum widerstrebt es Ihnen, »ich« zu sagen?
Das geht in meine Kindheit zurück. Meine erste große Enttäuschung als Leser erlebte ich mit Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Als ich begriff, dass der Ich-Erzähler Jim Hawkins nicht der Autor war, dessen Namen auf dem Umschlag stand, war ich schockiert. Ich sagte mir: Wie kann ich eine Geschichte erzählen und behaupten, das bin ich – und dabei bin ich es gar nicht? Es war, als würden Sie mitten im Gespräch sagen: »Ich bin nicht Sieglinde, ich bin John Smith.« Natürlich habe ich später verstanden, was hier aus literarischer Sicht geschah, aber als Kind war mir das sehr unangenehm.
Ein anderer Grund besteht darin, dass ich mich über Autoren wie Karl Ove Knausgård ärgere. Nach zwanzig Seiten möchte ich sagen: »Warum sollte ich mich für die Tatsache interessieren, dass Sie die Schokolade, die Sie suchten, nicht fanden und eine andere nehmen mussten und dass Sie dreimal auf der Toilette waren?« Das ist das Äquivalent zu einer Reality Show im Fernsehen. Wo ist hier das intellektuelle Interesse? Es ist wie im Zoo. Ich glaube nicht, dass Literatur ein Zoo sein sollte, und wenn doch, dann möchte ich mich nicht in den Käfig setzen, damit die Leute mich betrachten können.
Aber seither hat sich Ihre Einstellung gegenüber dem Ich-Erzähler geändert. Alle Ihre Bücher sind in der ersten Person geschrieben.
Das stimmt, heute benutze ich die erste Person Singular häufig. Aber ich tue es nur, um dem Leser einen angenehmeren Blickwinkel zu verschaffen: »Schau, ich sitze auf einem Stuhl wie du. Lass mich dir erzählen, was ich denke.« Aber weiter gehe ich nicht, ich will dem Leser nicht jedes Detail meines Privatlebens erzählen.
Eine Kindheit mit Ellin
Stand Literatur immer im Zentrum Ihres Lebens?
Oh ja, das begann schon in meiner Kindheit. Die Umstände waren sehr ungewöhnlich, allerdings war mir das als Kind nicht bewusst. Ich wuchs nicht bei meinen Eltern auf, sondern mit meiner Kinderfrau Ellin. Ich war der Älteste und wuchs getrennt von meinen Brüdern auf, also war ich gewissermaßen ein Einzelkind.
Es gab keine anderen Kinder in Ihrer Umgebung?
Nein, ich hatte keinen Kontakt zu anderen Kindern. Ich weiß nicht, warum man mich nicht mit anderen zum Spielen zusammenbrachte.
Wie war Ellin?
Mein erster Essay in Katabasis handelt von ihr. Der Titel ist deutsch: »Selbstgefühl«. Ich hatte das Wort bei Christa Wolf gefunden, es berührte mich. Es gibt eine komplizierte und wunderbare Vorstellung wieder, die das ausdrückt, was ich über Ellin sagen möchte. Auch in schwierigen Umständen bewahrte sie sich diesen Sinn ihrer selbst, der es ihr ermöglichte, diese wunderbare Mischung aus Elternteil und Lehrerin für mich zu sein.
Wer war sie?
Ellin stammte aus einer tschechisch-deutschen jüdischen Familie. Sie lebten in Stuttgart, und als die Nazis an die Macht kamen, blieben sie noch eine Weile dort, bevor sie fliehen konnten. Der Vater war Ingenieur, nebst der Mutter gab es noch einen Bruder und eine ältere Schwester. Ellins Bruder schloss sich dem Widerstand in England an, und die Eltern gingen mit den beiden Mädchen nach Südamerika. Als sie in Paraguay ankamen, wehten überall Hakenkreuzfahnen, denn der damalige Präsident von Paraguay, Higinio Morínigo, war ein Nazi-Sympathisant. Der Vater beging Selbstmord, und die Mutter starb kurz darauf ebenfalls. Ellins Schwester heiratete einen Engländer, der in Buenos Aires lebte, und sie riet Ellin, ebenfalls nach Buenos Aires zu kommen und sich dort eine Arbeit zu suchen.
Mein Vater war Jude, und 1948 wurde er zum Botschafter Argentiniens in Israel ernannt, da war ich gerade geboren. Er gab eine Anzeige für eine Kinderfrau auf, und Ellin meldete sich. Laut einer Anekdote, die man sich in meiner Familie erzählt, schrie ich bei ihrem Vorstellungsgespräch ununterbrochen, ich war drei Monate alt und litt unter Asthma. Ellin sagte: »Ich kann diese Stelle nicht annehmen.« Doch mein Vater hatte bereits ihren Pass an sich genommen und sagte: »Ich gebe Ihnen Ihren Pass nur zurück unter der Bedingung, dass Sie mit uns nach Israel kommen.« Und so wurde Ellin meine Kinderfrau. Ich lebte mit ihr zusammen, bis ich etwa acht Jahre alt war.
Ellin war tief verbunden mit »deutsche Kultur« (im Original deutsch). Sie war nicht religiös, doch wenn sie einen Glauben hatte, dann war es der Glaube an »Kultur«. In den Vereinigten Staaten gibt es eine grundsätzliche amerikanische Anständigkeit, eine Tradition der Demokratie, eine Kultur, die Trump nach Kräften zu zerstören versucht hat – und so verhielt es sich auch mit Deutschland: Auch Hitler tat alles, um diese »Kultur« zu zerstören, und doch hat sie überlebt.
Was meinen Sie mit »deutsche Kultur«?
Für Ellin verstand es sich von selbst, dass ein Kind Geographie, Geschichte, Mathematik lernt, dass es die großen Werke der Weltliteratur auswendig kennt. Darüber hinaus hat sie mir auch Fertigkeiten wie Nähen und Kochen beigebracht. Diese Idee von »Kultur« gehörte für sie zu einem normalen Leben. Sie erzählte mir von ihrer Familie in Stuttgart, dass sie jeden Samstag ins Theater gingen. Davor saßen sie am Tisch, lasen das Stück und diskutierten darüber, dann gingen sie ins Theater und schauten es sich an. Das hat mich fasziniert, denn ich hatte ja kein Familienleben.
Wie ist Ellin mit Ihnen umgegangen?
Sie behandelte mich wie einen Erwachsenen, mit allem Respekt und aller Ermutigung meiner Intelligenz, die man einem Erwachsenen gegenüber zeigen würde. Sie hatte keinen Begriff davon, dass Kinder keine Erwachsenen sind. Wir lasen Teile aus Der zerbrochene Krug und aus Faust, ich lernte Gedichte von Goethe auswendig oder von Heine: »Es waren zwei Grenadiere, sie waren in Russland gefangen« – ich kann es immer noch rezitieren. Für sie war das alles selbstverständlich.
Sie entdeckten mit vier Jahren, dass Sie lesen konnten. Wie kam es dazu?
Es geschah einfach. Wenn Ellin mir vorlas, schaute ich ihr dabei über die Schulter. Sie las mir auf Deutsch und Englisch vor, und die deutschen Texte waren in Frakturschrift gedruckt. Ich folgte einfach den jeweiligen Buchstaben und las Frakturschrift so leicht wie lateinische Buchstaben. Der Klang war der gleiche, aber die Zeichen waren verschieden, für mich war es selbstverständlich, dass »Katze« in Frakturschrift nicht gleich geschrieben wird wie »Katze« in lateinischen Buchstaben. Diese Wahrnehmungen haben dazu beigetragen, dass es mir leichtfiel, von einer Sprache in die andere zu wechseln. Wenn »Katze« in lateinischen Buchstaben das Gleiche darstellt wie »Katze« in Frakturschrift, dann ist beides das Gleiche wie »cat«, dann »gato« und später »chat«. Mein Gehirn hat mich für diese Übergänge vorbereitet. Kindern, die vor dem Alter von sechs Jahren bereits eine zweite Sprache lernen, fällt es leichter, andere Sprachen zu lernen, das ist physiologisch erwiesen. Ihr Gehirn ist nicht nur auf einen einzigen sprachlichen Pfad eingestellt; wenn bereits zwei Pfade vorhanden sind, kann sich jeder dieser Pfade weiterverzweigen, und so hat man unendliche Möglichkeiten.
Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie erkannten, dass Sie lesen können?
Daran erinnere ich mich genau. Wir saßen im Auto und fuhren durch Tel Aviv. Draußen sah ich ein Werbeplakat, es war nicht hebräisch, sondern englisch, denn in Tel Aviv gab es viele englische Plakate – und auf einmal wusste ich, was die Buchstaben auf dem Plakat bedeuteten. Ich konnte lesen! Es war wie bei diesen Tests mit einer Silhouette, in der man auf einmal ein Gesicht erkennt. Auf einmal hatte es klick gemacht. Ein magischer Moment: Auf einmal sah ich, was die Wörter bedeuteten. Ich fühlte mich wie ein Zauberer, ich konnte Tintenspuren in Wörter verwandeln und musste nicht länger warten, bis Ellin Zeit oder Lust hatte, mir vorzulesen, um zu erfahren, wie die Geschichte weiterging. Jetzt konnte ich mir einfach das Buch nehmen und selbst lesen. Oh, wie hat mir das gefallen!
Was bedeutete Ihnen das Lesen als Kind?
Ich war mir sehr früh bewusst, dass die Außenwelt, also die Welt, die nicht in mir war, sich auch in Büchern befand. Die Erfahrung des Reisens hatte ich bereits gemacht, ich konnte also die Reisen in den Büchern mit den Reisen vergleichen, die ich mit Ellin unternommen hatte. Als ich dagegen Geschichten über Freundschaft las, dachte ich: »Das ist eine Möglichkeit: Irgendwann werde ich so etwas erleben.« Und als ich über den Tod las, dachte ich: »Das ist etwas, was auch mir widerfahren wird.« Die Wirklichkeit war für mich oft die Wirklichkeit der Buchseiten, eine Wirklichkeit aus Worten.
Haben Sie sich mit den Figuren identifiziert?
Oh ja, in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Maß. Ich identifizierte mich etwa sehr mit Rotkäppchen: Ich spürte, dass ihr Ungehorsam einem Bedürfnis entsprang, ihr eigenes Leben zu leben. Ohne diesen Ungehorsam gäbe es die Geschichte nicht: Wäre Rotkäppchen stracks zu ihrer Großmutter gegangen und hätte ihr den Kuchen überbracht, wäre die Geschichte nach einem Satz zu Ende.
Ich identifizierte mich mit dem kleinen Muck, mit Kasperle, und ich identifizierte mich auch mit dunkleren Dingen. In Tausendundeine Nacht