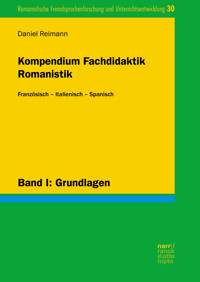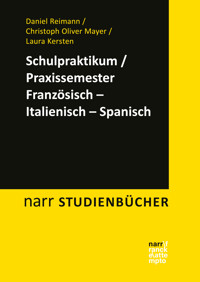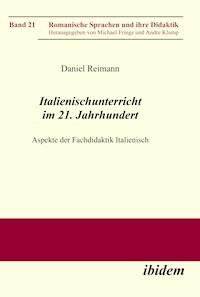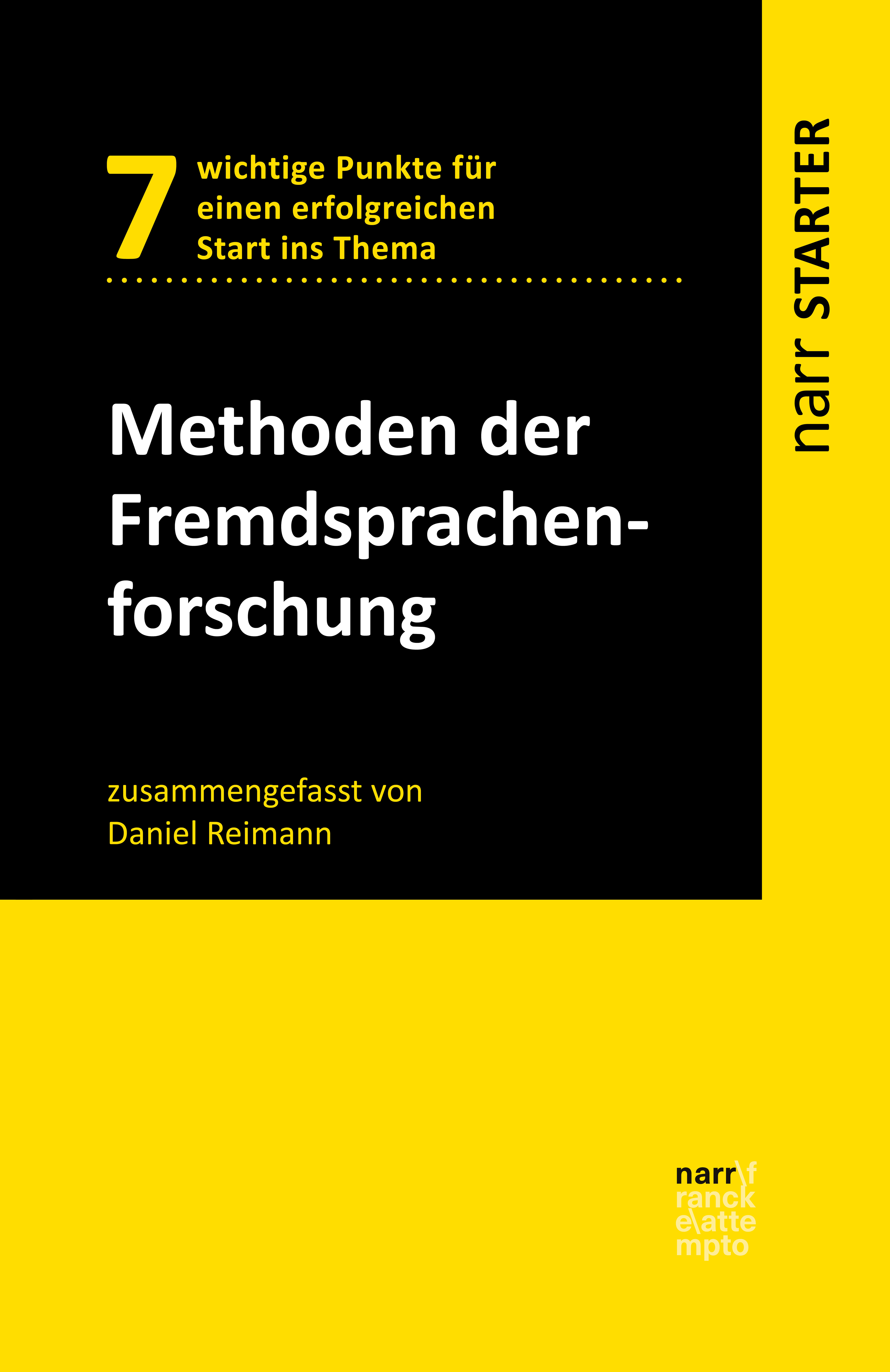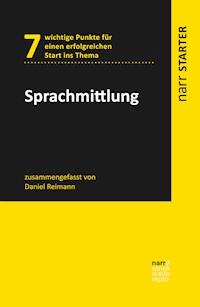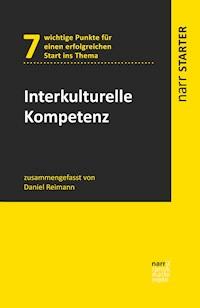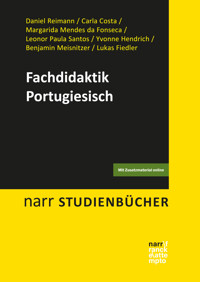
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
Portugiesisch ist eine im deutschen Bildungssystem vernachlässigte Sprache - trotz ihrer hohen Sprecherzahlen, ihrer geographischen Verbreitung und der Bedeutung der entsprechenden Sprachräume. Allerdings zeichnen sich im Schulsystem Entwicklungen ab, die das Potenzial des Portugiesischen allmählich erkennen und ihm Rechnung tragen. Ziel dieser Fachdidaktik ist es, eine Grundlage für fachdidaktische Lehrveranstaltungen des Portugiesischen zur Verfügung zu stellen. Zugleich kann die Einführung auch zur individuellen Aus-, Weiter- oder Fortbildung herangezogen werden. Neben der Vermittlung der theoretischen Grundlagen bietet sie Kapitel zu bezugswissenschaftlichen Orientierungen im Bereich Linguistik sowie Kultur- und Literaturwissenschaft. Eigene Abschnitte sind den Spezifika der portugiesischen Sprache aus der Sicht deutschsprachiger Lernender, den Varietäten des Portugiesischen und dem Portugiesischen als Unterrichtssprache gewidmet. Beispiele aus der schulischen Praxis, ergänzt durch ein umfangreiches Materialangebot online, bieten direkte Anregungen für den Unterricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Reimann / Carla Costa /Margarida Mendes da Fonseca /Leonor Paula Santos / Yvonne Hendrich /Benjamin Meisnitzer / Lukas Fiedler
Fachdidaktik Portugiesisch
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Publiziert mit Unterstützung von
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823394433
© 2025 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-8233-8443-4 (Print)
ISBN 978-3-8233-0532-3 (ePub)
Daniel Reimann ist Lehrstuhlinhaber für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor war er Studienrat für Latein und romanische Sprachen im bayerischen Schuldienst und lehrte an den Universitäten Würzburg, Regensburg und Duisburg-Essen. Mit zahlreichen Publikationen, Forschungsund Koordinationstätigkeiten, z. B. der Einrichtung fachdidaktischer Sektionen beim Deutschen Lusitanistentag, hat er die Grundlagen einer wissenschaftlichen Fachdidaktik des Portugiesischen als Schulsprache in Deutschland gelegt.
Carla Costa ist Oberstudienrätin für Englisch, Französisch und Portugiesisch, Fachvorsitzende für Portugiesisch und Europaschulkoordinatorin am Max-Planck-Gymnasium Dortmund. Darüber hinaus ist sie Mitarbeiterin in der Qualitätsentwicklung für das Fach Portugiesisch bei der Bezirksregierung Arnsberg.
Maria Margarida de Lima Mendes da Fonseca ist Gymnasiallehrerin i.R. für Portugiesisch und Geschichte. Sie war Fachvorsitzende für Portugiesisch am Max-Planck-Gymnasium Dortmund und von 1985 bis 2020 Mitglied der Lehrplankommissionen für Portugiesisch sowie der Aufgabenkommissionen für die Abiturprüfung im Fach Portugiesisch im Land Nordrhein-Westfalen.
Leonor Paula Santos ist Oberstudienrätin für Englisch, Deutsch und Portugiesisch und Fachvorsitzende für Portugiesisch am Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart. Sie ist Mitglied der Lehrplankommissionen für Portugiesisch in Baden-Württemberg und wird im Rahmen der Amtshilfe auch von Kultusministerien anderer Bundesländer in Fachfragen zum Portugiesischen konsultiert.
Yvonne Hendrich ist, nach einem Studium der Fächer Portugiesisch, Deutsch und Geschichte und historischer Promotion zu den deutsch-portugiesischen Kulturbeziehungen im Lissabon des frühen 16. Jahrhunderts, Lehrkraft für besondere Aufgaben für Lusitanistik sowie Koordinatorin des Hochschulaustauschs mit Portugal und Brasilien am Romanischen Seminar der Universität Mainz. Dort ist sie auch Initiatorin und Koordinatorin des Projekts „Português em Prática – PeP“ und des ersten Zertifikatsstudiengangs für das Lehramt im Fach Portugiesisch in Rheinland-Pfalz. Von 2017 bis 2021 war sie Mitglied im Vorstand des Deutschen Lusitanistenverbandes.
Benjamin Meisnitzer ist Professor für Romanische Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Hispanistik und Lusitanistik an der Universität Leipzig; dort ist er aktuell auch Prodekan für Studium der Philosophischen Fakultät. Zuvor lehrte er an den Universitäten München und Mainz. Neben genuin sprachwissenschaftlichen Forschungen (u.a. in den Bereichen Temporalsemantik, Modalitätsforschung, Varietätenlinguistik) vollzieht er immer wieder den Brückenschlag zur Fachdidaktik. Von 2017 bis 2021 war er Vizepräsident und von 2021 bis 2023 Präsident des Deutschen Lusitanistenverbandes.
Lukas Fiedler hat Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert und war von 2023 bis 2024 Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit den Schwerpunkten spanische und portugiesische Sprachwissenschaft an der Universität Leipzig. Seit 2024 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig für portugiesische Sprachwissenschaft und Sprachpraxis und Leiter des Portugiesischlektorats.
Unseren Familien
Unseren Lehrerinnen und Lehrern
Unseren Schülerinnen und Schülern und unseren Studierenden
Inhalt
1Definitionen | Daniel Reimann
2Bezugswissenschaftliche Orientierung
2.1Sprachwissenschaftliche Orientierungen für Portugiesischlehrkräfte | Benjamin Meisnitzer/Lukas Fiedler
2.1.1Wozu Linguistik in der Ausbildung von Lehrkräften?
2.1.2Portugiesisch in der Welt
2.1.3Portugiesisch als romanische Sprache
2.1.4Portugiesisch im deutschen Bildungssystem
2.1.5Die Bedeutung linguistischen Grundwissens für Vermittlung und Erwerb des Portugiesischen als Fremdsprache
2.1.6Herausforderungen im Portugiesischlernprozess: eine kontrastive Betrachtung mit dem Deutschen
2.1.7Das Portugiesische als plurizentrische Sprache mit zwei dominanten Varietäten als Herausforderung für den Fremdsprachenunterricht
2.1.8Fazit
2.2Kultur- und literaturwissenschaftliche Orientierungen für Portugiesischlehrkräfte | Yvonne Hendrich
2.2.1Kulturwissenschaftliche Inhalte
2.2.2Literaturwissenschaftliche Inhalte
3Geschichte und Gegenwart des Portugiesischunterrichts | Daniel Reimann
4GeR, Bildungsstandards, Lehrpläne | Daniel Reimann
4.1Rahmenbedingungen des gegenwärtigen Fremdsprachenunterrichts
4.1.1Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (2001)
4.1.2Der „Companion Volume“/„Begleitband“ zum GeR (2018/2020)
4.2Rahmensetzungen auf bundesdeutscher Ebene
4.2.1Bildungsstandards – Grundlagen
4.2.2Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (2003/2023)
4.2.3Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (1979-2004) und die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (2012)
4.3Rahmensetzungen auf Länderebene – Lehrpläne
4.3.1Portugiesisch als 3. Fremdsprache in der Sekundarstufe I (Nordrhein-Westfalen)
4.3.2Portugiesisch als fortgeführte Fremdsprache in der Oberstufe (Berlin)
4.3.3Portugiesisch als spät beginnende Fremdsprache (Baden-Württemberg)
5Unterrichtsplanung, Differenzierung und Inklusion | Daniel Reimann
5.1Unterrichtsqualität
5.2Unterrichtsplanung
5.2.1Aufbau einer Unterrichtsstunde
5.2.2Schriftliche Unterrichtsplanung
5.2.3Unterrichtsorganisation: Sozial- und Arbeitsformen, Offener Unterricht, Balanced Teaching
5.2.4Unterrichtsmethoden und Unterrichtstechniken
5.2.5Unterricht in der Zielsprache Portugiesisch
5.3Differenzierung
5.4Inklusion
6Medien und Lehrwerke | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
6.1Mediendidaktik | Daniel Reimann
6.1.1Typologie, Geschichte und Funktionen
6.1.2Lehrwerke als Medien des Fremdsprachenunterrichts
6.2Medien und Lehrwerke für den schulischen Portugiesischunterricht | Leonor Paula Santos
6.2.1Olá Portugal! neu
6.2.2Português a Valer
6.2.3Na Crista da Onda
6.2.4Português em Prática
7Portugiesisch als Schulsprache in Deutschland: eine linguistische Skizze aus schulpraktischer Perspektive | Leonor Paula Santos
7.1Spezifika der portugiesischen Sprache aus der Sicht deutschsprachiger Lernender
7.1.1Aussprache und Wortakzent
7.1.2Wortschatz und Grammatik
7.2Typische Strukturen des Portugiesischen und häufige Fehlerquellen
7.3Varietäten im Portugiesischunterricht
7.3.1Aussprache
7.3.2Wortschatz
7.4Schülerinnen und Schüler mit zielsprachlichem Hintergrund
8Mehrsprachenkompetenz | Daniel Reimann/Margarida Mendes da Fonseca
8.1Theoretischer Rahmen | Daniel Reimann
8.1.1Mehrsprachigkeitsdidaktik in historischer Perspektive
8.1.2Modelle des Mehrsprachenerwerbs und des Mehrsprachenlernens
8.1.3Das mehrdimensional-integrierende Modell der Mehrsprachenaneignung im schulischen Kontext
8.2Mehrsprachenkompetenz – Anwendung und Praxis | Margarida Mendes da Fonseca
8.2.1Kontextualisierung des Unterrichtsbeispiels
8.2.2Verlaufsplan
9Sprachliche Mittel
9.1Aussprache und Rechtschreibung | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
9.1.1Theoretischer Rahmen: Aussprache | Daniel Reimann
9.1.2Theoretischer Rahmen: Rechtschreibung | Daniel Reimann
9.1.3Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
9.2Wortschatz | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
9.2.1Theoretischer Rahmen: Wortschatz | Daniel Reimann
9.2.2Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
9.3Grammatik | Daniel Reimann/Carla Costa
9.3.1Theoretischer Rahmen: Grammatikaneignung | Daniel Reimann
9.3.2Anwendung und Praxis am Beispiel des pretérito perfeito simple | Carla Costa
10Kommunikative Fertigkeiten
10.1Hör-Sehverstehen | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
10.1.1Theoretischer Rahmen: Hörverstehen/Hör-Sehverstehen | Daniel Reimann
10.1.2Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
10.2Leseverstehen | Daniel Reimann/Carla Costa
10.2.1Theoretischer Rahmen: Lesekompetenz | Daniel Reimann
10.2.2Anwendung und Praxis | Carla Costa
10.3Sprechen und Interaktion | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
10.3.1Theoretischer Rahmen: Sprechkompetenz | Daniel Reimann
10.3.2Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
10.4Schreiben | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
10.4.1Theoretischer Rahmen: Schreibkompetenz | Daniel Reimann
10.4.2Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
10.5Sprachmittlung und Mediation | Daniel Reimann/Margarida Mendes da Fonseca
10.5.1Theoretischer Rahmen | Daniel Reimann
10.5.2Anwendung und Praxis | Margarida Mendes da Fonseca
11Soziokulturelles Orientierungswissen, inter- und transkulturelle kommunikative Kompetenz | Daniel Reimann/Margarida Mendes da Fonseca
11.1Theoretischer Rahmen | Daniel Reimann
11.1.1Mehrdimensionale Modelle inter- und transkultureller Lernprozesse
11.1.2Methoden und Techniken des inter- und transkulturellen Lernens
11.2Anwendung und Praxis | Margarida Mendes da Fonseca
11.2.1Schwerpunkt: Soziokulturelles Orientierungswissen
11.2.2Schwerpunkt: Inter- und transkulturelle kommunikative Kompetenz
12Filmdidaktik | Daniel Reimann/Leonor Paula Santos
12.1Theoretischer Rahmen | Daniel Reimann
12.1.1Filmbildung im Fremdsprachenunterricht
12.1.2Unterrichtstechniken und Filmbeispiele für den Portugiesischunterricht
12.2Anwendung und Praxis | Leonor Paula Santos
12.2.1Kurzfilme im Anfangsunterricht – „A receita dos Pastéis de Nata“
12.2.2Hinführung zur Unterscheidung zwischen den Varietäten des europäischen und des brasilianischen Portugiesisch mit dem Film „Rio“
12.2.3Themenorientiertes Arbeiten mit dem Film „Terra Vermelha“ („Birdwatchers“)
13Literatur und Textmusik | Daniel Reimann/Carla Costa/Margarida Mendes da Fonseca
13.1Theoretischer Rahmen: Literaturdidaktik | Daniel Reimann
13.1.1Geschichte des fremdsprachlichen Literaturunterrichts
13.1.2Literatur, Kompetenzorientierung und Bildung: ein Modell fremdsprachlich-literarästhetischer Kompetenz
13.1.3Literaturtheorie und Literaturdidaktik
13.2Anwendung und Praxis | Carla Costa/Margarida Mendes da Fonseca
13.2.1Textmusik: „Sexta-feira“ von Boss AC (2011) | Carla Costa
13.2.2Text- und Medienkompetenz: Produktionsorientierter Umgang mit literarischen Texten Microconto „Uma princesa de braços cruzados“ von Adília Lopes | Margarida Mendes da Fonseca
13.2.3Text- und Medienkompetenz/Inter- und transkulturelle Kompetenz: Produktionsorientierter Umgang mit dramatischen Texten | Margarida Mendes da Fonseca
14Evaluieren und prüfen | Daniel Reimann/Carla Costa
14.1Theoretischer Rahmen: Leistungsmessung | Daniel Reimann
14.1.1Ziele, Formen und Grundbegriffe der Evaluation im Fremdsprachenunterricht
14.1.2Testen und Evaluieren im schulischen Portugiesischunterricht
14.2Anwendung und Praxis | Carla Costa
14.2.1Klausurbeispiel für die Sekundarstufe I
14.2.2Klausurbeispiel für die Sekundarstufe II
14.2.3Beispiel für eine Kommunikationsprüfung als Ersatz für eine Klassenarbeit
Bibliographie
Vorwort
Daniel Reimann
Eine Fachdidaktik Portugiesisch existiert in Deutschland als akademisch institutionalisierte Disziplin bislang noch nicht. Insofern ist es ein ambitioniertes, vor allem aber ein idealistisches Projekt, eine überblickende Einführungsdarstellung für eine Fachdidaktik Portugiesisch zu erarbeiten, welche insofern vielleicht auch als Gründungsdokument dieser Disziplin gelten darf. Diesem Projekt lag die Überzeugung zu Grunde, dass es mehr Portugiesischunterricht geben müsste, als dies derzeit der Fall ist, sowie die Annahme, dass sich eine Lehrkräftebildung in der Gründungsphase einer Disziplin leichter etablieren lässt, wenn es ein Hilfsmittel gibt, auf das sie sich gerade in ihrer Anfangszeit stützen kann.
So gab und gibt es Gründe, ein solch idealistisches Projekt ins Auge zu fassen und trotz aller Schwierigkeiten – berufliche Belastungen, Pensionierungen, eine Pandemie, welche die Unterrichtsrealität zwischenzeitlich grundsätzlich veränderte – zu Ende zu bringen: Portugiesisch ist eine im deutschen Bildungssystem in hohem Maße vernachlässigte Sprache. So kontrastieren ihre Sprecherzahl – mit circa 250 Millionen erstsprachlichen Sprecherinnen und Sprechern gemessen an der Zahl der Sprecherinnen und Sprecher die zweitgrößte romanische Sprache, weit vor Französisch und Italienisch –, ihre geografische Verbreitung, die geopolitische Bedeutung der entsprechenden Sprachräume (v. a. Südamerika und Afrika), aber auch deren wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland (etwa ein Drittel des deutschen Außenhandels mit Lateinamerika, phasenweise sogar mehr, gemessen am Außenhandelsvolumen, wird mit Brasilien generiert) mit der geringen Berücksichtigung als schulischer, aber auch als hochschulischer Fremdsprache. Nicht zuletzt ließe sich aufgrund der Bedeutung der Kulturen und Literaturen in portugiesischer Sprache in Geschichte und Gegenwart eine stärkere Berücksichtigung des Portugiesischen als Bildungssprache begründen. Derzeit gibt es indes bundesweit nur drei Schulen, an denen Portugiesisch bis zum Leistungskurs belegt werden kann, die Zahl der Schülerinnen und Schüler beläuft sich auf unter Tausend (vgl. Reimann 2017e, 2022a; an diesen Schulen wie auch an der Europaschule Köln ist Portugiesisch jedoch fest etabliert, wovon in den letzten Jahren auch immer wieder Veröffentlichungen zeugen, wie z. B. Becker 1988, 1994, Campos Sardo 2024, Carreira da Silva 2024, Reimann 2022a, Santos 2019, 2022, 2024, Stahr 2022).
Es zeichnen sich Entwicklungen ab, die optimistisch stimmen, dass Portugiesisch bald eine größere Berücksichtigung in den deutschen Bildungssystemen finden könnte: So wurde mit Start im Wintersemester 2022/2023 an der Universität Mainz nach Genehmigung durch das zuständige Kultusministerium ein Zertifikat über die fachwissenschaftlichen Voraussetzungen zur Erlangung der Unterrichtserlaubnis in Portugiesischals Zusatzqualifikation für das Lehramtsstudium an Rheinland-Pfälzischen Schulen eingerichtet und erfreut sich bei den Studierenden spürbarer Beliebtheit (s. Kap. 2.2, vgl. auch Hendrich 2024, Mendes Haas/Frison 2024, Fritzinger 2024, Campos Sardo/Hendrich/Reimann 2025). Auch das Land Hessen hat mit einem Landtagsbeschluss im Jahr 2021 die formalen Voraussetzungen geschaffen, dass Portugiesisch ab dem Schuljahr 2023/2024 als zweite und dritte Fremdsprache angeboten werden kann (vgl. Reimann 2022b, Reimann 2023a, 88). Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass Potential und Bedeutung des Portugiesischen allmählich im deutschen Bildungssystem (hier besonders: dem deutschen Schulsystem) erkannt werden und ihnen zunehmend Rechnung getragen wird. Schon lange gibt es etwa in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen die administrativen Voraussetzungen in Form von Lehrplänen, die erlauben, Portugiesisch als Schulfach einzurichten. Seitens der universitären romanistischen Fremdsprachenforschung wird zuletzt verstärkt versucht, die Fundierung einer akademischen Fachdidaktik Portugiesisch voranzubringen, indem u. a. beim Deutschen Lusitanistentag immer wieder Fachdidaktik-Sektionen eingerichtet werden, die spätestens seit 2017 auch immer einen expliziten Fokus auf den schulischen Bereich legen (vgl. die Veröffentlichungen Koch/Reimann 2019a, Döll/Hundt/Reimann 2022, Koch/Reimann 2024, Campos Sardo/Reimann 2025).
Das oben genannte Mainzer Lehramts-Zertifikat wiederum ist im Rahmen des größeren und umfassenderen Projekts Português em Prática entwickelt und implementiert worden, welches 2020 unter Leitung von Yvonne Hendrich begründet und im Rahmen des Gutenberg-Lehrkollegs (GLK) aus Mitteln der Universität Mainz gefördert wurde. Neben dem Lehramtszertifikat sind das von einem Team studentischer Autorinnen und Autoren unter Leitung von Yvonne Hendrich entwickelte Lehrwerk Português em Prática, das insbesondere für Portugiesisch in Arbeitsgemeinschaften und als spät beginnende Fremdsprache konzipiert ist und parallel zu dieser Fachdidaktik im Verlag Gunter Narr erscheint, sowie eben diese Fachdidaktik Portugiesisch die beiden weiteren tragenden Säulen des Lehrprojekts Português em Prática. Schon zuvor bestehende Überlegungen zum Verfassen einer Fachdidaktik Portugiesisch konnten so im Rahmen dieses Projekts zwischen 2019 und 2024 von einem Team aus universitärer Fachdidaktik (Daniel Reimann) und Schulpraxis (Margarida de Lima Mendes da Fonseca, Carla Costa – Max-Planck-Gymnasium Dortmund, Leonor Paula Santos – Geschwister-Scholl-Gynasium Stuttgart) in die Tat umgesetzt werden.
Ziel der vorliegenden Fachdidaktik ist einerseits, dort, wo allmählich eine Lehramtsausbildung für das Fach Portugiesisch implementiert wird, eine Grundlage für entsprechende fachdidaktische Lehrveranstaltungen zu bieten – gerade auch da, wo die Dozierenden entsprechender hochschulischer Lehrveranstaltungen in einer solchen Aufbauphase des Faches ggf. zunächst noch über wenig Expertise im Portugiesischen oder in einer schulbezogenen Fachdidaktik verfügen. Andererseits kann die Fachdidaktik Portugiesisch sicherlich auch ergänzend, in vielen anderen Fällen vielleicht auch alleinig zur individuellen Aus-, Weiter- oder Fortbildung herangezogen werden: Nicht selten erteilen Lehrkräfte nach dem Auslandsschuldienst beispielsweise in Portugal oder Brasilien in einer Arbeitsgemeinschaft Portugiesischunterricht, und an den wenigen Schulstandorten, die es in Deutschland bisher mit etabliertem Portugiesischunterricht gibt, müssen mitunter Lehrpersonen eingestellt werden, die aufgrund der oben beschriebenen Situation über keinerlei fachdidaktische Ausbildung im Sinne der deutschen Schulsysteme verfügen.
Für die Lehrenden fachdidaktischer Einführungsveranstaltungen, die von ihrer eigenen Ausbildung her vielleicht ihrerseits eher in den Fachdidaktiken des Französischen, Spanischen und/oder Italienischen zu Hause sind, für ihre Studierenden und für all die angehenden und/oder praktizierenden Portugiesischlehrkräfte ohne eigentliche fachdidaktische Ausbildung im Portugiesischen ist dieses Werk gedacht. Aus diesem Grund wurde diese Einführung auch praxisnäher und fachspezifischer gestaltet als viele Einführungen in die Fachdidaktiken etablierter schulischer Fremdsprachen und es wurden – für solche Einführungsdarstellungen vielleicht sogar eher unüblich – zahlreiche Beispiele aus der schulischen Praxis des Portugiesischunterrichts integriert. Dabei wurden zu den einzelnen unterrichtlichen Handlungsfeldern in der Regel je ein Beispiel für den Anfangsunterricht, für den Unterricht mit leicht fortgeschrittenen Lernenden und für den Oberstufenunterricht gegeben. So sollen gerade auch Lehrkräften, die Portugiesisch als zusätzliches Fach, ggf. sogar ohne jegliche fremdsprachendidaktische und -methodische Grundausbildung in einer anderen Fremdsprache, unterrichten, unmittelbar fachbezogene und fachspezifische Orientierungen und ggf. direkte Anregungen für die Unterrichtspraxis angeboten werden. Zugleich werden einleitend zu den einzelnen Abschnitten und vor den Praxisbeispielen theoretische Grundlagen kurz eingeführt; für eine Vertiefung sei jeweils auf die entsprechenden Kapitel etwa im Kompendium Fachdidaktik Romanistik verwiesen (Reimann 2023a, 2024c, i. Vb. a).
Mithin ist das vorliegende Buch als Einführungsdarstellung konzipiert, die z. B. in folgenden Kontexten genutzt werden kann:
in Lehrveranstaltungen zur Ausbildung von Lehrkräften für Portugiesisch als Fremdsprache an Sekundarschulen (Sekundarstufe I und II), z. B. an Universitäten und in der 2. Phase der Ausbildung an Studienseminaren,
in Kursen zur nachträglichen Qualifikation praktizierender Lehrkräfte für den Portugiesischunterricht (z. B. an Akademien für Lehrkräftefortbildung),
im Selbststudium z. B. durch Lehrkräfte, die sich eigenständig nachträglich für das Unterrichten des Portugiesischen als Fremdsprache qualifizieren wollen.
Insgesamt wird im Wesentlichen der Gliederung und den Strukturen, wie sie sich in Einführungskursen und Einführungsdarstellungen herauskristallisiert und etabliert haben, gefolgt, wobei – als Spezifikum eines im Aufbau befindlichen Faches – auch eigene Kapitel zu bezugswissenschaftlichen Orientierungen, aber auch zu ausgewählten Aspekten des Portugiesischunterrichts in Deutschland, eingefügt wurden. Die bezugswissenschaftlichen Einführungskapitel zu Linguistik sowie Kultur- und Literaturwissenschaft sollen gerade auch für die individuelle Aus-, Fort- und Weiterbildung angehender Portugiesischlehrkräfte fachliche Orientierungen mit Blick auf das Schulfach Portugiesisch liefern. Eigene Abschnitte sind darüber hinaus etwa den Spezifika der portugiesischen Sprache aus der Sicht deutschsprachiger Lernender, den Varietäten des Portugiesischen und deren Vermittlung oder dem Portugiesischen als Unterrichtssprache gewidmet. Auch in den Abschnitten zur Verfügung über die sprachlichen Mittel werden jeweils Spezifika des Portugiesischen aus fremdsprachendidaktischer Perspektive eingeführt bzw. in Erinnerung gerufen.
Das Projekt wurde aus Mitteln des Gutenberg-Lehrkollegs (GLK) der Universität Mainz und durch den Deutschen Lusitanistenverband großzügig finanziell unterstützt, wofür der Universität Mainz und dem Deutschen Lusitanistenverband herzlich gedankt sei. Weitere finanzielle Unterstützung und damit größten Ausdruck der Wertschätzung erfuhr das Projekt durch die Brasilianische Botschaft in Berlin bzw. das brasilianische Außenministerium/das brasilianische Kulturinstitut Instituto Guimarães Rosa, wofür hier ebenso großer Dank ausgesprochen werden soll. Selbiges gilt für die Botschaft von Portugal in Berlin und den Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, über deren wertschätzende Förderung wir uns sehr freuen. Für außerordentliche Unterstützung sind wir weiterhin der Humboldt-Universität zu Berlin und dort insbesondere dem Dekanat der Sprach- und literaturwissenschaftlichen Fakultät verpflichtet. Nicht weniger groß ist der Dank, der an die drei Autorinnen der Praxisbeispiele geht, Frau Gymnasiallehrerin i.R. Margarida de Lima Mendes da Fonseca und Frau OStR’ Carla Costa vom Max-Planck-Gymnasium in Dortmund sowie Frau OStR’ Leonor Paula Santos vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stuttgart. Nur im permanenten und geduldigen, kollegialen und freundschaftlichen Austausch über die Jahre hinweg konnten die sprachlichen Beispiele im Theorieteil auf erstsprachlichem Niveau korrigiert und die unterrichtspraktischen Beispiele so reifen und verschriftlicht werden, wie sie nunmehr vorgelegt werden können und gerade angehenden und neuen Lehrkräften des Portugiesischen hoffentlich Anregungen und teilweise auch unmittelbare Hilfestellungen zu geben vermögen. Auch Laura Kersten, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Humboldt-Universität zu Berlin, gilt Dank für die äußerst gewissenhafte und geduldige Unterstützung bei der abschließenden redaktionellen Be- und Überarbeitung. Weiterhin sind wir Prof. Dr. Roger Schöntag (FAU Erlangen-Nürnberg/Humboldt-Universität zu Berlin) für eine kritische Lektüre und zahlreiche wertvolle Hinweise dankbar. Solcher Dank geht darüber hinaus auch an den Verlag Gunter Narr und seine das vorliegende Werk federführend betreuende Lektorin Kathrin Heyng, M. A., die dieses Projekt ohne zu zögern in die Reihe der etablierten „Studienbücher“ aufgenommen und in gewohnt kompetenter, hilfsbereiter und zuverlässiger Art und Weise betreut haben.
Berlin, im Dezember 2024
1Definitionen
Daniel Reimann
Fachdidaktik hat sich in ihrem wissenschaftstheoretischen Selbstverständnis und in ihrem methodologischen Anspruch in den letzten Jahrzehnten spürbar verändert. „Fachdidaktik“ war früher in ihrem landläufigen (Selbst-)Verständnis vor allem eine Disziplin der Reflexion von Praktikern über die Praxis z. B. in der zweiten Phase der Lehrerbildung und eine Disziplin der Entwicklung von Unterrichtsentwürfen, mithin eher ein Diskurs über (Unterrichts-)Methodik. Man spricht hier oft von „Best-practice“-Beispielen, die im Regelfall nicht wissenschaftlichen Ansprüchen im engeren Sinn entsprechen, da sie nicht konsequent (forschungs-)methodisch reflektiert sind (landläufig auch abfällig als „Rezeptologie“, „Meisterlehre“ usw. bezeichnet). Diese – für die Praxis mitunter verdienstvollen – Ansätze können also aus heutiger Sicht nicht mit wissenschaftlicher Fachdidaktik gleichgesetzt werden.
Spätestens seit etwa den 1960er Jahren, als die erste Phase der Lehrerausbildung zunehmend an die Universitäten integriert wurde, begannen insbesondere Linguisten, sich im Kontext einer „Angewandten Linguistik“ z. B. mit für das Fremdsprachenlernen relevanten Aspekten des Kontrasts zwischen Sprachen zu befassen oder auch die Interims- bzw. Lernersprachen auf typische Merkmale hin zu untersuchen. Zugleich wurde an den Pädagogischen Hochschulen, später auch an den Universitäten, die Disziplin „Fachdidaktik“ eingeführt, die sich als Wissenschaft der Transformation, d. h. der Adaption bezugswissenschaftlicher (z. B. sprach- oder literaturwissenschaftlicher) Inhalte für den schulischen Fremdsprachenunterricht verstand.
Seit den frühen 1970er Jahren wurde dann systematisch – auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als nationales Anliegen gefördert – eine so genannte „Sprachlehrforschung“ (auch: „Sprachlehr- und -lernforschung“) entwickelt, die, idealerweise auch sprachenübergreifend, auf empirischer Grundlage fremdsprachliche Lehr-/Lernprozesse zu ergründen versuchte. Ihre Entstehung ist u. a. der Tatsache zu verdanken, dass man seit den 1960er Jahren mit zunehmendem Zusammenrücken innerhalb Europas und einer sich abzeichnenden Globalisierung auf politischer Ebene die Bedeutung von Fremdsprachenunterricht erkannt hatte. Die Disziplin „Sprachlehrforschung“ wurde aus hochschulpolitischen Gründen an ihren wenigen Standorten in Deutschland inzwischen formal abgeschafft. Zugleich hat die Fachdidaktik, auch im weiteren Kontext einer empirischen Wende in den Bildungswissenschaften vor allem seit etwa dem Jahr 2000, (Forschungs-)Methoden und Zielsetzungen der genannten Forschungsrichtungen, also der Angewandten Linguistik, insbesondere aber der Sprachlehrforschung und der empirischen Bildungsforschung, integriert. Sie verbindet also traditionelle theoretisch-konzeptionelle und neuere empirische Forschungsansätze. Daher spricht man heute, gerade auch um die Forschungsorientierung der Disziplin zu kennzeichnen, häufig eher von „Fremdsprachenforschung“ (vgl. z. B. Reimann 2018b, 123 f.).
Die Tatsache, dass es seit den 1970er Jahren zwei Disziplinen bzw. Bündel von Disziplinen gab, die sich mit dem Lehren und Lernen von Fremdsprachen in institutionalisierten Kontexten befassten – namentlich die Sprachlehrforschung und die verschiedenen fremdsprachlichen Fachdidaktiken – stellt ein Spezifikum der fremdsprachlichen Fachbereiche dar. Indem eine dieser Disziplinen – die Sprachlehrforschung – explizit der empirischen Erforschung fremdsprachlicher Lehr-/Lernprozesse gewidmet war, nimmt die Erforschung des Lernens und Lehrens fremder Sprachen bei genauem Hinsehen eine Vorreiterrolle mit Blick auf die von anderen Fachdidaktiken erst viel später vollzogene Hinwendung zur Empirie ein.
Aus wissenschaftstheoretischer Perspektivierung ist festzuhalten, dass eine Disziplin dann als Wissenschaft gelten darf, wenn sie 1. über einen bestimmten Gegenstandsbereich und 2. über eigene Forschungsmethoden verfügt. Ulf Abraham und Martin Rothgangel formulieren dies für die Fachdidaktiken wie folgt:
In wissenschaftstheoretischer Hinsicht zeichnet sich jede Disziplin durch einen bestimmten Gegenstandsbereich aus, den sie erforscht (bzw. rekonstruiert oder modelliert), sowie bestimmte Methoden, die der Erforschung (bzw. Rekonstruktion oder Modellierung) des Gegenstandsbereichs dienen. (Abraham / Rothgangel 2017, 16)
Orientierend seien in einem ersten Schritt folgende Kurz- bzw. Arbeitsdefinitionen vorgeschlagen:
Fachdidaktik ist die fachbezogene Lehr-/Lernforschung, die in der heutigen Zeit traditionelle historische und hermeneutische Verfahren mit empirischen Methoden verbindet und sich mit der Geschichte, mit Inhalten, Kontextbedingungen und Verfahren sowie mit Akteurinnen und Akteuren von (hier: Fremdsprachen-)Unterricht befasst.
Sprachlehrforschung war die Disziplin der empirischen Erforschung fremdsprachlicher Lehr- und Lernprozesse, die von ihr bevorzugt sprachenübergreifend (also unabhängig von einzelnen Fächern) oder sogar sprachenunabhängig (z. B. mit Kunstwörtern) untersucht wurden. Innerhalb der Sprachlehrforschung spielte auch das Deutsche als Fremd- und Zweitsprache eine bedeutende Rolle. Sie zeichnete sich in ihrer wirkmächtigen Phase von den 1970er bis 1990er Jahren durch eine ausgesprochene Lernerorientierung aus, d. h. die Prozesse des Lernens und die Lernenden als solche wurden häufig in den Fokus genommen. Daher wird die Disziplin häufig auch präzisierend als Sprachlehr-/-lernforschung oder sogar Sprachlern-/-lehrforschung bezeichnet.
Fremdsprachendidaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen fremder Sprachen. Mit Einführung des Begriffs wurde ein besonderer Fokus auf den sprachenunabhängigen und sprachenübergreifenden Aspekt gelegt, eine Eigenschaft, die Fremdsprachendidaktik mit der Sprachlehrforschung teilte. Im Unterschied zur Sprachlehrforschung weist der zweite Bestandteil des Wortes „-didaktik“ darauf hin, dass nicht ausschließlich empirische, sondern traditionell auch hermeneutische bis hin zu lediglich auf Einzelerfahrungen bzw. Erfahrungswissen basierende (unterrichts-)methodische Fragestellungen Gegenstandsbereich von Fremdsprachendidaktik sein können. Letztlich wurde und wird Fremdsprachendidaktik häufig als Oberbegriff für die Gesamtheit der fremdsprachlichen Fachdidaktiken verwendet.
Fremdsprachenforschung ist die Disziplin der Erforschung fremdsprachlicher Lehr- und Lernkontexte, die in besonderem Maße Fragen und Methoden der Sprachlehrforschung aufgreift, weiterführt und mit den Forschungsgegenständen und traditionellen Methoden der fremdsprachlichen Fachdidaktiken verbindet. Fremdsprachenforschung kann daher als die Disziplin verstanden werden, die derzeit (auch empirisch) forschungsorientierte fremdsprachliche Fachdidaktiken unter einem Dach vereint. Fremdsprachenforschung ist, mit Blick auf die Forschungsorientierung, der im Verhältnis zur Fremdsprachendidaktik aktuell geläufigere Oberbegriff zur Bezeichnung aller forschungsorientierten fremdsprachlichen Fachdidaktiken einschließlich der Fachdidaktik des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache.
(Fach-)Methodik bezeichnet auf unterrichtspraktischer Ebene die Gesamtheit der (Unterrichts-)Methoden, also der Verfahren und Techniken u. a. von (Fremdsprachen-)Unterricht. Auf einer Meta-Ebene kann mit „Methodik“ oder „Methodologie“ auch die Reflexion über und die Erforschung von solchen Verfahren und Techniken gemeint sein. Man könnte also Methodik (oder eben Methodologie) auch als die Wissenschaft von der systematischen Beschreibung und der Erforschung von (Unterrichts-)Methoden – hier des Fremdsprachenunterrichts – definieren.
Weiterführend kann auf das Kompendium Fachdidaktik Romanistik. Band I: Grundlagen (Reimann 2023a), bes. 20-66, verwiesen werden, siehe für die vorherigen Ausführungen Reimann 2023a, 17-20.
2Bezugswissenschaftliche Orientierung
2.1Sprachwissenschaftliche Orientierungen für Portugiesischlehrkräfte
Benjamin Meisnitzer/Lukas Fiedler
2.1.1Wozu Linguistik in der Ausbildung von Lehrkräften?
Das folgende Kapitel geht der Frage nach, welche fachwissenschaftlichen Inhalte aus der Linguistik für die Ausbildung einer Portugiesischlehrkraft in Deutschland wichtig sind. Dabei sollen insbesondere die unterschiedlichen Profile der Lernenden berücksichtigt werden: Portugiesisch als Fremd-, Kontakt- oder Herkunftssprache und im Kontext des bilingualen Unterrichts (siehe hierzu Fiedler/Meisnitzer 2022, 235-244). Im Fremdsprachenunterricht steht der Erwerb der Zielsprache integriert in ihrem kulturellen Kontext im Vordergrund, weshalb die Linguistik in der Ausbildung von künftigen Fremdsprachenlehrkräften des Portugiesischen im Fokus stehen muss. Die Bedeutung einzelner Fachinhalte für die Sprachvermittlung und einen erfolgreichen Erwerb der Zielsprache soll im Folgenden skizziert werden. Eine solide linguistische Grundlage optimiert die mündlichen Kompetenzen, das Verständnis der Grammatik, die kommunikativ-pragmatische Kompetenz, vermittelt wichtige Einsichten in die sprachlichen Strukturen, die unabdingbar für Textredaktion/-produktion sind, und schult die Sensibilität für die Vielfalt in der Einheit des Portugiesischen als plurizentrische Sprache. Diese mündlichen und schriftlichen Fertigkeiten sind Grundvoraussetzungen für einen kompetenzorientierten Ansatz, der vier Kompetenzbereiche der Bildungsstandards vorsieht: kommunikative Fertigkeiten, das Verfügen über sprachliche Mittel, interkulturelle Kompetenzen und methodische Kompetenzen (Decke-Cornill/Küster 2015, 94-95). Diese Kompetenzen müssen insbesondere bei Lehrkräften gegeben sein, die schriftliche und mündliche Leistungen von Lernenden unterschiedlicher Niveaus in diversen kommunikativen und situativen Kontexten mit jeweils verschiedenen Kommunikationsbedingungen (Grad der Öffentlichkeit, Vertrautheit der Kommunikationspartner, emotionale Beteiligung, Situations- und Handlungseinbindung kommunikativer Akte, Referenzbezug, Spontaneität der Kommunikation und Themenfixierung) bewerten müssen. Denn die Kommunikationsbedingungen determinieren jeweils die gewählten Versprachlichungsstrategien und daraus ergeben sich unterschiedliche konzeptionelle Reliefs in Funktion der jeweiligen Diskurstraditionen1, im Sinn von Koch/Oesterreicher (2011, 6-14).
2.1.2Portugiesisch in der Welt
Portugiesisch ist eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt und nimmt eine bedeutende Stellung als globale Sprache ein. Mit etwa 250 Millionen L1-Sprechenden weltweit (Ethnologue 2025) gehört Portugiesisch zu den zehn meistgesprochenen Sprachen und belegt hinter dem Spanischen Platz zwei innerhalb der romanischen Sprachen (Reimann 2022b, 258). Ursprünglich aus der iberischen Halbinsel stammend, verbreitete sich die Sprache durch die Kolonialgeschichte Portugals über mehrere Kontinente hinweg.
Abb. 1: L1-Sprecher:innen des Portugiesischen (eigene Darstellung auf der Grundlage von https://i0.wp.com/brunostein.com/media/2016/07/mapa-portugues-azul-com-bandeiras-fonte-nova-1-1024x581.png und Ethnologue 2025, s.v. Portuguese, 30.07.2025)
Der Hauptanteil der portugiesischsprachigen Weltbevölkerung lebt in Brasilien, das etwa 216 Millionen Sprechende (Ethnologue 2025) umfasst. Brasilien ist somit das größte portugiesischsprachige Land der Welt und trägt entscheidend zur globalen Bedeutung der Sprache bei. In Afrika ist Portugiesisch in Ländern wie Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau und São Tomé und Príncipe Amtssprache. Diese Staaten, zusammen mit Portugal, Brasilien und Osttimor in Asien, bilden die CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), die sich der kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit widmet.
Darüber hinaus hat Portugiesisch eine wachsende Bedeutung in globalen Wirtschafts- und Kulturbeziehungen. Es ist eine wichtige Handelssprache, beispielsweise in Bezug auf Brasiliens Rolle innerhalb der BRICS-Staaten und in afrikanischen Ländern wie Angola. Portugiesisch wird auch zunehmend in Kontexten der Bildung und Diplomatie geschätzt. Immer mehr Menschen lernen die Sprache als Fremdsprache und sie ist eine der Arbeitssprachen in internationalen Organisationen wie der Afrikanischen Union und der Europäischen Union. Insbesondere in Regionen mit portugiesischen Gemeinden, wie in den USA, Frankreich oder der Schweiz, wird die Sprache auch außerhalb der klassischen portugiesischsprachigen Welt gepflegt.
Insgesamt ist Portugiesisch eine dynamische und global relevante Sprache, die durch ihre geografische Verbreitung und kulturelle Vielfalt eine einzigartige Position in der Welt einnimmt. Trotz seiner enormen territorialen Ausbreitung hat sich das Portugiesische nach Ende der Kolonialherrschaft, im Rahmen derer es nach Amerika (Brasilien), Afrika (Kapverden, Guinea-Bissau, São Tomé und Príncipe, Angola und Mosambik) und Asien (Macau, Goa, Daman, Diu und Osttimor) gelangte, eine zwar je nach Land unterschiedlich ausgeprägte, aber durchaus erkennbare Homogenität bewahrt. So besteht zwischen seinen Varietäten weitestgehend Interkomprehension2, auch wenn das Verständnis des gesprochenen europäischen Portugiesisch Brasilianerinnen und Brasilianern aufgrund der Tendenz zu Vokalreduktionen in der europäischen Varietät und der dadurch entstehenden Konsonantengruppen teils schwerfällt. Die „lusophone Welt“ ist in ihrer Entwicklung – anders als die spanischsprachige Welt – nicht vor sozialer Erosion und Reduktion des Portugiesischen zur Zweitsprache3 (in weiten Teilen Mosambiks, in Guinea-Bissau, aber auch mit steigender Tendenz auf den Kapverden) oder gar Fremdsprache (dominante Tendenz in Macao und Osttimor) bewahrt, erlebt diese jedoch nicht in demselben Ausmaß wie die frankophone Welt (vgl. Sánchez Miret 2012, 3).
2.1.3Portugiesisch als romanische Sprache
Die romanischen Sprachen sind eine Gruppe von indoeuropäischen Sprachen, die auf dem Boden des Römischen Reiches aus dem zur italischen Gruppe der indogermanischen Sprachen gehörenden Latein (Vulgärlatein) hervorgingen (Kaiser 2014a, 14). Das Portugiesische zählt zu den romanischen Sprachen der Westromania, in der Systematisierung von Walther von Wartburg in seinem Werk Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume (1950). Es handelt sich hierbei um eine typologische Teilung in Ost- und Westromania durch die La Spezia-Rimini-Linie, auf Basis der Opposition von {-s} und {-i} als Flexionsmorpheme (z. B. Pluralbildung: port. o comboio – os comboios vs. it. il treno – i treni) und der intervokalischen Sonorisierung der stimmlosen Okklusivlaute bzw. ihres Erhaltes (z. B. port. agudo; sp. agudo; kat. agudo; frz. aigu vs. it. acuto; rum. acut) (Becker 2013, 12). Gleichzeitig ist das Portugiesische innerhalb der romanischen Sprachen Teil der Gruppe der iberoromanischen Sprachen.
Mit der Ausbreitung Roms, die mit der Konsolidierung seiner Herrschaft in Mittelitalien im 3. Jahrhundert v. Chr. begann, ging die Romanisierung einher, also die Verbreitung römisch-italischer Zivilisation. Dies geschah u. a. durch die römische Kolonisation und römische Siedlungsarten, den römischen Handel, die Einführung des römischen Bürgerrechtes, die Einführung einer römischen Verwaltung und des römischen Straßennetzes sowie durch Sprache (das Latein) und Kultur (durch das Christentum, die Einführung römischer Schulen und Erziehung sowie mittels römischer Gesellschaftsstrukturen) im Römischen Reich (siehe hierzu Kiesler 2006, 18-23). Andererseits spielte sich die Latinisierung ab, unter der man die geistige und sprachliche Assimilierung der verschiedenen Völker versteht (Kiesler 2006, 18). Die Latinisierung erfolgte in unterschiedlichen Rhythmen und mit unterschiedlicher Intensität. Die romanischen Sprachen stammen jedoch nicht vom klassischen Latein etwa Ciceros ab (siehe hierzu Müller-Lancé 2020, 21-32), iberischen Bevölkerung (einführend Kabatek/Pusch 2011a, 242, für eine ausführliche Zusammenfassung bezüglich Romanisierung, Latinisierung und Kontakt mit den vorrömischen Völkern vgl. Schöntag 2008, 6-20). Das Vulgärlatein, aus dem die romanischen Sprachen entsprangen, umfasst in der Auffassung der Romanistik all jene Elemente aus der umgangssprachlichen gesprochenen Sprache – wobei davor gewarnt sei, die Grenze zwischen gesprochener und geschriebener Sprache hier überzubewerten (Kiesler 2006, 10) –, die in den romanischen Einzelsprachen weiterleben. Es handelt sich somit um die Umgangssprache, die zu „allen Zeiten der Latinität existierte […] vom Ende der archaischen Periode, also um 200 v. Chr., bis zu den ersten geschriebenen Texten in den romanischen Sprachen (9. Jh. n. Chr.)“ (Kiesler 2006, 11). Damit ist das Vulgärlatein keine Varietät, die zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort gesprochen wurde, sondern eher ein theoretisches Konstrukt, das sprachliche Elemente aus sämtlichen sermones umfasst (Müller-Lancé 2020, 60 & 71).
Die romanischen Sprachen sind also das Ergebnis einer Entwicklung des Sprechlateins weg vom starren klassischen Latein, das die Sprache der Autoren der Goldenen Latinität als Vorbild hatte und sprachliche Innovationen und Wandel nicht aufnahm, bis schließlich die vertikale Interkomprehension, sprich die Interkomprehension zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, nicht mehr gegeben war und wir eine Diglossiesituation hatten (mit klassischem Latein als high variety und Vulgärlatein und später Protoromanisch als low variety) (Ferguson 1959).
Abb. 2: Modellierung der Entwicklung der Beziehung von lateinischer Hochsprache (Schriftlatein) und gesprochenem Latein (Sprechlatein) und der Entstehung der romanischen Sprachen (adaptiert nach: Berschin/Felixberger/Goebl 2008, 62; vgl. a. Koch 2003, 115)
Die Verschriftlichung der volkssprachlichen romanischen Idiome erfolgte demzufolge im Zeichen des Kontaktes und Austausches von Sprachformen der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit, der somit ausschlaggebend für die Herausbildung und Etablierung der einzelnen romanischen Schreibstandards war (vgl. Koch/Oesterreicher 1985, 33).
Mit dem Einfall der Germanen (aus dem gotischen Superstrat: ganso, luva, agasalhar ‘Gans, Handschuh, warm anziehen’, für weitere Beispiele vgl. Schöntag 2008, 20-24) im 5. Jahrhundert n. Chr. und der Eroberung der iberischen Halbinsel 711 durch den Einfall der Mauren (aus dem Arabischen: alcaide, almocreve, azeitona, laranja ‘Bürgermeister, Lasttiertreiber, Olive, Orange’) und den damit einhergehenden Sprachwandel veränderte sich auch die Struktur des iberischen Romanisch weiter und differenzierte sich aus (Endruschat/Schmidt-Radefeldt 2014, 29-31; 39 & 41). Gleichzeitig wurde die Physiognomie der iberoromanischen Sprachen auch von den Sprachen vor der Eroberung durch die Römer geprägt, unter anderem durch Lexeme wie álamo (‘Pappel’) und colmeia (‘Bienenstock’) aus dem keltischen Substrat (Endruschat/Schmidt-Radefeldt 2014, 39).
Das (Alt-)Portugiesische bzw. Galicisch-Portugiesische ist im 13. Jahrhundert erstmals schriftlich überliefert, neben den Liedtexten der cantigas de amigo, cantigas de amor und cantigas de escárnio4 in zwei Notizen – einer halboffiziellen Textsorte (Koch 1990) – die Notícia de Fiadores (1175), in der die Schulden von Pelágio Romeu aufgelistet werden, und eine Notiz über Hinterhältigkeiten, deren Entstehungsraum zwischen Braga und Barcelos verortet ist, die Notícia de Torto (ca. 1210-1214), sowie in dem Testament von Afonso II. (1214) (vgl. Endruschat 2007 & Schöntag 2024). Die ältesten Sprachdenkmäler stellen nicht die „Geburtsstunde“ der romanischen Einzelsprachen dar, die mündlich wohl schon deutlich vor den schriftlichen Manifestationen existierten (Endruschat/Schmidt-Radefeldt 2014, 43, weiterführend Endruschat 2007, Schöntag 2024a).
Abb. 3: Die „Notícia Fiadores“ (1175) (120 x 327 mm in Mosteiro de São Cristóvão de Rio Tinto, maço 2, documento 10)
Abb. 4: Notícia de Torto (1210-1214) mit Transkription der ersten Sätze. (Quelle – Noticia de Torto. Ordem de San Benito, Mosteiro do Salvador de Vairão, mç. 2, doc. 40. 1 doc. (313 x 170 mm); perg. Anverso, https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia_de_torto; 10.12.2024)
[1] D(e) noticia d(e) torto que fecer(ũ) a Laurẽci(us) Fernãdiz por plazo que fec(e) Gõcauo [2] Ramiriz antre suos filios e Lourẽzo Ferrnãdiz q(u)ale podedes saber: e oue au(e)r d(e) erdad(e) [3] e dau(e)r, tãto q(u)ome uno d(e) suos filios da q(u)ãto podesẽ au(e)r d(e) bona d(e) seuo pater e fiolios seu […]
Abb. 5: Transkription der ersten Sätze der Notícia de Torto (Quelle – https://www.hs-augsburg.de/~harsch/lusitana/Cronologia/seculo13/Torto/tor_noti.html, 12.12.2024)
Sprachstrukturell ist in diesen beiden Texten deutlich ersichtlich, dass es sich nicht mehr um einen lateinischen Text handelt. Diese Grundeinsichten in die Geschichte des Portugiesischen sind wichtig für ein Verständnis der Interkomprehension der romanischen Sprachen. Interkomprehension ist aufgrund der gemeinsamen Basis im Fall der romanischen Sprachen besonders gegeben. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass in der Regel zuerst eine andere romanische Sprache (Französisch, Spanisch oder Italienisch) erworben wird, bevor Portugiesisch an der Schule gelernt wird, weshalb die Interkomprehension im Fall der Lehre des Portugiesischen eine wichtige Brücke zur Optimierung der Lernerfolge sein kann. Es lohnt sich daher, in das Curriculum für künftige Portugiesischlehrkräfte ein diachrones linguistisches Modul aufzunehmen oder ein Modul mit einem Seminar im Bereich der diachronen Sprachwissenschaft und einem varietätenlinguistischen Seminar zu gestalten.
Im Bereich des Konsonantismus weist das Portugiesische keine Geminaten auf, außer <r> vs. <rr> caro ‘teuer’ vs. carro ‘Auto’ (Bossong 2008, 66). Wenn man so möchte, ist das Portugiesische neben dem Katalanischen, Okzitanischen und Französischen eine Sprache mit seseo, da es dieselbe Neutralisierung der phonologischen Opposition wie das andalusische Spanisch aufweist.
Auf morphosyntaktischer Ebene weist das Portugiesisch kein Kasussystem auf und besitzt teils DOM (Bossong 2008, 68). Unter differentieller Objektmarkierung (DOM) versteht man die Markierung direkter Objekte (in der Regel menschlich bzw. belebt) mittels Kasusmarker a (dies ist keine Präposition, sondern hier liegt ein Formsynkretismus vor, vgl. Meisnitzer 2021, 399-403). DOM ist jedoch im Portugiesischen deutlich weniger produktiv als im Spanischen, wo es sogar zunimmt (siehe Meisnitzer 2021, 393), und ist obligatorisch bei Pronomen (vejo-te a ti5 ‘ich sehe dich’), bei ninguém ‘niemand’, in fossilisierten Konstruktionen aus älteren Sprachstufen (crucificar a Cristo ‘Christus kreuzigen’ und temer a Deus ‘Gott fürchten’) und um etwas zu verdeutlichen (Tratava-os como a amigos. ‘Ich habe sie wie Freunde behandelt’) (Bossong 2008, 68-69), nicht jedoch bei direkten belebten oder menschlichen Objekten wie im Spanischen. Der bestimmte Artikel ist wie überall in der Westromania von dem lateinischen Demonstrativum ille (Ausnahme Katalanisch: ipse) abgeleitet, wodurch die Nullmarkierung (Ø) zum mass noun grammatikalisiert wurde (Ø Como maçã. ‘Ich esse Äpfel’), und es finden sich anders als im Französischen keine Spuren des Partitivs mehr (Bossong 2008, 69). Im Verbalbereich hat das Portugiesische die synthetischen Tempora besser bewahrt als andere romanische Sprachen (Plusquamperfekt im europäischen Portugiesisch, wenn auch mit rückläufiger Produktivität) und der aoristische Aspekt wird mithilfe eines synthetischen Präteritums ausgedrückt – anders als im Französischen und in höherem Ausmaß als im Spanischen und im Italienischen (vgl. Bossong 2008, 70). Das zusammengesetzte Perfekt wird nur bei Verbalhandlungen mit perfektivischer Bedeutung, die sich bis zum Zeitpunkt des Sprechens ziehen und möglicherweise noch über diesen hinausgehen (extended now), verwendet – lediglich der Anfang der Handlung bzw. des Verbalereignisses vor der Sprechzeit ist in diesem Fall relevant (siehe hierzu Meisnitzer 2017). Im Portugiesischen ist wie im Spanischen ein reflexives Passiv (Vende-se peixe. ‘Es gibt Fisch’ oder ‘Fisch wird verkauft’) möglich, anders als im Französischen, wo ein periphrastisches „reales Passiv“ dominiert (Kabatek/Pusch 2011b, 86). Wie das Spanische und das Rumänische (also ein Phänomen der Randromania) hat das Portugiesische das Verbum lat. habere für das periphrastische Perfekt verallgemeinert – im Mittelalter fand noch Konkordanz des Partizips in Genus und Numerus statt und esseser stand noch bei unakkusativischen Verben (Bossong 2008, 71). Ähnlich wie im Spanischen, Galicischen und Katalanischen wird im Portugiesischen zwischen der Kopula ser und estar unterschieden (siehe hierzu Kap. 2.1.6.4) und es gibt einen flektierenden Infinitiv (neben Galicisch, Sardisch, Sizilianisch, Altnapoletanisch und Altrumänisch). Abschließend ist noch wichtig festzuhalten, dass es im Portugiesischen wie in allen romanischen Sprachen Objektklitika gibt, jedoch keine Subjektklitika (Bossong 2008, 72).
Auf syntaktischer Ebene wird bei unakkusativischen Verben im Portugiesischen ähnlich wie im Spanischen das syntaktische Subjekt in die Position des Objektes bewegt, wenn der Satz kein semantisches Subjekt aufweist (Entra o Pedro. ‘Peter tritt ein’), obwohl es wie alle romanischen Sprachen eine SVO-Sprache ist. Anhand der ausgewählten sprachlichen Besonderheiten des Portugiesischen konnte gezeigt werden, dass es sich typologisch eher wie das Spanische als wie das Französische verhält (Kabatek/Pusch 2011b).
Für die Schule bietet es sich an, abschließend nochmals die wichtigsten sprachstrukturellen Merkmale mit typologischer Relevanz für die romanischen Schulsprachen gegenüberzustellen.
Sprachen/Eigenschaften
Italienisch
Spanisch
Portugiesisch
Französisch
Kasusmarkierung
-
-
-
-
DOM
-
+
+
-
Partitive
+
-
-
+
Auxiliar ‘sein’/‘haben’
+
-
-
+
Overte Subjektklitika
-
-
-
+
SV-VS-Variation
+
+
+
-
se-Passiv
+
+
+
-
ser/ estar Kopula
- / (+)
+
+
-
Synthetisches Perfekt dominant
-
+
+
-
Abb. 6: Synopse zentraler typologischer Merkmale der romanischen Schulsprachen (ausgehend von Kabatek/Pusch 2011b, 93, modifiziert)
Sensibilität für diese sprachtypologischen Besonderheiten und deren explizite Erläuterung im Fremdsprachenunterricht erleichtern im Fall von Portugiesich als L3 substanziell den Zugang für Lernende, die vorher eine andere romanische Sprache gelernt haben.
2.1.4Portugiesisch im deutschen Bildungssystem
Zu den etwa 250 Millionen L1-Sprechenden des Portugiesischen in den vorgestellten Ländern kommt noch eine Vielzahl an Menschen, die Portugiesisch nicht als L1, sondern anders erworben haben. Diese sollen im Folgenden in den Blick genommen werden. Am Beispiel von Deutschland soll das Portugiesische als Herkunfts- sowie Tertiärsprache eingeordnet werden.
2.1.4.1Portugiesisch als Herkunftssprache
Der Begriff der Herkunftssprache bezeichnet die Sprache, die ein Individuum innerhalb einer Familie erlernt, wenn dort eine andere Sprache als die Umgebungssprache gesprochen wird. Diese kann entweder simultan mit der Umgebungssprache erworben oder vor dieser erlernt werden, wobei die Sprachkompetenz der Herkunftssprache der Sprecherinnen und Sprecher unterschiedlich ausgeprägt sein kann (Mehlhorn 2017, 123). Das häufigste Szenario stellt hierbei eine Migration von Familien über Ländergrenzen dar, wobei die Kinder in einem Land aufwachsen, in dem Portugiesisch nicht die Umgebungssprache stellt (vgl. auch Kap. 5.4, Kap. 7.4. und Kap. 8.1).
In Deutschland engagiert sich beispielsweise der Verein Mala de Herança für die Förderung der portugiesischen Sprache. Dabei kommen Familien mit lusophonem Hintergrund zusammen, pflegen die Sprache, und insbesondere für die Kinder wird ein Raum geschaffen, in dem sie ihre Herkunftssprache Portugiesisch anwenden und aufrechterhalten können (vgl. hierzu die Studie von Costa Wätzold 2023).
2.1.4.2Portugiesisch als Tertiärsprache
In Deutschland stellt Portugiesisch im Bildungssystem eine Tertiärsprache dar, da meist Englisch die erste Fremdsprache ist und nachfolgend häufig eine andere romanische Sprache wie Spanisch, Französisch oder Italienisch gewählt wird (Fiedler/Meisnitzer 2022, 233). Entscheidend für die Rolle als Tertiärsprache ist der Transfer aus bereits bekannten Sprachen im Lernprozess. So werden bereits erworbene Strategien und kognitive Ressourcen, insbesondere aus vorgelernten Sprachen, zur Aneignung der L3 genutzt. Die Didaktik der Tertiärsprache zielt auf eine Sensibilisierung der Lernenden für diese Transfers zwischen den Sprachen ab (vgl. Kap. 8).
2.1.4.3Portugiesisch als Kontaktsprache
Neben der Expansion während der Kolonialzeit trug das Portugiesische auch signifikant zur Herausbildung von Kreolsprachen wie dem Kabuverdianu, dem Angolar oder dem Santomense bei. Diese Kreolsprachen übernahmen unter anderem einen Großteil des Wortschatzes aus dem Portugiesischen, weisen aber auch vielfältige Einflüsse aus anderen Sprachen auf, sodass die portugiesischbasierten Kreolsprachen eigenständig sind. Im Entstehungsprozess war das Zusammenwirken der Sprachen entscheidend, wobei das Portugiesische als Kontaktsprache fungierte. Ähnliche Transferprozesse, wenn auch in reduzierterem Ausmaß, kann man bei Spracherwerbenden beobachten, die ungesteuert und mit geringem Input ‚Portugiesisch sprechen‘ in Deutschland bei Deutsch als dominanter Sprache oder in Kontexten, in denen im Familienkreis nur Portugiesisch gesprochen wird und Deutsch nur zur Kommunikation in punktuellen Situationen außerhalb dieses engeren Kreises verwendet wird – z. B. bei saisonalen Gastarbeitenden.
Zur Optimierung der Sprachkompetenz aller genannter Lerngruppen und vor allem zur Erarbeitung didaktisch sinnvoller Vermittlungsstrategien sind solide Kenntnisse in Systemlinguistik unabdingbar, gerade auch mit Blick auf Leistungsprüfungen und deren Beurteilung. Aber auch Kompetenzen in der kontrastiven Linguistik zwischen der Ausgangsund der Zielsprache der Lernenden sind wichtig, um deren Probleme besser diagnostizieren und mit ihnen Strategien entwickeln zu können, um die Sprachkompetenz und Performanz mündlich und schriftlich in der Zielsprache zu optimieren. Es bietet sich an, die kontrastive Linguistik, je nach Curricula der einzelnen Institute, im Bereich der Linguistik auf den Grundlagen der Systemlinguistik aufzubauen. Diese sollten in der Einführungsübung zur portugiesischen Sprachwissenschaft vermittelt werden, neben einer Vorlesung, die einen Überblick über die romanischen Sprachen, das Portugiesische als romanische Sprache, die Sprachgeschichte und Varietäten des Portugiesischen vermittelt (Fachmodul 1, im ersten Semester des Portugiesischstudiums). In dem zweiten systemlinguistischen Modul kann dann alternativ eine Vorlesung zur systematischen Vertiefung von Bereichen aus der Kernlinguistik, die den Lernenden und Lehrkräften besonders viele Probleme bereiten, oder eine Vorlesung zu Themen der kontrastiven Grammatik Portugiesisch-Deutsch, um den Lernenden zu helfen, die Interferenzen aus dem Deutschen zu reduzieren, angeboten werden – jeweils ergänzt durch ein Seminar zur Vertiefung eines systemlinguistischen Teilbereichs (Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax oder Morphosyntax, Semantik und optional Pragmatik). Hier ist jedoch mit Blick auf die Anforderungen einer guten Sprachkompetenz den ersten drei Bereichen der Vorrang zu geben. Oder alternativ, je nach thematischer Ausrichtung der Vorlesung, ein Seminar zur kontrastiven Linguistik, um den künftigen Lehrkräften den Blick für Probleme zu schärfen, die aus Direktübertragungen entstehen, die aus dem Deutschen vorgenommen werden (zur Situierung des Portugiesischen innerhalb einer Mehrsprachigkeitsdidaktik vgl. insgesamt Kap. 8).
2.1.5Die Bedeutung linguistischen Grundwissens für Vermittlung und Erwerb des Portugiesischen als Fremdsprache
Für künftige Sprachlehrende sind Grundlagenkenntnisse in der Linguistik unabdingbar, um sprachliche Strukturen zu erkennen und aktiv in der eigenen Sprachproduktion einzusetzen, was am Beispiel der Morphologie und der Phonetik dargestellt werden soll.
2.1.5.1Wortbildung im Portugiesischen
Die Wortbildung im Portugiesischen umfasst mehrere Verfahren, die den Lernenden helfen können, ihren Wortschatz systematisch zu erweitern (zum Wortschatz aus fachdidaktischer und unterrichtspraktischer Sicht vgl. Kap. 9.2, zur Wortbildung aus kontrastiver und unterrichtspraktischer Perspektive vgl. z. B. auch Kap. 7.1.2). Die häufigsten Methoden sind Derivation und Komposition.
Derivation im Portugiesischen
Derivation bezeichnet das Wortbildungsverfahren, bei dem ein bereits vorhandenes Wort als Basis fungiert und sich um ein gebundenes Morphem erweitert. Dieser Vorgang umfasst mehrere Mechanismen wie Präfigierung, Suffigierung und Zirkumfigierung. Diese Verfahren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Wortschatzes und der Ausdrucksmöglichkeiten in einer Sprache.
Die Präfigierung bezeichnet die Hinzufügung eines Präfixes an den Anfang eines Stammes, um ein neues Wort zu bilden. Ein Beispiel im Portugiesischen ist das Präfix {des-}, das oft eine gegenteilige Bedeutung ausdrückt, wie in desfazer (dt. ‘rückgängig machen’) von fazer (dt. ‘machen’). Ebenso erzeugt {in-} die Bedeutung von Negation, wie in injusto (dt. ‘ungerecht’) von justo (dt. ‘gerecht’). Diese Struktur erlaubt Lernenden, Grundbedeutungen zu erkennen und Wortbedeutungen systematisch abzuleiten.
Die Suffigierung ist der Prozess, bei dem ein Suffix an das Ende eines Stammes angefügt wird, um neue Wörter zu schaffen. Beispielsweise wird das Suffix {-ção} häufig zur Bildung von Substantiven aus Verben verwendet. Beispiele hierfür sind formação (dt. ‘Bildung’) von formar (dt. ‘bilden’) und criação (dt. ‘Schöpfung’) von criar (dt. ‘erschaffen’). Ein weiteres Beispiel ist das Suffix {-dade}, das Substantive mit einer abstrakten Bedeutung bildet, wie liberdade (dt. ‘Freiheit’) von livre (dt. ‘frei’) und felicidade (dt. ‘Glück’) von feliz (dt. ‘glücklich’). Diese Strukturen verdeutlichen, wie durch die Suffigierung neue Konzepte und abstrakte Begriffe geschaffen werden können. Die Suffigierung ist eine häufig verwendete Technik im Portugiesischen und bietet Sprachlernenden Möglichkeiten, neue Wörter auf Basis bekannter Stämme zu bilden.
Die Zirkumfigierung beschreibt die gleichzeitige Verwendung eines Präfixes und eines Suffixes, um ein neues Wort zu schaffen. Ein Beispiel ist empobrecer (dt. ‘verarmen’) von pobre (dt. ‘arm’), wobei {em-} als Präfix und {-ecer} als Suffix gemeinsam den Bedeutungswandel bewirken.
Komposition im Portugiesischen
Die Komposition ist ein weiterer zentraler Mechanismus der Wortbildung im Portugiesischen. Dabei werden zwei oder mehr Wörter zu einem neuen Begriff zusammengefügt. Diese Methode ist äußerst produktiv und ermöglicht, komplexe Bedeutungen effizient auszudrücken. Ein Beispiel ist guarda-chuva (dt. ‘Regenschirm’), das sich aus guardar (dt. ‘aufbewahren’) und chuva (dt. ‘Regen’) zusammensetzt. Innerhalb der Komposition differenziert man verschiedene Arten von Komposita, die sich hinsichtlich ihrer Struktur und semantischen Beziehung der Bestandteile unterscheiden. Dazu gehören Kopulativkomposita und Determinativkomposita.
Kopulativkomposita bestehen aus zwei gleichwertigen Bestandteilen, die semantisch parallel sind und gemeinsam eine neue Bedeutung schaffen. Ein Beispiel im Portugiesischen ist amor-ódio (dt. ‘Hassliebe’), das aus amor (dt. ‘Liebe’) und ódio (dt. ‘Hass’) besteht. Beide Bestandteile tragen gleichwertig zur Gesamtbedeutung bei, ohne dass einer den anderen näher bestimmt. Solche Wörter zeigen die Fähigkeit der Sprache, Konzepte durch Gleichstellung mehrerer Eigenschaften auszudrücken.
Determinativkomposita setzen sich aus einem bestimmenden (Determinans) und einem bestimmten (Determinatum) Teil zusammen. Der bestimmende Bestandteil modifiziert den Hauptbestandteil, wie bei guarda-roupa (dt. ‘Kleiderschrank’). Hier legt roupa (dt. ‘Kleidung’) die Funktion des Hauptbestandteils guarda (dt. ‘Schutz’ abgeleitet von guardar ‘aufbewahren’) fest. Diese Art der Komposition ist im Portugiesischen besonders häufig und ermöglicht eine präzise Spezifizierung von Objekten, Konzepten oder Tätigkeiten. Anders als im Deutschen (Determinans + Determinatum) weisen Komposita im Portugiesischen die interne Struktur (Determinatum + Determinans) auf. Folglich dominiert im Portugiesischen die Postdetermination als Wortbildungsmuster und im Deutschen die Prädetermination.
Didaktische Relevanz des systemlinguistischen Wissens über Wortbildungsverfahren
Die Verfahren sind für den Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung, da sie den Lernenden ein tieferes Verständnis für die Struktur und Dynamik der portugiesischen Sprache vermitteln. Sie bieten Lernenden systematische Werkzeuge, um den Wortschatz effektiv zu erweitern und komplexere sprachliche Strukturen zu verstehen. Lehrkräfte können Übungen entwickeln, bei denen Lernende neue Wörter durch Derivation und Komposition bilden, um ihr Sprachbewusstsein zu fördern. Durch diese Herangehensweise werden die Wortbildungsverfahren nicht nur ein linguistisches Thema, sondern auch ein praktisches Werkzeug im Sprachlernprozess.
2.1.5.2Phonetik und Phonologie des Portugiesischen
Das Phoneminventar des Portugiesischen unterscheidet sich signifikant von dem des Deutschen, insbesondere durch seine Nasalvokale und seine große Vielfalt an konsonantischen Phonemen. Es ist wichtig, Lernende von Anfang an für Unterschiede und vor allem für Laute, die es in ihrer L1 nicht gibt, zu sensibilisieren und deren Erwerb systematisch zu unterstützen. Dafür bietet es sich an, in einem ersten Schritt die Laute, die den Lernenden unbekannt sind, zu erproben (weiterführend zur Aussprache des Portugiesischen aus fachdidaktischer Sicht vgl. Kap. 7.1.1 und Kap. 9.1).
Bilabial
Labiodental
Dental
Alveolar
Postalveolar
Palatal
Velar
Uvular
Plosiv
p
b
t
d
k
g
Nasal
m
n
ɲ
Trill oder Vibrant
r
R
Tap oder Flap
ɾ
Frikativ
ß
f
v
ð
s
z
ʃ
ʒ
ç
x
ɣ
ʁ
Approximant
j
Lateraler Approximant
ʎ
ɫ
Grün – Phoneme, die in beiden Sprachen vorkommen.Orange – Phoneme, die nur im Portugiesischen auftreten.Blau – Phoneme, die nur im Deutschen auftreten.*Die Phoneme rechts in der Tabelle sind stimmhaft, die Phoneme links sind stimmlos.
Abb. 7: Die Konsonanten des Deutschen und des Portugiesischen (eigene Darstellung)
Abb. 8: Die Vokale des Portugiesischen und des Deutschen kontrastiv (eigene Darstellung)
2.1.6Herausforderungen im Portugiesischlernprozess: eine kontrastive Betrachtung mit dem Deutschen
Da das Portugiesische meist eine Tertiärsprache ist und Lernende vor allem auf Strukturen der ersten gesteuert erworbenen Fremdsprache zurückgreifen, ist es auch sinnvoll, kontrastive Seminare Englisch-Portugiesisch anzubieten. Da die erste erworbene Fremdsprache jedoch nicht notwendigerweise bei allen Lernenden in einem Kurs/in einer Klasse dieselbe sein muss und das Lehrbuch auf Adressatinnen und Adressaten in Deutschland abzielt, möchten wir im Folgenden einige Bereiche, die besondere Herausforderungen für L1-Deutsch-Sprechende darstellen, beleuchten und dadurch zeigen, wie wichtig eine solide Basis in Systemlinguistik ist.
Portugiesisch als Nicht-L1 zu lernen bringt spezifische Herausforderungen mit sich, die vor allem durch die strukturellen Unterschiede zum Deutschen bedingt sind. Im Folgenden sollen einige ausgewählte Charakteristika des Portugiesischen beleuchtet werden, welche aufgrund der Nichtexistenz im Deutschen anspruchsvolle Felder im Sprachlernprozess darstellen könnten: die Nasalität der Vokale, das Imperfekt, der conjuntivo und die Unterscheidung von ser und estar.
Nichtsdestotrotz gilt es zu betonen, dass hier auch entscheidende Transfers aus zuvor gelernten Sprachen dazu beitragen können, dass die Herausforderungen besser gemeistert werden oder erst gar nicht entstehen.
2.1.6.1Nasalität der Vokale
Die Nasalvokale sind ein prägnantes Merkmal des Portugiesischen, das deutsche L1-Sprecherinnen und -Sprecher vor eine ungewohnte Herausforderung stellt (Schäfer-Prieß/Schöntag 2012, 74). Diese Vokale entstehen, wenn beim Sprechen eines Vokals Luft durch die Nase entweicht. Sie werden entweder durch eine Tilde (~) über den Vokalen angezeigt, wie bei maçã (dt. ‘Apfel’) oder durch Kombinationen mit den Konsonanten <m> bzw. <n> markiert, wie in um (dt. ‘eins’) oder com (dt. ‘mit’). Der Klang der Nasalvokale unterscheidet sich stark von dem reinen Vokalklang, der im Deutschen üblich ist.
Im Deutschen gibt es keine Nasalvokale; stattdessen wird Nasalität durch nasale Konsonanten wie <m> und <n> erzeugt. Diese strukturelle Differenz macht es deutschsprachigen Lernenden schwer, die richtige Artikulationsweise zu erlernen. Sie müssen sowohl ihre Aussprachegewohnheiten als auch ihr Hörverständnis erweitern, um die Nuancen der Nasalität zu erkennen und korrekt umzusetzen. Dieser Weg kann über mehrere Stufen erfolgen. In erster Linie können Lernende über Eintauchübungen mit dem Klang der portugiesischen Sprache vertraut gemacht werden, bevor in einem zweiten Schritt begonnen wird, bei Diskriminationsübungen die Nasallaute den Orallauten gegenüberzustellen (Dieling/Hirschfeld 2000, 47-62). Dies kann für das Portugiesische wie folgt geschehen:
(1)
vi (dt. ‘ich sah’) [vi]
vim (dt. ‘ich kam’) [vĩ]
seda (dt. ‘Seide’) [ˈse.dɐ]
senda (‘Pfad’) [ˈsẽ.dɐ]
lá (dt. ‘dort’) [la]
lã (dt. ‘Wolle’) [lɐ̃]
roubo (dt. ‘Raub’) [ˈʀo.bu]
rombo (dt. ‘Raute’) [ˈʀõbu]
mudo (dt. ‘stumm’) [ˈmu.du]
mundo (dt. ‘Welt’) [ˈmũ.du]
(Bossong 2008, 64)
Durch gezielte Hörübungen, bei denen zwischen nasalierten und nicht-nasalierten Wörtern unterschieden wird, kann das Bewusstsein geschärft werden. In einem dritten Schritt sollen die Nasallaute in Form von Identifikationsübungen in längeren Passagen wiedererkannt werden. Über diesen Dreischritt können Lernende an die Differenzierung der Nasallaute herangeführt werden, welche über eine Bewusstmachung der Schriftform als wichtige Stütze im Sprachlernprozess begleitet werden sollte.
So können die Regeln fixiert werden, die einen nasalen Vokal anzeigen, was im Portugiesischen, wie bereits geschildert, durch die Tilde gekennzeichnet ist, oder auch, wenn ein Wort auf <m> bzw. <ns> endet oder falls ein Vokal von <m> oder <n> sowie einem weiteren Konsonanten gefolgt wird (mit Ausnahme von <nh>) (Malcata 2011, 17). Nach der Sensibilisierung des Gehörs für die Wahrnehmung der Nasallaute sollen diese auch reproduziert werden.
Für das Trainieren der Aussprache der Nasalvokale können ähnliche Wörter als Grundlage genutzt werden. Begonnen werden kann mit unmittelbaren Nachsprechübungen, wobei das Vorsprechen der Lehrperson oder ein Audio als Vorlage dient und die Lernenden die Wörter mit den Nasallauten direkt wiederholen. In einem zweiten Schritt kann das Wiederholen der Wörter durch ein Umformulieren einer Äußerung erfolgen. Hier werden die fokussierten Wörter mit Nasallauten bereits in einen Kontext gebettet, bis die Lernenden in immer freieren Kontexten die Nasalvokale ohne explizites vorheriges Hören sicher produzieren (Dieling/Hirschfeld 2000, 47-62).
2.1.6.2Das Imperfekt
Ein weiteres zentrales Thema ist der Gebrauch des Imperfekts (Pretérito Imperfeito) im Portugiesischen (zum Grammatikunterricht aus fachdidaktischer Perspektive allgemein vgl. Kap. 9.3, zum Kontrast aus spezifisch-unterrichtspraktischer Perspektive vgl. auch Kap. 7.2). Diese Verbform wird verwendet, um beispielsweise wiederholte oder andauernde Handlungen in der Vergangenheit zu beschreiben, wie in:
(2)
Eu falava com ele todos os dias. (dt. ‘Ich sprach jeden Tag mit ihm’)
Dabei legt das Imperfekt den Fokus der Betrachtung auf den Verlauf oder die Häufigkeit der Handlung (Meisnitzer 2022, 449-450). Jedoch ist die Verbform auch darüber hinaus vielseitig verwendbar.
Im Deutschen fehlt eine eindeutige Entsprechung für diese Differenzierung. Die Unterscheidung zwischen Perfekt und Präteritum im Deutschen basiert häufig auf stilistischen Vorlieben oder regionalen Tendenzen, nicht aber auf einer aspektuellen Opposition wie im Portugiesischen. Diese Diskrepanz führt dazu, dass deutsche Lernende oft unsicher sind, wann das Imperfekt im Portugiesischen korrekt angewendet werden sollte. Besonders anspruchsvoll ist die Unterscheidung zwischen dem Imperfeito und dem Pretérito Perfeito Simples, das abgeschlossene Handlungen beschreibt (imperfektive vs. perfektive Aspektualität). Gleichzeitig erleichtert ein Verständnis von Telizität (verblühen [+PUNKTUELL]) in Opposition zu Atelizität (blühen [-PUNKTUELL] von Verben bezüglich der von ihrer Semantik kodierten Perspektive auf das Verbalereignis als bounded (= abgeschlossenes Ganzes) vs. unbounded (im Verlauf) die Erklärung von möglichen abweichenden Verwendungen, wie in Ele está a morrer. (‘Er liegt im Sterben.’; ein eigentlich perfektives Verbalereignis STERBEN [+PUNKTUELL], das folglich keine Verlaufsperspektive zulässt).
Um Lernenden den Gebrauch des Imperfekts näherzubringen, können situationsbezogene Übungen hilfreich sein. Beispielsweise können Kontexte analysiert werden, in denen das Imperfekt üblich ist, etwa Beschreibungen von Routinen oder Szenarien aus der Vergangenheit. Die Verwendung von Diagrammen oder Zeitachsen, aber auch Filmszenen, die den Verlauf einer Handlung visualisieren, bieten weitere Möglichkeiten, das Verständnis zu vertiefen. Rollenspiele, bei denen Lernende vergangene Ereignisse nachstellen, fördern zudem die praktische Anwendung.
2.1.6.3Conjuntivo
Auch der Conjuntivo stellt für viele deutschsprachige Lernende eine besondere Herausforderung dar, da er im Portugiesischen eine zentrale Rolle spielt, um beispielsweise Unsicherheiten, Möglichkeiten, Wünsche oder Forderungen auszudrücken. Ein typisches Beispiel ist:
(3)
Espero que tu venhas. (dt. ‘Ich hoffe, dass du kommst’)
Der Conjuntivo wird vor allem in Nebensätzen verwendet, in denen Unsicherheiten oder subjektive Einstellungen hervorgehoben werden.
Im Deutschen wird in ähnlichen Kontexten mitunter der Konjunktiv I oder II verwendet. Allerdings sind diese Formen im deutschen Sprachgebrauch rückläufig und werden oft durch Modalverben oder Umschreibungen ersetzt, wie in: Ich hoffe, dass du kommen wirst. Diese Entwicklung erschwert es deutschen Lernenden, die Bedeutung und den Gebrauch des Conjuntivo im Portugiesischen zu erfassen.
Eine wichtige Säule für das Identifizieren und richtige Anwenden des Conjuntivo ist das Vermitteln der typischen Wendungen, den sogenannten Triggern, die den Conjuntivo auslösen (que für Präsens; se für Imperfekt und quando für Futur).
2.1.6.4Die Unterscheidung zwischen ser und estar
Die Unterscheidung zwischen ser und estar gehört zu den klassischen Herausforderungen für deutsche Portugiesischlernende (vgl. auch Kap. 7.2). Während das Deutsche nur eine Form für das Verb sein kennt, differenziert das Portugiesische zwischen ser (für dauerhafte Eigenschaften und Zustände) und estar (für vorübergehende Eigenschaften und Zustände) (Döll/Hundt 2021, 20-24). Ein Beispiel für diese Unterscheidung ist:
(4)
Ele é feliz. (dt. ‘Er ist glücklich’ – Eigenschaft bzw. dauerhafter Zustand)
gegenüber:
(5)
Ele está feliz. (dt. ‘Er ist glücklich’ – momentaner Zustand)
Diese feine semantische Nuancierung ist für deutsche L1-Sprechende oft ungewohnt, da sie im Deutschen durch den Kontext oder zusätzliche Ausdrücke vermittelt wird. Daher neigen Lernende dazu, ser und estar zu verwechseln oder beide Formen falsch zu verwenden.
Didaktische Anstöße umfassen kontrastive Beispielsätze, die typische Verwendungen von ser und estar illustrieren. Kontextsensitive Übungen, bei denen Lernende entscheiden müssen, welche Form in einer bestimmten Situation angemessen ist, können das Verständnis vertiefen.
Dies kann unterstützend durch Gegenüberstellung der beiden Verben in ähnlichen Kontexten erfolgen, wie dem Gebrauch mit Adjektiven. So wird estar mit Adjektiven verwendet, die aus einer Handlung resultieren:
(6)
Hoje estou bem-disposto (porque é o meu aniversário). (dt. ‘Heute bin ich gut gelaunt (weil mein Geburtstag ist)’)
Dagegen findet ser mit Adjektiven Verwendung, wenn eine Eigenschaft nicht das Resultat einer Handlung ist:
(7)
Ele é simpático. (dt. ‘Er ist sympathisch’), (Coimbra/Coimbra 2000, 10)
Ein solides linguistisches Grundwissen ermöglicht es der Lehrkraft, die richtige Verwendung sicherzustellen. Gleichzeitig ist die Frage, ob die Sprecherin oder der Sprecher eine Prädikation als gnomisch (überzeitlich mit ser) oder als zeitgebunden und potentiell veränderbar präsentiert (mit estar), entscheidend (Radatz 2021, 226). Aus kognitiv linguistischer Sicht hilft die Unterscheidung zwischen Individuenprädikaten (konstruiert mit ser) und Zustandsprädikaten (konstruiert mit estar) (Radatz 2021, 226) bei der Entscheidung, welches Verb in Kontexten, in denen beide möglich sind, verlangt wird. Bei Prädikatsadjektiven gilt, dass prototypische Adjektive ausgewählten Referenten Eigenschaften zuweisen, und dass es bei prototypischen, qualitativen Adjektiven (z. B. ser inteligente ‘intelligent sein’) zudem die Möglichkeit der Modifikation durch Adverbien (mais ‘mehr’, menos ‘weniger’) gibt. Aber neben den Adjektiven, die Eigenschaften bezeichnen, gibt es auch die relationalen Adjektive, z. B. português (< Portugal), semanal (< semana) oder muscular (< músculo), die den Substantiven ähnlicher sind, und adjektivische Komplemente, die ein klassifikatorisches, definitorisches Merkmal präsentieren (Bsp. As ovelhas são mansas. ‘Schafe sind zahm’) und daher ebenfalls mit ser konstruiert werden (Radatz 2021, 228). Das ser/estar-Problem stellt sich eigentlich im Wesentlichen in Prädikatskonstruktionen mit adjektivischem Prädikatsnomen, wenn das Adjektiv qualifizierend und nicht relational ist, das heißt, wenn es der semantischen Klasse der Eigenschaftsbezeichnungen angehört (Radatz 2021, 228). Soll ein qualifizierendes Adjektiv als überzeitlich und wesentliche Eigenschaft konstruiert werden, so wird es mit gnomischer Kopula ser gebildet; wenn es hingegen als eine akzidentelle Eigenschaft konstruiert werden soll, die nur potentiell und eher vorübergehend ist, wird die Veränderung zulassende Kopula estar verwendet (Radatz 2021, 228).
2.1.7Das Portugiesische als plurizentrische Sprache mit zwei dominanten Varietäten als Herausforderung für den Fremdsprachenunterricht
Das Portugiesische zählt zu den plurizentrischen Sprachen, da es mehrere konkurrierende normative Zentren aufweist. Neben den dominanten Standardvarietäten des brasilianischen (BP) und europäischen Portugiesisch (EP) bilden sich sukzessive endogene Standardvarietäten in Angola und Mosambik heraus. Ob und inwieweit diese im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden sollen, ist umstritten, auch wenn die sprachlichen Eigenschaften und der Sprachgebrauch in der kommunikativen Distanz es nahelegen (siehe hierzu Meisnitzer 2019). Mit Blick auf das EP und das BP fällt die Antwort wohl deutlich leichter und eindeutiger aus. Eine Herausforderung stellen die tiefgründigen strukturellen Unterschiede zwischen dem BP und dem EP dar, die im Erwerbsprozess zu einer hohen Fehleranfälligkeit bei den Lernenden führen, wenn die Varietäten nicht sorgfältig getrennt werden. So findet man profunde Unterschiede in beiden Varietäten. Auf phonetisch-phonologischer Ebene ist einer der deutlichsten Unterschiede zwischen EP und BP die Palatalisierung der okklusiven Konsonanten /t/ und /d/, wenn sie von einem Vokal [i] oder Halbvokal [j] gefolgt werden (z. B. in tia und dente [dẽtʃi], man beachte auch den vorangehenden Verschluss von [e] zu [i] in der zweiten unbetonten Silbe am Ende des Wortes, im Gegensatz zum EP, wo wir eine Zentralisierung und eine Erhöhung des Vokals [ɨ] in derselben Position haben) (Mattos e Silva 2013, 150). Im Gegensatz dazu ist ein sehr auffälliges Merkmal des Konsonantismus im EP die Palatalisierung des alveolaren Frikativs /S/ in Wortendstellung (z. B. cai[ʃ]) und vor einem Konsonanten (z. B. po[ʃ]to