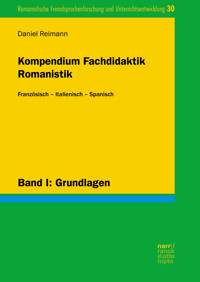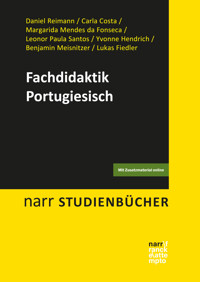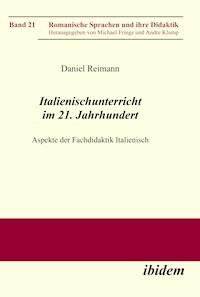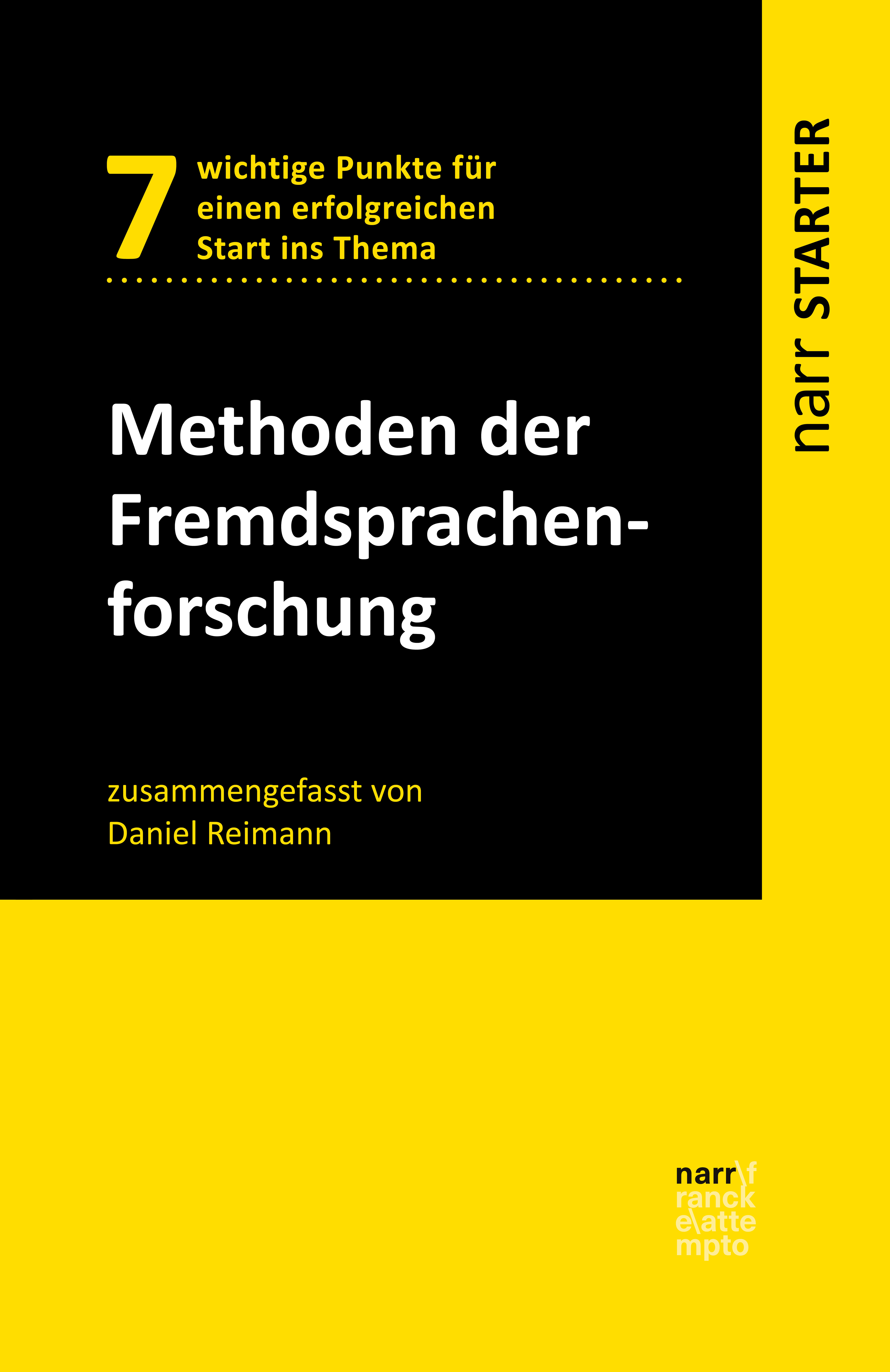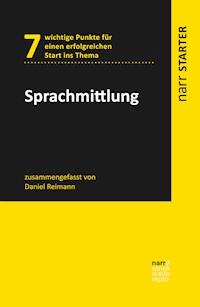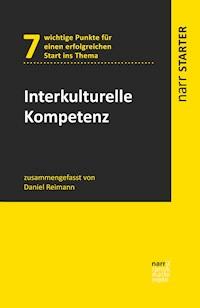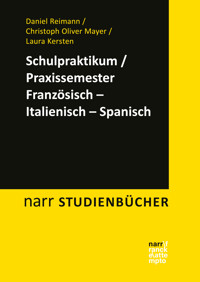
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
In beinahe allen Bundesländern sind längere Praxisphasen in den einzelnen Fächern (i.d.R. sog. "Praxissemester") verpflichtender Bestandteil aller Lehramtsstudiengänge. Zu diesen Praktika gehören auch vorbereitende und / oder begleitende und / oder nachbereitende Lehrveranstaltungen. Zur Begleitung solcher Lehrveranstaltungen wird hier erstmals eine praxisorientierte Veröffentlichung vorgelegt, die zur Vorbereitung von Praxisphasen in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung an Hochschulen und Universitäten in den Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch herangezogen werden kann. Themen sind u.a.: Administrative und wissenschaftliche Grundlagen, Best-practice-Beispiele, Lerngruppenanalysen, Hospitationen und Unterrichtsbeobachtung, Unterrichtsplanung, Unterrichtssprache in den romanischen Sprachen, Unterrichtsversuche, Fallanalysen, Arbeit mit Unterrichtsvideos, Portfolio-Arbeit usw. Das Buch ist explizit auch als Lehrbuch für entsprechende Lehrveranstaltungen konzipiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Reimann / Christoph Oliver Mayer / Laura Kersten
Schulpraktikum / Praxissemester Französisch – Italienisch – Spanisch
Schulpraktikum / Praxissemester Französisch – Italienisch – Spanisch
eLearning-Kurs & eBook
Zu diesem Band gibt es ein eBook und einen eLearning-Kurs, die Sie kostenfrei online abrufen können. Zu Beginn eines jeden Kapitels finden Sie einen QR-Code, der Sie zum dazugehörigen Fragenkatalog des eLearning-Kurses bringt. Erstellen Sie gleich einen persönlichen Account auf unserer eLibrary und schalten Sie eBook und eLearning-Kurs mit Ihrem Gutscheincode frei.
So geht’s
⯈ gutschein.narr.digital besuchen
⯈ den Schritten zum Aktivieren des Gutscheincodes folgen
⯈ eLearning-Kurs nutzen
Prof. Dr. Daniel Reimann ist Ordinarius für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Humboldt-Universität zu Berlin
PD Dr. Christoph Oliver Mayer ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Lehrstuhl für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen der Humboldt-Universität zu Berlin.
Laura Kersten ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen der Humboldt-Universität zu Berlin.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381108923
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-381-10891-6 (Print)
ISBN 978-3-381-10893-0 (ePub)
Inhalt
VorwortDaniel Reimann/Christoph Oliver Mayer/Laura Kersten
Das vorliegende Studienbuch möchte allen Studierenden, die eine intensivierte Praxisphase bzw. ein fachbezogen-fachdidaktisches Praktikum in den Lehramtsfächern Französisch, Italienisch und/oder Spanisch absolvieren, eine fachspezifische vorbereitende und begleitende Hilfestellung bieten. Es versteht sich dabei insbesondere als Begleitbuch für das Praxissemester oder ein studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum.
Zwar gibt es bereits zahlreiche „Praktikumsbegleiter“ für Schulpraktika im Lehramtsstudium, diese fokussieren aber meistens eher die schulpädagogische bzw. allgemein-didaktische Ebene und haben tendenziell eher den Primarbereich, allenfalls die Sekundarstufe I im Blick (z. B. Böhmann/Schäfer-Munro 2008, Wiater 2014, Kiel 2020). Teilweise beziehen sie sich explizit auf grundlegende Praktika wie das Orientierungspraktikum (z. B. Stephan/Thien 2009) bzw. eben auf allgemeine pädagogische (Block-) Praktika insbesondere in einer frühen Phase des Studiums (z. B. Ramusch/Reumüller 2009, Zierer 2023). Fehlanzeige bezüglich spezifisch fachdidaktisch orientierter Praktika besteht indes selbst in gymnasialspezifischen Veröffentlichungen wie etwa Glas/Schlagbauer (2017) (in diesem Fall auch, da die Darstellung v. a. die zweite Ausbildungsphase, das Referendariat, fokussiert). Zu allgemeinen und fächerübergreifenden bzw. fachunabhägigen Aspekten des Praxissemesters kann auf den derzeit vergriffenen Band Jürgens (2016) hingewiesen werden. Speziell für den fremdsprachendidaktischen Bereich, noch dazu für den romanistisch-didaktischen Bereich für die Sekundarstufen I und II, gibt es bislang sehr wenig (vgl. Mayer 2020a) – diese Lücke will der vorliegende Band schließen.
Das vorliegende Studienbuch ist im Rahmen der Praxisbetreuung von Studierenden der Fächer Französisch, Italienisch und Spanisch an der Humboldt-Universität zu Berlin aus der Zusammenarbeit des Lehrstuhl-Teams der Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen entstanden. Es ist jedoch bewusst so konzipiert, dass es sich an Studierende und deren Begleitende an Schulen und Hochschulen in längeren fachbezogenen Praktika in allen Bundesländern richtet. Hierfür konnten die Verfasserin und die Verfasser auf ihre langjährige eigene Unterrichtserfahrung, vor allem aber auch auf ihre Ausbildungserfahrung gerade im Kontext studienbegleitender fachdidaktischer Praktika und verschiedenener Praxissemester-Modelle außer in Berlin u. a. in Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen zurückgreifen. Wir hoffen, dass dieser Band Studierende der Lehramtsstudiengänge für Französisch, Italienisch und Spanisch insbesondere für die Sekundarstufen I und II in ihrer Professionalisierung für den faszinierenden Beruf der Lehrerin/des Lehrers einer oder mehrerer romanischer Sprachen unterstützen kann und ggf. auch gerade neuen Kolleg:innen in der schulischen und hochschulischen Praktikumsbetreuung und -begleitung (Mentor:innen, Praktikumslehrer:innen und Dozierende der Begleitveranstaltungen) hilfreich sein möge.
Berlin, im Mai 2025
1Schulpraktika und Praxissemester in den romanischen Sprachen – administrative und wissenschaftliche Grundlagen
1.1Praxisphasen im Unterricht der romanischen Sprachen – Übersicht über die BundesländerLaura Kersten
Grundlegendes Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, aus romanistisch-didaktischer Perspektive einen Überblick über die Regelungen und Ausformungen der Schulpraktischen Studien im Rahmen des Studiums für das Lehramt an allgemeinbildenden Sekundarschulen am Beispiel Gymnasium zu geben. Die KMK-Standards zur Lehrerbildung sprechen nur sehr allgemein von „praktischen Ausbildungsteile[n]“ (KMK 2004, 1, u. ö., KMK 2019, 7 u. ö.), im Fachprofil „Fremdsprachen“ verweist lediglich der Passus „[d]ie Studienabsolventinnen und -absolventen […] verfügen über erste reflektierte Erfahrungen in der kompetenzorientierten Planung und Durchführung von Fremdsprachenunterricht in heterogenen Lerngruppen“ (KMK 2024, 44) auf vorgesehene Praktika. Der folgende Überblick basiert daher auf der Rechtsgrundlage der einzelnen Bundesländer zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand 01/2025). Die tatsächliche Praktikumslandschaft kann noch vielfältiger sein, da in einzelnen Bundesländern im Rahmen der reformierten Lehramtsstudiengänge den Universitäten gewisse Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung der Praktika zugestanden werden.
Die Entscheidung über die Formate – Schaeper (2008, 32) differenziert in ihrem Beitrag zu den Umsetzungsmöglichkeiten der Anforderungen der Bologna-Reform zwischen
Kurzpraktika mit unterschiedlicher Einbettung,
Praktika im polyvalenten Professionalisierungsbereich des Bachelors,
Parallelstrukturen von theoretischer und praktischer Ausbildung im Bachelor- und Masterstudium (sog. „Duales System“) und
längeren, mehrere Monate andauernden Praktika, dem sog. Praxissemester (Schaeper 2008, 32) –
obliegt den Ländern, welche wiederum durch die einschlägigen Abschnitte der Lehrerbildungsgesetze, Lehramtsprüfungsordnungen usw. festlegen, wie die Hochschulen bzw. in der Regel deren Zentren für Lehrerbildung (Professional Schools of Education usw.) die Praktika ausgestalten sollen. Die gesetzlichen Regelungen spiegeln somit bis zu einem gewissen Maß wider, wie das Verhältnis von Theorie und Praxis in der ersten Phase der Lehramtsausbildung – auch im Zusammenspiel mit der zweiten Phase, dem Referendariat (vgl. Bach 2013, 80–90) – von den einzelnen Bundesländern konzipiert wird.1 Der hier im Länder-Überblick dargelegte Status quo (vgl. auch die Tabellen in Anhang 1–4) bildet daher auch die Hintergrundfolie für die Ausrichtung der gegenwärtigen wie zukünftigen Forschungsdesiderata bzw. -anliegen, wie z. B. die Notwendigkeit, die Wirkung, Wirksamkeit und Wirksamkeitsbedingungen für die unterschiedlichen Praxisformate zu untersuchen (siehe hierzu Kap. 1.2).
Der vorliegende Überblick knüpft dabei – in Adaption aus romanistisch-fachdidaktischer Perspektive – an die Darstellung von Weyland/Wittmann (2015) zur Implementierung von Langzeitpraktika („Praxissemester“) zwischen 2001 und 2015 an. Mit ihrem Beitrag legen Weyland/Wittmann (2015) eine Analyse zur Praktikumssituation anhand der Kategorien ‚von der Einführung des Langzeitpraktikums betroffene Lehrämter‘, ‚Bezeichnung der Praktika‘, ‚Dauer und Gesamt-ECTS-Punkte‘, ‚zeitliche Verortung‘ sowie ‚primäre institutionelle Zuständigkeit‘ in elf Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Hansestadt Bremen, Brandenburg, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) vor.
Dieses Kapitel fokussiert die Langzeitpraktika bzw. Praxissemester im Masterstudium bzw. Lehramtstudium, da die KMK mit Nachdruck die Forderung an die Bundesländer gestellt hat, den „Anteil der schulpraktischen Studien deutlich zu erhöhen und diese sowie die Bildungs- und Fachwissenschaften und deren Didaktik […] stärker miteinander zu vernetzen, um eine verbesserte Orientierung an den Erfordernissen des Lehrerberufes zu erreichen“ (2005, 2). Langzeitpraktika, in der Regel in Gestalt von Praxissemestern, dürfen grundsätzlich als Formate gelten, die nicht nur aufgrund des zeitlichen Umfangs (und somit auch im Umfang der zu erwerbenden ECTS-Punkte), der Modulstruktur und der inhaltlichen Ausgestaltung der Module, sondern auch aufgrund ihrer Einbettung in vor- und/oder nachbereitende und/oder begleitende Lehrveranstaltungen an den Hochschulen, sowohl in den Bildungswissenschaften als auch in den Fachdidaktiken, die Forderung der KMK aus dem Jahr 2005 zumindest in quantitativer Sicht einlösen.
Der Praxisbezug eines Lehramtsstudiums kann aber nur im Zusammenspiel aller Praktika, die im Verlaufe eines Studiums zu absolvieren sind, analysiert und verstanden werden. Daher soll im Folgenden auch die Bandbreite der pädagogischen und didaktischen Praktika im Bereich der Bachelor- und Masterstudiengänge (mit Spezialisierung auf Lehramt am Gymnasium) bzw. im Lehramtsstudium mit Staatsprüfung insgesamt erfasst werden; um der fachdidaktischen Perspektive Rechnung zu tragen, werden die Praktika in den Tabellenzeilen nicht chronologisch entsprechend ihrer Verortung im Studienverlauf abgebildet, sondern gemäß der Opposition ‚fachdidaktisch‘ und ‚allgemein pädagogisch/pädagogisch-didaktisch‘ geordnet. Betriebspraktika, Berufsfeldpraktika (z. B. Nordrhein-Westfalen) usw., die in der Regel im Bereich der Produktion, Weiterverarbeitung, Handel oder Dienstleistung absolviert werden, sind nicht erfasst worden, wohingegen verpflichtende Praktika im pädagogischen nicht-schulischen Bereich aufgrund des Bezugs zum pädagogischen Handlungsfeld zusammen mit allgemein pädagogischen/pädagogisch-didaktischen Praktika aufgeführt werden.
Terminologisch werden die folgenden Unterscheidungen vorgenommen: Mit Blick auf die rein zeitliche Dimension wird zwischen Kurzzeitpraktika (mit Tagespraktika als Sonderform der Kurzzeitpraktika) und Langzeitpraktika bzw. Praxissemestern (vgl. Bach 2020, Gröschner/Klaß 2020) unterschieden werden.2 Beispiele für die Vielfalt der Ausgestaltungen gerade auch an der Schnittstelle von Tages- und Langzeitpraktika sind z. B. die schulpraktischen Übungen in Sachsen (vgl. Kap. 1.3) bzw. das Studienbegleitende fachdidaktische Praktikum in Bayern (vgl. Kap. 1.4).
Da keine Übereinkunft darüber besteht, wie viele Wochen ein Kurzzeitpraktikum gegenüber einem Langzeitpraktikum umfasst, wurde in Orientierung an Bach (2020, 74) entschieden, ca. sechs Wochen als Obergrenze für ein Kurzzeitpraktikum anzusetzen und den Begriff des Langzeitpraktikums bzw. Praxissemesters für Praktika zu verwenden, die sich über mehrere Monate am Stück erstrecken und bei denen die Studierenden während des Semesters in der Regel wöchentlich mehrere Tage am Lern- und Einsatzort Schule verbringen. Somit gelten Blockpraktika hier als eine Form von Kurzpraktika, die zusätzlich das Merkmal aufweisen, dass sie in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden und somit eine parallele Belgeitung durch eine Lehrveranstaltung nicht möglich ist. Praktika, die nur an einem Tag in der Woche über einen längeren Zeitraum, in der Regel über ein Semester, stattfinden und von einer Lehrveranstaltung begleitet werden, werden in diesem Studienbuch als Langzeitpraktika besonderer Prägung bezeichnet, um den wiederkehrenden und kontinuierlichen Charakter der Lernerfahrung bei diesem Praktikumsformat zu unterstreichen (siehe Kapitel 1.4.1). Dieser umsichtig-pragmatische Vorschlag erfolgt auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass etwa Weyland/Wittmann (2015, 13) am Beispiel Hamburgs Tagespraktika über einen längeren Zeitraum als Langzeitpraktika anzusehen empfehlen, was in Analogie etwa auch für Bayern oder das Saarland zu diskutieren wäre (vgl. Anhänge 1, 3 und 4).
Unabhängig von der Anzahl und Ausgestaltung der Praxisphasen ist festzustellen, dass, basierend auf den aus dem Bologna-Prozess abgeleiteten Maßgaben, den Praktika im Bachelorstudium primär eine orientierende und berufsfelderschließende Funktion zukommt, wohingegen im Rahmen des Masters im Sinne der berufsbezogenen Spezialisierung die Funktion der vertieften Kompetenzentwicklung und Reflexion des didaktisch-pädagogischen Handelns im Vordergrund zu stehen scheint (vgl. Ulrich et al. 2020, 6, Schubarth 2014, 42 und Bach 2020, 622). Folglich besteht die Tendenz, ausgedehnte Fachpraktika in den Masterstudiengängen (vgl. Anhang 3), bevorzugt im 2. oder 3. Semester des Masterstudiums, anzusiedeln. Der Übersichtlichkeit halber wurden die Daten zu den Praktika in den gymnasialen Lehramtsstudiengängen (mind. eine romanische Sprache) der Länder für die Analyse in vier Kategorien gruppiert:
Anhang 1 beinhaltet die Darstellung über die Praktikumslage aller Bundesländer mit erster Staatsprüfung, die insgesamt nur Blockpraktika und Langzeitpraktika besonderer Prägung bzw. (erweiterte) Tagespraktika vorsehen, sowohl im Bereich der Fachpraktika (in der Regel dem letzten Praktikum im Studienverlauf) als auch im Bereich aller weiteren Praktika.
Anhang 2 beinhaltet die Darstellung über die Praktikumslage des einzigen Bundeslandes mit Lehramtstudium im Bachelor-/Mastersystem, das insgesamt nur Blockpraktika vorsieht, sowohl im Bereich der Masterpraktika als auch im Bereich aller weiteren Praktika.
Anhang 3 beinhaltet die Darstellung über die Praktikumslage aller Bundesländer mit erster Staatsprüfung, die im Bereich der Fachpraktika (in der Regel dem letzten Praktikum im Studienverlauf) Langzeitpraktika/Praxissemester und im Bereich aller anderen Praktika Kurzzeitpraktika aufweisen.
Anhang 4 beinhaltet die Darstellung über die Praktikumslage aller Bundesländer mit Lehramtstudium im Bachelor-/Mastersystem, die im Bereich der Masterpraktika Langzeitpraktika/Praxissemester und im Bereich aller vorhergehenden Praktika nur Blockpraktika aufweisen.3
Bei einer vergleichenden Betrachtung der Gegebenheiten in den verschiedenen Bundesländern kann u. a. Folgendes festgehalten werden: Den Bundesländern mit Staatsexamen und auch jenen mit Bachelor-/Master-Studiengängen ist gemein, dass es in der Regel ein Orientierungspraktikum gibt (alternative Bezeichnungen sind beispielsweise bildungswissenschaftliches Blockpraktikum, Grundpraktikum, berufsfelderschließendes Praktikum oder pädagogisches Praktikum), welches insgesamt einen Umfang von zwei bis sechs Wochen aufweisen kann. Für Bayern, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind vor dem letzten Fachpraktikum explizit Praktika mit einer (fach)didaktischen Komponente vorgesehen. Aus der Praktikumsübersicht in den Anhängen 2 und 4 lassen sich, unabhängig von der zeitlichen Dimension, zwei Tendenzen entnehmen. Es gibt Bundesländer, in denen gemäß der jeweiligen Verordnung auf Landesebene (im Minimum) das Modell 1+1, also je ein Praktikum im Bachelor- und ein Praktikum im Masterstudium, zu Grunde gelegt wird; in anderen wiederum folgt man dem Modell 2+1, also (mind.) zwei Praktika während des Bachelor- und ein Praktikum im Masterstudium.
Vergleicht man die Bundesländer mit Staatsexamen in Anhang 1 und 3, so wird deutlich, dass gemäß den Verordnungen für die Bundesländer Bayern, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt4, die für den gesamten Studienverlauf nur Blockpraktika und Langzeitpraktika besonderer Prägung ansetzen, drei Praxisphasen im Studienverlauf vorgesehen sind, wohingegen in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen, wo ein Praxissemester als Fachpraktikum eingeführt wurde, lediglich ein weiteres Kurzzeitpraktikum in der vorhergehenden Phase angesetzt ist. Für Sachsen-Anhalt sieht die für das romanistische Lehramtstudium relevante LPVO (§ 26 Abs. 2 Satz 2) zwei Schulpraktika von mindestens insgesamt acht Wochen und einem Gesamtumfang von 15 Leistungspunkten vor, die jedoch am Standort Halle in Form von vier unterschiedlichen Praktikumsarten – Beobachtungspraktikum, Schulpraktische Übung, Schulpraktikum, Außerunterrichtliches Pädgogisches Praktikum – umgesetzt werden.
Betrachtet man Anhänge 3 und 4 mit Blick auf die Realisierungsformen der Langzeitpraktika/Praxissemester, so ist wie beim Orientierungspraktikum eine gewisse terminologische Variation festzustellen. Der Begriff Praxissemester bzw. Schulpraxissemester wird in den Gesetzen und Verordnungen in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verwendet, wohingegen für Brandenburg von einem Schulpraktikum, für Hamburg von einem Kernpraktikum I und II (vgl. auch Weyland/Wittmann 2015, 13), für Mecklenburg-Vorpommern von einem Hauptpraktikum (Praktikumsordnung der Universität Rostock) bzw. von einem Schulpraktikum II (Praktikumsordnung der Universität Greifswald) und für Niedersachsen von einer Praxisphase mit Langzeitpraktikum als Praxisblock die Rede ist.
Unabhängig von der verwendeten Terminologie wird aus den Tabellen ersichtlich, dass es in Bezug auf den zeitlichen Umfang und folglich die vergebenen Leistungspunkte keine systematischen Übereinstimmungen beim Vergleich der Praktikumsarten untereinander gibt, wenngleich, wie bereits von Weyland/Wittmann (2015, 11) bemerkt, in den meisten Fällen z. B. für das Langzeitpraktikum ca. 30 Leistungspunkte angesetzt werden. Allerdings werden in Baden-Württemberg nur 16 Leistungspunkte, in Hessen 20 Leistungspunkte, in Bremen 24 Leistungspunkte, in Nordrhein-Westfalen 25 Leistungspunkte vorgesehen. Die angegebenen Leistungspunkte beinhalten auch die für die universitären Vor- und/oder Nachbereitungsveranstaltungen und Begleitseminare vergebenen Leistungspunkte, auch wenn nicht alle Verordnungen explizit darauf verweisen und die Verteilung der Leistungspunkte in der Regel nicht differenziert dargelegt wird. Allein im Fall Bremen wird die Verteilung der Leistungspunkte auf die Komponenten schulpraktischer Teil, Begleitung durch die Studienfächer und Begleitung durch die Erziehungswissenschaften auf dieser Ebene des rechtlichen Rahmens ersichtlich.
Mit Blick auf die bundesweite Situation der fachdidaktischen Praktika in den romanischen Sprachen lässt sich festhalten, dass bis 2025 die aus dem Bologna-Prozess resultierende Forderung nach einer Ausdehnung der Praxisphasen in 15 Bundesländern mit der Einführung von Praxissemestern bzw. der Entscheidung für ein Langzeitpraktikum besonderer Prägung umgesetzt worden ist. Es scheint, dass die Bundesländer mit Staatsexamen das mindestens dreiphasige Praktikumsmodell, bestehend aus mindestens drei kürzeren und/oder längeren Praxisphasen, beibehalten haben.
Ähnlich verhält es sich in Rheinland-Pfalz als einzigem Bundesland, das ausdrücklich für den Master nur ein vertiefendes Praktikum im Umfang von 15 Tagen vorsieht. Allerdings gehen bereits drei weitere Praktika im Umfang von je 15 Tagen, zwei orientierende Praktika und ein vertiefendes Praktikum im Bachelor, den Masterpraktika voraus. Schaeper (2008, 32) sieht hierbei das Praxisphasenmodell mit „Parallelstruktur von Theorie und Praxis“ verwirklicht, da hier Theorie und Praxis über das gesamte Studium verzahnt werden.
Was aus den Ausführungen und den Anhängen auch deutlich ersichtlich wird, ist die Tatsache, dass die Verordnungen und Gesetze in unterschiedlich ausführlicher Weise den Umfang und die Ausgestaltung der schulpraktischen Studien darlegen und somit der Rahmen, im dem sich die Universitäten qua Studien- und Prüfungsordnungen bewegen können, unterschiedlich eng gesteckt ist. Mit Blick auf die inhaltliche Ausgestaltung der Praktika im Allgemeinen und die Qualität fachdidaktischer Praxisphasen speziell auch in den romanischen Sprachen muss über diese Befunde hinaus berücksichtigt werden, dass es aktuell noch keine hinreichende empirische Forschungslage gibt (vgl. hierzu Kap. 1.2), die Evidenz für die besondere Wirksamkeit bestimmter Praxisformate erbringen würde, so dass die Präsenz oder Absenz eines Praxissemesters nicht mit einer Qualitätssteigerung- oder Minderung gleichgesetzt werden können und dürfen. Qualität und Wirksamkeit von Praxisphasen hängen zudem auch von der Ausgestaltung der universitären Begleitveranstaltungen und des Coachings ab, die in den Verordnungen, wenn überhaupt, nur zum Teil thematisiert werden (vgl. hierzu wiederum Kap. 1.2).
Anhang 1: Bundesländer mit Staatsexamen – mit fachbezogenem/fachdidaktischem Langzeitpraktikum besonderer Prägung im Studienverlauf (Stand 01/2025, exemplarisch für das Lehramt Gymnasium in mind. einer romanischen Fremdsprache i. A. gemäß der Länderverordnungen)
Bundesland
fachbezogene/fachdidaktische Praktika
orientierende, pädagogische/pädagogisch-didaktische Praktika bzw. Praktika im pädagogischen außerschulischen Kontext
Langzeitpraktika besonderer Prägung
Blockpraktika
Bayern
Ordnung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 13. März 2008
Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum
Umfang: ein Semester, einmal wöchentlich, mind. 4 Stunden Unterricht einschließlich Besprechung;
bezogen auf eines der gewählten Unterrichtsfächer
bzw. vertieft studierten Fächer; Begleitveranstaltung an der Universität (2 SWS)
Orientierungspraktikum
Umfang: 3 bis 4 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: vor Beginn des Studiums, spätestens aber vor Beginn des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums, in der vorlesungsfreien Zeit
pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum
Umfang: 150 bis 160 Unterrichtsstunden
Leistungspunkte: 6 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in zwei aufeinander folgenden Schulhalbjahren abzuleisten (d. h. ggf. über ein Semester hinweg); Voraussetzung für die Aufnahme des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums ist der Nachweis der erfolgreichen Ableistung des Orientierungspraktikums
Saarland
Ordnung der Schulpraktika für die Lehrämter an allgemein bildenden und beruflichen Schulen vom 1. Oktober 2021
semesterbegleitende fachdidaktische Schulpraktika jeweils für Fach 1 und Fach 2
Umfang: semesterbegleitend, an einem vom Zentrum für Lehrerbildung und dem Ministerium für Bildung und Kultur gemeinsam festzulegenden Wochentag
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: im 3. bis 5. Semester
fachdidaktische Praktika jeweils für Fach 1 und Fach 2
Umfang: je 4 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: nach dem jeweiligen semesterbegleitenden Praktikum, in der Regel nach dem 5., 6. oder 7. Semester in der vorlesungsfreien Zeit
bildungswissenschaftliches Orientierungspraktikum
Umfang: 5 Wochen (2 Wochen in einer Grundschule und 3 Wochen in einer Gemeinschaftsschule oder einem Gymnasium)
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: nach dem 1. oder 2.Semester in der vorlesungsfreien Zeit
Sachsen
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen im Freistaat Sachsen (Lehramtsprüfungsordnung I – LAPO I) vom 19. Januar 2022
„Schulpraktische Studien werden als Blockpraktika in der vorlesungsfreien Zeit und als semesterbegleitende Praktika durchgeführt. Mindestens zwei Blockpraktika und mindestens zwei semesterbegleitende Praktika werden inhaltlich durch die Grundschuldidaktik, Fachdidaktik, Berufsfelddidaktik oder die Förderschwerpunkte bestimmt. Mindestens ein Blockpraktikum ist inhaltlich auf die Bildungswissenschaften ausgerichtet.“ (§ 7 Abs. 2)
Gesamt-ECTS: 25 ECTS
Beispiel: Leipzig
Ordnung für schulpraktische Studien der Universität Leipzig vom 7. Januar 2021
(Typologie und Umfang analog für den Standort Dresden)
zwei schulpraktischen Studien als Gruppenpraktika (SPÜ)
Umfang: semesterbegleitend, einmal wöchentlich im Zeitraum April bis Juni und Oktober bis März
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 3.–6. Fachsemester
zwei fachdidaktische Blockpraktika
Umfang: je 4 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 6.–8. Fachsemester, in der vorlesungsfreien Zeit
bildungswissenschaftliches Blockpraktikum
Umfang: 4 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: vorlesungsfreie Zeit
Sachsen-Anhalt
Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an allgemein bildenden Schulen im Land Sachsen-Anhalt (1. LPVO – Allg. bild. Sch.) vom 26. März 2008
„zwei Schulpraktika von insgesamt mindestens acht Wochen Dauer mit einem Studienumfang von 15 LP “ (§ 26 Abs. 2 Satz 2)
Beispiel: Halle
Ordnung für die Durchführung der lehramtsspezifischen Praktika in den modularisierten Studiengängen für Lehrämter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 08. Juli 2009
Schulpraktische Übungen für jedes Fach
Umfang: 1 Semester, einmal pro Woche in Kleingruppen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: semesterbegleitend, in der Regel ab dem 3. Semester
Schulpraktikum 1 und 2
Umfang: je 4 Wochen
Leistungspunkte: 5 LP und 10 LP (für die Module)
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: je ab dem 4. bzw. ab dem 5. Semester in der vorlesungsfreien Zeit
Beobachtungspraktikum
Umfang: 2 Wochen
Leistungspunkte: 10 LP (für das Modul)
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der Regel während der vorlesungsfreien Zeit nach dem 1. Semester
Außerunterrichtliches pädagogisches Praktikum
Umfang: 2 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit
Leistungspunkte: 5 LP (für das Modul)
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: ab dem 4. Semester
Anhang 2: Bundesland mit M.Ed. – ohne Langzeitpraktikum (Stand 01/2025, exemplarisch für das Lehramt Gymnasium in mind. einer romanischen Fremdsprache gemäß der Länderverordnungen)
Bundesland
Fachbezogene/fachdidaktische Praktika im Hauptstudium
Orientierende, pädagogische/pädagogisch-didaktische Praktika bzw. Praktika im pädagogischen außerschulischen Kontext (ggf. anstatt eines der Orientungspraktika)
Blockpraktika
Blockpraktika
Rheinland-Pfalz
Landesverordnung über die Anerkennung von Hochschulprüfungen lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengänge als Erste Staatsprüfung für Lehrämter vom 12. September 2007
Vertiefendes Praktikum im Bachelor
Umfang: 15 Tage
Leistungspunkte: 4 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der Regel während der vorlesungsfreien Zeit nach dem Orientierenden Praktikum 2
Orientierendes Praktikum 1 im Bachelor
Umfang: 15 Tage, 15 Unterrichtsstunden pro Woche
Leistungspunkte: 3 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der Regel während der vorlesungsfreien Zeit nach dem 1. Semester des Bachelorstudiengangs
Vertiefendes Praktikum im Master
Umfang: 15 Tage
Leistungspunkte: 4 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der Regel während der vorlesungsfreien Zeit
Orientierendes Praktikum 2 (mit lehramtsspezifischem Schwerpunkt) im Bachelor
Umfang: 15 Tage, 15 Unterrichtsstunden pro Woche
Leistungspunkte: 3 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der Regel vor der Wahl des lehramtsspezifischen Schwerpunktes gemäß § 5 Abs. 3
Anhang 3: Bundesländer mit Staatsexamen – mit Langzeitpraktikum (Stand 01/2025, exemplarisch für das Lehramt Gymnasium in mind. einer romanischen Fremdsprache gemäß der Länderverordnungen)
Bundesland
fachbezogene/fachdidaktische Praktika im Hauptstudium
orientierende, pädagogische/pädagogisch-didaktische Praktika bzw. Praktika im pädagogischen außerschulischen Kontext
Langzeitpraktikum
Blockpraktika
Hessen
Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes (HLbGDV) vom 28. September 2011
Hessisches Lehrkräftebildungsgesetz (HLbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 2011
Praxissemester
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: zweite Hälfte des Studiums (also ab dem 4./5. Semester)
Grundpraktikum
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: erste Hälfte des Studiums
Mecklenburg-Vorpommern
Gesetz über die Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern. In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2014 (LehbildG M-V)
„In der Ersten Phase der Lehrkräftebildung absolvieren die Studierenden spätestens ab dem zweiten Semester Praktika mit einem Gesamtumfang von 15 Wochen, die mit 15 ECTS-Punkten als studentische Arbeitsbelastung angerechnet werden. Die Gestaltung kann auch als Langzeitpraktikum erfolgen. Die Schulen sind grundsätzlich dazu verpflichtet, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. “ (§ 7 Abs. 1)
Beispiel: Rostock
Praktikumsordnung für die Lehramtsstudiengänge der Universität Rostock
vom 08. März 2021
Hauptpraktikum
Umfang: 9 Wochen (am Stück oder in zwei Blöcken), 270 Arbeitsstunden, davon 20 Unterrichtsstunden
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der vorlesungsfreien Zeit, zwischen dem 4. und 9. Semester; Möglichkeit der Teilung in zwei Blöcke von je mind. 4 Wochen und ggf. auch Aufteilung auf zwei Schulen. Bei der Aufteilung in Blöcken muss ein Block in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
Sozialpraktikum
Umfang: 3 Wochen, 90 Arbeitsstunden
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der vorlesungsfreien Zeit, zwischen dem 1. und 4. Semester
Orientierungspraktikum
Umfang: 3 Wochen, 90 Arbeitsstunden
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der vorlesungsfreien Zeit, zwischen dem 2. und 6. Semester nach dem Sozialpraktikum und dem Besuch von semesterbegleitenden Vorbereitungsveranstaltungen
Thüringen (Jena)
Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (ThürEStPLGymVO) vom 9. Dezember 2008
Praxissemester
Umfang: werktägige Anwesenheit in der Praktikumsschule von mind. 5 Zeitstunden nicht unterschreiten
Leistungspunkte: 30 LP
Eingangspraktikum
Anhang 4: Bundesländer mit M.Ed. – mit Langzeitpraktikum (Stand 01/2025, exemplarisch für das Lehramt Gymnasium in mind. einer romanischen Fremdsprache i. A. gemäß der Länderverordnungen)
Bundesland
fachbezogene/fachdidaktische Praktika im M.Ed.
orientierende, allgemeine pädagogische(- didaktische) Praktika
Langzeitpraktikum
Blockpraktika
Blockpraktika
Baden-Württemberg
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) vom 27. April 2015
Schulpraxissemester
Umfang: 12 Wochen, 120 Stunden Unterricht, davon mind. 30 Stunden eigener Unterricht
Leistungspunkte: 16 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: Wintersemester
Orientierungspraktikum
Umfang: 2 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: Orientierungspraktikum als Studienvoraussetzung zusammen mit dem Lehrerorientierungstest; Absolvierung vor Studienbeginn oder bis spätestens zu Beginn des dritten Semesters
Berlin
Gesetz über die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Land Berlin (Lehrkräftebildungsgesetz – LbiG) vom 7. Februar 2024
Praxissemester
Umfang: 6 Monate
Leistungspunkte: 30 LP (insgesamt, beide Fächer und Erziehungswissenschaften)
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 2./3. Semester
berufsfelderschließendesPraktikum
Umfang: 6 Wochen
Brandenburg
Verordnung über die Anforderungen an das Lehramtsstudium an den Hochschulen im Land Brandenburg (Lehramtsstudienverordnung – LSV) vom 6. Juni 2013
Schulpraktikum
Umfang: mind. 16 Wochen
schulpraktische Studien – B.A.
Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern, die sich nicht auf den obligatorischen oder wahlobligatorischen Unterricht an Schulen beziehen
Umfang: insgesamt mind. 6 Wochen
Bremen
Gesetz über die Ausbildung für das Lehramt an öffentlichen Schulen (Bremisches Ausbildungsgesetz für Lehrämter – BremLAG) vom 16. Mai 2006
Praxissemester
Umfang: 16 Wochen
Leistungspunkte: 24 LP, zusammengesetzt aus 15 LP für den schulpraktischen Teil und je 3 für die Begleitung durch die beiden Studienfächer und die Erziehungswissenschaften
Orientierungspraktikum
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: vorlesungsfreie Zeit, nach dem 2. Semester
praxisorientierte Elemente
Umfang: 3 Wochen pro Fach
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: Schulpraxis in der vorlesungsfreien Zeit; ab dem 5. Semester
Hamburg
Bürgerschaft-Drucksache 18/3809 (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft) vom 28. Feburar 2006
Kernpraktikum I und II
(die Einteilung in Langzeitpraktikum und Blockpraktikum ist hier nicht sinnvoll möglich, da semesterbegleitende Phasen mit Schulbesuch einmal pro Woche mit Blockphasen von 4 bzw. 5 in vorlesungsfreien Zeit in komplexer Weise alternieren; Weyland/Wittmann (2015, 13) befürworten die Betrachtung der Kernpraktika in der Gesamtheit als Langzeipraktika, vgl. Anm. 3)
Orientierungspraktikum
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 3. Semester
Niedersachsen
Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen. In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2015
Praxisphase/Praktikum in beiden Unterrichtsfächern in der Sekundarstufe I und II
Leistungspunkte: mind. 19 LP entfallen im Master auf die Fachdidaktik und das Master-Praktikum; Weyland/Wittmann (2015, 13) geben hier 34 LP an, wie es an der Universität Osnabrück der Fall ist
Allgemeines Schulpraktikum
Leistungspunkte: insgesamt entfallen mind. 45 LP auf Bildungswissenschaften, das Betriebspraktikum und das allgemeine Schulpraktikum
Nordrhein-Westfahlen
Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 12. Mai 2009
Praxissemester
Umfang: 390 Zeitstunden innerhalb eines Schulhalbjahres, Dauer 5 Monate
Leistungspunkte: 25 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 2./3. Semester mit bildungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Vorbereitung
Eignungs- und Orientierungspraktikum
Umfang: 25 Tage; innerhalb von 5 Wochen während eines Schulhalbjahres
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 1. Semester, bildungswissenschaftlich oder fachdidaktisch begleitet
Schleswig-Holstein
Lehrkräftebildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) vom 15. Juli 2014
Praxissemester (LehrBG)
Praktika zur Berufsfelderkundung (LehrBG)
(ohne Weiterpräzisierung)
Beispiel: Kiel
Gemeinsame Prüfungsordnung (Satzung) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende der Zwei-Fächer-Bachelor- und Masterstudiengänge – 2017
(Zwei-Fächer-Prüfungsordnung – 2017) vom 1. März 2017
Schulpraktikum im Praxissemester (Masterpraktikum)
Umfang: 8 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: in der vorlesungsfreien Zeit nach einem verkürzten Wintersemester (im 2. Studienjahr)
Fachdidaktisches Praktikum
Umfang: 3 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: vorlesungsfreie Zeit eines Sommersemesters nach Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Praxismoduls 2 im 2. Studienjahr
Pädagogisches Praktikum
Umfang: 3 Wochen
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: vorlesungsfreie Zeit eines Sommersemesters nach Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Praxismoduls 1 im 1. Studienjahr
Beispiel: Flensburg
Ordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg zu den Schulpraktischen Studien für den Studiengang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts (Ordnung Schulpraktische Studien 2021) vom 4. Januar 2021
Praktikumsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg zum Praxissemester für die Studiengänge Lehramt an Grundschulen, Lehramt an Gemeinschaftsschulen, Lehramt an Gymnasien, Lehramt an Sekundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I sowie Lehramt an Sekundarschulen mit dem Abschluss Master of Education vom 25. Juni 2015
Praxissemester
Umfang: 10 Wochen
Leistungspunkte: 30 LP
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: 3. Semester
Fachdidaktisches Praktikum
Umfang: 3 Wochen
Leistungspunkte: 2,5 LP für den schulpraktischen Teil
zeitliche Einfügung in den Studienverlauf: im 3. oder 5. Semester
Orientierungspraktikum im erziehungswissenschaftlichen Theorie-Praxis-Modul
Umfang: 3 Wochen
Leistungspunkte: 3 LP für den schulpraktischen Teil
Anmerkung: Wo keine Zahl der Leistungspunkte angegeben ist, werden diese in den zitierten Dokumenten auf Landesebene nicht vorgegeben, sondern sind – sofern Leistungspunkte vergeben werden – nachgeordneten Dokumenten wie den Studien- und Prüfungsordnungen einzelner Universitäten zu entnehmen.
1.2Schulpraktika und Praxissemester: Forschungsstand mit Fokus auf den romanischen SchulsprachenLaura Kersten
Der Forschungsstand zu Schulpraktika und Praxissemestern in den romanischen Sprachen muss als in hohem Maße defizitär bezeichnet werden. Dennoch oder gerade deshalb soll die bisherige Forschung an dieser Stelle gewürdigt werden, um Schulpraktika in den romanischen Sprachen auf das Fundament des aktuellen Standes der Wissenschaft stellen zu können. Zugleich werden so Desiderata offensichtlich und es ergeben sich Anschlussstellen für künftige Forschungen.
In Nordrhein-Westfalen entstanden schon kurz nach Einführung des Praxissemesters im M.Ed. Mitte der 2010er Jahre zwei Beiträge, die im wesentlichen hochschuldidaktisch orientiert sind und Rahmenbedingungen wie auch die Anforderung des forschenden Lernens beschreiben. Die Beiträge Koch (2015) und Bürgel/Koch (2019) zur Gestaltung des Praxissemesters an der Universität Paderborn erweisen sich insofern als fruchtbar, als sie die Rolle der Fremdsprachendidaktik bei der Ausgestaltung der universitären Begleitung der Fachpraktika darlegen; es werden dabei zentrale Aspekte berührt, die auch im Zentrum der empirischen fremdsprachendidaktischen Praktikumsforschung in den romanischen Sprachen stehen (s. u. Abendroth-Timmer 2011, Frevel 2011, Abendroth-Timmer/Frevel 2013, Schädlich 2015, 2016, 2019, Bechtel/Mayer 2019a, 2019b, 2021, Mayer 2020b, Mayer/Rudolph 2021). Corinna Koch skizziert in ihrem Beitrag den Aufbau und Ablauf des fünfmonatigen Praxissemesters im zweiten Semester des Master of Education (Koch 2015, 88–90) und legt die damit verbundenen Herausforderung für die Fremdsprachendidaktik als Disziplin dar. Aus der Konzeption des Praxissemesters geht hervor, dass in den Praxiseinführungsveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit und in den Begleitseminaren während des Semesters sowohl die Fachdidaktiken der beiden studierten Fächer als auch die Bildungswissenschaften eingebunden sind. Das Lernen im Praktikum findet in Nordrhein-Westfalen an drei Lernorten, dem Lernort Universität, dem Lernort Schule und dem Lernort Zentrum für schulpraktische Lehrerbildung (Studienseminar/Fachseminar) statt, so dass das Lernen in den unterschiedlichen Kontexten verzahnt und koordiniert werden muss. Im universitären Kontext bilden Reflexion und forschendes Lernen den Wesenskern der Begleitseminare. Sie geht für ihre Untersuchung davon aus, dass im Sinne der Differenzhypothese von Arnold (2010, 72) die Abgrenzung unterschiedlicher Wissensarten und Wissensinhalte konstitutiv bei der Ausgestaltung der fremdsprachendidaktischen Begleitung vor und während des Praktikums ist, damit das Zusammenspiel der unterschiedlichen Wissensformen mit dem Ziel der Professionalisierung gefördert werden kann (Koch 2015, 91). Sie rekurriert hierbei auf das Modell von Weyland (2010 bzw. 2012), aus dem nicht nur die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Wissenssystemen ablesbar sind, sondern in dem durch die wechselseitige Bezogenheit der Wissenssysteme die Notwendigkeit erkennbar wird, besonders im Praxissemester durch eine reflexiv-forschende Ausrichtung das Bewusstsein für die Bedeutung, Funktion und Interaktion der Wissenssysteme zu fördern (Koch 2015, 91–94). Hierzu wird auf folgende graphische Darstellung (Abb. 1) Bezug genommen:
Bezugssysteme und Wissensformen erfolgreichen Lehrerhandelns (Weyland 2010, 320 nach Bayer et al. 1997, 8, zit. in Koch 2015, 92)
In dem Beitrag „Fachdidaktische Begleitforschung im Praxissemester an der Universität Paderborn: Ein Konzept für die Fächer Französisch und Spanisch“ fokussieren Bürgel/Koch 2019 den Aspekt des forschenden Lernens, der komplementär zur Reflexion gedacht werden kann. Das forschende Lernen ist curricular durch das fachbezogene Studien- oder Unterrichtsprojekt (SUP) im Studienverlauf implementiert (Bügel/Koch 2019, 80, 83). Dem forschenden Lernen kommt dabei die Aufgaben zu, Studierende dazu anzuleiten und zu befähigen, Wissensbestände – v. a. subjektives Wissen und subjektive Theorien – wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen und fachliche Wissensbestände systematisch im Rahmen der Entwicklung professioneller Reflexionskompetenz und professioneller Wahrnehmung einzusetzen (vgl. Bürgel/Koch 2019, 84–85; vgl. auch Bechtel/Mayer 2019, Kipf 2019, Schädlich 2019). Bürgel/Koch (2019, 87) beschreiben den Verlauf des forschenden Lernens im SUP, wie folgt (Abb. 2):
Forschendes Lernen im Praxissemester (Bürgel/Koch 2019, 87)
Themen, die von den Studierenden aus der Forschungsliteratur oder aus der eigenen Beobachtung als für den Fremdsprachenunterricht relevant erkannt werden, werden durch die Formulierung einer Forschungsfrage sowie untergeordneten Teilfragen und Hypothesen in ein Untersuchungsdesign überführt. Es können prinzipiell qualitative wie auch quantitative Daten erhoben werden (Bürgel/Koch 2019, 86–89). Wesentlich ist mit Blick auf Qualitätssicherung und der Förderung der Kompetenz zum forschenden Lernen, dass der Forschungsbericht, der neben der Analyse und Interpretation der Daten die Diskussion der Ergebnisse sowie das Ableiten von Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht vorsieht, durch ein Dossier begleitet wird, welches das individuelle Forschungscoaching dokumentiert. Ein exemplarisches Dossier besteht aus einer Tabelle mit Gütekriterien des empirischen Arbeitens, konkretisiert als Planungsschritte des fachbezogenen Studien- oder Unterrichtsprojekts, einer Gliederung des Forschungsberichts, einer Zusammenstellung von Gütekriterien zur Erstellung des Forschungsberichts im engeren Sinn und einem tabellarischen Beurteilungsbogen zum Forschungsbericht (Bürgel/Koch 2019, 89). Die umfassende Tabelle zu „Gütekriterien zur Überprüfung der Planungsschritte des SUP“ sowie der „Beurteilungsbogen zum Forschungsbericht“ sind im Anhang des Beitrags Bürgel/Koch (2019, 95–97) einsehbar und können ggf. auch in anderen Kontexten als nur in Nordrhein-Westfalen im längerfristigen fachdidaktischen Praktikum mit Gewinn eingesetzt werden.
Die empirische Forschung als solche, bezogen auf Praxisphasen in der ersten Phase der Lehramtsausbildung mit Fokus auf den romanischen Sprachen, ist derzeit überschaubar. Im engeren Sinne sind hier nur ausgewählte Studien von und aus dem Umfeld von Dagmar Abendroth-Timmer, Birgit Schädlich sowie Mark Bechtel und Christoph Oliver Mayer zu verzeichnen (s. u.). Die fremdsprachendidaktische evidenzbasierte empirische Praktikumsforschung knüpft ihrerseits an die bildungswissenschaftliche an, die sich bereits seit den 1950ern in diesem Bereich etabliert hat (Hascher 2012a, 90; Hascher 2012b, 111). Dass sich die empirisch ausgerichtete, romanistische fremdsprachendidaktische Praktikumsforschung im engen Sinn gemäß der Forschungslage erst seit etwa den 2010er Jahren in der Phase der Konstituierung befindet, dürfte unmittelbar mit der Tatsache in Verbindung stehen, dass es sich bei der romanistischen Fremdsprachendidaktik in Deutschland insgesamt um eine relative junge Disziplin handelt, von der man als wissenschaftliche Disziplin im eigentlichen Sinn erst seit den 1960er/1970er Jahren sprechen kann (vgl. Reimann 2023a, 28). Die Frage nach der Wirkung, der Wirksamkeit und vor allem nach den Wirksamkeitsbedingungen von Praktika ist eng mit der Frage danach verbunden, welche Wissensbestände, welche Art(en) von Wissen und welche Kompetenzen in (Fach-) Praktika im Rahmen des ersten Abschnitts der universitären oder hochschulischen Lehramtsausbildung vor dem Vorbereitungsdienst erworben werden sollen, welchen Beitrag Praktika im Rahmen der beruflichen Ausbildung bei der Entwicklung professioneller, im Sinn von lehrberufsspezifischer, Handlungskompetenz leisten können (sollen), wodurch sich professionelle Handlungskompetenz auszeichnet und in welcher Weise diese überhaupt erworben werden kann.
Professionelles pädagogisches Handeln zeichnet sich unter anderem durch die Fähigkeit aus, das eigene Tun im Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen reflektieren und pädagogische Regeln anwenden zu können sowie sich mit der aktuellen empirischen Forschung zu befassen, wodurch sich ein Prozess der Professionalisierung als lebenslanges Lernen auszeichnet. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Fokus in der empirischen Praktikumsforschung deutlich von der Art und Weise geprägt wird, wie Professionalität und Professionalisierung in unterschiedlichen Paradigmen, Diskursen und Ansätzen der Lehrer:innenbildung sowie -forschung konzeptualisiert werden und welche Vorstellung darüber vorliegt, an welchen Orten und in welcher Weise Professionalisierung stattfindet, welche Rolle den Hochschulen dabei zukommt und wie man das Verhältnis von Theorie und Praxis vor diesem Hintergrund charakterisiert.1 Die Wirksamkeit von Praxisphasen im ersten Abschnitt der Lehramtsausbildung wird also unter Berücksichtigung der „bildungstheoretische[n] Ausrichtung“ (Schädlich 2019, 8 sowie 8–30) der fremdsprachendidaktischen Professionsforschung daran bemessen, welchen Beitrag die Praxisphasen im Rahmen der Professionalisierung leisten können.
Aus der Perspektive der romanistischen Fachdidaktiken konstatiert Birgit Schädlich, dass es trotz der bildungspolitischen Tendenz zur Ausdehnung der Praxisphasen in der Phase der universitären Lehrer:innenausbildung (vgl. KMK 2005, 2; auch Bürgel/Koch 2019, 81) keine hinreichende empirische Grundlage gibt, die die grundsätzliche Wirksamkeit der Praxisformate belegen würde (vgl. Schädlich 2019, 75; vgl. König/Blömeke 2020, 173, Hascher 2014, Ulrich et al. 2020, Gröschener/Hascher 2019). Diese Aussage bezieht sich auf den Sachverhalt, dass Prognosen in Bezug auf die potentielle Wirksamkeit von Praxisphasen (jenseits der Operationalisierungsproblematik in Bezug auf die Konzepte Professionalisierung, Theorie und Praxis) von einer Vielzahl komplexer Faktoren und Faktorenzusammenhänge abhängen (vgl. Ulrich et al. 2020, Bucholz/Blömeke 2012) und letztendlich insgesamt nicht davon ausgegangen werden kann und darf, dass das Vorhandensein von Praxis automatisch Professionalisierung fördert. Bereits Weinert/Helmke (1996, 232) weisen darauf hin, dass die reine Unterrichtserfahrung in der Rolle als Lehrperson sich nicht automatisch in Wissen und Können transformiert, da kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Dauer der Berufstätigkeit von Lehrer:innen, dem Niveau ihres Expert:innenwissens und dem Unterrichtserfolg nachgewiesen werden konnte. Auch die Studie von Ronfeldt/Reininger (2012) belegt, dass die Dauer des Praktikums die Qualität des Lernerfolgs nicht bedingt, wohingegen die Qualität der Betreuung von Praktikant:innen insbesondere bei kürzeren Praktika die Wirkung der Praxisphasen positiv beeinflusst. Gleichzeitig liegt aktuell noch keine umfassende empirischer Forschung vor, die kurze und lange Praxisformate systematisch, auch mit Blick auf die qualitative Dimension und die Nachhaltigkeit2 der ermittelten Wirkung, in Beziehung setzen würde (vgl. Gröschner/Hascher 2019, 657, Ulrich et al. 2020, v. a. 9, 53).
Vor dem Hintergrund der Übereinkunft, dass Lernen im Unterricht sowie im Praktikum einerseits durch Merkmale der Lernsituation und des Lernkontextes – also den kontextuellen Ressourcen und Lerngelegenheiten – beeinflusst wird und anderseits davon abhängt, welchen Nutzen Lerner:innen/Praktikant:innen davon machen (können), lassen sich mögliche Wirkzusammenhänge durch das von Hascher/Kittinger (2014) für den Praktikumskontext adaptierte Angebots-Nutzungs-Modell3 skizzieren (NB: es liegt bisher keine Theorie des Lernens im Praktikum vor, vgl. Hascher/de Zordo 2015, 24). Wesentlich ist in diesem Zusammenhang v. a., dass der Erfolg bzw. die Wirksamkeit des Praktikums nicht ausschließlich auf der Basis der Merkmale des Praktikums vorhersagbar ist, sondern die Merkmale des Lernsettings ‚Praktikum‘ positiv wie negativ durch die begleitenden Lernangebote, aber auch durch deren Wahrnehmung und Nutzung auf der Seite der Praktikant:innen beeinflusst wird.4 Es zeigt sich mithin, dass die Frage nach der Wirksamkeit von Praktika weder auf theoretischer noch auf empirischer Ebene ohne Weiteres beantwortet werden kann, da man es mit komplexen Bedingungs- und Wirkungsgefügen zu tun hat und es somit einer empirischen Praktikumsforschung bedarf, die nicht nur die Lernergebnisse, sondern auch besonders die (individuellen) Lernprozesse sowie Lernervariablen untersucht (vgl. Gröschner/Hascher 2019, 656, Grassmé et al. 2018, Schöning et al. 2024).
Das Angebot-Nutzungs-Modell wird in der aktuellen Forschung immer wieder dazu herangezogen, um das Forschungsfeld ‚Praktikum‘ zu strukturieren und bereits erbrachte Forschungsbefunde durch In-Bezug-Setzung zu diesem Modell zu verorten. Beispielsweise macht sich auch der bildungswissenschaftlich ausgerichtete Überblick von Ulrich et al. (2020) über die Ergebnisse der empirischen Praktikumsforschung zwischen 2010 und 2019 das Angebots-Nutzungs-Modell zu eigen, um Forschungsbefunde zu gruppieren. In der Abb. 3 werden entsprechende Variablen und ihre Realisierungen exemplarisch auf der Basis der Ausführungen in Ulrich et al. (2020, 18–51) zusammengefasst, so dass man einen Eindruck davon bekommt, welche Bereiche in der rezenten Praktikumsforschung bezogen auf Langzeitpraktika von vorrangiger Bedeutung sind:
Output-Variable
kognitive Lernerträge z. B.
Wissen (mittels Testverfahren)
Unterrichtswahrnehmung (mittels Beobachtung)
Kompetenzentwicklung und Selbstwirksamkeit (mittels Selbsteinschätzung im Fragebogen)
berufliche Eignung/Berufswahl
studentische Reflexion
Bewertung von (konstruierten) Dilemmata aus dem Unterrichtalltag
Wahrnehmung des Lehramtsstudiums
Bewertung des Praktikums als Fazit/Ergebnis (nicht Wirkung im engen Sinn) des Praxissemesters
Individualfaktoren
emotionale Aspekte wie Freude und Belastungsempfinden
Professionalisierungsverständnis
Umfang mit (negativem) Feedback
Prozess-Variablen
Bedeutung der Betreuung der Studierenden
Feedbackeinflüsse von Mitstudierenden und Schüler:innen
Input-Variable
pädagogische Vorerfahrungen
Vorwissen
Lernziele der Studierenden
Auswirkungen institutionalisierter Schulwechsel in der Praxisphase
Überblick im Anschluss an Ulrich et al. 2020, 18–51
Gröschner/Hascher (2019) fokussieren in ihrem auf Studierende bezogen Überblick zur empirischen Forschung die outputbezogene Dimensionen von Lernertrag. Diese können in folgender Tabelle (Abb. 4) zusammengefasst werden (vgl. Gröschner/Hascher 2019, 656, dort mit weiterführenden Verweisen auf einzelne Studien):
Wissen
pädagogisches Unterrichtswissen
bildungswissenschaftliches Wissen
Wissen über produktive Unterrichtsproduktion
professionelle Unterrichtswahrnehmung
bildungswissenschaftliche Kompetenzeinschätzung
Kompetenzen
Planungskompetenz
Analysefähigkeit
Reflexionskompetenz
Motivation
Selbstwirksamkeit/Selbstkonzept
Emotions-, Belastungs- und Beanspruchungserleben
Motivation, Interesse, Berufswahl und Eignungsabklärung
Einstellungen
Verhältnis von Theorie und Praxis
Überblick im Anschluss an Gröschner/Hascher 2019, 656
Die beiden Tabellen zur Skizzierung des Forschungsfelds ‚empirische Praktikumsforschung‘ basierend auf Ulrich et al. (2020) und Gröschner/Hascher (2019) sind hier in dieses Kapitel aufgenommen worden, um im Folgenden zu erläutern, weshalb bildungswissenschaftliche Praktikumsforschung – obwohl die empirischen Bildungswissenschaften wesentliche Bezugswissenschaften der romanistischen Fremdsprachendidaktik darstellen (siehe Reimann 2023a, 53) – nicht ausreicht, um spezifische Fragestellungen der romanistischen Fremdsprachendidaktik zu den Fachpraktika zu beantworten. Aus fachdidaktischer Perspektive stehen sich innerhalb des ersten Abschnitts der Lehramtsausbildung, wie in Kapitel 1.1 ersichtlich geworden, im Wesentlichen Praktika mit orientierender und allgemein pädagogischer Ausrichtung sowie Fachpraktika bzw. Praktika mit fachdidaktischer Komponente gegenüber. Da zum Beispiel spezifisch fremdsprachendidaktisches Wissen oder besondere fremdsprachendidaktische Kompetenzen in der bildungswissenschaftlichen Praktikumsforschung nicht berücksichtigt werden (s. o., Abb. 3 und 4), lassen sich aus der bildungswissenschaftlichen Forschung beispielsweise keine Antworten auf die Frage ableiten, inwiefern allgemein pädagogische Praktika zur Entwicklung fremdsprachendidaktischer Kompetenzen beitragen oder ob Fachpraktika zwangsläufig die Steigerung von fremdsprachendidaktischen Kompetenzen herbeiführen.
Da eine (romanistisch-) fremdsprachendidaktische Perspektive in der Praktikumsforschung primär durch die Tatsache erschwert wird, dass es zu definieren gilt, worin das genuin Fremdsprachendidaktische besteht, haben es sich die im engeren Sinn empirischen Studien von Abendroth-Timmer (2011), Frevel (2011), Abendroth-Timmer/Frevel (2013), Schädlich (2015, 2016, 2019) und Mayer (2020b) zur Aufgabe gemacht, in einem ersten Schritt die Bereiche/Output-Variablen ‚Wissen‘ und ‚Kompetenz‘ mit Schwerpunkt ‚Reflexionskompetenz‘ für die Fremdsprachendidaktik zu operationalisieren bzw. mit inhaltlichen Anforderungen zu füllen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Studien zusammengefasst. Dabei wird mit Schädlich (2019) begonnen, da in dieser das Verhältnis von Wissen und Kompetenz durch die Einführung des Konzepts der „Reflexiven Handlungskompetenz“ besonders deutlich hervorgehoben wird, wohingegen in den Arbeiten von bei Abendroth-Timmer (2011) und Abendroth-Timmer/Frevel (2013) v. a. Reflexionskompetenz auch in Verbindung mit dem beruflichen Selbstbild5 in den Vordergrund rückt.
Die in der Monografie Fremdsprachendidaktische Reflexion als Interimsdidaktik. Eine Qualitative Inhaltsanalyse zum Fachpraktikum Französisch (Schädlich 2019) ausführlich dargelegte qualitative Studie, die an Schädlich (2015 und 2016) anknüpft, befasst sich dezidiert mit der Art und Weise, in der fremdsprachendidaktisches Wissen und somit Wissen, das sich nicht nur auf die Gestaltung von Unterricht an sich, sondern auf die Gestaltung von Unterricht hier speziell im Fach Französisch bezieht, genutzt wird. Die Studie bezieht sich dabei auf fünfwöchige Praktika, die in der vorlesungsfreien Zeit zwischen den Semestern stattfinden. Das Praxismodul des Master of Education der Universität Göttingen erstreckt sich insgesamt über zwei Semester, im Verlauf des Moduls wird zusätzlich ein Portfolio erstellt (Schädlich 2019, 117). Zentral ist die Denkfigur der „reflexiven Handlungskompetenz“, die definiert wird als die Fähigkeit „Französischunterricht vor dem Hintergrund fachdidaktischer und curricularer Texte zu planen und zu reflektieren und dabei die Relevanz dieser Texte für die individuellen und komplexen Erfahrungen in der Praxissituation ‚Fachpraktikum‘ zu explizieren“ (Schädlich 2019, 100).
In der Studie wurden die Kategorien „Fertigkeiten/Kompetenzen“, „Unterrichtsgespräch/Interaktion“, „Stimmigkeit der Unterrichtsplanung“, „Schülerorientierung“, „Methodenkenntnis“, „Inhaltsorientierung/Material“, „Kompetenzorientierung“ und „Aufgabenorientierung“ erfasst (Schädlich 2019, 141), in denen Reflexion als (ein) Indikator für Professionalisierung bei Studierenden mit Blick auf unterrichtliches Handeln zum Tragen kommt. Schwerpunktmäßig geht es dabei um die Präsenz und Absenz dieser Wissensbestände in den studentischen Reflexionen (reflection on action, also im Nachhinein, nicht reflection in action wie u. a. bei Frevel 2011, Abendroth-Timmer/Frevel 2013), die Qualität der Reflexionen – erfasst durch die Kategorien „einperspektivisch-linear“ versus „mehrperspektivisch-zyklisch“; „spontan“, „auf Nachfrage“, „abwesend“ (Schädlich 2019, 141) –, aber auch um die Bedeutsamkeit von fachdidaktischem Wissen im Zusammenhang mit Professionalisierung insgesamt. Durch die fremdsprachendidaktische Wissenskomponente wird die Rückbindung an fachspezifische Aspekte des Faches Französisch gewährleistet und somit über allgemeine, nicht fachbezogene pädagogisch-didaktische Reflexionen, hinausgegangen (zur Notwendigkeit der inhaltlich-fachlichen Spezifizierung von Reflexionskompetenz, um diese vermitteln und bewerten zu können, siehe vertiefend Häcker 2019, v. a. 81–84, 88–90).
In ihrer Untersuchung konnte Schädlich herausarbeiten, dass das Praxissemesterformat an sich die Entwicklung von reflexiver Handlungskompetenz zum Teil fördern kann bzw. fachdidaktische reflexive Handlungskompetenz bei den Praxissemesterstudierenden beobachtet werden kann.6 Es wird jedoch deutlich, dass die subjektive Erfahrung den jeweiligen Ausgangspunkt für Reflexion und den Einbezug des theoretischen fachdidaktischen Wissens bildet. Weiterhin war erkennbar, dass auf diese Wissensbestände v. a. im Zusammenhang mit konkreten, unterrichtsplanerischen Belangen rekurriert wurde (Schädlich 2019, 195), somit abstraktere fachdidaktische Wissensbestände seltener und in oftmals eher einperspektivisch-linear ohne Rückbindung an konkrete Erfahrungen eingebracht werden (Schädlich 2019, bes. 94–95, 188–185). Überdies beobachtet man auch v. a. in Bezug auf die Schüler:innenorientierung, Kompetenzorientierung und Handlungsorientierung eine Diskrepanz zwischen der Fähigkeit, der Dimension der Schüler:innenorientierung in den Reflexionen Rechnung zu tragen, und jener, diese handelnd umzusetzen (Schädlich 2019, u. a. 240–242). Die Ergebnisse sind mit Blick auf die Wirksamkeit von Fachpraktika insofern bedeutsam, da aus der Studie deutlich hervorgeht, dass reflexive Handlungskompetenz nur in Bezug auf konkrete Erfahrung existieren kann und somit nicht an sich von einer allgemeinen reflexiven Handlungskompetenz die Rede sein kann, mithin Theorie nur dann greift, wenn sie in der praktischen Erfahrung verortet werden kann (vgl. Helsper 1996, Nöll 2002, Schädlich 2019, u. a. 312).
Die Konstruktlogik des Konzepts der reflexiven Handlungskompetenz schließt mit ein, dass sich reflexive Handlungskompetenz sukzessive entwickeln kann, also innerhalb eines Individuums auch je nach Erfahrungsbereich in qualitativ unterschiedlicher Form vorliegen und dabei fachdidaktische Inhalte auch in qualitativ unterschiedlicher Weise inkorporieren kann. Schädlich (2019, u. a. 95–96) schlägt um diesen Sachverhalt erfassen zu können hierfür den Begriff der Interimsdidaktik vor: