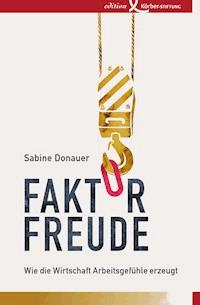
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Körber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Discounter bis zur Großbank: Jeder Job verspricht heute Bestätigung weit über die Bezahlung hinaus. Die Aussicht auf Anerkennung und Selbstverwirklichung ersetzt oft genug gesicherte Arbeitsverhältnisse und muss Erschöpfungszustände kompensieren. Die Historikerin Sabine Donauer weist nach, wie sich im 20. Jahrhundert unsere Haltung zur Arbeit verändert hat: Aus dem notwendigen Broterwerb wurde mehr und mehr eine innerlich motivierte und motivierende Beschäftigung. Diese Aufwertung der Arbeitsgefühle entspringt, wie Donauer nachweisen kann, einer geschickten Gefühlsarbeit der Unternehmen: Weil es ihnen im Laufe der letzten 100 Jahre gelungen ist, die Arbeitnehmer emotional an ihre Arbeit zu binden, haben sie höhere Leistungen erreicht und Arbeitskämpfe weitgehend vermieden - ohne mehr bezahlen zu müssen. Jedoch zu einem hohen Preis, denn die Kehrseite dieses Individualismus ist die weitreichende Entsolidarisierung der Arbeitnehmer und ein übermächtiger Konkurrenzdruck. Gibt es einen Ausweg aus dieser Wachstumsspirale von Leistung, Lust und Frust? Weniger ist mehr, wenn es uns gelingt, unsere Konsumkultur in eine Kultur des Zeitwohlstands zu verwandeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für M.
»Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel, sondern wir schaffen sie selbst; sie liegt in unseren Herzen eingeschlossen.«
Fjodor Dostojewski
Prolog
Keynes und seine Enkel
Im Jahr 1930 befasste sich der britische Ökonom John Maynard Keynes mit einem für einen Ökonomen recht untypischen Thema. In seinem Aufsatz Die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkel ging es Keynes um nichts Geringeres als die wohlbegründete Spekulation darüber, wie es um die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestellt sein könnte. Für die Generation seiner Enkel – also uns – sah er eine denkwürdige Zukunft:
Bis in hundert Jahren würde die Menschheit ihr »ökonomisches Problem« gelöst haben. Unter jenem ›Problem‹ verstand Keynes die Notwendigkeit, durch Arbeit für die eigene Lebensgrundlage zu sorgen. Nahrung, Kleidung, Behausung in menschenwürdigem Maße würden im Jahr 2030 durch maximal drei Arbeitsstunden am Tag gesichert sein. Dank eines kontinuierlichen technischen Fortschritts – Keynes dachte hier vor allem an eine Automatisierung der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung – würden seine Enkel nur noch ein Viertel des Aufwandes betreiben müssen, um ihre Existenz zu sichern. Die Sechzigstundenwoche der 1930er Jahre würde auf eine Fünfzehnstundenwoche schrumpfen.
Keynes wusste freilich, dass ein solch epochaler Wandel mehr bedurfte als technischer Innovation und der Steigerung von Produktivitätsraten. Wie alle Ökonomen seiner Zeit war auch er kein reiner Zahlenfuchs, sondern ebenso Philosoph wie Historiker. Dank seiner universalistischen Ausbildung in Cambridge und seines besonderen Gespürs für die Eigenheiten der menschlichen Spezies wusste er um die potenziell unersättliche Natur menschlicher Bedürfnisse. Diese teilte er in zwei Kategorien ein: in absolute Bedürfnisse, die den Menschen immer begleiten, wie das Grundbedürfnis nach Nahrung, Wärme oder einer Behausung; und in relative Bedürfnisse, deren Befriedigung in erster Linie dazu dient, sich seinem Nachbarn gegenüber erhaben zu fühlen. Stets unstillbar, sind Letztere auch der Motor für all die Bemühungen, immer mehr Geld anzuhäufen. Was die absoluten Bedürfnisse betraf, war Keynes optimistisch: Sie würden durch den Fortschritt bald für jedermann abgedeckt sein, worauf sich die Menschen nicht wirtschaftlichen Aktivitäten hingeben könnten.
Eine Fünfzehnstundenwoche würde natürlich voraussetzen, dass wir Enkel mit unserer neu gewonnenen Freiheit umzugehen wüssten. Freie Zeit – und hier war Keynes sicher nicht naiv – war ein Mysterium, Faszinosum und Tremendum zugleich, denn: Die Menschen, so wusste Keynes, waren viel zu lange darauf hin trainiert worden, nach neuen Einkommenszuwächsen zu streben. Würden sie in der Lage sein, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen, die freie Zeit zu füllen, sich sinnvoll zu beschäftigen, anstatt unaufhörlich und immer mehr materielle Güter anzuhäufen?
Dazu müsste sich aber die Mentalität der Menschen verändern, insbesondere ihre Beziehung zum Geld. Denn der Wandel steht und fällt für Keynes damit, wie der Mensch sein Verhältnis zum Geld austariert: Wenn der Mensch seine »Liebe zum Geld« (»the love of money«) nicht aufzugeben bereit ist, wird er unweigerlich unfrei und zur ewigen Unruhe verdammt bleiben. Gelingt es ihm hingegen, Geld als das zu sehen, was es ist, ein Behelf, um sich die notwendigen ›Lebensmittel‹ einzukaufen, würde der Mensch befreit werden, befreit vom Zwang, mehr zu verdienen und die Nachbarn mit immer neuen Konsumgütern zu übertrumpfen.
»Natürlich«, mutmaßt Keynes über die Zeit seiner Enkel, »wird es immer noch viele Menschen geben, die blind Wohlstandsgewinne jagen, bis sie einen plausiblen Ersatz hierfür finden. Aber der Rest von uns wird nicht mehr dazu gezwungen sein, ihnen zu applaudieren und sie darin zu bestärken. Wir werden stattdessen jene höchst angenehmen Menschen ehren, die uns beibringen, das Vorhandene unmittelbar zu genießen.«
»Es wird ein Bedürfnis daher nicht sowohl von denen,
welche es auf unmittelbare Weise haben,
als vielmehr durch solche hervorgebracht,
welche durch sein Entstehen einen Gewinn suchen.«
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Ein Vierteljahrhundert bevor Keynes seine Gedanken über die Zukunft seiner Enkel zu Papier gebracht hatte, machte sein Zeitgenosse, der deutsche Nationalökonom Max Weber, die bemerkenswerte Beobachtung, dass deutsche Fabrikarbeiter bei jeder Erhöhung des Stücklohnes früher nach Hause gingen. Sie entschieden sich also für mehr freie Zeit, anstatt den erhöhten Stücklohn bei gleicher Arbeitszeit in ein höheres Entgelt zu verwandeln. Mit solchen Arbeitern war kein Kapitalismus zu machen. Für eine Wirtschaftsform, die auf Wachstum ausgerichtet war, sei es nötig, die Arbeiter einem »Erziehungsprozess« zu unterwerfen, notierte Max Weber im Jahr 1905 in seinem Hauptwerk Die Protestantische Ethik oder der Geist des Kapitalismus1. Ihnen müssten die »rechte Gesinnung« und ein »Verantwortlichkeitsgefühl« für einen wachstumsorientierten Produktionsprozess erst anerzogen werden. Ohne diese, erkannte er, waren kapitalistische Steigerungsraten unmöglich.
Die Arbeiter zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts aber kamen aus einer anderen Welt: Sie waren vor der deutschen Industrialisierung in Verhältnissen groß geworden, in denen sie ihr ›Tagwerk‹ in Handwerksbetrieben oder in der Landwirtschaft vollbracht hatten. Ein Schmied musste nicht jährlich mehr Pferde beschlagen, als im Dorf tatsächlich zur Verfügung standen. Ein Knecht musste nicht jedes Jahr mehr Felder bestellen, gab es doch ohnehin nur die begrenzten Flächen des bäuerlichen Betriebs. Ein Auskommen zu haben – darin bestand der Sinn der täglichen Arbeit in dieser vorindustriellen Welt. War das Feld erst bestellt, konnte man getrost nach Hause gehen und sich im wahrsten Sinne des Wortes Müßiggang ›leisten‹.
Aus ebendieser bedächtigen Kreislaufwirtschaft wechselten Webers Arbeiter am Ende des 19. Jahrhunderts in eine Welt der Fabriken, die kein begrenztes Tagwerk mehr erforderte, sondern eine beständige Steigerung: schnellere Abläufe, höhere Stückzahlen, flinkere Handgriffe – am besten Jahr um Jahr. Als Anreiz wurden dafür höhere Löhne ausgezahlt. Aber die Fabrikbesitzer mussten sich doch so einiges einfallen lassen, bis die Arbeiter diese höheren Löhne auch zum Anlass nahmen, tatsächlich länger an der Werkbank zu stehen. Warum sollten sie auch mehr Zeit als zum Überleben nötig in die Erwerbstätigkeit stecken?
Heute, über hundert Jahre nach Max Webers Beschreibung der ländlich geprägten Arbeiter mit der hohen Freizeitpräferenz, finden wir bemerkenswerterweise das umgekehrte Phänomen: Menschen bleiben bis weit nach Feierabend in ihren Büros und an ihren E-Mail-Eingängen sitzen, ohne durch ein zusätzliches Entgelt dazu motiviert werden zu müssen. Diese modernen ›Helden der Arbeit‹ leisten unbezahlte Überstunden, und nicht wenige fühlen sich gut dabei. Während Max Webers Fabrikarbeiter zum Ärger der Fabrikherren bereits eine Minute vor Arbeitsschluss am Fabriktor standen, um dem verhassten Unternehmer keine Sekunde ihres Feierabends zu schenken, lassen heutzutage in Deutschland Millionen Arbeitnehmer ihre Mittagspausen und Feierabende ausfallen, um ein dringendes Projekt innerhalb der ›Deadline‹ zu Ende zu bringen. Ansonsten würde sie ein schlechtes Gewissen plagen. Sie tun dies nicht einmal innerhalb des Achtstundentages, der in der Weimarer Republik von der Arbeiterbewegung erkämpft wurde. Die Angestellten des neuen Jahrtausends arbeiten »freiwillig« länger, und dank der Segnungen des Smartphones gern auch am Wochenende oder im Urlaub. In einem Spiegel-Interview antwortete unlängst der Arbeitspsychologe Matthias Burisch auf die Frage, ob all das arbeitsbedingte Mail- und Internet-Checken wirklich nötig sei: »Viele, die am Handy hängen, wissen mit sich sonst einfach nichts mehr anzufangen. Ich sehe etwa in Flughäfen ganz selten Geschäftsleute, die einfach mal nichts tun – und damit Zeit haben nachzudenken.«
Max Webers Fabrikarbeiter um 1900 sehnten sich nach mehr freier Zeit. Aus Arbeiterinterviews der Jahrhundertwende wissen wir von den mannigfachen Interessen vieler Metalldreher oder Schlosser. In ihrer Freizeit betrieben sie Astronomie, pflegten einen eigenen kleinen Acker, bildeten sich als Botaniker weiter oder verbrachten ihre Abende mit dem Arbeitertheater. Nicht wenige gaben ihren Zwiespalt zu Protokoll, so gerne zu lesen, dass sie die halbe Nacht wach blieben und am nächsten Tag in der Fabrik nie ausgeschlafen waren. Bei dieser Arbeitermentalität hatte Keynes allen Grund zu der Annahme, dass jeder Produktivitätszuwachs auch in Zukunft von den Arbeitnehmern in freie Zeit umgemünzt werden würde. Heute aber brennen nachts die Lichter nicht in den heimischen Lesestuben, sondern in Firmenbüros. Arbeits-E-Mails werden oft auch noch nach Mitternacht verschickt. Die Deutschen leisten sogar die meisten Überstunden im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn. Der EU-Sozialkommissar László Andor stellte im Herbst 2014 fest: »In keinem Land der Euro-Zone gibt es einen so großen Unterschied zwischen der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit und der tatsächlichen Wochenarbeitszeit wie in Deutschland.«
Die meisten dieser Überstunden werden unbezahlt und ohne einen Freizeitausgleich geleistet. Dabei hat sich die Produktivität der deutschen Arbeitnehmer pro Arbeitsstunde allein zwischen 1975 und 2014 verdoppelt.2 In diesem Zeitraum stagnierten zugleich die Reallöhne oder sind gesunken. Der Deutsche arbeitet also seit vier Jahrzehnten deutlich mehr, für weniger Geld und ohne Unmutsbekundungen.
Was ist passiert zwischen 1905 und 2015? Warum sind wir nicht Keynes’ Enkel geworden?
Arbeitsgefühle – Gefühlsarbeit
»Der Kapitalismus tritt den Menschen nicht entgegen,
so dass sie sich Aug in Aug mit ihm auseinandersetzen könnten.
Vielmehr befindet er sich in ihnen und lebt durch sie.
Erst durch ihr Denken, Fühlen und Handeln wird er existent. Würden die Menschen anders denken,
fühlen und handeln, gäbe es ihn nicht.«
Meinhard Miegel
Nicht durch Zufall ist aus einer Mehrheit an widerständigen, streikenden, freizeitaffinen Arbeitern im Laufe der letzten hundert Jahre eine beflissene, hochproduktive Arbeitsbevölkerung geworden. Dieser enorme Zuwachs an Leistungsbereitschaft kann nicht dadurch erklärt werden, dass die Arbeitnehmer mehr verdienen und deshalb auch mehr zu leisten bereit sind. Die ernüchternden Zahlen der Einkommensstatistik erteilen diesem Erklärungsansatz eine klare Absage. Vielmehr ist der Schlüssel zu dieser bemerkenswerten Aufopferungsbereitschaft im Job in einem gewandelten Verständnis der Arbeit selbst zu suchen. Vor hundert Jahren auf das Thema Arbeit angesprochen, wäre ein Arbeiter vermutlich vor allem auf zweierlei zu sprechen gekommen: das leidige ›Malochen‹ und den Kampf gegen die Unternehmerschaft, der sich auf den viel zitierten ›Klassenhass‹ gründete. Die Arbeiter lebten im beständigen Gefühl, durch ihre harte Arbeit Unternehmensgewinne zu erwirtschaften, an denen sie schließlich nicht beteiligt wurden.
Heutige Umfragen zum Thema Arbeit fördern ein ganz anderes Verhältnis zum Erwerbsarbeitsplatz zutage: Viele, insbesondere jüngere Arbeitnehmer wollen vor allem ›Spaß bei der Arbeit‹ haben. Sie suchen im Job nach ›Selbstverwirklichung‹ durch neue, spannende Herausforderungen und erwarten ein motivierendes Arbeitsumfeld. Die Kette jener Begriffe, die Menschen gewohnheitsmäßig mit dem Thema Arbeit assoziieren, hat sich, so scheint es, im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts komplett gewandelt: Statt der Arbeitslast steht nun die Arbeitslust im Vordergrund.
Will man den Verheißungen postmoderner Stellenanzeigen und Karriereratgeber folgen, so liegt in der Erwerbsarbeit die Quelle persönlicher Entwicklung und Entfaltung. Ein erfülltes Arbeitsleben wird heute als unbedingte Voraussetzung eines gelungenen Lebens präsentiert. Adressaten dieser enormen Glücksversprechen sind vom Berufseinsteiger bis zum ›Professional‹ alle Arbeitssuchenden: So verspricht BMW seinen künftigen Auszubildenden: »Egal, für welchen Beruf du dich entschieden hast – TaLEnt macht die Ausbildung bei der BMW Group sehr vielseitig und wertvoll für deine persönliche Entwicklung.« Ähnlich wirbt auch DHL für ein Traineeship: »Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern nicht nur anspruchsvolle Aufgaben, sondern auch vielfältige Chancen für Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Wir bestärken Sie fortwährend darin, Ihr Potenzial auszuschöpfen und sich weiterzuentwickeln. Davon profitieren nicht nur wir als Unternehmen, sondern vor allem die Mitarbeiter selbst.« Und auch die Unternehmensberatung BCG lockt die Consultants in spe mit dem Versprechen: »Sie werden nicht wachsen, wenn Sie jeden Tag nur das tun, was Sie schon können. Sondern nur, wenn Sie Ihre Grenzen überwinden. Das ist der Grund, warum Sie bei BCG mehr erreichen können. Nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für sich selbst.«
Nun ist erst einmal nichts Schlechtes daran, wenn der Arbeitsplatz in einem recht freundlichen Licht und mit positiven Emotionen ausgestattet daherkommt. Wer wünscht sich schon die Zeiten zurück, in denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer hasserfüllt gegenüberstanden und Streiks durch Werkspolizisten niedergeschlagen wurden? Wenn Arbeitnehmer ›Spaß im Job‹ erwarten und Arbeitgeber selbigen versprechen, klingt das nach einer Win-win-Situation.
Dass Arbeitnehmer in dieser schönen neuen Arbeitswelt in den vergangenen hundert Jahren jedoch auch etwas verloren haben, ist der Gegenstand dieses Buches. Die wachsende Emotionalisierung des Arbeitsverhältnisses ist kein Zufall, und sie hat ihren Preis.
Erste Ideen, wie man dem allgegenwärtigen ›Klassenhass‹ gezielt ein emotional positives Erwerbsverhältnis entgegensetzen konnte, kamen vor über hundert Jahren auf. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg lenkte die Management-Zeitschrift Organisation die Aufmerksamkeit ihrer Leser aus dem Unternehmerkreis darauf, wie wichtig das »Interesse der Angestellten am Geschäft« und deren »Liebe zum Beruf« für den Unternehmenserfolg seien. Arbeitnehmer sollten sich idealerweise »durch Bande, wie sie langjährige Beziehungen herausbilden, mit dem Unternehmen eng verknüpft fühlen«. Befehle und die Androhung von Disziplinarmaßnahmen sollten nun der Vergangenheit angehören, stattdessen forderten die Diskussionsbeiträge in der Zeitschrift indirekte Leitungstechniken. Man empfahl dem Chef ein »leutseliges Wesen« und die stets »achtungsvolle Behandlung« des Personals, ebenso Taktgefühl wie auch »aufmunternde Worte und gelegentliche Anerkennung«, die besser wirkten als »das beliebte Straffspannen der Zügel«.3 Die Unternehmerschaft erkannte die Gefühle ihrer Mitarbeiter ab dem frühen 20. Jahrhundert immer mehr als ›Ressource‹, die es klug zu nutzen galt. Streikende, bummelnde oder sabotierende Arbeiter bedeuteten hohe Verluste in den Bilanzbüchern der Unternehmen. Engagierte, interessierte und idealerweise begeisterte Mitarbeiter jedoch konnten den entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Firma erbringen.
Diese Erkenntnis war der Startschuss für das unternehmerische Gefühlsmanagement: Als die Unternehmen das enorme ökonomische Gewicht der Gefühle ihrer Arbeiter wahrnahmen, begannen sie gezielt, diese Ressource zu ›bewirtschaften‹. Jahrzehnte bevor das Wort ›Humankapital‹ zu einem Begriff (und schließlich zum Unwort des Jahres 2005 gewählt) wurde, investierten Unternehmen in genau das: in die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter, nicht nur durch ihre handwerklichen Fertigkeiten, sondern auch durch ihre innere Haltung der Firma zum Erfolg zu verhelfen.
Dieser unternehmerische ›Bedarf‹ – eine Arbeiterschaft zu formen, die täglich Arbeitsfreude statt Ressentiments zum Einsatz brachte – erzeugte eine eigene Disziplin: die Arbeitswissenschaften. Seit dem frühen 20. Jahrhundert entwickelten Arbeitsphysiologen, Betriebssoziologen, Arbeitspsychologen und (näher an unserer Gegenwart) HR- und ›Feel-Good‹-Manager Konzepte, wie man den lustlosen Entgeltempfänger in jemanden verwandeln konnte, der sich leidenschaftlich dem Unternehmenserfolg verschrieb. Eine Heerschar von Personalexperten hat in den vergangenen Jahrzehnten darauf hingewirkt, aus der oppositionell gesinnten Arbeiterklasse einen Pool individualistischer, selbst motivierter Leistungsträger zu machen. Ob dieses Vorhaben tatsächlich und in seiner Gänze aufgegangen ist, darüber lässt sich trefflich streiten, auch davon soll in diesem Buch noch die Rede sein. Allein jedoch der Versuch, das Innenleben der Arbeitnehmer mit wirtschaftlichen Erfordernissen produktiv zu verbinden, ist nicht ohne Spuren und Effekte geblieben. Die Art, wie wir heute über Arbeitslust und Arbeitslast nachdenken, wie wir über Selbstverwirklichung oder Burn-out reden, wie wir uns in Bewerbungsgesprächen präsentieren, wie wir besser oder schlechter mit unserer physischen und psychischen Energie bei der Arbeit haushalten, ist zutiefst von den Konzepten geprägt, die Arbeitswissenschaftler und Personalexperten in der Vergangenheit entwickelt und umgesetzt haben. Kurz: Unsere ›Arbeitsgefühle‹ können nicht verstanden werden, ohne jene ›Gefühlsarbeit‹ nachzuzeichnen, die Unternehmen seit über hundert Jahren an ihren Mitarbeitern verrichten.
Und: Diese Gefühle haben nicht nur eine Geschichte, sie ›machen‹ auch Geschichte. Es macht einen Unterschied, ob sich ein Arbeitnehmer als ›Klassenantagonist‹ oder als ›High Potential‹ empfindet. Ob er mit Abscheu Routinetätigkeiten verrichtet oder freudig gespannt ist auf neue Herausforderungen. Die Geschichte dieser Unterschiede möchte ich in diesem Buch erzählen. Sie kreist um vier große historische Entwicklungslinien, die im vergangenen Jahrhundert untrennbar mit der Emotionalisierung des Erwerbsverhältnisses einhergegangen sind. Man kann sie als den ›Preis‹ unseres heutigen Arbeitsverständnisses bezeichnen. Die erste der vier geschichtlichen Entwicklungen lässt sich unter dem Begriff der ›Desomatisierung‹ zusammenfassen, denn in unserem Arbeitsverständnis ist der Körper des Arbeitnehmers immer weiter verschwunden. Heutzutage ist alles eine Frage der ›Motivation‹, und diese ist ein rein mentaler Begriff. Das Sprechen über körperliche Kapazitäten und auch über Grenzen der Belastbarkeit bei der Arbeit ist uns im Vergleich zum frühen 20. Jahrhundert gänzlich abhandengekommen.
Zweitens lässt sich für die vergangenen Jahrzehnte eine ›Dematerialisierung‹ in Bezug auf die Arbeit und die Emotionen feststellen: Waren in der Zeit um 1900 Unternehmer noch fest davon überzeugt, ihre Arbeiter würden mit einem Plus in der Lohntüte auch mehr leisten, so werden heute völlig andere Vorannahmen in der Personalwirtschaft verbreitet: Durch Geld kann man die Menschen angeblich nicht motivieren. Wer wirklich Spaß an der Arbeit hat und begeistert dabei ist, fragt nicht gleich nach der fälligen Gehaltserhöhung, sobald das Pensum zunimmt. Dieses Verständnis von Arbeit und Emotionen bedient eine Wirtschaftsordnung, in der die Belastungen steigen, nicht aber die Reallöhne.
Drittens beschreibe ich mit dem Wort ›Dynamisierung‹, dass wir mittlerweile bei einem Arbeitsmodell angelangt sind, welches von einem ständigen ›Schneller, Höher, Weiter‹ ausgeht. Und auch das war historisch betrachtet nicht immer so. Dass Menschen einfach Tag um Tag und Jahr um Jahr ein fixes Pensum verrichten, ohne sich jedes Jahr noch weiter nach der Decke beziehungsweise neuen Wachstumszahlen strecken zu müssen, war bis weit in das 20. Jahrhundert hinein eine gängige Vorstellung. Die Fragen, wann und wie (viel spannender noch: durch wen!) sie sich geändert hat, führen hier zum Kern.
Viertens und letztens hat sich unser Bezug zur Arbeit individualisiert. Während um 1900 die Arbeiterschaft en bloc für die gemeinsame Sache, um bessere Arbeitsbedingungen, stritt, gilt heute jeder Einzelne selbst als seines Glückes Schmied. Solidarität erscheint in Deutschland weniger denn je als innerbetriebliche Denkfigur. Auch daran haben Unternehmen mit großem Nachdruck gearbeitet: den Stolz auf die eigene Leistungsfähigkeit herauszupräparieren und die gefühlten Klassenbande aufzulösen.
Die kritische Schilderung unserer gewandelten Arbeitsgefühle fußt auf meiner geschichtswissenschaftlichen Dissertation Emotions at Work – Working on Emotions: On the Production of Economic Selves in Twentieth-Century Germany. Sie entstand am Forschungsbereich ›Geschichte der Gefühle‹ des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.4
Dieses Buch erlaubt mir nun zwei Dinge, auf die ich in der wissenschaftlichen Form verzichten musste: die Reflexion von Alltagsbeobachtungen und Gesprächen. Denn schon die bloße Erwähnung meiner wissenschaftlichen Arbeit brachte mir stets zuverlässig eine Flut anekdotischer Erzählungen aus der Arbeitswelt ein. Und einige dieser kleinen und großen Begebenheiten aus dem Arbeitsleben meiner Mitmenschen führen unmittelbarer zum Kern meiner Kritik an der heutigen Arbeitswelt als jede fachwissenschaftliche Abhandlung.
Zweitens ermöglicht mir dieses Buch, soziale mit ökologischer Kritik zu verknüpfen, denn unser Arbeitseifer hat seinen Preis. Wir arbeiten und produzieren mehr, als unser Planet verträgt. Mit den ökologischen Konsequenzen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Noch nie in der Geschichte des arbeitenden Menschen gab es so viele gute Gründe dafür, in Zukunft weniger zu schaffen und sich dabei gut zu fühlen.
I. Von der Last zur Lust
Auf eine grundsätzliche Art ist Arbeit selbstverständlich immer wichtig – vor allem dann, wenn sie fehlt oder Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Wenn Arbeitnehmer aber bereit sind, ohne Not körperliche und seelische Grenzen zu überschreiten, muss ihrer Arbeit eine besondere Qualität innewohnen: eine Sinnhaftigkeit, ein Glücksversprechen. Dieses Kapitel erzählt von jenem ungeheuren Bedeutungszuwachs, den die Arbeit über die vergangenen hundert Jahre hinweg erfahren hat. Welchen besonderen Stellenwert die Erwerbsarbeit heute in unserem Leben einnimmt, ist das Ergebnis einer wandlungsreichen Geschichte. Einer Geschichte, in der die unaufhörlichen Bemühungen von Unternehmern und Personalexperten, der Arbeit ein ›transzendentes‹ Wesen zu verleihen, eine entscheidende Rolle spielen. Wie ist es ihnen gelungen, die Arbeit über ihre profane Funktion hinauszuheben, ohne diese zu leugnen? Noch immer ist sie ja in erster Linie dazu da, eine Existenz zu sichern, die Miete und die Brötchen zu bezahlen. Um außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, müssen Arbeitnehmer ›glauben‹, dass Arbeit mehr ist als nur das.
In diesen ›Glaubensdingen‹ – heute würde man von ›vision & mission‹ eines Unternehmens sprechen – haben sich Unternehmen allerdings stets nur um jene Mitarbeiter bemüht, die auf dem Arbeitsmarkt im Vorteil waren oder deren ›Output‹ schwer zu kontrollieren war. Bei näherem Hinsehen ist dies völlig einleuchtend: Ein prekär beschäftigter Paketbote muss nicht motiviert werden, um ihn effizient zu machen. Er wird allein durch die fest vorgegebene Anzahl an auszuliefernden Paketen zu schnellstmöglichem Arbeiten gezwungen. Wenn er die erwartete Leistung nicht erbringt, rekrutiert die Firma einen neuen Mitarbeiter aus dem Heer der 22 Prozent Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Die kostspielige und aufwendige Arbeit, einen ›Glauben‹ an die Corporate Identity und das Firmenziel zu erzeugen, lohnt sich im Gegensatz dazu beispielsweise bei einem Ingenieur. Seine Leistung ist nicht so leicht zu kontrollieren wie die eines Paketboten. Der Ingenieur kann relativ lustlos seinen ›Dienst nach Vorschrift‹ verrichten. Oder vorausschauend und engagiert neue Ideen entwickeln, sein Team begeistern. Auf Englisch würde man dann über einen solchen Mitarbeiter sagen: »He runs the extra mile.«
Weil er als Ingenieur auf dem Arbeitsmarkt begehrt ist, ist es ihm möglich, die Firma wechseln, wenn ihm die Bedingungen nicht mehr zusagen. In diesem Fall ist die Firma auf ihn angewiesen. Ideal ist für sie ein Mitarbeiter, der eine Bindung zum Unternehmen verspürt und auch in strapaziösen Phasen seinen hohen Marktwert nicht in einen neuen Job ummünzt. Nur die emotionale Bindung wird den begehrten Wissensarbeiter zu Höchstleistungen motivieren. Niemand arbeitet auf Dauer freiwillig mehr, als er muss, außer er sieht in seiner Tätigkeit einen übergeordneten Sinn. Um diesen zu generieren, haben sich Firmen in den letzten hundert Jahren so einiges einfallen lassen.
Die Entdeckung der Arbeitsgefühle um 1900
Um 1900 wäre kein Arbeitnehmer auf die Idee gekommen, über seine Arbeit als ›Selbstverwirklichung‹ zu sprechen. Allzu oft zwang der Broterwerb zu langen, öden Stunden in Fabrikhallen oder Schreibstuben. Die Rechnung für diese emotional unattraktiven Bedingungen wurde den Unternehmern noch im Kaiserreich präsentiert: Die Streikzahlen stiegen in schwindelerregende Höhen. Seit 1880 hatte sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder alle fünf Jahre verdoppelt und eine äußerst erfolgreiche Streikpolitik hervorgebracht. In den 1890er Jahren kam es jährlich zu über tausend Arbeitsniederlegungen. Allein im Jahr 1905 streikte eine halbe Million Arbeiter, was zu einem Ausfall von über sieben Millionen Arbeitstagen führte. Aber nicht nur die hohen Streikzahlen machten den Unternehmen zu schaffen. Die seit 1895 nahezu herrschende Vollbeschäftigung nutzten Arbeitnehmer verständlicherweise zu ihrem Vorteil: Ertrugen sie die Arbeitsbedingungen in der einen Firma nicht länger, suchten sie kurzerhand bei der Konkurrenz ihr Glück. In einem Großunternehmen wie Bayer blieb zu jener Zeit nur ein Drittel der Arbeiter länger als drei Jahre.5
Dieses renitente Verhalten brachte den Arbeitern zum ersten Mal ein hohes und dauerhaftes Maß an Aufmerksamkeit aus den bürgerlichen Medien. Und auch die sozialwissenschaftliche Forschung nahm den Gemütszustand der widerständigen und unzuverlässigen Arbeitsbevölkerung ins Blickfeld. Was ging in den Arbeitern vor? Warum diese Proteste? Wie waren sie zu beruhigen? All diese Fragen drängten sich Nationalökonomen, Arbeitsmedizinern und Soziologen unmittelbar auf – schließlich drohte die ›Volkskraft‹, so der zeitgenössische Terminus, zu versiegen, weil die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung in den Fabriken dahinvegetierte, statt mit Tatkraft zum ›Nationaleinkommen‹ beizutragen.




























