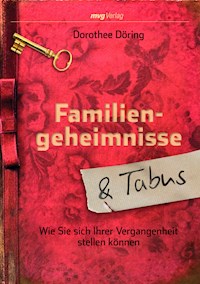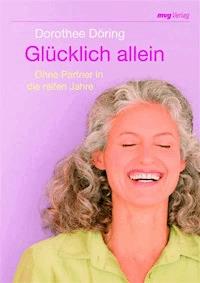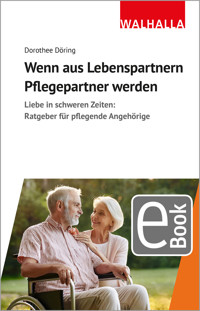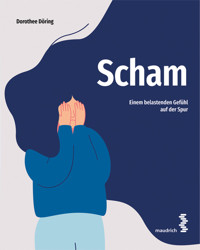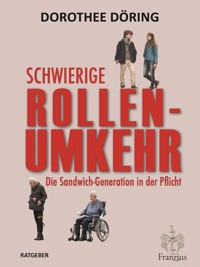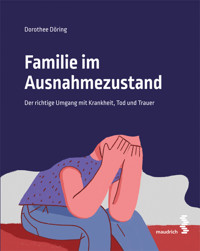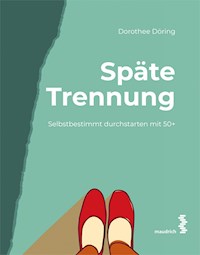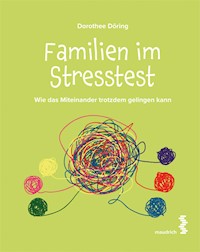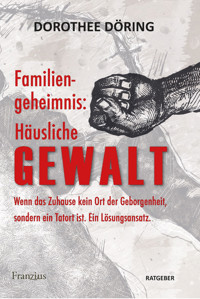
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franzius Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern eine Straftat und eine tiefgreifende Menschenrechtsverletzung. Hinter verschlossenen Türen, in einem Umfeld, das eigentlich Geborgenheit und Sicherheit bieten sollte, erleben Frauen und Kinder oft die Hölle. Die Spuren körperlicher Misshandlung mögen verblassen, doch die seelischen Narben bleiben für immer. Dieser Ratgeber beleuchtet anhand zahlreicher authentischer Fallbeispiele die verborgenen Mechanismen häuslicher Gewalt. Er zeigt, wie die Spirale aus Liebe, Abhängigkeit und Gewalt entsteht - oft beginnend mit vermeintlicher Zuneigung, die in Erniedrigung und Aggression mündet. Warum bleiben Betroffene in diesen Beziehungen? Welche seelischen Muster und gesellschaftlichen Tabus fördern das Schweigen? Mit einem Fokus auf Sensibilisierung und Prävention vermittelt dieses Buch Handlungsoptionen und macht Mut, die Ketten häuslicher Gewalt zu durchbrechen. Denn nur wer die Dynamiken erkennt, kann frühzeitig handeln - für ein Leben in Freiheit und Würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DOROTHEE DÖRING
Familien-
geheimnis:
Häusliche
Gewalt
Wenn das Zuhause kein Ort der Geborgenheit,
sondern ein Tatort ist. Ein Lösungsansatz.
Ratgeber
Ein Buch aus dem FRANZIUS VERLAG
Cover: Simone C. Franzius
Bildlizenzen: shutterstock, Dorothee Döring
Korrektorat: Franzius Verlag
Verantwortlich für den Inhalt des Textes
ist die Autorin Dorothee Döring
Satz, Herstellung und Verlag: Franzius Verlag GmbH
Druck und Bindung: BoD, Norderstedt
ISBN 978-3-96050-266-1 (E-Book)
Alle Rechte liegen bei der Franzius Verlag GmbH
Hogen Kamp 33, 26160 Bad Zwischenahn
Copyright © 2025 Franzius Verlag GmbH
www.franzius-verlag.de
Informationen gemäß der Produktsicherheitsverordnung der EU,
auch als General Product Safety Regulation (GPSR) bekannt:
- Der Hersteller dieses Buches im Sinne der GPSR ist die Franzius Verlag GmbH.
- Ansprechpartner für GPSR-Fragen ist die Geschäftsführerin Simone C. Franzius.
- Die Kontakt-E-Mail bei Fragen im Sinne der GPSR lautet: [email protected]
- Der eindeutige Produktcode gemäß GPSR ist die ISBN.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie zum Beispiel manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
INHALT
Vorabbemerkung des Verlages
Einführung
I. Definition und Abgrenzung
1. Was ist häusliche Gewalt?
2. Risikofaktoren – Was begünstigt häusliche Gewalt?
3. Wie entwickelt sich häusliche Gewalt?
4. Die Strategien der Täter
5. Gewaltdynamik und Gewalteskalation
6. Was macht häusliche Gewalt zum Tabuthema?
II. Formen häuslicher Gewalt
1. Seelische Gewalt
1.1 Seelische Gewalt von Eltern gegenüber ihren Kindern
1.2 Seelische Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern
1.3 Seelische Gewalt gegen Frauen
1.4 Unbeachtet & tabuisiert – Seelische Gewalt gegen Männer
1.5 Ökonomische Gewalt
2. Körperliche Gewalt
2.1 Kinder als Opfer
2.2 Geschwister als Opfer
2.3 Eltern als Opfer
2.4 Frauen als Opfer
2.5 Männer als Opfer
2.6 Pflegebedürftige Familienangehörige als Opfer
3. Sexualisierte Gewalt
3.1 Frauen als Opfer
3.2 Kinder als Opfer
III. Die Folgen häuslicher Gewalt
1. Die Folgen häuslicher Gewalt bei Kindern
2. Folgen häuslicher Gewalt bei misshandelten Frauen
3. Gewalteskalation – Wenn Gewalt tödlich endet
4. Spätfolge – Transgenerationale Weitergabe
IV. Befreiung aus häuslicher Gewalt
1. Erkennen von Gewalt und Gewaltdynamik
2. Erkennen familiärer Gewaltmuster
3. Anker im Strudel der Gewalt
4. Befreiung vom Druck des Schweigens
5. Die Trennung als Weg in die Freiheit
5.1 Die mentale Vorbereitung der Trennung
5.2 Die organisatorische Vorbereitung der Trennung
5.3 Trennungshindernisse erkennen
V. Prävention zur Vermeidung häuslicher Gewalt
1. Sensibilisieren der Wahrnehmung und des seelischen Frühwarnsystems
2. Entwickeln von Ich-Stärke und seelischer Widerstandskraft
3. Förderung sozialer Kompetenzen
4. Gewaltfreie Kommunikation Vermeidung eskalierenden Streits
5. Training der Emotionssteuerung
6. Gelassenheit als emotionale Pausentaste
7. Konsequente Haltung – Null Toleranz bei Gewalt
8. Offenheit statt Schweigen
Abschließende Bemerkungen
Hilfreiche Kontaktadressen – Keine Toleranz bei Gewalt!
Kontaktadressen
Hilfe für Kinder
Beratung für Kinder und Jugendliche
Über die Autorin
Ihre bisherigen Publikationen
Quellen
Vorabbemerkung des Verlages
Wegen stilistischer Klarheit und leichterer Lesbarkeit wurde im Text auf die sprachliche Verwendung weiblicher Formen verzichtet. Die Verwendung der männlichen Form gilt für alle Geschlechter und stellt keinesfalls einen sexistischen Sprachgebrauch dar.
Einführung
Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern eine Straftat und eine Menschenrechtsverletzung, die sich in Familien hinter verschlossenen Türen abspielt. Leider sind Familie und das Zuhause nicht immer Orte der Sicherheit und Geborgenheit, sondern häufig Tatorte häuslicher Gewalt. Zahlreiche authentische Fallbeispiele in diesem Ratgeber zeigen, dass überwiegend Frauen und Kinder hilflos allen Formen häuslicher Gewalt in einem Umfeld ausgesetzt sind, in dem sie sich eigentlich sicher fühlen sollten. Viele Opfer häuslicher Gewalt erleben in ihrem Zuhause die Hölle – eine Hölle, die leider oft genug in der Psychiatrie endet oder sogar mit dem Tod. Und diejenigen, die häusliche Gewalt überleben, sind gezeichnet. Spuren der Misshandlungen mögen verblassen, doch die Seelenqualen und die tiefen Wunden, die Opfern häuslicher Gewalt zugefügt wurden, heilen nie.
Dieser Ratgeber zeigt, dass häusliche Gewalt fast nie mit Schlägen beginnt, sondern meist mit großer Liebe, die blind macht für die Aggressions- und Abwertungsspirale. Diese beginnt oft mit Worten und Gesten, kann aber in einer Katastrophe enden. Liebe macht jedoch nicht nur blind, sondern auch süchtig und abhängig – sogar von Partnern, die zuschlagen. Deshalb ist die Scham so groß, dass häusliche Gewalt tabuisiert wird.
Der Ratgeber beleuchtet zudem die seelischen Fesseln, die meist schon in der frühen Kindheit durch eine Erziehung zu absolutem Gehorsam und Anpassung angelegt wurden und häusliche Gewalt begünstigen. Darüber hinaus werden folgende Fragen geklärt: Wie geht man damit um, wenn Gewalt eine Beziehung beherrscht? Warum bleiben Frauen allzu oft bei ihren gewalttätigen Partnern? Wie entsteht die Spirale aus Liebe und Gewalt – und wie kann man sie durchbrechen?
Eine zentrale Intention dieses Ratgebers ist es zu vermitteln, dass man häuslicher Gewalt nur dann gewachsen ist und Handlungsoptionen hat, wenn neben der Gewaltprävention auch eine Sensibilisierung der Wahrnehmung erfolgt – mit dem Ziel der Früherkennung.
I. Definition und Abgrenzung
1. Was ist häusliche Gewalt?
Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalt in engen persönlichen Beziehungen, vor allem in der Partnerschaft und der Familie. Sie umfasst alle Handlungen körperlicher, psychischer, sexueller und ökonomischer Gewalt. Kinder, die in diesen gewaltbelasteten Beziehungen leben, sind hochgradig mitbetroffen.
Bei häuslicher Gewalt handelt es sich um gewalttätige Übergriffe, die Menschen betreffen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, beispielsweise in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft.
Häusliche Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung, die in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt, unabhängig von Bildungsstand, Einkommen, Sozialstatus, Altersgruppe, Nationalität oder kultureller oder religiöser Zugehörigkeit.
Obwohl sich häusliche Gewalt hinter verschlossenen Türen abspielt, ist sie nie Privatsache, sondern ein Straftatbestand. Aufgrund des Artikels 2 des Grundgesetzes hat jeder Mensch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit:
»Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.«
2. Risikofaktoren – Was begünstigt häusliche Gewalt?
Erst wenn geklärt ist, was häusliche Gewalt begünstigt, können Strategien entwickelt werden, sie zu verhindern.
Zu häuslicher Gewalt kommt es oft im Zusammenhang mit Umbruchsituationen, z. B. der Geburt eines Kindes, der Arbeitslosigkeit, einer Trennung sowie belastenden Umständen wie Schulden oder Suchterkrankungen oder anderen Überforderungssituationen. Sie kann aber auch Folge einer Persönlichkeitsveränderung sein.
Janina Steinert, Professorin für Global Health an der Technischen Universität München (TUM), und Dr. Cara Ebert vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung haben deshalb rund 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren online nach ihren Erfahrungen befragt. Die Studie ist hinsichtlich Alter, Bildungsstand, Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnort repräsentativ für Deutschland.
Beide Forscherinnen konnten in einer ersten großen repräsentativen Umfrage zu häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie zeigen, dass rund drei Prozent der Frauen in Deutschland während der verordneten strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt wurden:
3,6 Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Waren die Frauen in Quarantäne oder hatten die Familien finanzielle Sorgen, lagen die Zahlen deutlich höher. Nur ein sehr kleiner Teil der betroffenen Frauen nutzte Hilfsangebote.1
Aber nicht nur die ungewohnte Zwangsnähe durch den Lockdown hat viele Familien, Ehen und Partnerschaften vor große Herausforderungen gestellt, auch Einschränkungenim Alltag und ungewohnte Tagesabläufe sorgten für Anspannung und Stress. Auch Zukunfts- und Existenzängste und finanzielle Sorgen durch pandemiebedingten Arbeitsplatzverlust waren Auslöser für häufigeren Streit, der sich zu Aggressionen und Gewaltausbrüchen steigerte.Aber auch die Überforderung, neben dem Homeoffice Kinder unterschiedlichen Alters angemessen zu betreuen und beim Homeschooling zu unterstützen und zu fördern, waren zusätzliche Verstärker.
In dieser schwierigen Situation stieg nachweislich die häusliche Gewalt. Bekannt ist es vor allem aus dem Bereich »häuslicher Pflege«, dass jahrelang überforderte Familienangehörige übergriffig und gewalttätig werden können.
Die Möglichkeiten, sich Hilfe im Familien- oder Freundeskreis oder bei einer Beratungsstelle zu suchen, waren während der Pandemie durch Kontaktbeschränkungen oder Quarantäne eingeschränkt.
Gründe für häusliche Gewaltbereitschaft können aber auch Gewalterfahrungen in der Kindheit sein. Diejenigen, die häusliche Gewalt in ihren Familien erlebt hatten, empfinden sie als normal und geben sie unbewusst und unreflektiert transgenerational an die nächste Generation weiter oder werden selbst wieder zum Opfer von Gewalt. Selbst erlebte Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie beeinträchtigen die eigene Wahrnehmung und Sensibilität.
Abgesehen von den familiären begünstigen folgende weitere Faktoren »häusliche Gewalt« an Frauen:
Alter:
Jüngere Frauen sind häufiger Opfer von Gewalt als ältere. Frauen unter 30 werden doppelt so häufig geschlagen wie Frauen über 30. Allerdings sollte bei diesen Zahlen berücksichtigt werden, dass ältere Menschen sich seltener an Hilfseinrichtungen wenden und die Dunkelziffer daher sehr groß sein könnte.
Statusungleichheit:
Gibt es eine Statusdifferenz innerhalb der Partnerschaft, dann wird diese Ungleichheit zum Risikofaktor. Wenn Frauen darüber hinaus emotional und wirtschaftlich abhängig sind, erhöht sich das Risiko für Gewalt.
Gewalt in Herkunftsfamilien:
Zahlreiche Forschungen scheinen zu bestätigen, dass zwischen erlebter bzw. beobachteter Gewalt in der Kindheit und späterer Gewaltausübung ein Zusammenhang besteht. Gewalt wird durch Prägung transgenerational von Generation zu Generation weitergegeben. Allerdings gilt dieser Zusammenhang mehr für männliche Täter. Frauen, die in der Kindheit Gewalt erlebt bzw. beobachtet haben, sind dagegen stark gefährdet, selbst Opfer eines gewalttätigen Partners zu werden.
Alkohol:
Die Forschung kann keinen direkten Zusammenhang zwischen Gewalt und Alkoholkonsum herstellen. Alkoholmissbrauch ist ein möglicher Auslöser, aber nicht Ursache von Gewalt.
Persönlichkeitsbedingte Risiken:
Wer sich in einen persönlichkeitsgestörten Menschen verliebt (Narzisst, Choleriker, Rechthaber, Manipulierer), ist einem größeren Risiko für häusliche Gewalt ausgesetzt.
Sozioökonomische Faktoren:
Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Gewalt in Familien vor allem in ökonomisch ärmeren Schichten anzutreffen ist, kann die Forschung keinerlei Bestätigung dieser Hypothese liefern. Allerdings spielt die sozioökonomische Schicht eine Rolle, ob Anzeige erstattet wird oder nicht. Betroffene aus höheren Einkommens- und Bildungsschichten wenden sich seltener an Hilfseinrichtungen als jene aus niedrigeren Schichten.
Konflikte als Auslöser von Gewalt:
Den meisten Gewalttaten gegen Frauen gehen Konflikte voraus, die das Alltagsleben betreffen (Besitzansprüche des Mannes, Eifersucht, Anspruch auf Dominanz, Macht und Kontrolle, verbunden mit »Bestrafung« der Frau, Erwartungen bzw. Uneinigkeit bezüglich der Hausarbeit und finanzieller Ressourcen, Erziehung und Betreuung der Kinder, sexuelle Ansprüche).
Permanente Überforderung:
Während der Rushhour des Lebens können Beruf, Familie und Pflege von Angehörigen zur Überforderung werden und sich in Gewalt äußern. Die Corona-Pandemie mit Lockdown, Homeoffice und Homeschooling hat zu einer nachweisbaren Zunahme häuslicher Gewalt geführt.
Den meisten Opfern häuslicher Gewalt fällt es schwer, sich jemandem anzuvertrauen – zu groß ist die Scham, zu groß das gesellschaftliche Tabu. Hilfe gibt es bundesweit durch das Krisentelefon (siehe auch das letzte Kapitel mit Ansprechpartnern), bei dem man sich anonym Hilfe holen kann.
3. Wie entwickelt sich häusliche Gewalt?
Am Anfang destruktiver Gewaltbeziehungen steht häufig eine sehr intensive, leidenschaftliche Phase: Ein Mann zeigt sich z. B. sehr verliebt, will schnell mit seiner »Auserwählten« zusammenziehen und kann sich nur mit ihr eine Zukunft vorstellen. Eine junge Frau hat mir in einem Beratungsgespräch geschildert, wie sich bei ihr häusliche Gewalt entwickelte:
»Meine Beziehung hat nicht mit Gewalt begonnen, sondern mit der ganz großen Liebe – wie ich damals glaubte. Ich war verliebt, habe absichtlich rote Flaggen übersehen und Dinge, die ich normalerweise komisch gefunden hätte. Ich war in meiner Liebe sogar so blind, dass ich es zugelassen habe, dass mein Freund mich von Familie und Freunden isoliert hat, um allein Einfluss und Macht über mich zu haben und mich manipulieren zu können. Alle Menschen in meinem Leben waren plötzlich sein Feind. Hat mir jemand eine WhatsApp geschrieben, bekam ich dafür üblen Ärger. Mein Freund wusste immer, wo ich war, weil er mich gestalkt und regelrecht überwacht hat. Als ich mich trennen wollte, sagte er: ›Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um!‹ Erst mit Hilfe einer Therapeutin habe ich es geschafft, mich aus dieser kranken Beziehung zu befreien.«
Das Beispiel zeigt, dass häusliche Gewalt meist nicht – wie z. B. bei einer Kneipenschlägerei – aus einer konkreten Situation heraus entsteht. Sie ist vielmehr Ausdruck eines andauernden Macht- und Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Täter bzw. Täterin und Opfer.
Meistens beginnt häusliche Gewalt fast unmerklich mit Kleinigkeiten als schleichender Prozess. Deshalb werden erste Signale viel zu oft übersehen! Anfangs ist der Partner oder die Partnerin vielleicht immer wieder launisch und aggressiv und »rastet schnell aus«. Dann können Beleidigungen, Demütigungen, Stimmungsschwankungen und seelische Grausamkeit in der Ehe oder Partnerschaft folgen. Der Partner oder die Partnerin reagiert möglicherweise eifersüchtig und beginnt, finanzielle Ausgaben, soziale Kontakte oder das Handy zu kontrollieren. Sie sollten alarmiert sein, wenn Sie Folgendes feststellen:
Am Anfang des Gewaltzyklus stehen Demütigungen, Beleidigungen, Bloßstellungen und Diskriminierungen.
Gewalthandlungen folgen in immer kürzeren Abständen und werden immer unberechenbarer und aggressiver.
Gewaltausbrüchen folgen Versöhnungen und Versprechen, die nicht eingehalten werden.
Danach versuchen die Täter, ihr gewalttätiges Handeln zu entschuldigen und zu bagatellisieren. Sie versuchen, dem Opfer eine Teilschuld zu geben. Ausreden wie
»Ausrutscher«
,
»Alkohol«
,
»Kinder zu laut«
oder
»Sie hat mich halt provoziert«
werden vorgeschoben.
Häufig entschuldigen gewalttätige Partner ein vermeintlich einmaliges Verhalten wie demütigende Bemerkungen oder Aggressivität. Und viele Gewaltopfer reden sich ein:
»Wenn mein Mann betrunken ist, beleidigt er mich – aber normalerweise ist er ja nett zu mir«,
»Mein Freund ist aggressiv – aber er regt sich auch schnell wieder ab« oder
»Mein Freund bezeichnet mich als ›blöde Kuh‹ – aber nur, wenn er schlechte Laune hat.«
Aber oft bleibt es nicht bei einem einmaligen Vorfall, die Angriffe wiederholen sich und werden in vielen Fällen schlimmer.
Oft steht am Anfang die Kontrolle. Der Mann entscheidet z. B., wie die Beziehung zu laufen hat, wofür Geld ausgegeben wird, mit wem seine Frau sich trifft. Hinzu kommt extreme Eifersucht. Was zuerst wie ein Ausdruck großer Liebe erscheint, wird zum Albtraum. Er kann es nicht ertragen, wenn sie mit Kollegen spricht, einen anderen Mann zu lange ansieht. Also versucht sie, ihr Verhalten anzupassen, sie will ihn ja nicht provozieren.
Dann kommen die Demütigungen, die Abwertung ihrer Leistungen und Persönlichkeit, das Absprechen ihrer Wahrnehmung. Wenn sie von seinen Beleidigungen getroffen ist, ist sie überempfindlich oder bildet sich das nur ein. Wenn sie sich wehrt, vergiftet sie die Beziehung mit ständigem Drama, verletzt seine Gefühle mit ihren falschen, unberechtigten Vorwürfen. Nicht selten unterstellt der Mann seiner Frau auch noch, ihn zu betrügen.
Dazu kommt die soziale Isolation: Er hat keine Lust, ihre Familie zu treffen, ihre Freunde sind nicht vertrauenswürdig, und überhaupt hat sie viel zu wenig Zeit für ihn. So wird es für sie fast unmöglich, mit anderen über die Beziehung zu reden, zu erkennen, dass er sie in eine völlig verzerrte Realität von Verboten, Vorwürfen und Schuldzuweisungen drängt, eine Welt, in der die Beziehung viel besser liefe, wenn sie sich nur richtig verhalten würde, wie er ihr suggeriert.
Meist dauert es Jahre, bis Betroffene begreifen, dass ein Großteil ihres Leidens durch das feindselige Verhalten des Menschen verursacht wird, der vorgibt, sie zu lieben. Statt sich Unterstützung zu holen, um sich aus der Situation zu befreien, glauben sie, dass alles sich zum Besseren wenden werde, wenn sie sich änderten und dem anderen gegenüber nur verständnisvoller und toleranter zeigten. Die Erfahrung zeigt aber: Wer einmal zugeschlagen hat, wird es wieder tun.
Ein weiterer Grund, warum Gewaltopfer leider oft zu spät erkennen, dass sie manipuliert werden, liegt darin, dass diejenigen, die Gewalt in nahen Beziehungen ausüben, meist raffiniert und vor allem strategisch vorgehen. Opfern häuslicher Gewalt ergeht es wie dem Frosch, der ins kalte Wasser gelegt wird. Er erkennt meist zu spät, dass das Wasser erhitzt und für ihn lebensgefährlich wird.
4. Die Strategien der Täter
»Täter« können grundsätzlich alle Familienmitglieder sein. Oft bedienen sie sich bestimmter Strategien, um ihre Gewalttätigkeit zu tarnen und die Verantwortung dafür nicht übernehmen zu müssen. Geschickt und wie selbstverständlich verdrehen sie die Tatsachen und verunsichern und verwirren damit ihre Opfer. Es gelingt ihnen ebenfalls häufig, Außenstehende dazu zu bringen, ihnen zu glauben und sich auf ihre Seite zu stellen. Dazu folgendes Beispiel:
Raphaela, 42:
»Ich bin Krankenschwester und lebte mit meinen drei Kindern fast zwölf Jahre in einer Gewaltbeziehung, die bestens getarnt war und von der niemand etwas mitbekam. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in ständiger Angst zu leben. Meinen Mann, einen charmanten ägyptischen Arzt, lernte ich in dem Krankenhaus kennen, in dem ich arbeite. Ich glaubte, einen liebevollen Mann getroffen zu haben, und war ein Jahr lang glücklich, bis zur Hochzeit. Noch an diesem Tag veränderte er sich. ›Ich werde dich erziehen‹, drohte er. Ich erinnere mich an den ersten Faustschlag, der mich völlig unerwartet traf, nachdem ich ihn nur gefragt hatte, wo er hingehe, als er die Wohnung verlassen wollte. Ich war so perplex, dass ich den Schmerz nicht spürte und zur Arbeit ging, als sei nichts gewesen. Meinen besorgten Kollegen sagte ich, dass ich mich an der Tür gestoßen habe. Die Fragen waren mir unangenehm, ich schämte mich. Meinem Mann war es wichtig, dass meine blauen Flecken nicht sichtbar sein sollten. Deshalb verprügelte er mich nun anders: Tritte in den Unterleib und immer wieder ins Gesicht. Statt mit der Faust schlug er mit der flachen Hand, so dass man die Spuren nicht sehen konnte.«
Es gibt viele Gewalttäter, die sich nach außen als charmante, nette Menschen geben. Auch Raphaelas Mann gehört dazu, der seine Frau an Stellen verletzt, die für andere nicht sichtbar sind. Und wahrscheinlich ist er im Ärzteteam der beliebteste Kollege, hilfsbereit und sympathisch.
Am besten zu tarnen ist psychische (seelische oder emotionale) Gewalt, denn man kann von außen meist weder die Gewalttat noch ihre Folgen sehen. Psychische, verbale oder wirtschaftliche Gewalt trifft vor allem Frauen und Kinder. Aus Scham und Angst bleibt diese Gewalt in vielen Fällen lange Zeit unerwähnt und somit unentdeckt.
Auch die Ethnologin Barbara Peveling hat häusliche Gewalt erfahren. In ihrem Buch »Gewalt im Haus. Intime Formen der Dominanz«2 analysiert sie viele selbst erlebte Formen versteckter Aggression – über Manipulation bis zu zersetzendem Sarkasmus. Auch Stalking durch den (Ex-)Lebens- oder Ehepartner und Mobbing zählen zu dieser meist verdeckten Form der häuslichen Gewalt.
Ein häuslicher Gewalttäter tarnt eine Aggression besonders mit zwei Formen der toxischen Kommunikation:
»Getarnte Aggression«
durch Anspielungen, sogenannte »Scherze«, verbunden mit Verharmlosung, Herunterspielen und Leugnung der aggressiven Absicht,
»Aggressives Schweigen«,
indem man sich der Kommunikation entzieht.
Subtile Formen verbaler Gewalt, die getarnt oder maskiert werden, sind oft schwer zu erkennen, wirken aber ebenso verheerend.
Wie geht ein häuslicher Gewalttäter strategisch vor?
Zunächst tarnt sich der Aggressor gegenüber seiner Umwelt: Außenstehende erleben ihn meist als anständigen, erfolgreichen, sensiblen, ruhigen, unauffälligen Menschen. Er wirkt gelassen und kontrolliert. Die Wahrheit aber ist: Täter haben zwei Gesichter. Gegenüber seiner Partnerin benimmt er sich kontrollierend, egozentrisch, hyperkritisch und bösartig. Außenstehende sehen, wenn sie überhaupt etwas mitbekommen, nur die Reaktion des Opfers und nicht die Misshandlung, durch die sie ausgelöst wurde. Wer soll einem Opfer glauben, dass dieser charmante, nette, hilfsbereite, erfolgreiche Mann so grausam und verletzend sein kann? Hinzu kommt, dass die Aggressionen selbst getarnt werden. Hierzu gibt es mehrere Strategien:
Die Aggression wird in einem Witz auf Kosten des Opfers versteckt.
Die Aggression wird geleugnet.
Die Gründe für die Aggression werden geleugnet.
Die Aggression wird in einem Witz versteckt
Verbale Angriffe werden häufig als Scherze getarnt oder bedienen sich der Waffe der Ironie. Der tatsächlich erfolgte Hieb wird oft nicht sofort erkannt, sondern hinterlässt nur ein dumpfes Gefühl von »irgendwie tat das weh, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll«.
Es gibt aber auch feige Täter, die in Abwesenheit der Partnerin über sie lästern und sogar andere dazu einladen, sich an der Demontage zu beteiligen. Deren Kommentare werden dann genüsslich an die Partnerin weitergegeben, und der Täter wird äußerst überrascht tun, wenn sie sich darüber echauffiert und die Kommentare der anderen alles andere als witzig oder komisch findet. Typischerweise behauptet er, dass sie wieder einmal überreagiere, dass doch alles »nur ein Spaß« sei und dass niemand sie durch diese kleinen Scherze verletzen wolle. Da es Gewalttätern um Macht und Kontrolle geht, nutzen sie diverse Strategien, um sich im häuslichen Umfeld beides zu sichern. Wahrheit ist für sie das, was ihnen nützt. Deshalb streiten sie ab, wenn sie auf etwas angesprochen werden, das unangemessen ist. Sie stellen Aggressivität als Empathie dar, machen die Partnerin für Übergriffe verantwortlich und tarnen sie als Sorge.
Häusliche Gewalttäter sind Meister darin, ihre Gewalt zu tarnen oder zu rationalisieren. Sie kleiden Verletzungen in der Öffentlichkeit in die Masken von Anteilnahme. Dabei klagen sie bei anderen über die »Defizite« ihrer Partnerin: »Meine Frau ist schwierig, mit der habe ich es nicht leicht. Trotzdem helfe ich ihr, wo ich nur kann.« In der Regel bekommen Außenstehende ein schlechtes Bild vom Opfer, während der Täter als Altruist erscheint.
Wenn häusliche Gewalttäter auf ihre Gewalt angesprochen werden, unterstellen sie dem Opfer eine »blühende Fantasie« oder raten ihm, eine Psychotherapie aufzusuchen. Sie verbitten sich Einmischung von außen und unterstellen Kritikern, keine Ahnung zu haben, oder behaupten, sich an konkrete Geschehnisse nicht zu erinnern. Der Täter nimmt dem Opfer dessen Wahrnehmung der Realität, bis das Opfer seiner Intuition und Erinnerung nicht mehr traut.
Häusliche Gewalttäter lügen gegenüber Außenstehenden sehr geschickt. Statt frei zu erfinden, drehen sie Handlungen des Opfers um oder interpretieren Aussagen bewusst falsch. Meist lügen sie präventiv, und um ihre Taten zu tarnen, versuchen sie, das Opfer im Vorfeld als unglaubwürdig und unzurechnungsfähig darzustellen.
Am schwierigsten sind folgende Strategien des Täters für das Opfer:
Verharmlosung:
»Das kann ja mal passieren!«
»Mir ist nur die Hand ausgerutscht!«
»Das war doch nicht so schlimm!«
Leugnen:
»Du bist eine Lügnerin!«
»Glauben Sie ihr kein Wort!«
»Ich würde so was nie tun!«
»Du hast doch Wahnvorstellungen!«
Schuldzuweisung:
»Du hast mich provoziert!«
»Du bringst mich zur Weißglut!«
»Du bist selbst schuld!«
Beschämung:
»Dir glaubt doch eh keiner!«
»Wer sollte dir schon helfen?«
»Ohne mich bist du nichts!«
»Guck dich doch an, wie erbärmlich du bist!«
Drohung:
»Wenn du jemandem davon erzählst, wirst du das bereuen!«
»Wenn du gehst, bring ich dich (oder mich) um!«
»Ich sorge dafür, dass sie dir die Kinder wegnehmen!«
»Vor mir bist du nirgendwo in Sicherheit!«
Es gibt aber nicht nur männliche Gewalttäter. Im Gegensatz zu Männern leben Frauen ihre Aggressivität verdeckt aus, indem sie zum Beispiel sticheln, hetzen, demütigen oder Gerüchte verbreiten.
»Du Versager, du bekommst doch nichts auf die Reihe«, solche und ähnliche Beleidigungen und Demütigungen (»Papa ist doof«, »Papa hat einen fetten Bauch«, »Wir suchen uns einen neuen Papa«) musste sich der heute 48 Jahre alte IT-Experte Hendrik jahrelang von seiner Ehefrau gefallen lassen. Auch Schläge auf den Kopf, Tritte gegen sein Geschlechtsteil und den Magen waren für ihn lange an der Tagesordnung.
»Unser Sohn musste alles miterleben«, erzählt er. Sein Weg aus der zerstörerischen Ehe sei ein langer gewesen. Immerzu habe er Angst gehabt, dass er sein Kind nie wiedersieht.
Die wenigsten Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, erstatten Anzeige, weil sie häufig die Erfahrung machen, nicht ernst genommen zu werden, da dieser Straftatbestand nicht in das vorherrschende Rollenbild des Mannes passt.
Auch Hendrik geht es so: »Männer zeigen Frauen nicht an. Männer zeigen keine Schwäche. Männer halten so etwas aus. Wenn ich mich oute, hält man mich für unmännlich. Das wirst du doch selbst regeln können, du Weichei.«
Verständlich, dass Männer sich nicht outen und keine Hilfe suchen, denn sie fürchten die gesellschaftliche Stigmatisierung.
Von diesen Strategien unterschiedlicher Formen der Gewalt, die innerhalb des Haushaltes stattfinden, bekommt niemand etwas mit. Es ist die perfekte Tarnung für Gewalttäter. Allerdings führt das verharmlosende, gewalttätige Verhalten zu einem sekundären Schaden, indem diese Haltung des Täters von seinen Kindern übernommen wird.
5. Gewaltdynamik und Gewalteskalation
Die Dynamik bei Gewalt in der Partnerschaft wird »Gewaltspirale« genannt.
Grafik: Spirale der Gewalt, nach Dr. H. Henzinger3
Die Gewaltspirale baut sich über verschiedene Phasen auf:
Phase 1: Spannungsaufbau. Der Täter baut über einen längeren Zeitraum hinweg mit psychischer Gewalt eine belastende, angsterfüllte Atmosphäre auf. Abwertungen und Beschimpfungen finden statt, übersteigerte Eifersucht sowie »kleinere körperliche Übergriffe«. Das Opfer, meist die Frau, versucht, ihr Verhalten anzupassen, um eine Eskalation zu vermeiden.
Phase 2: Die Gewalttätigkeit wird durch einen oft banalen äußeren Anlass ausgelöst.
Der Täter versucht, seine Kontrolle über die Situation durch Gewalt zu sichern. Er handelt zunächst bewusst gewaltvoll, verliert dann meist die Kontrolle. Opfer, die nicht mit Flucht oder Abwehr reagieren können, sind dem Täter hilflos ausgeliefert. Je nach Schwere der Gewalt ist das Erleben für die Opfer nicht selten mit Todesängsten verbunden.
Phase 3:Entschuldigung, Reue, Zuwendung.
Typischerweise bemüht sich der Täter im Anschluss an einen Gewaltausbruch um Aussöhnung und Beschwichtigung. Oftmals verhält er sich dann besonders liebevoll, entschuldigt sich, zeigt Reue und versichert, dass es sich um einen Ausnahmefall gehandelt habe, der nicht wieder vorkommen werde. Bei vielen Betroffenen löst dieses Verhalten die Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation aus, die der Beziehung eine weitere Chance einräumt. Damit wird der Weg für die Fortführung der Gewaltspirale geebnet.
Phase 4: Abschieben der Verantwortung.
Die Verantwortung für den Gewaltausbruch wird geleugnet, gerechtfertigt oder heruntergespielt. Die Verantwortung für den Gewaltausbruch wird dem Opfer zugeschoben … »Wenn du mich nicht so gereizt hättest …« Damit wird in Form von Manipulation erneut Gewalt ausgeübt.
Phase 5: Schweigen.
Sofern es sich um Gewalt unter Ehe- bzw. Lebenspartnern handelt, bemühen sich »Täter« und »Opfer«, die Gewalttat zu vergessen und die unangenehmen Gefühle daran zu verdrängen.
Das Opfer – meist die Frau – übernimmt die Mitschuld, rührt das Thema nicht mehr an, auch um keine neue Gewalt zu provozieren. Erst mit der Zeit bemerkt das Opfer, dass es das immer stärker werdende gewalttätige Verhalten seines Partners nicht beeinflussen und kontrollieren kann. Da der »Täter« sein Problem im Umgang mit Emotionen und Stress nicht bearbeitet hat und die Verantwortung für seine Taten nicht übernommen hat, wird er wieder gewalttätig werden. Der Zyklus der Gewalt hat begonnen, Gewalteskalationen ereignen sich immer öfter und werden gefährlicher. Durch das Schweigen befindet sich das Opfer in einem Dauerzustand von Unsicherheit, Angst und Belastung.
Viele gewaltbereite Partner rechtfertigen ihren Gewaltausbruch als etwas, das über sie kommt, und suchen die Gründe für den Kontrollverlust bei der Partnerin oder bei äußeren Umständen. Damit schieben sie die Verantwortung für ihr Handeln dem Opfer zu. Wenn der gewaltausübende Partner keine fachliche Hilfe sucht, ist die Gefahr groß, dass sich die Gewaltspirale weiterdreht.