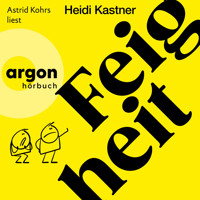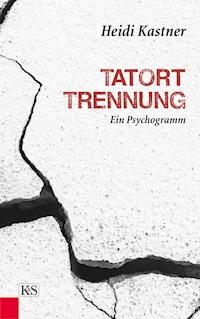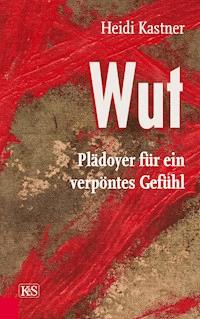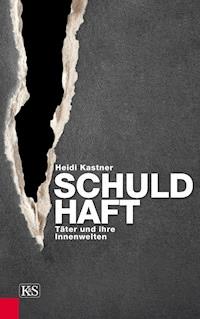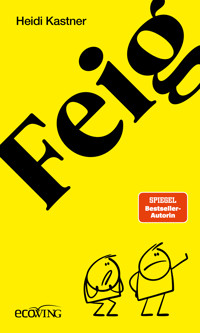
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Angst oder Mut, Gefahr oder Risiko? – Feige Menschen als gesellschaftliches Phänomen und seine Folgen In einer Zeit, in der angesichts zunehmender Krisen Zivilcourage, Verantwortungsbewusstsein und Mut gefordert sind, scheint sich gerade das Gegenteil zu verbreiten: Vermeidung, Angst, Gleichgültigkeit oder das Unterlassen des Gebotenen – kurz: Feigheit. In ihrem Buch geht die Spiegel-Bestsellerautorin und Psychiaterin Heidi Kastner den möglichen Gründen für diese Entwicklung nach. - Sozialpsychologische Analyse der Feigheit und ihrer Bedeutung in unterschiedlichen Erscheinungsformen - Kritische Diagnose der Gefahren und Risiken einer feigen Gesellschaft - Moralische Werte und Handlungsmuster im Alltag und in Krisensituationen - Der Wandel von Ethik und Moral und seine gesellschaftspolitischen Konsequenzen - Ein Plädoyer für Mut und Verantwortungsbereitschaft sowie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Verantwortungsethik: Welche Folgen hat feiges Verhalten für den Einzelnen und die Gesellschaft? Sei es das Aufbegehren gegen Autoritäten, das Ghosting in Beziehungen oder das Eintreten für Schwächere: An vielen Beispielen macht Heidi Kastner die Bedeutung von Feigheit im Denken, Fühlen und Handeln der Menschen deutlich. Von konformem Verhalten und der Angst, etwas Falsches zu sagen, über das Ignorieren von Missständen aus Selbstschutz bis hin zu banaler Bequemlichkeit – beim Lesen erschließt sich die ganze Bandbreite der Feigheit als vielschichtiges und facettenreiches Phänomen. Haltung zeigen und sich Herausforderungen stellen: Dieses sozialpsychologische Buch lässt einen nicht kalt und macht Mut, couragiert und mit Anstand zu handeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Heidi Kastner
Feigheit
Heidi Kastner
Feigheit
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2025 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Umschlaggestaltung: Isabel Neudhart-Haitzinger
Illustration Cover: © ekapanova
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Gazpacho
Lektorat: Barbara Köszegi
Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN: 978-3-7110-0363-8
eISBN: 978-3-7110-5379-4
Für den Verlag, der nicht zu feige war, dieses Buch herauszubringen.
Inhalt
Feigheit
Feigheit und Zivilcourage
Feigheit und Beziehung
Feigheit und Verbrechen
Feigheit und politische Korrektheit
Feigheit und Toleranz
Feigheit und Politik
Feigheit und die Geschichte von Männern und Frauen
Nachwort
Literatur
Über die Autorin
Feigheit
Das vorliegende Buch ist als Essay über die Feigheit zu verstehen beziehungsweise über diejenigen Aspekte dieses Phänomens, die bei mir wiederkehrend Unbehagen auslösen. Es ist deutlich zu kurz, um das Thema mit wissenschaftlicher Gründlichkeit oder moralphilosophischer Tiefe abzuhandeln. Feigheit ist ein derart umfassendes und vielschichtiges Phänomen, dass man ihm kaum in allen Aspekten gerecht werden kann, aber eines, das die Menschheit vermutlich seit Anbeginn begleitet und durchgängig negativ bewertet wurde.
Unser deutsches Wort »feige« stammt aus dem achten Jahrhundert und bedeutete ursprünglich »dem Tod geweiht«. Erst sekundär wurde daraus die Bezeichnung für ein »Verhalten, so wie wenn man dem Tod geweiht wäre«. In den nordischen Sprachen wurde es zum Synonym für »verrückt«, im Mittelhochdeutschen bekam es die Bedeutung von »vor dem Tode oder der Gefahr zurückschreckend«, »ängstlich«, »gottlos« und auch »verhasst«, war aber noch unscharf definiert. Feigheit oder auch Memmenhaftigkeit (abgeleitet von »mamma«, dem lateinischen Wort für Mutterbrust) als ein Wesenszug furchtsamer, verweichlichter Menschen, die eben zu lange an der Mutterbrust gehangen und nie gelernt hatten, für sich oder für andere einzustehen, wurde immer negativ bewertet und mit mangelndem Ehr- und Schamgefühl verbunden. Theophrast, ein griechischer Philosoph, beschrieb die Feigheit als »furchtsame Nachgiebigkeit der Seele«, Platon führte die Tapferkeit (griechisch »andreia«) als eine der vier Kardinaltugenden an (und ihr Antonym, die Feigheit, damit als das Gegenteil einer Tugend), Shakespeare schloss an die Bedeutung der Todgeweihtheit an und schrieb: »Es stirbt der Feige oftmals, eh er stirbt.« Jonathan Swift meinte gar, dass es unklug sei, Feige mit Schande zu strafen, »denn achteten sie deren, so wären sie keine Feiglinge: Hier muss Tod die Strafe sein, weil sie den am meisten fürchten«.
Feigheit kann als Persönlichkeitseigenschaft (immer feig) oder als Phänomen verstanden werden, das sich nur in spezifischen Situationen manifestiert (jetzt gerade feig, aber sonst auch mutig), und bezeichnet ein Verhalten, das aus einer Kombination von Emotionen und kognitiver Bewertung resultiert.
Schon in der Antike bezog sich die Feigheit hauptsächlich auf den Militärdienst beziehungsweise auf dessen Verweigerung und wurde mit sozialer Ächtung bestraft, wobei die Römer deutlich weiter gingen und die ganze Truppe, die einen Feigling inkludierte, mit Dezimation sanktionierten, also der Exekution jedes Zehnten. Diese Form des Umgangs mit Feigheit im Kampf, nämlich die Bestrafung mit dem Tod, hielt sich bis in die Neuzeit, wobei je nach dem Stand des Betroffenen Unterschiede gemacht wurden: Mittelalterliche Ritter wurden nur aus dem Kreis der Standesgenossen ausgeschlossen. Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich hatte nach der verlorenen Schlacht von Breitenfeld 1642 ein ausgeprägtes Bedürfnis, die aus seiner Sicht für die Niederlage Verantwortlichen massiv zu bestrafen, und ließ die höheren Offiziere köpfen, die niederen hängen und jeden Zehnten aus der Mannschaft erschießen. Im Ersten Weltkrieg wurden Soldaten, die das Kämpfen verweigerten, erschossen (so auch rund 200 britische Soldaten, einige davon vermutlich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung wie Private Harry Farr, der 2006 rehabilitiert wurde). In Frankreich nannte man die Exekutierten »les fusillés pour l’exemple«, man statuierte also ein Exempel, um das kampfverweigernde Verhalten nicht ausufern zu lassen. Besondere Hochkonjunktur hatten solche terminalen, gegen die eigenen Leute gerichteten Maßnahmen immer in diktatorischen Regimen: Stalin erließ 1942 den berüchtigten Befehl Nr. 227 (»Nicht einen Schritt zurück!«), nach dem alle flüchtenden Armeeangehörigen von Schutzsperrabteilungen, die hinter der Truppe positioniert waren, sofort erschossen wurden. Das deutsche NS-Regime stand dem nicht nach und exekutierte circa 15.000 Soldaten wegen Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung, einige davon durch öffentliche Erschießung. Im US-Militärstrafrecht ist Feigheit vor dem Feind (UCMJ, Artikel 99) weiterhin ein Straftatbestand.
Eine besonders negative und sanktionsintensive Bewertung der Feigheit findet sich also (außer in diktatorischen Regimen: dort wird sie nur im Krieg sanktioniert, in allen anderen Bereichen aber vorausgesetzt) immer dort, wo in einer Gesellschaft gemeinsame Moralvorstellungen herrschen und feiges Verhalten andere gefährdet oder einer Bedrohung aussetzt, die durch gemeinsame Anstrengung abgewehrt werden muss, in erster Linie also in Kriegen, die von der Bevölkerung eines Staates als erforderlich erachtet werden. Die Haltung der amerikanischen Zivilgesellschaft zu amerikanischen Wehrdienstflüchtigen im Vietnamkrieg spiegelte die generell gespaltene Einstellung zu diesem Krieg wider, der von vielen als »ungerechter Krieg« angesehen wurde (diese sahen in Deserteuren mutige moralische Vorbilder, und Kanada gewährte circa 50.000 bis 100.000 solchen Amerikanern Asyl), wohingegen konservative, patriotische Gruppen die Wehrdienstverweigerer als feige Vaterlandsverräter empfanden und dafür sorgten, dass sie bei ihrer Rückkehr von Hochschulen ausgeschlossen und beruflich benachteiligt wurden.
Im zivilen Leben drohte für Feigheit in erster Linie Ehrverlust, wohingegen der vermeintlich Ehrhafte, der die Herausforderung zu einem Duell annahm, Gefahr lief, getötet zu werden. Je nach subjektiver Werthaltung konnte es also durchaus sinnvoller sein, feige zu sein, aber am Leben zu bleiben, was in der chinesischen Philosophie auch so gesehen wurde: Dort sah man unreflektiert mutiges Verhalten je nach Ausgangslage als potenziell selbstgefährdend an und hielt denjenigen für weise, der nicht vorpreschte, sondern auf eine günstige Entwicklung der Verhältnisse wartete. Angesichts der in der aktuellen Jugendkultur fest verankerten »Mutproben« (wie das »Selfie-Surfen« mit immer wieder einmal tödlichem Ausgang) würde man sich bisweilen fast mehr Feigheit wünschen.
Klar wird jedenfalls, dass die negative Bewertung der Feigheit sehr viel mit moralischer Wertung zu tun hat und dass Feigheit heute hauptsächlich als mangelndes Moralempfinden und Untugend gesehen wird. Der Schriftsteller Ambrose Bierce, für den der amerikanische Bürgerkrieg das prägende Lebensereignis war, nannte in seinem »Wörterbuch des Teufels« einen Feigling »einen Mann, der mit den Beinen denkt«, der sich wegduckt, Konfrontationen aus dem Weg geht oder sich in Lügen und Ausreden flüchtet, also einen Getriebenen, der nie zur Ruhe kommen kann und immer auf der Hut sein muss. Was ihn antreibt, ist die Angst vor irgendeinem persönlichen Schaden oder Nachteil, wobei er seinen Vorteil immer höher bewertet als mögliche Nachteile anderer und daher moralisch gesehen versagt. Hannah Arendt befasste sich in ihren Werken wiederholt mit der Feigheit, vor allem in Zusammenhang mit Totalitarismus, moralischer Verantwortung und individuellem Handeln in Krisenzeiten. Sie sah Feigheit als eine Form von Verantwortungslosigkeit, die dazu führt, dass Menschen sich nicht als moralisches Subjekt verhalten, sich mit anderen nicht verbunden fühlen, aus Angst oder Bequemlichkeit nicht handeln und damit Unrecht zulassen oder ermöglichen. »Das größte Übel, das wir unseren Menschen antun können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist die absolute Unmenschlichkeit«, schrieb George Bernard Shaw in seinem Theaterstück »Der Teufelsschüler«. Einstein schlug in eine ähnliche Kerbe und meinte einmal, die Welt werde nicht bedroht von denen, die böse seien, sondern von denen, die das Böse zuließen. Dabei manifestierte sich laut Arendt die Feigheit oft als Kombinationspaket mit Denkfaulheit: Statt sich zu eigenen moralischen Wertungen durchzuringen, wird aus Bequemlichkeit die Konformität gewählt und die individuelle Schuld unter der Masse der Gleichgesinnten begraben. »Wo alle schuldig sind, ist es keiner«, so Hannah Arendt in »Macht und Gewalt«.
2008 verfasste Franz M. Wuketits, Professor für Wissenschaftstheorie an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Biowissenschaft, sein Buch »Lob der Feigheit«. Darin vertrat er, ausgehend von einer evolutionsgenetischen Perspektive, die Ansicht, dass der Feigling, der Gefahren und das Risiko von Auseinandersetzungen nach Möglichkeit meidet, grundsätzlich positiv zu bewerten sei und für die Haltung des moralischen Individualismus stehe, der den Einzelnen und sein Wohlergehen in den Vordergrund stelle. Diese Einstellung beruhe auf dem Egoismus: Der moralische Individualist akzeptiere aber die Lebensstile der anderen, übe sich in Toleranz, wolle in Ruhe gelassen werden und lasse andere in Ruhe. Statt Prinzipienethik vertrete er eine individuelle Verhandlungsmoral. Er akzeptiere alles, was ihm und anderen nachweislich nicht schade, lasse sich aber nichts vorschreiben und trete für ein selbstbestimmtes Leben ein. Abgesehen davon, dass hier offenbleibt, wie im Zusammenleben unvermeidliche Konflikte gelöst und überbordende Ansprüche anderer eingegrenzt werden sollen, nach welchen Richtlinien also die gesellschaftliche Struktur des sozialen Wesens Mensch organisiert werden soll, klingt diese Einstellung mittlerweile sehr vertraut und manifestierte sich nicht zuletzt in den massiven Protesten während der rezenten Pandemie, ist also nicht mehr nur Theorie, sondern zumindest anlassbezogen erlebbare Praxis. Der Begriff der Feigheit, der bislang mit einer moralischen Ordnung verknüpft war, die als Orientierung an einer über uns selbst hinausreichenden Verantwortung für andere, für die Welt gesehen wurde, erfährt so eine neue (und eben positive) Bedeutungszuschreibung. Wenn noch dazu aktuell weltweit offensichtlich verlogene, unverhohlen egomanische und anstandsbefreite Personen mit Führungsanspruch dafür als »mutig« (ergo: tugendhaft) gelobt werden, dass sie ihre Ansichten lauthals verkünden, stellt sich die Frage, ob wir nicht nur in einer Zeit des Klimawandels, sondern vor allem in einer Zeit des Moralwandels leben und welcher Wandel sich im Ergebnis als bedrohlicher erweisen wird.