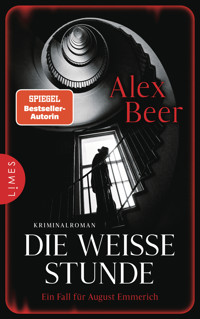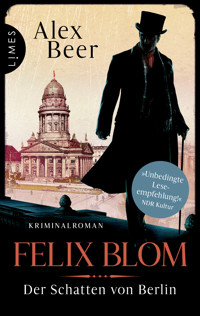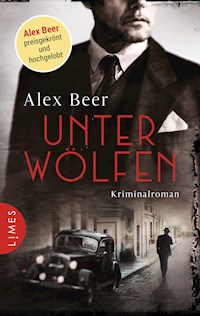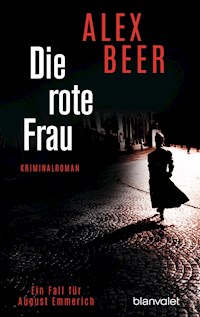9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Felix-Blom-Krimi
- Sprache: Deutsch
Vom Gauner zum Meisterdetektiv: Felix Blom kennt alle Tricks und bringt Berlins Verbrecher ins Schwitzen – der grandiose Auftakt der neuen spannenden Krimireihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Alex Beer!
Berlin, 1878: Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, scheitern. Aber dann hat Blom eine geniale Idee: Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin zusammentun? Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei, allerdings sind die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt: „In wenigen Tagen wirst Du eine Leiche sein.“ Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich …
Lesen Sie auch die anderen Bücher von Alex Beer!
Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe:
Der zweite Reiter: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 1)
Die rote Frau: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 2)
Der dunkle Bote: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 3)
Das schwarze Band: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 4)
Der letzte Tod: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 4)
Die Isaak-Rubinstein-Reihe:
Unter Wölfen (Bd. 1)
Unter Wölfen – Der verborgene Feind (Bd. 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Berlin, 1878: Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, scheitern. Aber dann hat Blom eine geniale Idee: Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin zusammentun? Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei, allerdings sind die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt: »Binnen dreißig Stunden musst Du eine Leiche sein.« Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich …
Die Autorin
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Für ihre Kriminalromane wurde sie mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter der Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur 2017 und 2019, der Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels MIMI 2020, der Österreichische Krimipreis 2019 sowie der Fine Crime Award 2021. Zudem stand sie auf den Shortlists für den Friedrich Glauser Preis, den Viktor Crime Award und den Crime Cologne Award. »Felix Blom – Der Häftling aus Moabit« ist der Auftakt einer neuen Krimireihe, die im preußischen Berlin spielt.
Von Alex Beer bereits erschienen
Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe:
Der zweite Reiter
Die rote Frau
Der dunkle Bote
Das schwarze Band
Der letzte Tod
Die Isaak-Rubinstein-Reihe:
Unter Wölfen
Unter Wölfen – Der verborgene Feind
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
ALEXBEER
FELIXBLOM –DERHÄFTLINGAUSMOABIT
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann GbR.
© 2022 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Regine Weißbrod
Covergestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Colin Thomas/bookcoversphotolibrary.com, stock.adobe.com (АлександрБеспалый, ilolab, rh2010, schab, bluepen) und Niday Picture Library/Alamy Stock Foto
JA · Herstellung: sam
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-29717-6V002
www.limes-verlag.de
1
Die Abenddämmerung neigte sich ihrem Ende zu. Das blasse Himmelsblau verwandelte sich in düsteres Grau, das dem nahen Spreeufer eine unheimliche Aura verlieh.
»Mir gefällt das hier nicht!« Ein grobschlächtiger Kerl, der wegen seiner tiefen Blatternarben »Atzi das Sieb« genannt wurde, blieb stehen und kniff die Augen zusammen.
Atzis Kumpane, zwei schlaksige Brüder namens Fred und Hugo, runzelten die Stirn und sahen sich um.
»Warum?«, fragte Hugo.
Der Wind frischte auf, spielte mit den Zweigen der Bäume und Büsche, sodass konfuse Schattenspiele entstanden.
»Spürt ihr es nicht?« Atzi fröstelte. »Das ist kein guter Ort hier.« Zur Untermauerung seiner Worte präsentierte er seinen Arm. »Seht nur: Gänsehaut.«
»Du bist viel zu dünn angezogen.« Fred rieb den Stoff von Atzis löchrigem Gehrock zwischen den Fingern und bedeutete ihm weiterzugehen.
»Die Härchen prügeln sich nicht wegen der Kälte um einen Stehplatz«, erklärte Atzi trotzig. »Das ungute Gefühl kommt von hier.« Er klopfte sich mit der flachen Hand auf den Bauch.
»Hast wohl zu viel Aal gegessen.« Hugo grinste.
Atzi ging nicht auf die Bemerkung ein. »Jungchen, hat meine Mutter immer gesagt. Jungchen, du musst auf deine Gedärme hören – und die sagen, dass wir uns trollen sollen. Das ist kein guter Ort hier«, wiederholte er.
»Spinnste? Wir sind nicht den ganzen Weg nach Bohneshof gekommen, um jetzt wieder abzuhauen, nur weil deine Mutter einen auf Gefühle gemacht hat«, schimpfte Hugo. Tatsächlich hatte es die drei Ganoven viel Zeit gekostet, um von ihrer Unterkunft in Tempelhof an den östlichsten Zipfel von Charlottenburg zu gelangen, der sich in den vergangenen Jahren trotz schlechter Verkehrsanbindung zu einem aufstrebenden Industriegebiet gemausert hatte.
Atzi das Sieb sah sich noch einmal um. Rechts von ihnen ragte, flankiert von Speicher- und Mühlengebäuden, eine Zichorienfabrik in den Himmel, während auf der anderen Seite ein Kahn durch die dunklen Wasser der Spree glitt.
»Seit wann bist du ein Feigling?«, wunderte sich Fred. »Ich kann mich gut an die Schlacht von Orléans erinnern. Weißt du noch? Wir haben an vorderster Front gestanden, und die verdammten Franzmänner hatten ihre gesamte Artillerie aufgefahren. Trotzdem hast du nicht mal mit der Wimper gezuckt.«
»Damals hatten wir keine Wahl und – was am allerwichtigsten ist: Mein Bauch hat gesagt, dass alles gut ist.« Atzi hielt die Nase in den Wind und schnupperte. »Riecht doch mal. Das riecht nach Tod und Verderben. Nicht mal nach dem Gemetzel bei Weißenburg hat es so gestunken – und das war im Hochsommer.« Er schauderte und murmelte etwas von Blut, Schweiß und Kot.
»Der Mief kommt von der Knochenmehlfabrik.« Fred deutete mit dem Kopf nach Westen, wo sich vor dem Charlottenburger Verbindungskanal massive Gebäude und hohe Fabrikschlote abzeichneten.
»Bist du sicher?«
»Ja. Woher soll’s denn sonst kommen?« Ein ungehaltener Unterton hatte sich in Hugos Stimme geschlichen.
»Na ja …« Atzi druckste herum.
»Alles läuft nach Plan«, versicherte Fred. »Wir warten, bis es dunkel ist, dann holen wir uns die Kohle aus der Ludloff’schen Porzellanmanufaktur und hauen wieder ab. Mindestens tausend Mark liegen in der Kasse, hat die fette Rosalie gemeint. Vielleicht sogar mehr.« Er stieß Atzi den Ellenbogen in die Rippen. »Überleg doch nur, was du dir mit deinem Anteil alles gönnen könntest: Weiber, Schnaps, schöne Schuhe …«
Atzi seufzte, zog sich den Hemdkragen über Mund und Nase und stapfte weiter über den unebenen Boden der schlammigen Brache. Das Gelände war unwegsam, grobe Steine und Frostlöcher wurden zu Stolperfallen und machten das Gehen im Zwielicht zur Herausforderung. »Und du bist sicher, dass die fette Rosalie das hinkriegt?«
Fred nickte. »Der Nachtwächter, der hier auf dem Gelände patrouilliert, besucht jeden Sonntagabend den Puff, in dem sie arbeitet. Ich hab ihr einen Anteil an der Beute versprochen, wenn sie dem Kerl heute Schnaps ins Bier kippt und ihn anschließend richtig hart rannimmt. Auf jeden Fall wird sie dafür sorgen, dass er nicht vor neun hier antanzt.« Er blieb hinter einem windschiefen Schuppen stehen und steckte sich eine Kippe an. »Hast du das Stemmeisen?«
Atzi zog das Werkzeug aus dem groben, feucht müffelnden Jutesack, der über seiner Schulter hing. Als über seinem Kopf eine Fledermaus durch das Dunkel flatterte, zuckte er zusammen.
»Herr im Himmel, Atzi, was ist denn heute los mit dir?«
»Hab ich doch schon gesagt. Das Bauchgefühl.« Atzi atmete schwer, deutete auf die Zigarette, die in Freds Mundwinkel klemmte, und streckte die Hand aus. »Das Bauchgefühl und …«, fügte er flüsternd hinzu, sprach aber nicht weiter.
»Das Bauchgefühl und was?« Missmutig reichte Fred seinem Kumpan eine Kippe.
»Raus mit der Sprache!«, forderte auch Hugo.
Atzi blickte sich um. »Das …«, sagte er schließlich. »Das und Siemens.«
»Siemens?«
Atzi nickte. »Ich hab gehört, dass die hier in Bohneshof ein Versuchslaboratorium eingerichtet haben sollen.«
»Na und?« Fred sah ihn an, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. »Wahrscheinlich ist das Siemenswerk drüben in der Friedrichstadt zu klein geworden, also haben sie hier ein Gebäude dazugekauft.«
»In der Friedrichstadt ist genug Platz«, flüsterte Atzi. »Und auch, wenn nicht … Warum das neue Labor hier in Bohneshof bauen? Am Arsch der Welt? Ich sag’s euch«, fuhr er fort, ohne auf eine Antwort zu warten, »die Jungs von Siemens sind hergezogen, weil sie hier kaum Nachbarn haben und ihre Versuche im Geheimen durchführen können.«
»Und wenn schon. Sollen sie doch.« Hugo zuckte mit den Schultern. »Was geht uns das an? Wir wollen nichts von denen. Alles, was wir wollen, ist der Zaster aus der Porzellanmanufaktur. Was ist also das Problem?«
Atzi steckte sich die Zigarette an und kratzte sich am Kopf. »Ihr glaubt mir ja doch nicht.«
»Jetzt sag schon.«
Atzi seufzte leise. »Erinnert ihr euch an den ollen Meister Emil?«
»Den Klugscheißer?«
»Das ist kein Klugscheißer, der ist echt schlau. Der hat viele Bücher gelesen und so. Jedenfalls hat er mir was erzählt.« Atzi trat näher an Fred und Hugo heran. Er senkte die Stimme. »An der Universität in Ingolstadt, da soll es einen Wissenschaftler geben, einen Schweizer, der macht Tote mit Elektrizität wieder lebendig.«
»Und wie? Indem er ihnen Strom in den Arsch leitet?« Fred lachte. »Da hat dir der alte Schlaumeier einen ordentlichen Bären aufgebunden.«
»Hat er nicht«, beteuerte Atzi. »Überleg doch mal, wie viel Schotter man mit so ’ner Erfindung machen könnte. Die Jungs bei Siemens wären schön blöd, nicht daran zu forschen.«
Plötzlich erklang hinter ihnen das Knirschen von Steinchen, begleitet von leisem Wimmern.
Atzi riss die Augen auf und ließ das Stemmeisen fallen. »Verdammt! Was war das?«
»Jetzt mach dir nicht ins Hemd«, versuchte Fred ihn zu beruhigen. »Das war nur irgendein Tier. Wahrscheinlich eine Katze oder ein streunender Köter.« Er warf den Zigarettenstummel zu Boden, trat ihn aus und hob das Brecheisen auf. »Packen wir’s an. Vom Nachtwächter ist weit und breit nichts zu sehen. Wie’s aussieht, hat die fette Rosalie ganze Arbeit geleistet.« Er ging los, als die Geräusche erneut erklangen.
Atzi bekreuzigte sich, machte zwei Schritte rückwärts, stolperte und fiel auf den Hintern. Mit aufgerissenen Augen starrte er nach Süden, wo sich im fahlen Schein des aufgehenden Mondes die Silhouette eines Menschen abzeichnete, der mit ungelenken Schritten in Richtung Spree wankte.
»Das ist nur ein Besoffener.« Hugo reichte seinem Kumpan die Hand und zog ihn hoch. »Knüppeldicke voll.«
»Hier ist weit und breit keine Kneipe«, flüsterte Atzi. Er ließ die Gestalt, die nun regungslos am Flussufer stand, nicht aus den Augen. »Dafür aber das Labor von Siemens.«
Darauf wussten selbst seine Kumpane nichts zu sagen. Fred umfasste das Stemmeisen fester. Hugo spannte die Muskeln an.
Im kalten Mondlicht schimmerte plötzlich etwas Silbernes. Ein faustgroßer Funke blitzte auf, während gleichzeitig ein ohrenbetäubender Knall ertönte.
»Scheiße! War das etwa …«
»Ein Schuss«, vervollständigte Fred den Satz.
Hugo boxte Atzi in die Seite. »Beinahe hättest du uns mit deinem Gerede über Siemens und diesen Kerl aus Ingolstadt ins Bockshorn gejagt«, schimpfte er. »Das war kein lebender Toter – das war ein Selbstmörder.« Er zündete seine Laterne an, marschierte ans Ufer und blieb neben dem leblosen Körper stehen.
Das Licht war schwach, trotzdem ließ sich erkennen, dass es sich bei dem Toten um einen hübschen jungen Mann handelte. Seine Gesichtszüge waren ebenmäßig, die makellose Haut so hell, dass sie einen starken Kontrast zu dem dunklen Blut bildete, das aus einer Wunde an der Schläfe rann und ins Erdreich sickerte. Seine Augen starrten ins Nichts, sein Mund stand offen, als habe ihn sich der Tod inmitten eines letzten Seufzers geholt.
»Der ist hinüber«, sagte Fred, der seinem Bruder gefolgt war.
»Lasst uns ’ne Fliege machen«, rief Atzi aus sicherer Entfernung.
»Gleich.« Fred ging in die Hocke und schob die Hand in die Hosentasche des Toten.
»Spinnst du? Du kannst das arme Schwein doch nicht ausnehmen!«, rief Atzi.
»Warum nicht? Er braucht’s nicht mehr.« Fred nestelte und wühlte, zog ein paar Münzen hervor, steckte sie ein und klopfte die Jacke ab.
»Mach schneller.« Atzi war näher gekommen und schauderte. »Irgendwas ist hier nicht koscher, ich fühl mich beobachtet. Spürt ihr es nicht? Wir sind nicht allein.« Er sah sich um. »Kommt, wir scheißen auf die fette Rosalie und die Porzellanfabrik. Lasst uns in den Tiergarten fahren. Ich geb euch ein Bier aus.«
Fred seufzte. »Von mir aus.« Er wollte die Leichenfledderei gerade beenden, als es unter seinen Fingern raschelte. Er hielt inne und zog zufrieden lächelnd einen Packen Papier aus der Tasche des Toten. Das Lächeln verschwand, als er erkannte, dass er keine Geldscheine ins Dämmerlicht befördert hatte, sondern Briefe.
Hugo nahm ihm einen davon aus der Hand, faltete ihn auseinander und hielt sich das Papier nah vors Gesicht. Es war mit kleinen, ungelenken Buchstaben beschrieben. »Abschiedsbriefe«, murmelte er, kniff die Augen zusammen und versuchte, die Worte zu entziffern.
»Steckt die zurück.« Atzi klang verärgert. »Das ist nicht in Ordnung. Eure Eltern wären auch froh, wenn eure letzten Worte kein Wildfremder lesen würde.«
»Unsere Eltern sind tot, und auch, wenn nicht – um unsere letzten Worte hätten die sich genauso wenig geschert wie um unsere ersten.« Fred seufzte erneut, tat jedoch, wie ihm geheißen.
Hugo strich mit den Fingerspitzen über das Hemd des Selbstmörders. »Seine Kleider sind sauber und gepflegt. Er sieht wie jemand aus, dem die Welt weit offen stand. Was ihn wohl zu solch einer Verzweiflungstat getrieben hat? Geldsorgen? Harter Schanker? Erinnerungen an den Krieg?«
Atzi trippelte nervös von einem Fuß auf den anderen. »Weiber. Am Ende sind’s immer die Weiber.«
Hugo hielt die Laterne so, dass ihr Schein das Gesicht des Toten beleuchtete, während seine Hand in die Innentasche von dessen Jacke glitt. »Der Kerl hat wirklich gut ausgesehen, der hatte doch sicher kein Problem mit Frauenzimmern.« Er hielt inne, zog eine Karte aus der Tasche und musterte sie. Sie war nicht mit den kleinen, gedrungenen Buchstaben der Abschiedsbriefe vollgekrakelt, sondern wurde von elegant geschwungen Lettern geziert.
Fred sah seinem Bruder über die Schulter und las mit. »Scheiße«, murmelte er.
»Mir reicht’s«, erklärte Atzi. »Ich mach jetzt einen Abgang.«
Die Brüder schienen die Worte ihres Kompagnons nicht wahrzunehmen. »Um Himmels willen …«, murmelte Hugo und las erneut, was auf der Karte stand. Sein Blick wanderte zurück zu der Leiche. »Was hat das nur zu bedeuten?«, fragte er leise, wobei seine Stimme zitterte.
»Kommt ihr?«
Fred und Hugo nickten und steckten die Karte zurück.
»Die Weiber waren’s nicht«, erklärte Hugo und stand auf.
»Dein Bauch hat recht, Atzi.« Fred sah sich nervös um. »Irgendwas stimmt hier nicht.«
2
Drei Jahre lang war er wie lebendig begraben gewesen. Gefangen hinter Mauern des Schweigens. Tag für Tag dieselbe geistlose Routine, dieselben farblosen Wände, faden Gerüche und derselbe geschmacklose Fraß. Jedes Kloster hatte mehr Sinn und Lebensfreude zu bieten als dieser eintönige, trübsinnige Albtraum: das Zellengefängnis Moabit.
Felix Blom, Häftling mit der Nummer D13, schloss die Augen und versuchte, sich an die Außenwelt mit ihren Schönheiten und Genüssen zu erinnern: an das zarte Schmelzen von Borchardts Entenpastete im Mund, das Prickeln von Champagnerperlen auf der Zunge und den Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee. Er dachte an Augustes süße Lippen, an das Gefühl von Seide auf der Haut, das Kribbeln von Schnupftabak in der Nase und an die Klänge von Verdis Aida.
Wie sehr er sein altes Leben vermisste!
Das Rattern der vorbeifahrenden Lehrter Eisenbahn erfüllte die zwei mal vier Meter, die seit Juni 1875 sein Zuhause darstellten, und Blom seufzte wohlig. Jeden Laut, ganz gleich welcher Natur, empfand er als Wohltat, denn nichts war so schrecklich wie die verdammte Stille hier drinnen – diese alles durchdringende, alles erstickende Ruhe.
Der preußische Strafvollzug behandelte Kriminalität, als sei sie etwas Ansteckendes, weswegen die Gefangenen, die länger als ein paar Monate saßen, strikt voneinander separiert wurden. Jeder von ihnen – gleich, was er verbrochen hatte – war in Isolationshaft untergebracht. Die Insassen mussten einsam und allein essen, schlafen und arbeiten, in Zellen mit Wänden so dick und Fugen so eng, dass jeglicher Kontakt durch Rufen oder Klopfen ein Ding der Unmöglichkeit war.
Selbst der Spazierhof war in einer Art und Weise angelegt, dass die Häftlinge einander nicht sehen und hören konnten. Sogar beim sonntäglichen Kirchgang waren sie durch Holzwände streng voneinander getrennt.
Der Staat hielt dieses System für eine moderne Errungenschaft. Blom hielt es für menschenverachtend.
Die einzigen Gespräche, die er in den vergangenen eintausendundsechsundneunzig Tagen geführt hatte, waren jene mit sich selbst. Vor ein paar Wochen war er deswegen so bedrückt gewesen, dass er entgegen jeglicher persönlichen Überzeugung mit dem Gedanken gespielt hatte, zur Beichte zu gehen, nur um endlich mit einem anderen menschlichen Wesen zu reden, selbst wenn es sich dabei um einen Pfaffen handelte.
»Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen«, sang er leise den Freiheitschor aus Verdis Nabucco vor sich hin und lächelte. Mit der Verzagtheit war es nun vorbei, denn heute war es so weit: Er hatte seine Strafe verbüßt und würde entlassen werden.
Er hatte es geschafft, Tausende von öden, stillen Stunden hinter sich zu bringen, ohne den Verstand zu verlieren. Andere Häftlinge, das wusste er, hatten nicht so viel Glück gehabt. Und er wusste auch, dass die Wärter und Priester dieser vermaledeiten Einrichtung tatsächlich glaubten, die häufigen Fälle von Wahnsinn hätten ihren Ursprung in der unerträglichen Last der Schuld, die die eingesperrten Verbrecher trugen. Doch das war nicht der Grund. Es lag an dieser verdammten Enge, dem Stumpfsinn und der Langeweile. Daran, dass sie von den vier weißen Wänden, die sie umgaben, jeden kleinen Fleck und jede winzige Spalte auswendig kannten.
Blom verschränkte die Arme hinter dem Kopf, schloss die Augen und fühlte, wie sein Herz vor Freude zu hüpfen begann. Endlich würde er aus diesen Mauern hinaustreten und ungefilterte Luft atmen. Er würde die Sonne auf der Haut spüren und den Wind im Gesicht. Danach würde er den verdammten Bastard zur Rechenschaft ziehen, der ihm die Haft eingebrockt hatte. Und sobald das erledigt war, wollte er seine geliebte Auguste zurückgewinnen. Gemeinsam würden sie Fasanenbraten bei Lutter in der Französischen Straße essen und im Orpheum tanzen. Sie würden Sekt schlürfen, singen und trunken vor Freiheit das Leben feiern.
Er warf einen Blick zur Tür und zum Fenster. Die Sonne war bereits aufgegangen. Wo blieben die Aufseher? Sie sollten längst hier gewesen sein, um ihn abzuholen.
Ein ungutes Gefühl kroch durch seinen Körper, ein Hauch von Panik überkam ihn. Was, wenn sie ihn vergessen hatten? Was, wenn sie nicht daran dachten, ihn gehen zu lassen? Hatte er sich etwa bei den abgebüßten Tagen verzählt? Oder alles nur geträumt? War seine Zeit noch gar nicht gekommen?
Das laute Ratsch, das mit dem Öffnen der Beobachtungsspalte einherging, brachte seine Gedanken zum Stillstand. Ein Paar dunkler Augen starrte ihn durch den schmalen Schlitz an, dann wurde das Klappern von Schlüsseln hörbar. Kurz darauf ging die Tür auf, und ein Wärter erschien.
»Los!«, sagte er in strengem Tonfall. »Auf mit dir, D13. Zieh dich an!«
Noch nie hatte sich Blom so sehr über derart ruppige Worte gefreut. Er schwang sich aus der schmalen Hängematte, die knapp über den Zellenboden gespannt war, und streifte die braune Häftlingskleidung über, auf deren Brust ein Messingabzeichen prangte, in das seine Nummer geprägt war. »Ich bin nicht länger D13. Seit heute habe ich einen Namen. Ich bin …«
»Nicht, solange du hier drinnen bist«, unterbrach der Wärter. »Mütze!«, wies er an und deutete nach draußen.
Blom setzte die Kopfbedeckung auf, die in der Haftanstalt Moabit verpflichtend war, sobald man seine Zelle verließ. Er klappte deren Schirm hinunter, so dass sein Gesicht zur Hälfte verdeckt und sein Sichtfeld stark eingeschränkt war. Auf diese Weise konnten die Insassen keinen Augenkontakt miteinander herstellen.
Den Blick auf die Füße gerichtet, folgte er dem Wärter durch das Hochsicherheitsgefängnis, das nach Vorlage der englischen Strafvollzugsanstalt Pentonville erbaut worden war: Vier hell beleuchtete Zellenflügel strahlten wie die Speichen eines Rades sternförmig von einem zentralen Punkt aus, von dem jeder Winkel des Gebäudes einsehbar war.
Hier saß sie ein, die Crème de la Crème der Berliner Verbrecherwelt.
Und er war einer von ihnen.
Der Beste.
Schweigend marschierten sie über den schwarzen Asphaltboden, der so glänzte, als bestünde er aus poliertem Blei. Sie kamen an einer Vielzahl schmaler Türen vorbei, bis sie schließlich die Zentralhalle erreichten, in der sich die vier Flügel vereinten. Hier lauerten zwei Wärter wie Spinnen in einem Netz, ob irgendwo eine Fliege zappelte, die es einzufangen galt. Beide Männer starrten ihn mit böser Miene an.
»Kopf runter!«, knurrte der Aufseher, der ihn abgeholt hatte.
Blom gehorchte. Es würde das letzte Mal sein.
Als sie die schmale Pforte passierten, die hinaus zum Hinrichtungsplatz führte, fröstelte er. Schnell folgte er dem Wärter weiter in den Verwaltungstrakt, wo sein Aufpasser an eine Tür klopfte, sie öffnete und ihn in den Raum schubste.
»Na sieh mal einer an«, tönte ihm eine sonore Stimme entgegen. »Wen haben wir denn da?« In dem kargen, zweckmäßig eingerichteten Zimmer saß hinter einem massiven Schreibtisch ein beleibter Herr mit weißem Backenbart. Es war kein Geringerer als Carl Wilke, der Anstaltsleiter höchstpersönlich. Er hatte die Hände vor der Brust verschränkt und musterte seinen Gefangenen mit einer Mischung aus Abneigung und Neugierde.
Felix Blom beachtete ihn nicht, sondern schwelgte in den ersten neuen Eindrücken, die er seit drei Jahren wahrnehmen konnte: das Ticken einer Standuhr, das Knacken von Holzdielen, der Geruch von Kölnisch Wasser, Schuhpaste und Leder.
»Nur, damit Sie’s wissen«, erklärte Wilke, während er sich seitlich hinunterbeugte, eine Kiste vom Boden aufhob und diese unsanft auf dem Tisch abstellte. »Wenn es nach mir ginge, würden sie mindestens zehn weitere Jahre Gast meiner Institution bleiben.« Er öffnete den Deckel. »Oder noch länger.«
»Ich wurde reingelegt«, murmelte Blom geistesabwesend, während er sich umsah. Der weißgetünchte Raum mit dem dunkelbraunen Schiffsplankenboden war ungefähr zwanzig Quadratmeter groß, wirkte auf ihn aber so riesig wie ein Ballsaal. Ganz besonders hatte es ihm das Fenster angetan, das hinter dem Gefängnisdirektor in die Wand eingelassen war. Es war nicht vergittert und gab den Blick auf einen begrünten Innenhof frei, in dem sich eine Linde sanft im Wind wog. »Ich war’s nicht.« Es fühlte sich sonderbar an, mit einem anderen menschlichen Wesen zu sprechen.
Wilke lachte auf. »Hätte ich für jede heuchlerische Unschuldsbeteuerung, die ich in den letzten Jahren zu hören gekriegt habe, einen Pfennig bekommen, dann wäre ich längst ein reicher Mann.« Er schüttelte den Kopf und hob den Zeigefinger, so als wäre er kein Gefängnis-, sondern ein Schuldirektor, der ein ungezogenes Kind tadelte. »Sie haben mehr gestohlen als alle Diebe hier drinnen gemeinsam«, erklärte er. »Sie hatten Glück, dass die Beweislage damals so dürftig, Ihr Anwalt so gerissen und der Richter so gnädig war.« Ohne Blom auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen fasste er in die Kiste, zog Papiere sowie ein Bündel Kleider daraus hervor und schob diese über den Tisch. »Wie gesagt, wenn es nach mir ginge …«
Tut es aber nicht, wollte Blom entgegnen, verkniff es sich aber. Stattdessen griff er nach den Dingen auf dem Tisch. Es handelte sich dabei um das Entlassungsschreiben und die Kleidung, die er bei seiner Einlieferung getragen hatte: ein weißes Leinenhemd mit hohem Kragen, eine Halsbinde aus zinnoberrotem Samt, eine Hose mit Streifenmuster und darüber ein eleganter Gehrock aus besticktem Brokat. »Wo sind meine Melone und mein Spazierstock? Und wo sind meine Taschenuhr und meine Schnupftabakdose?«
Wilke tat, als hätte er die Fragen nicht gehört, und deutete auf das Entlassungsschreiben. »Unterzeichnen Sie das«, verlangte er und reichte Blom eine Schreibfeder. »Sie verpflichten sich darin, in eine feste Unterkunft zu ziehen und einer geregelten Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ihre Adresse sowie Ihren Arbeitgeber müssen Sie bei der nächsten Polizeistelle bekanntgeben, und zwar …« Seine Mundwinkel zuckten, es fiel ihm offenbar schwer, nicht zu lachen.
Blom verstand sofort: Die Sache hatte einen Haken. »Und zwar …?«
»Und zwar innerhalb von drei Tagen.«
Blom riss die Augen auf. »Drei Tage? Wie soll das gehen? Wie soll ich in so kurzer Zeit eine Bleibe und Arbeit finden?«
»Das ist nicht mein Problem.« Wilke lehnte sich zurück und zeigte auf das Dokument. »Ohne Unterschrift keine Entlassung.«
Blom runzelte die Stirn. »Warum hat mir das niemand gesagt? Ich hätte Briefe und Gesuche schreiben und mich um alles kümmern können. Zeit dafür hatte ich in den vergangenen drei Jahren mehr als genug, ich wäre sogar froh über eine Aufgabe und Kontakt mit der Außenwelt gewesen.«
»Was soll das heißen … niemand gesagt?« Wilke gab sich verdutzt. »Ich bin sicher, Sie wurden über sämtliche Auflagen genauestens informiert.« Seine Miene ließ keinen Zweifel daran, dass er sich seiner Lüge bewusst war.
Blom schnaubte. Er hätte sich denken können, dass die Exekutive ihm das Leben schwermachte. »Was, wenn ich es in der kurzen Zeit nicht schaffe?«
Dies war der Moment, in dem Wilke seine Häme endgültig nicht mehr verbergen konnte. Ein süffisantes Grinsen legte sich auf seine Lippen, und seine Augen leuchteten. »Bei einem Verstoß gegen die Auflagen erwarten Sie acht Tage Arrest im Stadtgefängnis mit anschließendem Aufenthalt im Arbeitshaus. Sollten Sie danach erneut nicht in der Lage sein, innerhalb von drei Tagen eine Meldeadresse und ein geregeltes legales Einkommen nachzuweisen …«, er breitete die Arme aus, »… dann heißt es: Willkommen zurück in Moabit.«
Blom schluckte und holte tief Luft. Der Weg in die Freiheit gestaltete sich schwieriger als gedacht, doch er hatte schon früh im Leben gelernt, dass man Probleme beseitigen konnte, und zwar am besten mit Geld.
Demonstrativ tauchte er die Feder in das Tintenfass, das vor Wilke stand, und unterschrieb das Dokument. »Apropos Einkommen … Was ist mit meinem Lohn? Für die Plackerei, die ich in den vergangenen drei Jahren verrichtet habe, steht mir eine Kompensation zu, nicht wahr?«
»Typisch Gauner«, murrte der Gefängnisdirektor. »Haben keine Ahnung von ihren Pflichten, aber kennen dafür ihre Rechte umso besser.« Er öffnete eine Schublade, entnahm ihr ein paar Scheine und Münzen und legte sie auf den Tisch. »Hundertfünfzehn Mark«, erklärte gönnerhaft. »Und dreißig Pfennig.«
Blom starrte auf seine schwieligen Finger. »Für drei Jahre Teppichknüpfen scheint mir das reichlich wenig.« Er betrachtete die paar lausigen Mark. Früher hatte er solch eine Summe oft innerhalb einer einzigen Nacht verprasst.
»Erstens haben wir Ihnen Kost und Logis verrechnet«, erklärte Wilke. »Es ist schließlich nicht einzusehen, dass das gesetzestreue Volk für Ihre Unterbringung aufkommen soll. Und zweitens sind Sie, was ehrliche Arbeit anbelangt, eine ungelernte Hilfskraft, verdienen also keinen hohen Stundentarif.« Er legte den Kopf schief und zuckte mit den Schultern. »Willkommen im echten Leben – dem Leben der ehrbaren, hart schuftenden Bürger, dem Leben des einfachen Mannes.«
Blom streckte die Hand aus, um nach dem Geld zu greifen, Wilke war schneller.
»Aber nicht doch.« Er schüttelte den Kopf. »So läuft das nicht.« Er reichte Blom ein paar Münzen. »Für eine Fahrkarte und etwas zu essen«, erklärte er gönnerhaft, während er das übrige Geld in einen Umschlag steckte. »Der Rest wird an das Polizeipräsidium am Molkenmarkt weitergeleitet. Dort wird es Ihnen ausbezahlt, sobald Sie vorstellig werden, um Ihren Wohnort und Ihre Arbeitsstätte zu melden.« Er ergötzte sich an Bloms Gesichtsausdruck und erhob sich. »Nun denn. Ziehen Sie sich um. Es wird gleich jemand kommen und Sie hinausbegleiten. Auf Wiedersehen.« Er sprach die beiden letzten Worte langsam und übertrieben deutlich aus.
»Ich denke nicht.«
Der Gefängnisdirektor schritt zur Tür, wobei er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete und auf Blom, der einen halben Kopf kleiner war, hinabblickte. »Ich bezweifle, dass Sie innerhalb von drei Tagen eine Bleibe und eine anständige Anstellung finden werden. Und selbst wenn das Wunder geschehen sollte … Sie sind einen großspurigen, ausschweifenden Lebensstil gewöhnt. Früher oder später werden Sie erneut straffällig werden. Ich tippe auf Ersteres. In diesem Sinne: Ziehen Sie sich um – und dann auf Wiedersehen.«
Blom unterdrückte den Impuls, dem Kerl die goldene Uhr zu stehlen, deren Kette viel zu auffällig aus der Westentasche baumelte. Stattdessen zog er unter Wilkes abschätzigem Blick seine braune Häftlingsuniform aus und schlüpfte in seine ursprünglich maßgeschneiderten Kleider. Inzwischen waren sie von Motten zerfressen worden und schlotterten lose um seinen dünnen Körper, dennoch – das Gefühl der edlen Stoffe auf der Haut war unbeschreiblich gut.
Er steckte die Entlassungspapiere ein und trat an die Tür, die exakt in diesem Moment geöffnet wurde.
Der Wärter, der ihn hergeführt hatte, bedachte ihn mit einem irritierten Blick.
Man konnte sagen, was man wollte: Kleider, auch wenn sie nicht mehr wie angegossen passten und Mottenlöcher hatten, machten Leute.
Schweigend verließen sie den Verwaltungstrakt, durchquerten einen kleinen Hof und ein massives Tor. Dann schritt Blom tatsächlich hinaus auf die Straße, die Gefängnispforten schlossen sich leise quietschend hinter ihm.
Überrumpelt und überwältigt zugleich stand er an der Lehrter Straße, inmitten von Farben, Gerüchen und Geräuschen. Inmitten von Leben und Freiheit.
D13 war Geschichte.
Er war zurück.
Felix Blom, der Meister der Tarnung und der Täuschung, der Mann mit den goldenen Fingern, der König der Diebe.
3
Kriminalkommissar Ernst Cronenberg, ein kleiner Mann, dessen wache blaue Augen hinter einer runden Drahtbrille blitzten, blieb stehen und atmete die kühle Morgenluft ein. Sie roch nach Flieder und frisch geschnittenem Gras. Dann betrat er mit zügigen Schritten den knarzenden Holzsteg, der über die dahinplätschernde Panke führte. »Warum genau wurden wir hergerufen?«
Cronenbergs hünenhafter Assistent, ein Polizist namens Bruno Harting, dessen rechter Haken weit über die Stadtgrenzen hinaus gefürchtet war, folgte seinem Vorgesetzten. Das morsche Holz der schmalen Brücke ächzte unter dem Gewicht seiner Muskelberge und bog sich gefährlich weit durch. »Wegen einer Leiche.«
Cronenberg seufzte und schüttelte den Kopf, auf dem ein Zylinder aus schwarzem Filz saß. »So viel war mir auch schon klar. Wir sind auf dem Weg in die Königliche Anatomie, mein lieber Bruno. Was sollte denn sonst dort auf uns warten, wenn nicht die Toten?«
»Mehr weiß ich leider auch nicht.« Bruno kaute gemächlich schmatzend auf einem Stück Tabak herum, während sie durch eine weitläufige Parkanlage gingen. Vögel zwitscherten in den knospenden Kastanienbäumen, in den Wiesen glitzerte der Morgentau, und unter ihren genagelten Schuhsohlen knirschte jene Sorte von hellgrauen Kieselsteinen, die man an so manchem Ostseestrand finden konnte.
Vor einem hohen, schwarz gestrichenen Gitterzaun, der ein ausgedehntes Grundstück nahe der Charité umschloss, blieben sie stehen. Das Gebäude dahinter ließ sich nur erahnen, da es von dichten Sträuchern und Bäumen umgeben wurde, sodass den Außenstehenden jegliche Einsicht verwehrt blieb – aus gutem Grund, denn was in dem gelb-roten Backsteinbau geschah, war selbst für das durch den Krieg abgehärtete Berliner Volk kein leicht erträglicher Anblick.
»Ich bin an vieles gewöhnt«, erklärte Bruno, nachdem sie ein schmales, schmiedeeisernes Tor durchschritten hatten. »Aber wie jemand die Arbeit in der Anatomie verrichten kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel.« Er spuckte einen dunkelbraunen Tabakklumpen auf den Boden und deutete nach rechts, wo sich ein unauffälliger Ziegelbau mit einem flachen Zinkdach befand – das sogenannte Mazerationshaus. »Professor Liman hat mir bei unserem letzten Besuch erklärt, was dort drinnen vor sich geht. Wollen Sie’s wissen?«
Cronenberg schien kein Interesse an der Information zu haben und beschleunigte seinen Schritt.
»Menschliche Kadaver werden gehäutet und entfleischt«, erzählte Bruno dennoch. »Die Organe werden entfernt und der Rest in kleine Teile zerschnitten. Welcher halbwegs gottesfürchtige Mensch macht so etwas freiwillig?«
Cronenberg rückte seinen Hut zurecht und wandte seine Aufmerksamkeit dem Haupthaus zu, einem eleganten Gebäude, das von Türmchen und Bogenfriesen geziert wurde. Es hatte die Anmutung einer herrschaftlichen Residenz, und rein gar nichts daran ließ auf die schaurigen Vorgänge schließen, die in seinem Inneren vollzogen wurden. »Ich weiß, was du meinst«, sagte er und zupfte gedankenverloren an seinem Kragen herum. »Aber wie heißt es so schön: Ius ad finem dat ius ad media – das Recht auf das Ergebnis gibt das Recht auf das Mittel. Die Anatomen verrichten ihre Arbeit im Namen der Wissenschaft, und ihre Erkenntnisse kommen uns allen zugute. Denk nur an medizinische Errungenschaften wie die Äthernarkose oder das Pockenvakzin.« Er stieg über steinerne Stufen zum Eingangsportal und öffnete die schwere Holztür.
»Wie Sie meinen.« Bruno steckte sich erneut ein Stück Kautabak in den Mund, folgte seinem Vorgesetzten in das Vestibül und weiter in den Präpariersaal.
Die Wände des großen Raums waren mit Ölfarbe gestrichen, sodass man sie schnell und unkompliziert abwaschen konnte. Der Fußboden war asphaltiert und mit einem Gefälle versehen, an dessen tiefstem Punkt alle möglichen Körpersäfte durch gusseiserne Röhren abflossen. Mehr als zwanzig junge Männer, die mit Lederschürzen und Ärmelschonern ausgestattet waren, hatten sich um einen Metalltisch gruppiert und studierten das Innenleben einer Leiche. Geschäftiges Flüstern war zu hören, begleitet vom Kratzen von Bleistiftminen auf Papier.
Ein süßlich-fauliger Geruch hing in der Luft. Bruno verzog das Gesicht und kaute intensiv auf seinem Tabak herum. »Sakrileg«, schimpfte er leise und murmelte etwas von wegen diabolischer Ausdünstungen.
Die Anatomen waren in ihre makabre Tätigkeit versunken, und es dauerte ein paar Augenblicke, bis die Anwesenheit der beiden Polizisten bemerkt wurde.
»Ah, die Kommissare Cronenberg und Harting.« Ein weißhaariger Mann mit akkurat getrimmtem Spitzbart und Zwicker auf der Nase trug einem seiner Kollegen auf, den Unterricht zu übernehmen, und ging zu einer der Waschschüsseln, die im Saal aufgestellt waren. Er tauchte die Finger kurz in das Wasser und strich anschließend über seine Schürze. »Meine Herren.« Der Professor schüttelte Cronenbergs Hand und streckte sie anschließend Bruno hin.
Der tat, als würde er die Geste nicht wahrnehmen. »Ich dachte, im Sommersemester wird nicht seziert«, lenkte er ab.
Professor Liman nickte. »Üblicherweise nicht, doch das starke Wachstum der Bevölkerung und die damit einhergehende Anzahl von Unglücksfällen, Selbstmorden und Verbrechen hat dazu geführt, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit den Toten.« Er ließ seinen Blick über die tiefgrün gestrichenen Wände wandern und seufzte. »Wir brauchen dringend mehr Platz – besonders, wenn man bedenkt, dass Berlin seinen Zenit noch längst nicht erreicht hat. Ich habe kürzlich gehört, dass jeden Monat drei- bis viertausend Menschen von außerhalb zuziehen, Tendenz steigend. Vor allem arme Proletarier, die sich eine bessere Zukunft erhoffen, finden den Weg in unsere schöne Hauptstadt. Und natürlich Glücksritter auf der Suche nach Abenteuer und dem schnellen Geld.«
»Ich weiß.« Cronenberg seufzte. »Sie alle sind dem Irrglauben erlegen, Berlin wäre ein Eldorado, das gelobte Land.«
»Man sollte jedem von ihnen verpflichtend einen Besuch im Keller verordnen, damit sie sehen, was in Wahrheit auf sie wartet.« Bruno zeigte nach unten. »Ich möchte Sie nicht drängen, aber wollen wir es hinter uns bringen?«
»Natürlich.« Liman bedeutete ihnen, ihm zu folgen, und stieg über eine gusseiserne Wendeltreppe hinab ins Untergeschoss, wo sämtliche unbekannten Verunglückten und Selbstmörder Berlins sowie die gerichtlich zu öffnenden Leichen aufbewahrt wurden.
Sie passierten das Kühllager, das bis unter die Decke mit massiven Eisblöcken vollgeräumt war, sowie die hydraulische Hebevorrichtung, die die Toten durch eine Öffnung in der Decke direkt in den Präpariesaal beförderte. Endlich erreichten sie ihr Ziel: den Leichenkeller – hier wurden die Verstorbenen entkleidet, gewaschen und aufgebahrt.
»Hier stinkt es noch schlimmer als oben.« Bruno rümpfte die Nase und sah sich um. »Sie sollten an Ihrer Kühlung arbeiten.«
»Der Geruch geht nicht von den Leichen aus, das ist Dr. Wickersheims neue Balsamierlösung«, erklärte Liman. »Er experimentiert neuerdings mit Alaun, Kochsalz, Pottasche, Salpeter und Arsen.« Er zeigte nach rechts auf die Tür der anatomischen Küche, hinter der menschliche Überreste zerlegt und konserviert wurden. Daraus war Hämmern und Sägen zu vernehmen, und Bruno gab ein ungehaltenes Grunzen von sich.
»Ius ad finem …«, setzte Cronenberg an.
»Jaja, ich weiß schon«, murrte Bruno. »Der Zweck heiligt die Mittel. Alles für die Wissenschaft und den medizinischen Fortschritt.«
»Welcher Ihrer Gäste ist denn nun der Grund für unseren Besuch?«, kam Cronenberg auf den Punkt. Er ließ seinen Blick über die Vielzahl an bleichen, kalten Körpern wandern, die zu beiden Seiten auf hölzernen Pritschen lagen und in ihrer Nacktheit einen befremdlichen Anblick boten.
Liman trat an die vorderste Bahre zu ihrer Linken, auf der ein junger Mann lag. Er hatte dichtes blondes Haar, ebenmäßige Züge und einen feingliedrigen Körperbau. Er wirkte, als wäre er einem Renaissancegemälde entstiegen. »Er wurde heute Morgen von Fabrikarbeitern in Bohneshof gefunden.«
»Bohneshof?« Bruno runzelte die Stirn. »Da draußen befinden sich nur ein paar zerfallene Schuppen und stinkende Fabriken. Was hat er dort gewollt?«
Cronenberg strich über das Einschussloch, das sich dunkel auf der schneeweißen Schläfe des jungen Mannes abzeichnete. Dann hob er die rechte Hand der Leiche, rückte seine Brille zurecht und studierte im flackernden Licht der Gaslampe deren Fingerspitzen. »Keine Abwehrverletzungen, dafür aber Pulverrückstände. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte er sich selbst erschossen.«
»Hat er auch.« Professor Liman trat ans Fußende der Bahre, wo die Kleider des Toten fein säuberlich zusammengefaltet lagen. Er fasste unter das Bündel und zog einen Revolver hervor. »Der wurde neben ihm gefunden.«
»Sieht neu aus.« Bruno nahm die Waffe und begutachtete sie von allen Seiten. Anschließend klappte er den Lauf nach unten und blickte in die Trommel. »Voll«, stellte er fest. »Bis auf eine Kugel.«
»Und die steckt in Jacobis Hirn«, sagte Liman.
»Jacobi? Sie kennen seinen Namen?«
»Er heißt Julius Jacobi, ist neunzehn Jahre alt und stammt aus Dresden. Dort war er wohl als Konditorgehilfe tätig.« Liman reichte Cronenberg einen Packen Briefe. »Die steckten in seinen Taschen.«
Der Kriminalkommissar faltete den obersten Brief auseinander. »An meine liebe Mutter«, las er vor, überflog den Rest und blickte hoch. »Herrn Jacobis letzten Worten folgt eine genaue Aufstellung all seiner Besitztümer – bis zu den Hosenknöpfen.«
»Pulverrückstände, Schläfenschuss, Abschiedsbriefe, die Regelung seiner Hinterlassenschaft …« Bruno wirkte irritiert. »Das war Selbstmord. Noch eindeutiger geht es wohl nicht. Seine Identität ist auch geklärt. Ich verstehe nicht, warum Sie nach uns geschickt haben.«
Auch Cronenberg sah den Professor fragend an.
»Weil der junge Jacobi zwar durch seine eigene Hand starb, aber, wie es aussieht, nicht durch seinen eigenen Willen.« Liman reichte Cronenberg eine Karte aus elfenbeinfarbenem Büttenpapier, die mit eleganten schwarzen Buchstaben beschrieben war. »Entscheiden Sie selbst. Mir jedenfalls scheint das alles sehr sonderbar.«
»Sonderbar?«, murrte Bruno. »Wenn wir uns um alles kümmern müssten, das irgendwem sonderbar vorkommt, würden wir aus dem Kümmern gar nicht mehr rauskommen. Dann müssten wir …«
Cronenberg hob die Hand und bedeutete seinem Assistenten zu schweigen. »Der Herr Professor hat recht. Das ist in der Tat befremdlich.« Er reichte seinem Assistenten die Karte und musterte den Toten.
»Binnen dreißig Stunden musst Du eine Leiche sein«, las Bruno laut vor.
»Aus den Abschiedsbriefen geht hervor, dass ihm die Karte am Freitag auf der Promenade in Dresden in die Hand gedrückt wurde«, erklärte Liman.
»Und daraufhin ist der Kerl tatsächlich in den Zug gestiegen und nach Berlin gefahren, um sich draußen in Bohneshof eine Kugel ins Hirn zu jagen?« Bruno nahm seine Kappe ab und kratzte sich am Scheitel.
»So sieht es aus.« Liman rückte seinen Zwicker zurecht. »Sonderbar, sagte ich doch. Ich dachte mir, Sie sollten Bescheid wissen, denn auch jemanden in den Tod zu schicken – auch wenn man selbst nicht den Abzug betätigt – ist in gewisser Weise Mord. Finden Sie nicht?« Er betrachtete Julius Jacobi und strich dem Toten beinahe zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Cronenberg trat neben den Anatomieprofessor, der, wie er wusste, vor sieben Jahren im Krieg gegen die Franzosen seinen Sohn verloren hatte. »Ich stimme Ihnen zu. Wenn jemand diesen armen Jungen durch Drohungen dazu gebracht hat, sich zu erschießen, ist es beinahe so, als hätte er ihn selbst getötet.«
»Vielleicht wurde er hypnotisiert«, überlegte Bruno laut. »Oder er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen …«
»Das sind denkbare Möglichkeiten«, bestätigte Cronenberg. »Was auch immer hinter diesem Todesfall steckt – wir werden es ergründen.«
Professor Liman nickte und zog eine Taschenuhr unter seiner Lederschürze hervor. »Ich muss wieder zu meinen Studenten. Wenn Sie noch länger bleiben wollen, können Sie das gerne tun.«
»Ich denke, wir haben genug gesehen«, erklärte Cronenberg.
»Und gerochen und gehört«, fügte Bruno leise hinzu.
»Nun denn.« Liman warf einen letzten Blick auf Julius Jacobi. »Lassen Sie uns zurück ins Reich der Lebenden gehen.«
»Wir senden so schnell wie möglich den Polizeifotografen zu Ihnen«, erklärte Cronenberg, während sie gemeinsam über die Wendeltreppe nach oben in die Vorhalle stiegen. »Er soll ein Bild von Jacobi anfertigen, das wir in der Öffentlichkeit herumzeigen können.«
»Eine gute Idee. Ich werde meine Mitarbeiter anweisen, Ihren Mann zu unterstützen.«
Die beiden Kriminalbeamten reichten dem Professor zum Abschied die Hand und verließen das Gebäude. Schweigend gingen sie über den schmalen Kiesweg und ließen sich eine sanfte Brise um die Nase wehen. Die Sonne strahlte am wolkenlosen Himmel und machte Hoffnung auf einen lauen Junitag.
»Wie lange sind Sie jetzt schon bei der Polizei?«, fragte Bruno, als sie auf die Louisenstraße traten.
»Fünfundzwanzig Jahre«, sagte Cronenberg, ohne zu überlegen. »Fünfundzwanzig lange Jahre.« Er fasste in seine Tasche, zog eine silberne Dose daraus hervor und entnahm ihr eine Pastille. »Biliner Verdauungstabletten«, erklärte er. »Gut gegen Sodbrennen. Auch eine?«
Bruno schüttelte den Kopf. »Ist Ihnen schon mal so ein Fall untergekommen?«
Cronenberg dachte kurz nach. »Nein, und dabei hatte ich es schon mit vielen kniffligen Fällen zu tun.«
»Apropos knifflige Fälle …« Bruno sprang zur Seite, als eine herrschaftliche Equipage in scharfem Trab an ihnen vorbeistob, und rief dem Kutscher einen derben Fluch hinterher. »Heute …« Er zögerte. »Heute ist der Tag, an dem …«
Cronenberg seufzte. »Ich weiß, mein lieber Bruno, ich weiß. Heute ist der Tag, an dem Felix Blom entlassen wird.«
4
Felix Blom war von einem einzigen Gedanken beseelt. Er wollte fort vom Gefängnis, raus aus Moabit, und zwar so schnell und so weit wie möglich. Mit eiligen Schritten ging er deshalb in südlicher Richtung, vorbei am Humboldthafen und der Charité, über die baufällige Marschallbrücke bis in die Wilhelmstraße.
Die Bewegung und die frische Luft erfüllten ihn mit solcher Euphorie, dass er das Problem, weder über Geld noch über eine Unterkunft zu verfügen – geschweige denn über legale Arbeit –, kurz beiseiteschob und sich erlaubte, den Moment zu genießen.
Beschwingten Fußes tänzelte er über den Pariser Platz, hinein in die Friedrichstadt, das pulsierende Herz Berlins. Dort erfreute er sich an den bunten Auslagen der Läden, schwelgte im Anblick der herrschaftlichen Paläste, sog die Düfte ein, die den Cafés und Restaurants entströmten, und küsste ein hübsches, blondgelocktes Dienstmädchen, das gar nicht wusste, wie ihm geschah, auf die Wange.
Doch dann, ohne dass es einen konkreten Anlass gegeben hätte, trübte sich seine Stimmung. Blom wurde nervös. Das geschäftige Treiben, die Lastwagen der Kaufleute, die Droschken, Pferde, Omnibusse und Karren … Sie wurden ihm plötzlich zu viel. Hinzu kamen die unzähligen Polizisten und Soldaten. An jeder Ecke standen bewaffnete Männer in Uniform, die jeden Passanten genau musterten.
Mit wild pochendem Herzen bog er in die Leipziger Straße, wo er beinahe von einer Postkutsche über den Haufen gefahren worden wäre. Er machte einen Satz zur Seite, stieß mit einem Mann zusammen und stolperte über einen Packen mit Gazetten, den ein Zeitungsjunge neben einem Laternenmast abgestellt hatte.
Von schadenfrohem Gelächter begleitet rappelte er sich hoch und taumelte weiter durch den Lärm und das Chaos, die die Straßen Berlins erfüllten. Inmitten dieses tosenden und schreienden Knäuels aus Menschen und Vieh, in einer Vielfalt von Farben, Gerüchen und Geräuschen trieb Felix Blom und drohte in alldem, wonach er sich so lange gesehnt hatte, zu ertrinken.
Ihm wurde eng um die Brust, Schweißperlen traten ihm auf die Stirn, sein Puls raste. Mit einem Mal fühlte er sich beobachtet, von Blicken durchbohrt, doch als er sich umdrehte, schien niemand ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Erstaunlich, was so ein paar Jahre in Isolation mit dem menschlichen Geist anstellten. Er flüchtete in eine Toreinfahrt, presste sich mit dem Rücken gegen die Mauer und versuchte, sich zu sammeln. Reflexartig fasste er in seine Tasche, um nach seiner Schnupftabakdose zu greifen, griff aber ins Leere.
So hatte er sich die Freiheit nicht vorgestellt.
Der kurze Freudentaumel war offenbar vorüber – er musste sich der Realität stellen. Wo sollte er hin? Er wusste, dass seine Wohnung längst weitervermietet und sein Besitz von den Behörden beschlagnahmt worden war. Seine sogenannten Freunde hatten sich von ihm abgewandt, als sie erfuhren, dass er nicht, wie behauptet, ein wohlhabender Erbe aus gutem Haus war, sondern ein Dieb mit proletarischen Wurzeln. Und seine geliebte Auguste … Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie zu ihm stand. Außerdem wollte er ihr so heruntergekommen nicht unter die Augen treten.
Natürlich hatte er sich bereits im Gefängnis Gedanken über die Zeit nach der Entlassung gemacht, doch er war davon ausgegangen, seinen Gefängnislohn sofort ausbezahlt zu bekommen und dadurch über genügend Mittel zu verfügen, um sich fürs Erste in einem billigen Hotel einmieten zu können. Dort hatte er bleiben und alles Weitere regeln wollen.
Wilke und seine verdammten Auflagen hatten ihm einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht.
»Wo ein Wille, da ein Weg«, murmelte Blom. Er wartete, bis sein Herz wieder in einem normalen Takt schlug, atmete durch und trat zurück auf die Straße, wo gerade eine elegant gekleidete Dame aus einer Kutsche stieg. Sie war klein und rundlich, trug eine seidene Stola und roch förmlich nach Geld. Reflexartig begannen seine Finger zu kribbeln, und er brachte sich in Stellung, um sie anzurempeln.
Der Rempeltrick: Rempelt man fremde Menschen an, kontrollieren sie danach meist instinktiv, ob ihre Wertsachen noch an Ort und Stelle sind, und verraten somit, wo sich jene Dinge befinden, die es sich zu stehlen lohnt.
»Auf Wiedersehen«, hallten Gefängnisdirektor Wilkes Worte in Felix Bloms Ohren. Er ließ seinen Blick zu den beiden Polizisten wandern, die nur wenige Meter entfernt vor einem Haustor standen, woraufhin das Kribbeln verflog.
Blom verzichtete darauf, die Dame um ihr Portemonnaie zu erleichtern, und seufzte leise. Er brauchte Unterstützung, und es gab nur eine Person, die ihn aus seiner Misere befreien konnte: Arthur Lugowski.
Der Gangsterboss residierte üblicherweise in der Nähe des Landwehrkanals, im Hinterzimmer einer Kneipe namens Alt Berlin – und dorthin würde Blom nun gehen. Er bog in die Friedrichstraße, wo es ebenfalls von Uniformierten nur so wimmelte, und spazierte nach Süden.
»Verzeihung«, sprach er eine rotwangige Marktfrau an, die am Rand des Belle-Alliance-Platzes ihren Stand hatte und Fische ausnahm. »Was ist denn in der Stadt los? Warum stehen Soldaten und Polizisten an allen Ecken und Enden?«
Die Frau sah ihn an, als wäre er der Irrenanstalt entsprungen. »Mensch, Jungchen«, sagte sie und stemmte die Hände in die breiten Hüften. »Wo haste denn die letzten Monate gesteckt? Hast wohl hintam Mond jelebt.«
»So was in der Art.« Blom grinste schief und kassierte dafür einen weiteren skeptischen Blick.
»Die Sozis wollen den Kaiser umbringen«, erklärte sie, während sie mit flinken Fingern den Bauch eines Zanders aufschlitzte und mit bloßen Händen die Gedärme herauszog. »Zweema ham se schon vasucht, den ollen Willi zu erschießen. Beim letzten Ma hammse ihn janz schön erwischt. Keene Ahnung, ob der sich noch ma erholt. Und dat Janze ausjerechnet jetzt, wo doch der Kongress in die Stadt kommt.«
Blom atmete auf. Die enorme Polizeipräsenz war also echt und keine Wahnvorstellung. Er hatte schon befürchtet, dass die Isolationshaft doch nicht so spurlos an ihm vorübergegangen war, wie er gehofft hatte. »Welcher Kongress?«
»Sach ma, kannste nich lesen?« Sie fasste neben sich, wickelte einen ihrer Fische aus einer Zeitungsseite und drückte Blom das feuchte Papier in die Hand.
»Europa am grünen Tisch«, las er vor. »Heute Mittag werden die Bevollmächtigten sämtlicher europäischer Vertragsmächte in Berlin versammelt sein, um noch im Laufe dieser Woche über die Zukunft des Kontinents und die orientalische Frage zu verhandeln.«
»Frieden will der olle Bismarck schaffen.« Die Marktfrau fing an zu lachen. »Ausjerechnet der, wo der doch immer auf Blut und Eisen jeschworen hat.«
Sie sprach weiter, doch Blom hörte ihr nicht mehr zu. Attentate auf den Kaiser, ein internationaler Kongress … Die Welt hatte sich in den vergangenen drei Jahren schnell gedreht. Zu schnell für seinen Geschmack. »Danke«, unterbrach er ihr munteres Geplapper und ging weiter.
Beinahe hatte er damit gerechnet, dass das Alt Berlin nicht mehr da war, und es fiel ihm ein Stein vom Herzen, als das heruntergekommene Eckhaus mit dem vertrauten Schriftzug vor ihm auftauchte. Manche Dinge würde selbst die Apokalypse nicht auslöschen können, und diese Kneipe gehörte Gott sei Dank dazu.
Blom öffnete die unscheinbare Holztür, die seit einer Ewigkeit vergeblich auf einen neuen Anstrich wartete, und das erste Mal seit langem verspürte er das wohlige Gefühl, daheim zu sein. Die warme Luft, die ihm entgegenschlug, war nikotin- und alkoholschwanger, leises Gemurmel war zu vernehmen, und das schummrige Licht einer altersschwachen Gaslampe verlieh dem Raum die Anmutung einer Opiumhöhle.
Hier hatte er seine Jugend verbracht. Seine Mutter war gestorben, als er noch klein war, und sein Vater hatte Trost im Schnaps gefunden. Blom musste früh für sich selbst sorgen und war über Umwege als Handlanger im Alt Berlin gelandet. Bald war ihm klargeworden, dass es in der Kneipe um mehr ging als um Bier und Buletten und dass Arthur Lugowski, der Chef des Etablissements, mehr war als ein einfacher Wirt.
Nach und nach hatte er von den Männern, die hier ein und aus gingen, alles gelernt, was es über das Gaunerhandwerk zu erfahren gab. Das Alt Berlin war seine Schule gewesen, Lugowski und der Rest der Bande seine Lehrer. Während die Knaben aus gutem Elternhaus Homer lasen und sich in Algebra übten, lernte er, wie man Schlösser knackte und echte Diamanten von falschen unterschied. Während die feinen Bürschchen sich mit Erdkunde und Schönschreiben beschäftigten, übte er sich im Herstellen von Verkleidungen und dem Proben von Taschenspielertricks.
All das war lange her. Seitdem waren Kriege ausgefochten und Herrscher gestürzt worden. Staaten waren kollabiert, neue entstanden, und Berlin hatte sich von einer provinziellen Residenzstadt zur Kapitale eines Weltreichs gemausert.
Nur im Alt Berlin schien die Zeit stehen geblieben zu sein.