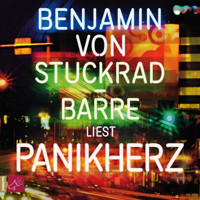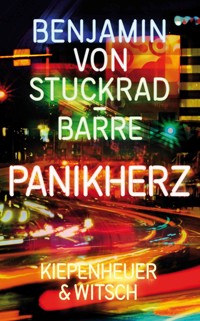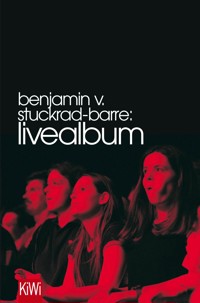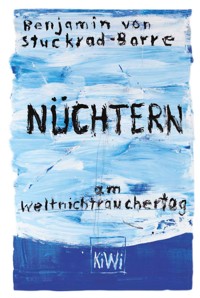9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alltagsarchäologie und Gegenwartsstenographie Remix 2 ist ein Fortsetzungsroman. Daher die 2 im Titel. Vor vier Jahren erschien Remix 1 eine Sammlung von Stuckrad-Barres besten journalistischen Texten und damit eine perfekte Ergänzung seiner erzählerischen Werke wie Soloalbum und Livealbum. Die Grenzen zwischen literarischer und journalistischer Produktion haben sich bei Stuckrad-Barre seither immer mehr verwischt. Der Autor als Jäger, Sammler und Kronzeuge. In einem Schweizer Chemielabor sucht er nach Bomben, bei Paola und Kurt Felix nach dem Geheimnis der Liebe und auf Sylt nach Gartennazis. Er fährt los, ein Kempowski-Porträt zu verfassen und archiviert dessen gerade entstehenden Tagebucheintrag zum 11.9. Remix 2 ist eine raffinierte Textkomposition, die durch ihre Vielstimmigkeit besticht und somit Satz für Satz nach Stuckrad-Barre klingt: Den Ton unterwirft er dem Untersuchungsgegenstand, die Form folgt der Funktion: Reportagen, Duette, Erzählungen, Montagen, Protokolle, Tagebuchtexte, Experimente, Rätsel. Sie bilden ein Prisma, das scheinbar vertraute Wirklichkeiten bricht und die Welt neu ausleuchtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benjamin von Stuckrad-Barre
Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft
[Remix 2]
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Benjamin von Stuckrad-Barre, 1975 in Bremen geboren, ist Autor von: »Soloalbum«, 1998, »Livealbum«, 1999, »Remix«, 1999, »Blackbox«, 2000, »Transkript«, 2001, »Deutsches Theater«, 2001, »Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft – Remix 2«, 2004, »Auch Deutsche unter den Opfern«, 2010, »Panikherz«, 2016 und »Nüchtern am Weltnichtrauchertag«, 2016, »Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal hinlegen – Remix 3«, 2018.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Remix 2« ist die Fortschreibung von »Remix 1«, der ersten Sammlung von Stuckrad-Barres besten journalistischen Texten. Auch in »Remix 2« betreibt der Autor Alltagsarchäologie und Gegenwartsstenographie, als Jäger, Sammler und Kronzeuge. In einem Schweizer Chemielabor sucht er nach Bomben, bei Paola und Kurt Felix nach dem Geheimnis der Liebe und auf Sylt nach Gartennazis. Er fährt los, ein Kempowski-Porträt zu verfassen, und archiviert dessen gerade entstandenen Tagebucheintrag zum 11.9.
»Remix 2« ist eine raffinierte Textkomposition, die durch ihre Vielstimmigkeit besticht. Der Ton unterwirft sich dem Untersuchungsgegenstand, die Form folgt der Funktion: Reportagen, Duette, Erzählungen, Montagen, Protokolle, Tagebuchtexte, Experimente, Rätsel. Sie bilden ein Prisma, das scheinbar vertraute Wirklichkeit bricht und die Welt neu ausleuchtet.
»Großartige Stücke und Reportagen.« (Ursula März, Frankfurter Rundschau)
»Die Texte sind präzise, bescheiden, komisch, stark im Dienst der Sache, oft auch von einer poetisch durchwirkten Melancholie und einige wirklich schräg und experimentell.« (Simone Meier, Tages-Anzeiger Zürich)
»Wer immer etwas über unsere verdammten Jahre in diesem merkwürdigen Land erfahren will, der sollte da hineinlesen. Ein großer Reporter unserer Zeit.« (Julia Encke, Süddeutsche Zeitung)
»Mit viel Sprachwitz, Beobachtungsgabe und bissiger Ironie vermischt er Realität und Fiktion, bis daraus Kunst wird.« (Stern)
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2004, 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Ein Teil der Texte ist in ähnlicher Form erschienen in FAZ, Süddeutsche Zeitung, Stern, taz, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, jetzt, Welt am Sonntag, Die Woche, Spex, Die Weltwoche, Rolling Stone, Allegra.
Covergestaltung: Walter Schönauer, Berlin
ISBN978-3-462-31900-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
1 Waffeninspektion
2 Gartennazis
3 Nobelpreisträger-Homestory
4 11.09.2001: Daheim bei Walter Kempowski
5 Fernsehen mit Kempowski
6 Presseclub
7 Schlingensief vs. Jauch
8 Wickerts Wetter
9 Reich-Ranicki-Gucken
10 Je t’aime
11 Paola & Kurt Felix
12 Leserbriefe
13 Sporthilfe
14 Studienabbrecher
15 Nicolette Krebitz
16 Gesendet 2001
17 Musikschule
18 Eselverstärker
19 Hängende Spitze
20 Tagebuch-Auszug: Eine Woche im September 1998
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
21 Das erste Buch
22 Das erste Exemplar
23 Dürer in Osnabrück
Brief an die Osnabrücker Dürer-Ausstellungs-Besucher
24 Rockliteratur
25 Madonna in Tübingen
26 Robbie Williams in Berlin
27 Götz Alsmann bei Karstadt
28 Bodylanguage
29 Westbam: Basso Continuo
1. Recognize
2. Inner City Front
3. Roots Rock Riot
4. Coras Corner
5. World Rebellion Plan
6. Oldschool, Baby
7. Psycholectro
8. The Disco In My Head
9. The 4th Floor
10. Right On
11. Air Max
12. Bleiben und Abfahren
13. Backstage Kings
30 Oasis auf Gigantenschultern
31 Rio Reisers 50. Geburtstag
32 Herbert Grönemeyer: Mensch
33 Herbert Grönemeyer: Lächeln (mit Wiglaf Droste)
34 Lesereisen (mit Wiglaf Droste)
Übernachten
Auftreten
Gästebücher
Hoteldiebstahl etc.
Wiederholungstäter
Gesund bleiben
Geld und Geschenke
Zurück in Berlin
35 Tourtagebuch: Frühjahr & Herbst 2000
Frühjahr
Herbst
36 Staatslenker
37 Über alles. (Stolz, ein Deutscher zu sein)
38 Ministerin a.D.
39 Bonn
40 Cherno Jobatey: Wir sind da (dada)
41 Minister a.D.
42 Erinnerungen
43 Oskar Lafontaine bei Kiepert
44 Britische Botschaft
45 Herbst in Berlin
46 Karneval im Exil
47 Boulevard: Setlur & B. Becker!
48 Hohe Schuhe
49 06.12.: Hertha BSC stellt die Schuhe raus
50 31.12.: Abfall von allen
51 Tagebuch-Auszug: Eine Woche im September 1999
52 Wohnen, Möbel, Leben
53 Im Solarium
54 Im Copy-Shop
55 Die Beziehung von Körper und Geist im Jahr 2004 (Dancing With The Rebels)
56 Ich war hier
Turmtreppenhaus im Kölner Dom
Fußball-Fan-Graffiti
Zaun am Borussia-Dortmund-Trainingsgelände
Graphologie I
Gästebuch Wehrmachtsausstellung (Institut für Sozialforschung)
Zoologie I
Steine und Bänke im Botanischen Garten
Kulturtheorie I
Tiefgarage des TV-Senders Viva
Reinigung, Spurentilgung, Leinwandwiederherstellung I
Rockclub, Decke der Cocktailbar & Backstagetoilettentür
Graphologie II
Universitäts-WC-Kabinentüren (Herren)
Grafik-Design I
Gästebuch Traktorenmuseum
Kulturtheorie II
www.paperball.de
Zoologie II
Schulbushaltestelle
Gästebuch Zinnfigurenmuseum
Graphologie III
Hotels, Hotels I
Grafik-Design II
Homepage-Gästebuch von Jürgen Fliege
Zellenwände Steinwache Dortmund
Gästebuch Steinwache Dortmund
Zoologie III
Externsteine, Aussichtsplattform und Aufgang
Ich war hier – Beweismittelbeschaffung: Die Souvenir-Prägemaschine
Gästebuch Homepage Helge Schneider
Kulturtheorie III
Internet-Kondolenzbuch für Katharine Hepburn
Zoologie IV
Hotels, Hotels II
Nachtclubklotüren
Grafik-Design III
Gedenkstätte KZ Bergen-Belsen, Gästebuch
Haus der Stille, Gedenkstätte KZ Bergen-Belsen
Reinigung, Spurentilgung, Leinwandwiederherstellung II
Eine eigene Geschichte
//::Woran ich interessiert bin? Das einer Situation oder einem Gespräch zu Grunde liegende Muster zu erkennen, die Fiktionen, die verstümmelten Träume usw.//
(((UND: der nächste Schritt ist, darüber hinauszugehen, indem man genau die Umwelt verfolgt, die Szenen, in denen man war und in denen ich mich jeweils bis zum Abbruch aufgehalten habe, bis alles leer war, und habe mich dann nochmal umgesehen, hinter den Kulissen: das heißt einfach: das Grundmuster sehen/was als Bewegung firmiert, ist bisher bloß ’ne Variation gewesen!)))/: schließlich: ALLE sind längst weg, die sprechen könnten (bis auf die wuselige, rührselige Großmutter um 80!)/: und sie sprechen alle nicht! die könnten!
Rolf-Dieter Brinkmann, »Erkundungen«
Man kann doch zu sich stehen, wie man will
Die meisten stehen lebenslänglich still
Der Wind bläst ihnen ständig ins Gesicht
Doch aufzufliegen trauen sie sich nicht
Man sehe nur mal mich an
Wie ich lebe, was ich tu’
Im besten Falle längerfristig nichts
Ich sitz in meiner Wohnung und ich fei’re Pubertät
Und freu mich an der Wanderung des Lichts
Es gibt da zwar Momente, wo der Wahnsinn leise lacht
Und man sich völlig überflüssig fühlt
Doch nur an solchem Fluchtpunkt schafft man die Chronistenhaft
Den zu skizzier’n, der eine Rolle spielt
Heinz-Rudolf Kunze, »Man kann doch zu sich stehen, wie man will«
Für
Fritz Lehmann (*16.10.1913 †02.12.2003)
und Rocco Clein (*20.07.1968 †01.02.04)
Waffeninspektion
Das Ding tickt, und trotzdem scheint die Zeit zu stehen. Tick, tick, draußen Regen, Industriegebiet, dahinter Berge, auffälligste Unauffälligkeit, ein grauer Tag, ein braunes Tischhufeisen, ein düsteres Hier – im Neonlicht. Tick, tick, sonst hört man nichts, nur den marschierenden Sekundenzeiger, minutenlang. Dann:
Huch! Kawums. Die Tür ist zu, der Herr ist da, der Herr Laborleiter, unterm Arm hat er den genauen Wortlaut der Resolution. Ein Haufen Zettel legt sich zu seinen Geschwistern: Broschüren, Geschäftsberichte, Bücher, Archivmaterial. Bestens vorbereitet, alte Journalistenschule. Heute: Reportage. Knallharte Fragen dabei, Argumente aller Seiten in petto, keine Abkürzung nie gehört, OPCW, SIVEP, VBS, DMod, FKK, Unscom. Themenabzweigungen: Anthrax, Tokio, Moskau, Uranmunition und noch vierhundert mehr.
Alles am Mann, auf dem Tisch und jetzt, danke, unter der Resolution. Und, Entschuldigung, könnten wir dann jetzt mal eine Bombe sehen? Wo haben Sie denn Ihre Waffen? Welches Reagenzglas darf nicht umkippen, wenn ich hier lebend raus will? Der Laborleiter lacht, der Pressesprecher hustet und rettet die Situation, indem er in bester Sachwaltermanier »erst mal zur Orientierung« einen Stapel Folien über den Overheadprojektor scheucht. Hier sind wir, das sind wir, aus dieser Konstellation heraus, im Gegensatz zu den bisher angenommenen und hier erstmals erweitert abgebildeten Standorten, so ist das Verhältnis, dies ist die Entwicklung, die schraffierte und die gepunktete Fläche haben die im Dreieck vergrößert dargestellte gemeinsame Schnittmenge; da sind wir tätig, dort marktführend; bei Fragen, Unklarheiten und allem sonst – bitte ein kurzes Zeichen. Ja, Entschuldigung, ein Schwung Fragen direkt: Wo sind denn jetzt die Granaten, dürfte ich mir mal den Keller ansehen, darf ich mal gegen diese Wand klopfen, was haben Sie zum Frühstück gegessen – und wie nennt Ihre Frau Sie nachts?
Natürlich ist man versaut durchs Fernsehen. Heiß gemacht durch Übertreibung und abgestumpft durch Gewöhnung, ja, zugegeben. Aber eine Waffeninspektion wird man sich doch wohl bitte noch aufregend vorstellen dürfen? Darf man natürlich. Aber es ist auch viel Papierkram. Ist es das? Sagen Sie das nicht, das ist doch klar, die Antwort gilt ja für alles heutzutage, von Ehe über Frieden bis hin zum Wäschetrocknerleasing – Papierkram, Papierkram, natürlich. Ich unterschreib auch alles, aber ich will jetzt mal die Bomben sehen.
Der Professor kratzt seine korrekt getrimmte Mundherumbehaarung und erzählt aus dem Irak. Dort – oder, wie man gemeinhin sagt: da unten, womit man den eigenen Standpunkt im Verhältnis als oben, nicht nur in Hinblick auf die eigene Weiternördlichkeit, definiert – dort unten im Irak also war der Leiter des AC-Labors Spiez in den neunziger Jahren zweimal, um als Teil einer internationalen Abordnung die Einhaltung des Rüstungsabkommens zu überprüfen. Waffeninspektor ist er somit, so heißt das offiziell. Der Pressesprecher klopft mit einem Kugelschreiber gegen die Projektionsfläche, die Konferenzraumwand, auf der Pressesprecher-Wange steht Nato, denn gerade beugt er sich vor, hinein ins Strahlfeld des Projektors. Das Labor Spiez hieß früher Gaslabi, sagt er jetzt, und da haben wir irgendwie den Übergang verpasst. So viele Informationen!
Der Pressesprecher geht mit dem Fotografen durchs Haus, schöne Motive suchen, wie man so sagt. Ein schönes Motiv ist nicht zwangsläufig etwas, das landläufig als schön gilt, berichterstattungsgegenstandsabhängig sogar das genaue Gegenteil, aber das ist ein anderes Thema. Der Fotograf ist etwas unzufrieden bislang, es sehe, flüstert er kurz, ja hier aus wie in jedem Labor, im Grunde sehe es aus wie in einer Schule, könne man fast sagen. Dabei geht es doch um Krieg! Was machen wir denn da? Dann folgt er dem Pressesprecher ins Gasmaskenmuseum, der Autor verbleibt mit dem Laborleiter im vom Tageslichtprojektor besummten Konferenzraum.
Haben Sie noch Fragen? Eine Menge.
Mögen Sie noch Kaffee? Eine Tasse.
Schwarz, danke. A für atomare, B für biologische, C für chemische Waffen – warum heißt es dann nur AC-Labor, grundsätzlich? Darf man so was fragen?
Eben deshalb heiße es jetzt Labor Spiez. Der 11. Oktober 2001 habe gezeigt – nicht 11. September Fragezeichen, nein, eben nicht, mit Bedrohung durch biologische Waffen habe ja der nichts zu tun, das sei ja eine amerikanische Stützbehauptung; aha. Nun gut, und – peinliche Stille – letzten Satz nicht verstanden – überhaupt gerade: den Zusammenhang. Alles, alles ganz anders vorgestellt. Gedacht, es gäbe einen Katalog mit Waffen, eine Art Bestimmungsbuch wie beim Pilzesammeln, und damit, plus Lupe, Bunsenbrenner und Lackmuspapier bewehrt, latschten die Inspektoren durch den Schurkenstaat. Ist also nicht so. Mal bisschen blättern.
Schweißperlenvollversammlung auf der Stirn, Äh-Getümmel im Nebensatzsalat. Der Laborleiter versteht, sein Gegenüber nämlich kaum noch was, also zwei Gänge zurück, noch mal von vorn, mal aufs Verständnislevel der Legospielfähigkeit heruntergedimmt formuliert; der Autor muss seinen Fragen gar kein unlustig feuerzangenbowleskes und hier aber vollkommen ernst gemeintes »Wenn man sich mal ganz, ganz dumm stellt« vorausschicken, das denkt der Laborleiter spätestens jetzt selbständig jeweils mit. Jaja, wir gehen ja gleich ins Hochtoxiklabor. Da haben wir schnapsglasweise Kampfstoffe. Echt. Deshalb auch der Zaun rundherum.
Also: Wie geht das, Bombensuchen? Wie unterscheidet man einzeln gelagerte Bombenbauteile von Melkmaschinenersatzteilen? Zunächst mal: Wir suchen nicht, erklärt der Laborleiter. Es wird entlang der offiziellen Deklaration überprüft.
Ach?
Ja.
Oh.
Nun.
Hm, und man gräbt nicht verdachtsweise so ein bisschen in der Wüste rum und bricht scheinbar verlassene Garagen auf, und man klopft auch keine Kellerwände nach Hohlräumen ab? Nein, macht man nicht. Man hat allerhand Unterlagen, Satellitenbilder, Geheimdienste, Messgeräte, Hubschrauber, Menschenkenntnis, Erfahrung, man hat geständige Überläufer, redselige Nachbarstaatsbürger, sich verplappernde Handlanger und so weiter. Und irgendwann komme man immer an den Punkt, sagt der Laborleiter, da ende die Deutungshoheit der Wissenschaft, da gelange die Beweisbarkeit an ihre Grenzen. Irgendwann, sagt er, sei es dann Ermessenssache, da müsse man sich dann entscheiden, zu glauben oder nicht; diese Fundamentalfrage formulierend, blickt er, ganz Wissenschaftler, empirisch auf den Linoleumboden, wo seine Gummisohlen gerade einen Kaffeefleck radieren. Also, wie geht das, Waffeninspektor sein, nehmen wir einen normalen Tag.
Aber gern. Noch Kaffee?
Nein danke, jetzt bitte einen normalen Tag.
Also. Da setzt man sich morgens in einen Bus mit Kollegen aus mancher Herren Länder. Man steuert eine Fabrik an. Dann noch eine, dann – halt! Man kommt da an in der Fabrik – und dann? Guten Tag, wir sind von der Unscom, aufmachen, Sie sind umstellt, keiner rührt sich, Finger weg vom Computer, Hände in den Nacken?
Nee, nee, langsam. Nehmen wir mal eine hochverdächtige Fabrik. Eine, in der früher mal oder heute vielleicht oder sogar ausgewiesenermaßen heute noch, aber nur im erlaubten Rahmen (angeblich!), Waffen produziert werden. Naturgemäß aber wird es anderswo interessant.
Im Hinterzimmer?
I wo.
Unter Tage?
Romantiker.
Wo dann?
Zum Beispiel in einer Tomatenpüreefabrik.
Ach was!
Aber ja! Mit so einer Sterilisationseinrichtung kann man natürlich allerhand herstellen. Und eben auch: Bomben, vereinfacht gesagt.
Vereinfacht weitergefragt: Wie ist denn so die Stimmung in einem international zusammengesetzten Expertenbus?
Sachlich bis freundlich, sagt der Laborleiter, und sein Blick wird kurz etwas durchlässiger.
Typische Überzeugungswissenschaftler, die viele äußerliche Übereinstimmungen mit der Klischeekarikatur ihres Berufes aufweisen, wirken, wenn sie von gewöhnlichem Tagestun abseits der Forschung reden, immer etwas verlegen, so als müssten sie zugeben, über Michelle Hunziker promoviert zu haben. Wenn Zerstreuung, dann bitte hochgradig wissensdurstig und weltenrätselverpflichtet gewählt! Ja, sagt der Laborleiter, natürlich habe man auch mal gemeinsam eine quasi privattouristische Exkursion unternommen, als man, dieser Zusatz darf nicht fehlen, ohnehin gerade inspektionsbedingt in der Nähe war, habe man dieses uralte Wendeltreppen-Minarett besichtigt. Man habe auch mal das so genannte eine oder andere Wort privat gewechselt, von Inspektor zu Inspektor, im Bus, das blieb nicht aus, das gehörte dazu, das ergab sich so. Als müsse er sich entschuldigen. Und worüber spricht man dann? Über die Familien daheim, sagt er, über Restaurants vielleicht oder über das Neueste aus der Zeitung. Nicht so unbedingt »über das Politische«. Gibt ja den Sportteil. Zum Beispiel. Na eben.
Dann also kommt man bei einer Fabrik an – und dann? Dann sagt man, wer man ist, was man will, Armbinde und Helm der UNO verkürzen die Ouvertüre, dann trinke man einen Tee, bekäme einen Lageplan des Geländes und jemanden mit Schlüsselbund zur Seite. Dann guckt man herum, entnimmt Proben, blättert in Unterlagen, befragt Mitarbeiter, schlägt Planen zurück, schraubt Deckel auf, misst allerlei, behandelt den Ort wie einen Verdächtigen: Und was ist bitte das? Und dies ist wirklich nur? Seit wann haben Sie dies, seit wann jenes nicht mehr? Und erklären Sie bitte diese Stromrechnung und jene Überweisung. Eine Brauerei muss nicht zwangsläufig nur Bier herstellen. Fermentierung ist das Stichwort. Dann kommen wieder Abkürzungen. Das Missverhältnis von Ehrlichkeit und Höflichkeit entlässt ein »Verstehe!«-Nicken zu viel in den Raum, dann ist der Zug abgefahren. Und man kommt auch nicht mehr drauf. Schul-Erinnerungen. Der Blick wandert. Man sagt jetzt immer öfter »Hmhmhm, ah, genau«. Oh, verdammt, jetzt müsste man darüber hinaus etwas sagen, so richtig mit Wörtern und Syntax, argusäugig blinzeln und pfeilschnell nachhaken, irgendwie sachbezogen mit dieser neuen Informationslage umgehen, sagen die Augen des Laborleiters.
»Um nochmal zurückzukommen auf …«, versucht man eine Rettung. Äh: Wenn die Iraker nun entgegen ihrer Behauptung Massenvernichtungswaffen besitzen oder Mittel und Anlagen zur Herstellung derselben – dann gäbe es Krieg, nicht wahr? Den wird es sowieso geben, und finden wird man schon was, der Friedenswille sei doch etwas geheuchelt, ruft da jemand. Soso. Um etwas grundsätzlicher zu werden, denn bei solchen Debatten herrscht doch stets Mangel an Informationen, Meinungen hingegen gibt es überall gratis, sie verhalten sich umgekehrt proportional zueinander, wo viel Information ist, hat es weniger Meinung und umgekehrt. Am Stammtisch der Weltpolitik ist somit jede Argumentationsausrichtung möglich. Und da steht man wie eine Kindergärtnerin vor einer in der Sandkiste heulend verblutenden Kinderansammlung und soll entscheiden, wer wen zuerst gehauen hat. Wer zu weit gegangen ist. Was man sagt, hört dann aber auch keiner, weil alle schreien.
Also: Was genau ist eine Massenvernichtungswaffe? Ein verlässlich arbeitendes Maschinengewehr kann ja in der Summe sehr wohl auch eine Masse vernichten. Wie viele Menschen sind eine Masse? Sind Soldaten nicht immer auch Tötende oder eben Getötete, da das allein ihre Bestimmung ist; und ist ihr Tod deshalb nicht trotzdem ebenso tragisch wie der von so genannten Frauen und Kindern? Man kann sich die geistesgestörte Nato-Kampagne ohne große Phantasie zusammenbasteln: Fair töten ohne Chemie. Gibt es das, okayes Töten? Schwierig. Waffen, die nicht unterscheiden zwischen zivilen und militärischen Zielen, solche sind Massenvernichtungswaffen. Wobei ein Bombenteppich auch nicht gerade wählerisch ist, aber der fällt aus der Definition. Irgendwann kommt man an den Punkt, da muss man glauben.
Das gilt auch in der Milchpulverfabrik: Man kann nicht zu hundert Prozent nachweisen, dass hier bestimmt kein Anthrax hergestellt wurde, wird oder werden wird. Und in der Farbfabrik wird ein Lösungsmittel verwendet, das auch Bestandteil eines Nervengases – und so weiter. Und was lagern Sie in dem Schuppen da hinten? Oh, da hat jetzt gerade keiner den Schlüssel, der Zuständige ist just zu Tisch. Aha! Gar nichts aha. Tausende kleine Indizien müssen die Inspektoren abwägen – ist das noch Schlamperei oder schon Verschleierung, wenn man über eine Stunde lang auf einen Schlüssel wartet? Alles kann man nicht kontrollieren. In einer Fünfmillionenstadt wie Bagdad, sagt der Laborleiter und massiert seine Augenbrauen, in einer Fünfmillionenstadt wie Bagdad ist die zweithäufigste Gebäudeform das Lagerhaus. Unmöglich, da ohne Wahrscheinlichkeitsrechnung vorzugehen, also Stichproben.
Es treffen in jeder Hinsicht Welten aufeinander, der Dolmetscher ändert nichts an den verschiedenen Sprachen: Die Fabriken rechnen in Tonnen, die Wissenschaftler fahnden nach Nanogramm. Und außerdem: In Afrika zum Beispiel, lehrt der Laborleiter, da kenne man nicht so Arbeitszeiten wie bei uns.Da unten sei es normal, dass mal jemand etwa zum Einkaufen gehe während der Arbeitszeit. Das müsse noch keine Flucht sein, keine Beweismittelverschiebung, kein Zeitgewinnenwollen. Allerdings kann eben auch – na ja. Da müsse man schon Fingerspitzengefühl haben. Und Vertrauen, kurioserweise. Menschenverstand schade auch nicht: Wenn die Mitarbeiter einer Fabrik in normaler Kleidung über ein Gelände spazieren, lassen auch die Inspektoren ihre Schutzanzüge im Auto – es wirke einfach merkwürdig bis lächerlich, in jeder x-beliebigen Kugellagerfabrik mit Gasmaske rumzurennen. Und eine Waffenfabrik muss ja auch nicht in einem ordentlichen Gebäude untergebracht sein, Schiffe auf dem Tigris, sagt man, beherbergten eventuell Reaktoren, vielleicht, ebenfalls im Verdacht sind LKWs, aber dann ist die Zielrichtung des Herstellungsprozesses noch lange nicht eindeutig: Pockenimpfung, Hefepilz oder Massenmord?
Die Recherche besteht also aus dem Negativabhaken. Vergleichbar mit der unfassbaren Sendung »Deutschland sucht den Superstar« (Kofi Annan, übernehmen Sie!), in der man ja auch dauernd keine Superstars vorgeführt bekommt, auf der Suche nach dem einen, bis dann der so genannte Pop-Titan Dieter Bohlen endlich schreien darf: »Geil!« Bzw.: »Eine Granate, deine Stimme.«
Außerdem, grinst der Laborleiter, hätte er sich dann ja den Bart abrasieren müssen, um die Gasmaske zu tragen. Zur Sicherheit habe er natürlich einen Bartschneider dabeigehabt. Kam aber vollbärtig durch den Einsatz.
Dann gehen wir jetzt mal ins Hochtoxiklabor. Endlich! Über den Steinweg, dort das Gebüsch, die Straßenlaternen, was könnte man hier herrliche Krimis drehen, Eurocops könnten hier allerhand Weltpolizeiliches erledigen, das sähen alle gern, schöne Schweizer Alpen und dazwischen in Schnapsgläsern die Gefahr, huhuhu. Am Trottoirrand das Gras, vielleicht mal unauffällig bücken, Schuh zubinden, dabei ein Grasbüschel herausreißen, die Hand als Plastiktütengreifmaul, wie beim Hundescheißeaufsammeln. Routinekontrolle. Der Rasen ist schön grün, die Berge, die hinterm Labor aufsteigen, sind schön weiß.
Der Berufsberater sagte zum heutigen Laborleiter damals, nach der Schule, er sei vom Typ her geeignet für den Einsatz von Händen und Kopf, er solle doch bitte Gärtner werden oder Chemiker. Seit 1985 leitet er das Labor in Spiez, noch einmal in den Irak würde er nun nicht gehen. Erstens, sagt er, wären jetzt mal Jüngere dran, und zweitens, das sei seine persönliche Meinung als zeitungslesender Bürger und habe mit seinem Beruf nichts zu tun, zweitens seien die Amerikaner doch ziemlich arrogant, und er habe wenig Lust, als akademischer Vorwand für einen offenbar ohnehin geplanten Krieg zu dienen. Bei den ersten Einsätzen sei die Gemengelage klarer gewesen, Irak böse, Kuwait befreien; heute alles schwieriger. Der Fotograf ist verzweifelt. Im Hochtoxiklabor sieht es auch aus wie im Chemieunterrichtsraum eines Gymnasiums. Kolben, Fläschchen, Brenner, Schläuche, Röhrchen, Dreifüße, Zylinder, Pipetten. Wo ist denn jetzt der Kampfstoff? Sagt er nicht, der Laborleiter. Ach so, natürlich. Unangenehm: Man war doch wieder so naiv, etwas Aufregendes erwartet zu haben. Dass es zumindest ein bisschen knallt oder jemand Vorsicht! schreit. Alles ganz ruhig. Immerhin ein leichter Unterdruck in der Ecke, im Vergleich zum Flur, damit im Falle eines Falles – aber zu behaupten, dass man den spürt, wäre gelogen. Gehen wir mal zur Radioaktivität, aha, soso, hier, ein Glas mit der legendären Probe von 1984 aus dem Iran. Hmhm. Es könnte auch ein Posten aus dem Gewürzregal sein, das Heimtückische an Massenvernichtungswaffen ist ja gerade ihre Unauffälligkeit. Einer Kanone sieht man ihre Bestimmung an – die Pulverform hat vielerlei Nutzungsabgründe. Man kann mit einem entsprechend munitionierten Flugzeug ein Feld düngen oder einen Landstrich ausrotten. Die Industrialisierung des Mordes einerseits, die so genannten friedensbringenden Kriege andererseits machen uns ethisch weitestgehend ratlos – und dann muss man auch noch glauben, sagt ja der Laborleiter, an irgendeinem Punkt, aber an welchem? Na eben, amen.
Gehen wir mal in den Gasmaskenraum, den Ausstellungsraum. Der Fotograf wirkt nun etwas versöhnt. Ohne Deckenlicht könnte man hier immerhin Kinder erschrecken. Im Halbkreis stehen ein Dutzend Plastikfiguren in von links nach rechts jüngeren Datums verwendeter Schutzkleidung. In der Ecke hängt als Kuriosum eine Pferdegasmaske. Der Laborleiter ist Hobbyreiter, und ein alter Kollegenpingpongspaß zwischen ihm und dem Pressesprecher geht so:
Irgendwann probier ich das nochmal aus.
Die Pferdemaske, ne?
Ja, muss ja getestet werden.
Und jetzt kommen die Geheimnisse. Die schmutzigen Geschichten. Der Pressesprecher und der Laborleiter wandern zwischen den schutzangezogenen Plastikfiguren herum und erzählen Anekdoten zu Schutzkleidungsentwicklungsphasen. »Meine Grundausbildung habe ich noch in diesem Anzug gemacht, hier haben wir anstelle von Filtern damals Bierdosen reingetan, diese Schuhe trage ich privat heute noch, die wollten meine Töchter vor kurzem wegschmeißen, aber die sind noch tadellos, und für Karneval oder als Requisit fürs Dorftheater sind sie immer noch im Einsatz. Diese Schuhe wurden auch bei der Erstbesteigung der Eigernordwand getragen.« Die Militärmode folge der allgemeinen Mode in einem Sicherheitsabstand von zirka zwanzig Jahren, erklärt der Pressesprecher und erinnert sich, wie er damals in der Rekrutenschule eine Exerzierhose zweckentfremdet habe zum nächtlichen Ausgang, da Röhrlihosen zu der Zeit gerade in Mode kamen; der Laborleiter zupft an einer »für Aufklärungs- und Entgiftungsaufgaben dichten« Gummitracht: Da hält man es maximal zwanzig Minuten drin aus, erzählt er, dann steht einem der Schweiß bis zu den Knien. Dort liegen Spritzen voll Gegengift. Nochmal der Pferdemaskenwitz. Ende der Kontrolle.
Alles in Ordnung. »Meine Herren – vielen Dank. Wir bringen Sie gerade noch zum Wagen.« Dunkelgrau hängt eine dichte Wolkendecke sich schwer in den Nachmittag hinein und möchte losregnen. Die Aussichten sind düster. Morgen soll es aber wieder schön werden, sagt der Pressesprecher.
Irgendwann kommt man an diesen Punkt, da muss man glauben. Tick, tick. Der Regen ploingt aufs Autodach.
Gartennazis
D. Jurko und G. Brandenburg in BILD: Es ist 8.30 Uhr, und auf Sylt ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Die »Gartennazi«-Affäre um Liedermacher Reinhard Mey – nun wollen es ihm die Nachbarn auf der feinen Urlauberinsel zeigen. Mey hatte sie in einem offenen Brief als »Gartennazis« bezeichnet, weil sie ihn beim Komponieren ständig mit Rasenmäherlärm stören würden. In schwarzen Shorts und Pulli kommt Reinhard Mey des Weges, hat sich beim Bäcker Brötchen und BILD gekauft.
Reinhard Mey (nimmt die Gitarre vom Gepäckträger und singt):
Er schloss die Türe hinter sich
Hängte Hut und Mantel in den Schrank, fein säuberlich
Setzte sich, »Na, woll’n wir erst mal seh’n, was in der Zeitung steht!«
Und da stand es fett auf Seite zwei:
»Gartennazis! Reinhard Mey!«
Er las den Text, und ihm war sofort klar
Eine Verwechslung, nein, da war kein Wort von wahr
Aber, wie kann etwas erlogen sein, was in der Zeitung steht?
(Er legt die Gitarre in den Sandkasten.)
Seit einer Woche suchen wir Erholung in unserem Ferienparadies – vergeblich! In dieser Zeit waren jeden Tag um uns herum die Gartennazis mit schwerem Gerät und unter Höllenlärm-Entwicklung damit beschäftigt, auf handtuchgroßen Grundstücken kleinen, unschuldigen Grashalmen den Garaus zu machen.
Vor Meys Haus: eine Ansammlung aus hauptsächlich Bürgervertretern, echten Bürgern, BILD-Lesern, BILD-Schreibern, Fotografen, Gärtnern, Geldgesocks.
BILD-Leser Günter Schullenberg: Laute Nachbarn als »Gartennazis« zu bezeichnen ist eine nicht hinnehmbare Verharmlosung der Nazis des Dritten Reiches.
Reinhard Mey: Das ist eine Wortschöpfung des Kabarettisten Georg Ringsgwandl für fanatische Rasenstutzer, Heckenspießer und Halmausrotter.
Dr. Georg Ringsgwandl:
Scharf rechts, hinterm Mond, wo der Gartennazi wohnt, nicht mehr Stadt und noch nicht Land, wo der Gartennazi wohnt. der ständig rumschleicht, spioniert, die andren alle drangsaliert, er gehört zu dieser Art von Leut’, die mit der Nagelscher’ den Rasen schneid’t.
Reinhard Mey: Dieses Lied hat Ringsgwandl im letzten Jahr hier auf Sylt präsentiert – das hat damals Jubel ausgelöst! Wer sich durch meine Worte vor den Kopf gestoßen fühlen will – bitte schön. Jeder zieht sich die Jacke an, die ihm passt. Ich wende mich gegen diese fanatischen Menschen, die in ihrer Abwesenheit dafür sorgen, dass aus ihrem Grundstück mit Flammenwerfer, elektrischem Zweitakter und Nagelschere ein englischer Rasen oder Golfplatz wird.
Nachbar Lothar Denkewitz, Autor der Buches »Gartenpflege einfach und erfolgreich«: Walzenmäher schneiden, Sichelmäher schlagen das Gras ab. Ein Rasen, der mit einem Walzenmäher geschnitten wird, sieht sauberer und grüner aus. Für kleinere Rasenflächen bis 200 qm reicht ein Handrasenmäher. Das Mähen mit ihm ist eine gute Gymnastik, bringt den Kreislauf auf Trab und fördert die Gesundheit.
Reinhard Mey (aufgebracht): Es stinkt und knattert!
Hans W. Hansen, Leiter der Ordnungsbehörde des Amtes Landschaft Sylt: Heutige Rasenmäher sind viel leiser als die vorgeschriebene Norm. Ein weiterer Ortstermin bei Herrn Mey ist nicht notwendig. Allerdings sollte er sich überlegen, ob die Wortwahl so richtig war – und dann die Dinge wieder gerade rücken.
Frank Jung, Sylter Nachrichten: Nun rückt den Musiker umgekehrt niemand in die Nähe von Skinheads, bloß weil der seine Haartracht mindestens so kurz zu scheren pflegt wie seine Nachbarn ihr Gras. Zwar kritisiert der Star zu Recht ein Verhalten, das auch viele Otto Normalbürger plagt. Aber um da gleich zur Nazi-Keule zu greifen, muss man schon ziemlich abgehoben sein.
Reinhard Mey: Wenn man etwas satirisch meint, muss man hier zu Lande wohl eine Riesen-Leuchtschrift anknipsen. Ich nehme kein einziges Wort zurück. Kurioserweise hat die Realität ja nun Dr. Ringsgwandls satirische Überspitzung eingeholt.
Kurausschuss-Vorsitzender Dirk Erdmann: Das wird doch alles nur hochgespielt.
Dr. Georg Ringsgwandl: Zu dem Lied hat mich ein Nachbar inspiriert. Zehn Tage nachdem wir eingezogen waren, hat er sich erschossen. Diese zehn Tage lang habe ich ihn nur schimpfend und Unkraut jätend erlebt. Und wie er meiner Frau gartengestalterische Direktiven erteilte. Der klingelte zwei Häuser weiter und sagte, Entschuldigung, Sie haben ja Ihr Kaminholz im Garten gar nicht korrekt abgedeckt, das schimmelt doch, das geht ja nicht, ich habe zufällig ein Blech dabei, das kommt da jetzt drauf. Na, der hat sich dann halt umgebracht, der war gut bewaffnet, wie sich hinterher herausstellte. Wir haben ja hier 80 % CSU-Wähler. Alles solide, Ärzte, Bänker, Chefs aller Art, dazu massig Frührentner, geldige Leute. Da kann man Geld auf der Straße liegen lassen – da kommt nichts weg. So, alles bestens, und dann hat da einer ein Waffenarsenal in der Speisekammer. Eben ein Pedantenarsch, ein gemeingefährliches.
Reinhard Mey: Montag links von uns, Dienstag hinter uns, Mittwoch schräg links über die Straße, Donnerstag gegenüber, Freitag rechts über die Straße, Sonnabend (doch nicht etwa Schwarzarbeit?) rechts neben uns, und heute fangen sie links von uns wieder von vorne an. Gleichzeitig stoßen sie zu, mit einem 4-Takt-Rasenmäher, einem 2-Takt-Kantentrimmer und einem 2-Takt-Laubpuster, alle an der oberen Drehzahlgrenze und mit Sicherheit jenseits aller zulässigen Lärmnormen.
Sylts Bürgermeisterin Ruth Sönksen: In der Amtsverordnung zum Schutz des Kurbetriebs steht unter § 2, Absatz 2: Während der Ruhezeiten (13 bis 15 Uhr, 21 bis 8 Uhr) ist jeglicher Lärm verboten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nachts Rasen mäht.
Kurausschuss-Vorsitzender Dirk Erdmann: Das wird doch alles nur hochgespielt.
Reinhard Mey: Die Urlaubsqualität sinkt durch diese ständigen Lärmattacken auf das Niveau einer mittleren Baustelle. Es gibt nur einen Ausweg aus dieser unerträglichen Situation und ein Mittel gegen diese völlig unnötige Umweltbelastung: ein strenges Gartenmaschinenreglement bzw. -verbot in den Sommermonaten. Es steht keine Katastrophe ins Haus, wenn im Juli und August nicht gemäht wird.
B. u. M. Dethloff aus Westerland: Sie irren: Einige Kurgäste inszenieren regelrechte Dramen, wenn ihr mitgemieteter Garten nicht regelmäßig gepflegt wird. Vor kurzem beschwerte sich z.B. ein Feriengast bei seinem auswärts wohnenden Vermieter, der Garten sei total verkommen. Richtig war: Es wurde einen Tag später als sonst gemäht, weil es den Tag zuvor stark geregnet hatte.
Reinhard Mey: Ich selbst habe unserem Garten eine Schonzeit im Sommer verordnet, und er ist wunderschön, mit blühenden Blumen und Gräsern und Insekten und Vögelchen, die in dieser Oase Zuflucht finden. Es gibt ästhetisch und biologisch keine zwingende Notwendigkeit, das Gras im Sommer am Wachsen zu hindern.
BILD-Leserin Josephine Tibackx: An alle Rasenmäherbesitzer: Verschrottet die teuflischen Dinger und gebt der Natur wieder eine Chance.
Mathias Rey aus Westerland: Es wäre sehr nett, wenn Sie Ihre Heimreise mit einer Anzeige in der Sylter Rundschau bekannt geben würden, damit wir dann einen Mähdrescher bestellen können.
Reinhard Mey: Kompromissvorschlag: Damit die Gartenpflege-Betriebe keine Einbußen haben, finden Sie bitte einen 4- wöchigen Turnus – so wie es mit der Leerung der Mülltonnen ja auch funktioniert –, mit dem Sie das Mähen in einem Inselort auf einen Tag im Monat begrenzen.
B. u. M. Dethloff aus Westerland: Die von uns betreuten Grundstücke sind auf drei Ortschaften verteilt. Wenn wir pro Inselort nur einen Tag im Monat mähen dürften, müssten wir ein paar Aufträge abgeben. Nun müssen wir Normalverdiener aber durchaus die ganze Woche über arbeiten.
Amtsvorsteher Heinz Maurus: Gehen Sie am Strand spazieren und entspannen Sie sich! Lassen Sie die Toleranz walten, die Sie in Ihren Liedern von anderen fordern.
Reinhard Mey: Kann es sein, dass Kampen, das sich so gern als Künstlerdorf darstellt, keins mehr ist, weil hier die Musen von Rasenmähern und Gartenmaschinen vertrieben werden?
Herr Baedeker: Als »St. Tropez des Nordens«, als »Worpswede an der Küste« oder als »Hiddensee der Nordsee« wird Kampen bezeichnet. Während zunächst tatsächlich Maler, Schriftsteller und ein paar Intellektuelle Kampen liebten, haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend Jet-Set und Schickeria breit gemacht.
Moritz Rinke: Ich komme aus Worpswede, aus dem richtigen Worpswede! Verzeihung, Rinke mein Name: Sie kennen mich wahrscheinlich als Schriftsteller, Dramatiker und Kanzlerspargelesser. Aber jetzt bin ich auch noch diesjähriger Sylter Inselschreiber. 111 Autorinnen und Autoren des deutschsprachigen Raums hatten sich mit einem Essay zum Thema »Das Wichtigste an einer Insel ist das Wasser drum herum« um den Förderpreis beworben. Das zum dritten Mal vergebene Stipendium des Mineralwasserkonzerns Sylt-Quelle umfasst einen achtwöchigen Aufenthalt auf Sylt, kostenfreies Wohnen in Rantum sowie ein Preisgeld von 5000 Euro. Mein Beitrag überzeugte die Jury durch gekonnte Metaphorik jenseits der gängigen Insel-Klischees.
Dr. Georg Ringsgwandl: Man muss schon wenig Scham haben, in Kampen zu wohnen. Neureiche unter sich, na servus. Da muss man schon robust sein. Kampen! Bäh, da gibt es so einen spießigen Scheißladen, erinnere ich mich, da gibt es im Grunde NUR spießige Scheißläden, erinnere ich mich, aber der spießigste Scheißladen, an den ich mich erinnere, ist das »Gogärtchen«.
Herr Baedeker: Im legendären Gogärtchen trifft sich die Kampener Szene nachmittags zu Kaffee und Kuchen, abends gibt es Sylter Kost zu gehobenen Preisen.
BILD-Leser Klaus Schützler aus Hamburg: Sylt kann ich mir als Rentner nicht leisten, verbringe jeden Urlaub daher in einer einsamen Hütte im Wald. Mein Angebot: Reinhard, lass uns doch mal tauschen!
Reinhard Mey: Ich appelliere an die Fürsorgepflicht der Gemeinde für diesen wunderbaren Flecken Erde. »Irgendein Depp mäht irgendwo immer«, singe ich trotzig-traurig auf meiner Terrasse in das Dröhnen der nachbarlichen Motorsense.
Rosemarie Katzera aus Westerland: Durch tausendfaches Hören deiner Lieder scheinst du mir so vertraut, dass mir ein »Sie« fast wie eine Beleidigung vorkäme. Wirst du das tun: Für deine nicht Rasen mähenden Nachbarn singen und spielen? Es gibt unendlich viele Sylter, die ihren Rasenmäher für ein Konzert von dir auf Sylt hergeben würden.
Reinhard Mey: Eigentlich hatte ich hier auf der Bank hinterm Haus eine Verabredung mit meiner Inspiration, aber bei dem Radau möchte sie mir doch lieber an anderer Stelle begegnen.
Hans W. Hansen, Leiter der Ordnungsbehörde des Amtes Landschaft Sylt: Es gibt mehr Unternehmer, die vom Gartenbau als von der Inspiration auf der Terrasse leben.
Moritz Rinke: Es ist schwer zu erklären, aber die Arbeit, das Schreiben auf einer Insel hat irgendwie etwas Befreiendes und zugleich Behütendes. Ich sitze wie auf einem kleinen Planeten und habe viel mehr Mut, zu wissen und zu behaupten, wie das Leben auf dem großen Planeten ist.
Über den Zaun winkt Friede Springer: Trinken Sie einen mit? Ich werde gerade 60 Jahre alt. Aber joggen hält mich fit. (Sie sprintet herbei.) Tag, die Herren. Äh, was ich sagen wollte, wegen der Nazi-Schose: Christian Kracht, der Schriftsteller und gleichnamige Sohn des einstigen Generalbevollmächtigten meines Mannes Axel sen. selig, dieser Christian Kracht, junior, besitzt das Copyright für den Begriff »SPD-Nazi«. Wussten Sie das? Und wer trinkt jetzt was mit?
Moritz Rinke: In Kampen ist man als dranner Dichter ja noch ’n Tick dichter dran. Gibt’s ja nicht! Der Sylt-Quellen-Dichter trifft die Gärtnerstochter von der Insel Föhr – Friede Springer! Zum Glück habe ich ein blau-weiß gestreiftes Hemd an. Meine Verehrung, Madame!
Reinhard Mey: Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr über’n Zaun,
Und genauso regelmäßig wurde ich dafür verhau’n.
Es gibt keine Maikäfer mehr, es gibt keine Maikäfer mehr!
Es gibt wichtigere Dinge, aber ich schreibe trotzdem
Auf ein Birkenblatt die Noten für ein Käferrequiem.
Dr. Georg Ringsgwandl: Reinhard Mey verkörpert im Grunde die Speerspitze des Linksspießertums. Vor Jahren rief er mal im SZ-Magazin den Trend »Vegetarisches Grillen« aus. Ja, geht’s denn noch? Ich weiß noch, da hab ich damals direkt in die Zeitschrift kotzen müssen.
Moritz Rinke: »Es ist besser, Gemüse zu essen und keine Gläubiger zu fürchten, als Ente zu essen und sich vor ihnen zu verstecken.« Gut, oder? Hab’ ich aus dem Talmud.
Reinhard Mey: Gemüse ist billig und gesund, und wie die meisten Armeleuteessen schmeckt es gut. Mir zumindest.
Nachbarin Katrin Lehmann: Der ist frustriert, weil er keinen Erfolg mehr hat. Er macht einen auf grün und fährt hier im dicken Mercedes und teuren Porsche rum.
Reinhard Mey: Ich sehe immer öfter lebendig, was tot vor mir auf dem Teller liegt. Gibt es Grillwurst, dann rennen ganze Herden von Schweinen vor meinem geistigen Auge herum. Wenn es Lammkoteletts gibt, sehe ich ein Lämmchen.
Eine Nachbarin namens »Eine Nachbarin«, (die, in einem Hula-Hoop-Reifen stehend, einen Gutinformierten Kreis darstellt): Sollen wir uns Schafe halten? Dann beschwert er sich, dass die Tiere zu laut blöken.
Reinhard Mey: Es soll zwar Menschen gegeben haben – wie etwa den Schriftsteller George Bernard Shaw –, die behaupteten, sie hätten beim Anblick von Steaks die Kühe muhen hören. So weit ist das bei mir aber nie gekommen. Ich habe sie immer nur gesehen.
BILD-Leser Jens Hansen (mäht gerade mit einem Kantentrimmer, kopfschüttelnd zu seinem Auffangkorb): Der ist bekloppt.
Moritz Rinke (schaukelt und liest dabei aus dem ihm über den Zaun gereichten Friede-Springer-Poesiealbum vor): Shaw schrieb auch ganz richtig: Am ehesten findet man Gott in einem Garten. Dort kann man nach ihm graben. (Er wirft das Buch zurück zu Friede Springer.) Mögen Sie in die Kurmuschel kommen morgen Abend? Ich inszeniere dort das Kanzler-Kandidaten-Duell. »Oh, oh, oh. Nein – Ha, ha, ha« heißt das Stück. Mit sensationellem Gastauftritt von Mario Adorf in der Rolle des Rezzo Schlauch. Wer spielt denn da so schön Klavier in Ihrem Teehaus?
Friede Springer: Das ist Matthias Döpfner. Wunderbar, nicht? Gleich wird er meinen Rasen mähen. Mit einem Aufsitzmäher. Bei der Fläche kommt man anders gar nicht gegen an, gegen den Graswuchs.
Reinhard Mey: Ist das das Flair des gepriesenen Kurortes? Ist das die heilsame Ruhe des berühmten Seebades?
BILD-Leserin Marga Niebuhr: Statt den Rasen zu trimmen, sollten die Nachbarn mal Reinhard Meys Lieder hören. Daraus spricht das wahre Leben!
Reinhard Mey liefert geschmeichelt eine Kostprobe: Alles, was ich habe, ist meine Küchenschabe/Sie liegt auf meinem Ofen, da kann sie ruhig poofen.
BILD-Leser Wolfgang Ludewig: Denkt dieser unsympathische Liedermacher auch mal an die ruinierten Nerven anderer Leute, wenn sie sich im Rundfunk seine zum Teil widerlichen Liedertexte anhören müssen?
Dr. Georg Ringsgwandl: Ich kenne tatsächlich Leute, die Platten von Reinhard Mey besitzen. Ich suche ja meine Freunde nicht nach ihrer Plattensammlung aus. Und irgendwas müssen die SPD-Wähler ja auch hören. Kitsch ist’s, Kitsch für Krankenschwestern. Oder Sekretärinnen. Es gibt ja auch Germanistikstudenten, die behaupten, Konstantin Wecker mache Lyrik.
(Friede Springers sprechender Dobermann hechelt herbei.)
Friede Springer: Sitz, BILD, mach Platz, BILD!
BILD macht Platz und fragt Frauchen: Ekeln Nachbarn Reinhard Mey weg von Sylt?
»Eine Nachbarin« bricht das Beckenkreisen ab – 25 Jahre Elvis tot! –, der Hula-Hoop-Reifen trudelt auf den Wimbledonrasen: Dann soll der Lieder-Trottel doch ins Watt ziehen. Da gibt’s kein Gras.
Hendrik Tongers, BILD-Leser aus Langeoog: Liebe Sylter Gartenzwerge! Mäht Mey nieder!
Friede Springer:BILD, fass!
Moritz Rinke: »Man kann die Natur mit einer Forke vertreiben, aber sie kehrt immer wieder zurück.« Horaz. Find ich auch nicht so ohne.
Dr. Georg Ringsgwandl: Den Gefallen, jetzt auf mein Gartennazi-Copyright zu pochen, den tu’ ich dem Hansel nicht. Ich mach mich doch nicht zum Leistungsschutzrechtsnazi.
Nobelpreisträger-Homestory
Man klingelt vergeblich bei der »Integrationsgruppe Harmonie« an diesem regnerischen Herbstnachmittag. Auch nützt es nichts, wahllos eine Mehrfamilienhausklingel zu betätigen und »Ich bin es« zu rufen. »Wer ist ich?«, blecht es nämlich zurück. Ein anderer, denkt der Reporter und schweigt besser still. Die Tür bleibt verschlossen. Nebenan, im Haus Nummer 13, bei den Grassens sowieso. Die lassen keinen rein heute. Seit ein paar Minuten wird es im Radio gemeldet, jetzt hat er den Preis, auf den er jahrzehntelang gewartet, ja den er erwartet hat. In diesem Haus hätte 1972 das Telefon klingeln und die frohe Botschaft übermittelt werden sollen – aber da war Böll erst dran. Am Preis, nicht am Telefon. Jetzt ist der Preis da, endlich, doch Grass ist weg. Auf dem Messingklingelschild steht zwar sein Name, die Familie wohnt noch dort, zum Teil, zu welchem genau muss man raten. Oder klingeln und einfach fragen?
Auf dem Bürgersteig ist das Laub ordnungsgemäß zusammengefegt. Ein paar hundert Meter weiter auf dem Markt kaufen die Friedenauer Bürger Frischwaren, tragen sie nach Hause und treten auf dem Heimweg gut gelaunt ein paar Kastanien den Gehweg entlang. Der Zeitungsladen hat auch Haustierfutter im Angebot und Backwaren, an den Bäumen informieren die Anwohner einander über Verlorengegangenes oder Möglichkeiten nachbarschaftlichen Entgegenkommens. Grassens trennen den Müll. Die Passanten auf ihre Art auch, im Rinnstein modert einiger Abfall, Werbung für Wolfgang Schäuble und einen Pizzabringdienst, eine leere Zigarettenschachtel, Kaugummipapier und ein Medikamentenbeipackzettel, nicht verschreibungspflichtig. Monoton donnern drei Jungs ihren Lederball gegen einen Metallzaun, sie schreien gedämpft und um 18 Uhr werden sie Bratkartoffeln serviert bekommen; der Nachmittag gähnt bleiern, da!, ein zu schnell fahrender Kleintransporter, der von einer schimpfenden Mutter auf spielende Kinder hingewiesen wird und kleinlaut abbremst, dann ist es wieder ruhig, nur der Regen und der Ball tönen, von fern die Hauptstraße. Da kommen zwei Mädchen vom Spielplatz, der Nieselregen scheint Ernst zu machen, die Mädchen haben das Spielen aufgegeben und betreten Grundstück Nummer 13, fragen den Reporter zu Recht, was er denn da macht, und er verwickelt sie geschickt in ein Gespräch, statt zuzugeben, dass er spioniert, die Kreideschrift auf der Treppe (»Anne«, gleich mehrmals, hat wohl gerade schreiben gelernt, die Anne) memoriert und alles, was er entdecken kann, was etwas bedeuten könnte; dass er neugierig ins Arbeitszimmer schielt, dann ins Kinderzimmer und sich wundert, dass gar keine Vorhänge vorgezogen sind, kein Wachhund bellt, dass man einfach klingeln kann (ob es wohl bimmelt, schellt oder läutet?), wenn man sich traut, dass im ersten Stock tatsächlich noch eine große rote lachende Sonne der Kernenergie eine höfliche Absage erteilt, nein danke. Die Grassens wohnen doch hier, tastet der Reporter sich vor. Ja, das sind wir, nicken die Mädchen. Der Reporter staunt. Echte Grassens. Er möchte mehr wissen, wie denn der Opa Günter und wann zuletzt und ob nicht – da erscheint die Mutter der beiden. Sie muss gar nichts sagen, der Reporter hebt entschuldigend die Hände, zieht von dannen, drinnen kreischen die Kinder und die Mutter dreht den Schlüssel zweimal um.
Es ist sein Haus, es ist seine Familie, es ist sein Tag heute, aber es ist nicht mehr sein Zuhause, diese Nummer 13. Es wird früh dunkel, und die 13 beginnt zu leuchten, wie in all den Jahren zuvor.
11.09.2001: Daheim bei Walter Kempowski
Die Bilder waren übermächtig, Schweigen wäre die adäquateste Kommentarform gewesen, doch in Ausnahmesituationen misstrauen Fernsehjournalisten dem Vorteil ihres Mediums, hin und wieder ohne Worte auszukommen, und meinen, ihre Sprachlosigkeit durch superlativischen Blindtext überlisten zu können. Das Undenkbare ist eingetreten. Die Welt wird von nun an eine andere sein. Eine neue Zeitrechnung! Wieder mal. Walter Kempowski lag auf seinem Bett, notierte, was er sah, und ärgerte sich über das Verhältnis von Information und Emotion in der Berichterstattung. Die dagegengesetzte detaillierte Beschreibung sowohl der Bilder als auch ihrer Aufbereitung macht seine Aufzeichnungen nun, zwölf Jahre nach dem Mauerfall, so wertvoll. »Alkor«, Kempowskis gerade erschienenes Tagebuch des Jahres 1989, ist eines der gehaltvollsten Geschichts- und Geschichtenbücher über dieses bewegte deutsche Jahr.
Für sein »Echolot« hat Kempowski hunderte Tagebücher gelesen und ausgewertet (und tut es weiterhin), deshalb wohl gelingt es ihm in »Alkor« so mustergültig, eine Existenz zu skizzieren, an der entlang erzählt die Historie greifbar wird. Jeder Tagebuchtag beginnt mit der unkommentierten Gegenüberstellung der Überschriften von BILD und Neues Deutschland, und dann nimmt Kempowski irgendeinen Faden auf und beginnt zu erzählen, über das Landleben im niedersächsischen Nartum, das Füttern der Hühner, den Fortgang der Arbeit, seine Ehefrau, die Weltgeschichte, das Wetter, Lektüre und das Mittagessen. Da ihn das TV-Gelalle eines Politikers oder das Werk eines selbstherrlichen Kollegen in exakt demselben Maße erzürnt wie das Telefonklingeln während des Mittagsschlafs, da er also nicht in die Eitelkeitsfalle des Auswiegens und Nachsortierens tappt, ist der Leser 600 Seiten lang auf Seiten des Auskunftgebenden.
Durch die tägliche Schlagzeilen-Ouvertüre ist man schnell wieder in der Hysteriegrammatik jener Zeit, und anders als bei den TV-Wiederholungen der Tagesschau, bei denen Frisur und Krawattenwahl des Moderators die Geschehnisse, auch wenn sie nur zehn Jahre zurückliegen, unbestimmt weit zurückdatieren, der Bezugsfaden gekappt wird, so erzielt Kempowskis meisterliche Verzahnung von kollektiver und persönlicher Erinnerung beim Leser ein Gefühl der absoluten Unmittelbarkeit. In der Erinnerung und Nachbetrachtung kürzt man ja gern das Drumherum, beschränkt sich auf das vermeintlich Wesentliche, lässt dem Leben damit nachträglich die Luft raus, und viele Tagebuchveröffentlichungen kranken an diesem parfümierenden Gestus: Schon damals war mir klar. Jaja. All die neuen Zeitrechnungen dauernd.
Interessant und also überliefernswert findet Kempowski tatsächlich alles (»2. Quartett von Mendelsohn. ›Dem Kronprinzen von Schweden gewidmet‹. Möchte man gerne wissen: Warum?«), und je banaler, für sich genommen, die zusammengetragenen Zeugenpartikel sind, desto besser. Auch dies scheint eine aus der Arbeit am und der Wirkung vom »Echolot« gewonnene Erkenntnis, die ihm nun bei der persönlichen Geschichtsschreibung nützt. Die unterschiedlichen, gleichberechtigten Quellen und Schnipsel, die er zusammenführt, sind in ihrer Wahl sehr persönlich und daher nachvollziehbar, werden durch ihre Breite aber allgemein gültig, und dadurch gelingt es ihm, 1989 in einer ungeheuren Vielstimmigkeit erstehen zu lassen. Ihm selbst ist wahrscheinlich sogar das noch zu subjektiv, Walter Kempowskis Gesamtwerk ist ja geprägt von dieser Sammelwut, dieser asymptotischen Annäherung an die VOLLSTÄNDIGE Dokumentation – zum Beispiel, unter so viel anderem, Steffi Graf betreffend, überlegt er in »Alkor« schelmisch, dabei stets im Dienst: »Was die wohl für perverse Briefe kriegt. Ob sie die mal einer Forschungsstelle zur Verfügung stellt?«
Durch seine deskriptive, bewusst naive (»Was das nun wieder soll?«), alles hinterfragende Schilderung der Ereignisse kommt Kempowskis Text tatsächlichem Erleben sehr nahe, er nennt die Bilder und Situationen, die sich einprägen, und nicht die, von denen man es gern hätte. In seinen Urteilsfindungen nähert er sich von ganz, ganz außen: Aufgehört, Tennis im Fernsehen zu verfolgen, hat Kempowski exakt an dem Tag, an dem Michael Stich zum ersten Mal eine Mütze verkehrt herum aufsetzte. Das Getöse wird vereinfacht, Weltgeschichte entlärmt (»Hitler im weißen Jackett« oder auch »Honecker mit Strohhut«), denn Hildegard hat Husten oder der Hühnerstall ist endlich fertig. Schilderungen und Erkenntnissen des Landlebens setzt Kempowski in »Alkor« den Begriff »Dorfroman« voran, offenbar der Arbeitstitel seines 1999 erschienenen Buchs »Heile Welt«, doch lässt sich diese Stoffsammlung im Tagebuch auch anders lesen: das Bekenntnis zum Leben als Literatur. Alles ist, alle sind Literatur! Jeder schreibt seine Geschichte, indem er lebt. Jeden Tag. Walter Kempowski würde sich wohl nie eine Geschichte ausdenken. Er lebt den Dorfroman, stilisiert das ihm anhängige Image des reaktionären Welt am Sonntag-Lesers gründlich über die Satiregrenze hinaus (»Was bleibt, sind die deutschen Militärmärsche«), bastelt sich eine Murmelbahn, ihm wachsen Haare aus den Ohren, er hört Brahms und findet allerlei zum Kotzen. Vollkommen sympathisch.
Er scheint in seiner (Selbst-)Beobachtung keinen Lebensbereich auszulassen, doch die sachliche, mildironische Diktion gibt dem Leser nie das Gefühl, an etwas Intimem teilzuhaben, alles scheint exemplarisch, selbst das »Leibschneiden«. Oft verniedlicht Kempowski, fast scheint es, als rede er beruhigend auf ein schreiendes Baby ein, dabei ist es eine brutalgenaue Nationsanamnese.
Das meiste erscheint ihm erstaunlich, komisch, seltsam, er würde vielleicht sagen: »merkwürdig, und zwar im Wortsinn«; und im Grunde ist er pausenlos dezent beleidigt: vom Körper genervt, vom Kontostand in Sorge versetzt, vom Verlag vernachlässigt, von der Kritik ignoriert, von Lektüre, Fernsehen, Besuch oder Wetter in den Wahn getrieben. Aber nur kurz, immer auch spielerisch: Hochamüsante Schimpfkanonaden enden nicht selten in Gewaltphantasien. Diese dicke Frau im Süßwarengeschäft – »kleine Arschtritte und im belgischen Kongo aussetzen!« Als Bewältigungsreflex erzeugen die Zumutungen immer wieder knappe Brutalurteile: »Revuescheiße«, »Skischeiße«, »Ladenschlussscheiße«, »Walzerscheiße«.
Kempowski ist meinungsfreudig, jedoch in der immer auch schon stilisierten Verbohrtheit von einer beispiellosen Offenheit nach allen Seiten, die wohl auch seine Alleinstellung im deutschen Literaturbetrieb erklärt. Preise, Frauen, Auflagen, Übersetzungen haben die anderen.
Dass man ihn, den ehemaligen Bautzenhäftling, nun nicht täglich in der »Tagesschau« interviewt, wundert ihn wie eigentlich alles, und doch kann er diese Verletzung erfrischend offensiv und immer noch lakonisch darlegen: »Ja, unsereiner steht hier jetzt ein bisschen blöd in der Gegend rum. Hat da einer gerufen? Nein, es hat niemand gerufen. Lesung in Neuwulmstorf.« Und in Berlin halten die anderen wichtige Reden oder signieren in Hamburg noch viel wichtigere Appelle. Erhellend ist es, parallel zu »Alkor« in Peter Rühmkorfs 1995 erschienenem Tagebuch der Jahre 1989–91 (»Tabu 1«) zulesen. Und was einem damals vergnüglich erschien, bleibt nun, im direkten Vergleich, bloß eitel nachpoliert, als singuläre Onaniebestleistung wahrscheinlich bemerkenswert, als Zeitdokument aber recht unerheblich. Im November 1989 schreibt Kempowski tagelang nurmehr mit, protokolliert phasenweise lediglich stichwortartig, baut daraus eine wunderbare Chronikcollage, während Rühmkorf zeitgleich alles sowieso schon durchschaut und es leider verpasst, kurz mal von sich abzusehen. Im Vergleich zu »Tabu« deutlich angenehmer ist »Alkor« auch dadurch, dass Kempowski auf jegliche Dirty-old-man-Posen verzichtet. Einmal bekommt er Besuch von Mädchen aus dem Dorf, die Briefmarken geschenkt haben wollen. »Ich fragte, ob sie schielen könnten. Sie konnten. Und wie! – Folglich bekamen sie Briefmarken.« Ein anderes Mal wünscht er sich ältere Schaffnerinnen, da die jungen solche »Schafsgesichter« hätten. Rühmkorf hingegen wäre, dem »Tabu«-Selbstentwurf nach, wahrscheinlich lieber mit der jungen Kontrolleurin kiffen gegangen und dann mal sehen und so weiter, und bei der Briefmarkenmädchenepisode hätte er kaum auf die Einbringung des Wortes »lecken« verzichten mögen, dessen kann man gewiss sein.
Vor zwei Jahren, bei einem von Kempowski in seinem Haus ausgerichteten »Tagebuchseminar«, las Rühmkorf abends vor den anwesenden »Ich schreibe auch«-s (überwiegend regulationsdefekte ältere Damen mit Brillenbändern und Strickzeug). Das Verhalten der beiden Schriftsteller unterschied sich an diesem Abend exakt so voneinander wie Ton und Absicht ihrer Tagebücher: Rühmkorf singsangte einige Gedichte und trank Wein dazu (Literatur!), streichelte dabei seinen mehrfarbigen Seidenschal. Kempowski schlich mit einer Fliegenklatsche durch den Raum und grinste. Nach der Lesung setzte sich Rühmkorf neben die jüngsten Damen im Raum, bis er sie müde geredet hatte, dann zur Nächsten, es wurde später, die Jüngsten älter. Die Sitzgruppen um Rühmkorf herum tönten weinselig, Kempowski gesellte sich derweil (kurz stehen bleibend, nie Platz nehmend, immer freundlich, nie verbindlich) zu allein herumsitzenden Gesellschaftsversagern, sagte tröstend »Na, mein Herr?« oder so etwas – und ging sehr früh ins Bett. Am darauf folgenden Morgen, am späten Vormittag, hieß es, Rühmkorf habe sein Auto ins Maisfeld gesetzt und im Übrigen seine Medikamente im Vorleseraum vergessen. Er selbst liege ebenfalls noch, und gut gehe es ihm nicht gerade. Für Kempowski war es da fast schon wieder Mittagsschlafenszeit.
Als am 11. September 2001 das World Trade Center brannte und schließlich in sich zusammenfiel und angesichts der irreal erscheinenden Bilder die einzig normale Reaktion entsetztes Schweigen gewesen wäre, die Fernsehjournalisten aber das Unerklärliche einzuordnen versuchten – da lag Walter Kempowski wieder auf seinem Bett und notierte, was er sah. »Der Strom von Kitsch ekelt an«, benotete er die Berichterstattung. In zwölf Jahren wird sein Tagebuch von 2001 veröffentlicht werden. Die Bilder wird man bis dahin nicht vergessen, das Drumherum größtenteils schon. Gut also, dass Kempowski mitschreibt: »Es werden Choräle angestimmt. Na.«
Fernsehen mit Kempowski
Walter Kempowskis Buch »Bloomsday« ist das Protokoll eines ganzen Fernsehtages. Ein Gespräch mit ihm darüber – am Telefon und zappend.
BvS-B: Guten Abend, Herr Kempowski!
WALTER KEMPOWSKI: Na, mein Herr, Sie wollen heute Abend einen großen technischen Versuch starten, ja?
Nun, wir unterhalten uns, sehen dabei fern, gucken, wie sich das Programm einmischt oder ob wir es notschlachten müssen, und das alles wird dann mitgeschnitten; also Versuch: ja, großtechnisch: eher nicht.
Gut. Ich sitze genau vor dem Fernseher.
Wie gucken Sie denn im normalen Leben fern – geplant oder aufs Geratewohl zappend?
Ich sehe beim Frühstück die Rundfunkzeitung durch, und da finde ich dann Sendungen, die ich gerne sehen möchte oder nicht – heute zum Beispiel nichts. Im Tagesverlauf flippe ich da dann schon mal durch, einfach so, um auf andere Gedanken zu kommen.
Welche Fernsehzeitung frühstücken Sie denn?
Welche haben wir, Hildegard? Die Hörzu, ja. Weil die einen guten Rundfunkteil hat, sagt meine Frau. Und das stimmt auch.
Und darin markieren Sie dann täglich Ihre Favoriten?
Ja, am Sonntag kam eine ganze Stunde über Glenn Gould, »Die Kunst der Fuge«; wann kriegt man so was schon geboten, das ist doch ausgezeichnet! So etwas gucke ich mir gern an.
Für Ihr Fernsehprotokoll »Bloomsday« haben Sie sich äußerst diszipliniert – bis nahe zur Selbstaufgabe, muss man vermuten – und sich 37 Kanäle im ständigen Durchschalten zugemutet.
Normalerweise habe ich nur 20 oder 22 zur Verfügung. Das ist, glaube ich, normal.
Ich habe nur vier. Anormal?
Dann haben Sie also kein Kabel. Seien Sie glücklich, wenn Sie damit auskommen. Aber arte zum Beispiel entgeht Ihnen dann. Oder denken Sie an die tägliche Kultursendung auf 3sat, da wird man sehr gut informiert – fast besser als durch Zeitungen.
In der ARD läuft gerade die »Tagesschau«.
Erstes Programm, Moment, ja, da ist die Hübsche, wie heißt sie noch?
Dagmar Berghoff.
Ja, mit kurzem Haar und gepuderter Nase.
Wie wäre es mal mit RTL?
Von mir aus. Da streckt gerade einer die Zunge heraus. Huch!, wenn im Fernsehen das Telefon klingelt, denke ich immer, es klingelt bei mir. Jetzt gucke ich wieder ins erste Programm, da ist diese neue Wetterkarte, die ärgert mich, auf der findet man überhaupt nichts mehr. Im ZDF wird gerade so ein Schlipsmensch verhört von einem Unrasierten mit modischem Hemd, der ist wahrscheinlich der Gute.
Läuft der Fernseher bei Ihnen auch nebenbei?
Nein, wenn nichts Gescheites läuft, stelle ich ihn aus.
Am »Bloomsday« mussten Sie dranbleiben und haben etwa im 15-Sekunden-Takt weitergeschaltet. Hat Sie da nichts länger fesseln können, oder haben Sie sich das verboten?
Ungefähr dreimal bin ich länger drangeblieben: bei Heiner Müller, bei Biolek und Kohl und einmal, als es um Busen ging. Das war lustig, wie die Frauen sich darüber unterhielten, wie man den Busen größer macht. Aber das war die Ausnahme, mir lag explizit an einer Zufallsstatistik. Ich wollte einfach mal dokumentieren, was das Fernsehen so innerhalb von 19 Stunden verzapft.
Dabei ließen Sie die Menschen ausreden. Da haben Sie höflich gezappt.
Man lässt sie schon ausreden, aber dann in der nächsten Sendung kommt man natürlich mitten in irgendeinen Halbsatz hinein, und da habe ich dann ein bisschen korrigiert, indem ich begonnene Halbsätze herausgenommen habe, damit es verständlich wird.
Trotzdem lesen sich Ihre unkommentierten Aufzeichnungen wie das Protokoll eines Hofgangs im Irrenhaus.
Wenn man dem Strand von Warnemünde einen Löffel voll Sandkörner entnimmt, dann ist das eine »stetige Menge« – ziemlich langweilig. Wenn Sie aber die Sandkörner einzeln mit dem Vergrößerungsglas betrachten, bemerken Sie große Unterschiede.
Das grobe Sandkorn »Geh aufs Ganze« haben Sie mal sehr gelobt – war das zynisch?
Nein, das mochte ich wirklich ganz gerne, das war so direkt. Normalerweise kriegen die Menschen bei solchen Sendungen Punkte oder so, aber wenn der da die zerknüllten Geldscheine aus der Tasche holte und den Kandidaten unter die Nase rieb, das fand ich irgendwie gut.
Absurderweise wird ja im Fernsehen – trotz visueller Darstellung – viel mehr gequatscht als im Radio.
Jaja, ununterbrochen wird da gesprochen. 365 Tage im Jahr auf 78 Kanälen, ist das nicht ungeheuerlich?
Ist es. Wie haben Ihnen denn eigentlich dabei die Bilder gefallen?
Die kann man ja nun leider nicht abtippen. Wir hatten vorher überlegt, ein Video-Printgerät zu besorgen, aber dann schien uns die konsequente Übersetzung in das andere Medium sinnvoller.
Ist dieser Wechsel fair, oder ist das Fernsehen nicht eigentlich ganz bewusst nur Fernsehen, Unterhaltung zumeist, und so auch angelegt – müssen sich Kohärenz und Sinngehalt also messen lassen am Medium Buch?
Das wirklich repräsentative Protokoll von 19 Stunden – und das war ja die Intention – zeigt, dass dort in der Tat überwiegend Dünnsinn geredet wird, aber dafür kann ja ich nichts, die haben das ja wirklich alles gesendet!
Aber hat nicht Ihre Vorgehensweise das Ergebnis a priori festgelegt – oder anders gefragt: Hat Sie die nun vorliegende Gaga-Collage überrascht?
Ich war ehrlich gesagt schon geplättet hinterher. So schlimm hatte ich es mir einfach nicht vorgestellt.
Macht das Fernsehen krank oder machen Kranke das Fernsehen?
Das Fernsehen an sich ist ja wertfrei. Wie ein Auto enthält es verschiedene Potentiale: Idiotie, aber auch Vernunft. Sinnvoll genutzt, ist doch das Auto ein höchst nützlicher Gegenstand. Andererseits ruinieren manche Leute mit ihren Autos sich selbst und die Umwelt, denkt man etwa an Formel-1-Rennen – da kichert dann Idiotie heraus. Genau wie beim Fernsehen.
Der »Bloomsday« war Ihnen wohl tatsächlich ein Experiment – Sie schalten gar nicht so rasant beziehungsweise eigentlich gar nicht um.
Überhaupt nicht. Gerade ist da wieder diese Frau mit den roten Lippen.
Immer noch das ZDF, nun schalten Sie doch mal um!
Na gut, auf RTL ist diese großäugige Kommissarin, die mag ich auch nicht, sie spielt einfach nicht gut, da würde ich also weiterschalten. Nun kommt der Bayerische Rundfunk, da wird ein Vortrag über Blutproben oder so gehalten, das ist Ekel erregend! Weiter: Ein Kapitän im NDR, jetzt spricht er, hören Sie mal, der hat wohl sein Schiff restauriert, auch uninteressant, irgendwelche Kurbelwellen sieht man da.
Viele Menschen schalten einfach so lange weiter, bis etwas erträglich genug ist. Sie dagegen können ja lange suchen mit Ihren Ansprüchen.
In der Not frisst der Teufel Fliegen. Also, auf MDR heult eine Frau, ganz uninteressant, durch den SDR läuft eine Tankstellenkassiererin mit einem Pferd, im WDR lecken sich gerade Vampire gegenseitig das Maul – vielleicht würde ich mir das eine Weile ansehen, das ist doch ganz possierlich.
Ihre Arbeitsweise haben Sie mal als Ordnung schaffendes Sichten bezeichnet. Ist »Bloomsday« auch so ein Versuch zu reduzieren, freizulegen?
Versuch ist schon richtig, aber – ach, jetzt bin ich zu abgelenkt durch dieses unsägliche Fernsehen.
Dann schalten Sie den Apparat doch aus!
Ich sollte ihn doch anhaben, haben Sie gesagt. Herrgottnochmal, da kommt man ja ganz durcheinander! Also, worüber wollten Sie nun noch sprechen?
Romanschreiben als Ordnungschaffen, Mülltrennung vielleicht, Sie und die Zettelkästen. Die Verblödung, die einen da umzingelt, dass Sie die reduziert haben auf das gesprochene Wort und so den Ausblick freigelegt haben auf die Struktur …
Ja, Struktur stimmt. Eine gewisse Ordnung – nicht pedantisch, wohlgemerkt! Die Struktur des Angebots mal festhalten.
Nochmal die Frau mit den Lippen im ZDF, in der ARD Manfred Krug. Was sehen Sie gerade?
Ich hatte den Apparat jetzt abgeschaltet. Soll ich den denn nun wieder anschalten, Hildegard? Sie sind gründlich, sagt meine Frau. Also, in der ARD ein Mensch mit Brille, der in »Tadellöser & Wolff« mitgespielt hat, dessen Namen ich aber vergessen habe, der junge Mann da, der jetzt von hinten zu sehen ist. ZDF: die unerträgliche Frau Schreinemakers, die küssen sich jetzt, nein, das ist sie ja gar nicht … (so weiter)
Presseclub
Studio.
Da sitzen sie mit ihren Dialekten. Sie wissen, worum es geht. Jedem ins Gesicht geschrieben: die Angst, der Weg bis hierhin; leider auch: wie es weitergeht. Entschuldigen Sie mal. Wenn Sie mich ausreden lassen. Warum ausreden lassen? Man weiß, was kommt, jeder weiß es. Wir lügen. Entschuldigen Sie bitte. Das ist eine ganz andere Frage. Die Diskussion kommt mir bekannt vor. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich sag mal. Das kann man so sehen.
Dann gehen sie hinaus, zurück an die Arbeit, nein: Sonntag. Überstunden oder Familie. In Familie machen, sagen sie. Wenn sie eine haben. Sonst: einen Film ausleihen. Mal ein
#
GUTES BUCH
#
lesen.
Um mal diese drei Beispiele zu nennen. Und jetzt frage ich Sie. Gerade Sie, ich will da jetzt keine Namen nennen. Warum nicht, warum nicht? Die gedeckten Farben. Schulfernsehen. Mit Resthaar überkämmte Tonsuren, Wassergläser, Stabilopoint88-Stifte stochern Argumente in die Luft. Sowohl als auch. Doppelkinne.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, auf Wiedersehen. Die blaue Eins.
12:44:49
12:44:50
12:44:51
12:44:52
12:44:53
12:44:54
12:44:55
12:44:56
12:44:57
12:44:58
12:44:59
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem »Wochenspiegel«.
Abspann.
Schlingensief vs. Jauch
Der Kassierer an der Tankstelle in Potsdam guckte Günther Jauch gestern Morgen fröhlich ins Gesicht. Er hielt es für unumgänglich, sich originell zu verhalten, und sagte deshalb nicht Guten Tag, sondern: »Ah, Herr Jauch! Wollen Sie:
Brötchen
Eine Sonntagszeitung
Eine Grillwurst
Tanken?«
Gequält murmelte der Moderator etwas und beeilte sich mit dem Bezahlen, um unbedingt den frohlockenden, sich im Feixen des Kassierers schon ankündigenden Zusatz noch abwenden zu können, er, Jauch, könne natürlich auch jemanden anrufen, wenn er unsicher sei.