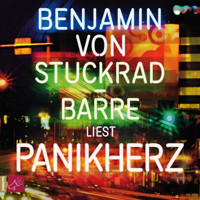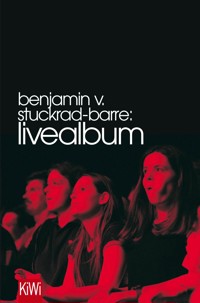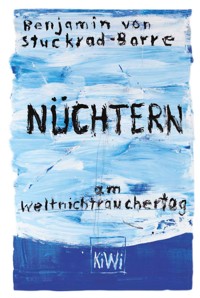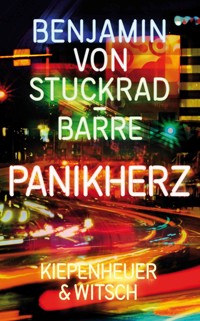
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Abschied von der Nacht: Benjamin von Stuckrad-Barres Comeback! Er wollte genau da rein: zu den Helden, in die rauschhaften Nächte – dahin, wo die Musik spielt. Erst hinter und dann auf die Bühne. Unglaublich schnell kam er an, stürzte sich hinein und ging darin fast verloren. Udo Lindenbergs rebellische Märchenlieder prägten und verführten ihn, doch Udo selbst wird Freund und später Retter. Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man sie sich nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das Rockstar-Leben, bekam beides und folgerichtig auch den Rockstar-Absturz. Früher Ruhm, Realitätsverlust, Drogenabhängigkeit. Und nun eine Selbstfindung am dafür unwahrscheinlichsten Ort – im mythenumrankten »Chateau Marmont« in Hollywood, in das ihn Udo führte. Was als Rückzug und Klausur geplant war, erweist sich als Rückkehr ins Schreiben und in ein Leben als Roman. Drumherum tobt der Rausch, der Erzähler bleibt diesmal nüchtern. Schreibend erinnert er sich an seine Träume und Helden – und trifft viele von ihnen wieder. Mit Bret Easton Ellis inspiziert er einen Duschvorhang, er begegnet Westernhagen beim Arzt und Courtney Love in der Raucherecke und geht mit Thomas Gottschalk zum Konzert von Brian Wilson. Andere sind tot und werden doch gegenwärtig, Kurt Cobain, Helmut Dietl. Stuckrad-Barre erzählt mit seiner eigenen Geschichte zugleich die Geschichte der Popkultur der letzten 20 Jahre. »Panikherz« ist eine Reise in die Nacht, eine Suche nach Wahrheit, eine Rückkehr aus dem Nebel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Benjamin von Stuckrad-Barre
Panikherz
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Benjamin von Stuckrad-Barre, 1975 in Bremen geboren, ist Autor von »Soloalbum«, 1998, »Livealbum«, 1999, »Remix«, 1999, »Blackbox«, 2000, »Transkript«, 2001, »Deutsches Theater«, 2001, »Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft – Remix 2«, 2004, »Was.Wir.Wissen«, 2005, »Auch Deutsche unter den Opfern«, 2010, »Panikherz«, 2016, »Nüchtern am Weltnichtrauchertag«, 2016, »Udo Fröhliche«, 2016, »Ich glaub, mir geht’s nicht so gut, ich muss mich mal hinlegen – Remix 3«, 2018 und »Alle sind so ernst geworden« (mit Martin Suter), 2020. Der neue Roman erscheint im April 2023.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Er wollte genau da rein: zu den Helden, in die rauschhaften Nächte – dahin, wo die Musik spielt. Erst hinter und dann auf die Bühne. Unglaublich schnell kam er an, stürzte sich hinein und ging darin fast verloren. Udo Lindenbergs rebellische Märchenlieder prägten und verführten ihn, doch Udo selbst wird Freund und später Retter.
Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man sie sich nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das Rockstar-Leben, bekam beides und folgerichtig auch den Rockstar-Absturz. Früher Ruhm, Realitätsverlust, Drogenabhängigkeit. Und nun eine Selbstfindung am dafür unwahrscheinlichsten Ort – im mythenumrankten Chateau Marmont in Hollywood, in das ihn Udo führte. Was als Rückzug und Klausur geplant war, erweist sich als Rückkehr ins Schreiben und in ein Leben als Roman. Drum herum tobt der Rausch, der Erzähler bleibt diesmal nüchtern. Schreibend erinnert er sich an seine Träume und Helden – und trifft viele von ihnen wieder. Mit Bret Easton Ellis inspiziert er einen Duschvorhang, er begegnet Westernhagen beim Arzt und Courtney Love in der Raucherecke und geht mit Thomas Gottschalk zum Konzert von Brian Wilson. Andere sind tot und werden doch gegenwärtig, Kurt Cobain, Helmut Dietl.
Stuckrad-Barre erzählt mit seiner eigenen Geschichte zugleich die Geschichte der Popkultur der letzten 20 Jahre. »Panikherz« ist eine Reise in die Nacht, eine Suche nach Wahrheit, eine Rückkehr aus dem Nebel.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2016, 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung und -motiv, Titel- und Deckblätter Walter Schönauer, Berlin
ISBN978-3-462-31575-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Neulich war ich mal wieder in Amerika
Wir heben ab
Schneller Junge
Auf Entdeckungstour
Abtörnstadt
Hallöchen, DDR!
Hollywoodschwüre
An der Bar, auch wenn’s nur Kaffee war
Der kleine Boxer
Ein Hinterhof in Hamburg-Altona
So laut wie’s geht
Spießertrance
Die bunte Glitzerstadt
Guckte hoch aufs weiße Schloss
Wunschkino
Glitzerknabe
Show-Business-Maschine
Zur blauen Stunde
Na, Popstar?
Manchmal nachts
Allmählich wegjonglieren
Irgendwie ein Gefühl zu viel
Madman-Discothek
Mich zieht’s zum Kiez
Wenn’s drauf ankommt
Durchdreh-Lebensstil
Ich mach für dich ’n Fanclub auf
Da oben hinter den Sternen
Relaxium-Rauscho-Easylin
Nebelschwadenbilder
Ferngesteuerte Quälerei
Nun singt er sein Lied in den stürmischen Wind
Dieses Zimmer ist ein Sarg
Stürzt ab, steht auf und startet von vorn
Mein Puls geht ganz normal
In Hollywood am Swimmingpool
Achterbahn der Welt
Mitternacht, ich ging spazieren
Und er macht seinen Koffer auf
»Die längsten Reisen fangen an, wenn es auf den Straßen dunkel wird.«
Jörg Fauser
Wir haben beide einen Hut auf. Udo konnte sich nicht entscheiden, welchen er mitnimmt, hatte keine Hutschachtel griffbereit, also war für den Zweithut die sicherste Beförderungsart: mein Kopf.
Wir sind Touristen. Das ist ganz wichtig. Holiday, vacation! Urlaub, Urlaub, Urlaub. Davon darf man nicht abweichen. Egal, mit welchen Trickfragen sie kommen – Urlaub. Ich habe zur Sicherheit auch Udos ESTA-Nummer auf einem Klebezettel in meiner Reiseunterlagenklarsichtfolie, Udo hat seinen Reisepass schon aufgeklappt in der Hand, er glaubt, dass es ganz schnell geht. Wie immer, wenn wir zusammen reisen, nehme ich ihm kurz Pass und Ausweis ab und freue mich an den dort festgehaltenen Staatsbürgerfakten: Udo Gerhard Lindenberg. Gerhard! Wohnsitz: Hotel Atlantic.
Ein Schalter wird frei, und der Uniformierte in dem uns barsch (»Next!«) zugewiesenen Glaskasten hat besonders schlechte Laune. Natürlich sind wir rein äußerlich ein seltsames Paar, nicht unbedingt Leute, die man ohne Nachfragen durchwinkt: Udo in engen Nadelstreifenhosen, mit Nietengürtel und auf neongrünen Socken, er hatte keine Lust mehr auf Schuhe nach dem langen Flug, dazu eine Art Kapitänsuniformjacke und einen braunen Hut, ich mit Matrosenhemd und Jogginghose, Udos Zweithut auf dem Kopf, einem Tropenhut. In Deutschland wäre das gewiss anders, doch wenn man ihn nicht kennt und einfach zum ersten Mal Udo Lindenberg sieht, so, wie er eben aussieht, tja, was macht man da als Grenzkontrolldobermann? Es ist ja nicht so, dass wir aussehen, als hätten wir eventuell Drogen dabei oder so, wir sehen vielmehr aus, als bestünden wir praktisch aus Drogen. Säße ich in so einem Glaskasten: Diese beiden Typen würde ich mir auf jeden Fall genauer angucken.
Jetzt keinen Fehler machen. Freundlich, aufgeräumt, klar, unverdächtig wirken. Immer wenn man das versucht, wirkt man natürlich besonders verdächtig. Ich fange an zu schwitzen. Schon bei dem Herrn vor uns hat es zehn Minuten gedauert, und der sah nun wirklich so aus, wie ein Zwölfjähriger einen seriösen Geschäftsmann malen würde.
Erst jetzt bemerke ich, dass Udo tatsächlich Zigarre raucht, ganz lässig, beiläufig, im Flughafengebäude, im rauchparanoiden Amerika.
Hi, hi, yeah, here we are, happy to be here again, how are you doing man, good looking, sagt Udo und pafft an seiner Zigarre. Und ich denke: Das war’s dann.
Der Uniformierte ist nicht zu Späßen aufgelegt. Doch da kennt er Udo schlecht. Den aus der Ruhe zu bringen, da braucht es schon mehr, als missmutig zu gucken und zu bellen: No smoking, Sir!
Oh, excuse me, yeahyeahyeah, sagt Udo friedlich – und lässt die Zigarre brennen, hält sie aber jetzt auf Gürtelhöhe, das ist sein Kompromissangebot.
Ich versuche, das Schlimmste zu verhindern, und geselle mich dazu, werde aber streng zurück hinter die Absperrung geschickt, Einzelvernehmung. Und so kann ich nicht eingreifen und sehe und höre nur, wie alles immer schlimmer wird. Udo hört gar nicht auf zu reden.
Der Uniformierte fragt Udo, was er beruflich mache. Schon toll, dass Udo das noch mal gefragt wird in seinem Leben. I’m a musician, started as a drummer, you know, back then, hundred years ago …
Das ist komplett wahnsinnig. Udo trommelt ein bisschen mit seinem Reisepass und seiner Sonnenbrille auf dem Grenzschaltertresen herum. Drummer, Jazz-Drummer, you know? Yeah! But now …
Er muss jetzt sofort aufhören, seinen Wikipedia-Eintrag szenisch vorzutanzen. Ich nähere mich noch mal, um die Sache abzukürzen, aber der Uniformierte wedelt mich weg wie eine Schmeißfliege. Dass man sich so fühlt, ist ja Ziel dieses amerikanischen Einreisewahnsinns.
Ich höre Udo sagen, er sei von Beruf Udo Lindenberg, diesen Beruf gebe es nur einmal auf der Welt, Udo, nicht Ufo, wobei, so sicher könne man da gar nicht sein, denn er sei eigentlich, heimlich, aber das dürfe keiner wissen, das entführte Kind von Charles Lindbergh.
Ah ja? Der Uniformierte guckt jetzt nicht mehr misstrauisch, es ist mehr so ein Guantanamo-Blick.
Er sei, fährt Udo fort, ein in Deutschland sehr berühmter Rockmusiker, aber man wisse ja nie, junge Talente, weltweit unterwegs, vielleicht werde das ja noch was mit seiner Karriere in Amerika? Er zeigt, das tut er wirklich, dem Uniformierten auf seinem iPhone einen Videomitschnitt von einem seiner Stadionkonzerte.
Yeah, godong, godong, sagt Udo.
Und ich denke, alles klar, das endet auf jeden Fall in einem fensterlosen Raum.
Schade, die Reise war so heiter losgegangen. Udo und ich, zu zweit nach Los Angeles. Weil es jetzt ja schon wieder vorbei ist, fliegen die schönsten Szenen der bisherigen Reise noch mal an mir vorbei: Gestern Abend mein erster grober Fehler als Reiseleiter, beim Zwischenstopp in Zürich folgte ich der Ausschilderung, Transit Hotel, ich dachte, das sei richtig, denn Transit war es doch, was wir machten, Zwischenhalt in Zürich, anderntags von dort der Direktflug nach Los Angeles. Weil Udo durchgängig plapperte und vor allem ein Zigarrengeschäft suchte, merkte er kaum, dass wir einmal im Kreis durchs gesamte Flughafengebäude liefen.
Schließlich, an der sehr seltsamen Rezeption (ein Resopaltisch) des Transit Hotels, blickte Udo sich irritiert um: Sah letztes Mal irgendwie ganz anders aus, ist das echt das Radisson Blu?
Nein, es war das Transit Hotel, eine Notunterkunft für Menschen ohne Visum.
Udo: Joah, Schlafsaal, Jugendherberge, ne, könnten wir auch machen, führt vielleicht zu erotischen Begegnungen mit gestrandeten Elfen, hm? Aber lass mal vielleicht doch gucken, ob wir das Radisson Blu nicht noch finden, die hatten so ’ne gute Bar.
Wir fanden das richtige Hotel, und Udo sagte zum Rezeptionisten: Sag mal, muss man bei euch auch zum Rauchen raus vor die Tür, wie ’n Hund? Jaaaaaa, echt? Sogar in der phantasievollen Schweiz? Lektionen in Udo-Charme, funktioniert weltweit.
Als er beim Auschecken nach der PIN seiner Kreditkarte gefragt wurde, wusste er nicht weiter. Wie könnte die denn sein? Das wusste ich natürlich auch nicht. Hm, überlegte Udo, da müsse er wohl mal seine Reisefee anrufen oder seinen Steuerberater – oder wer das eben weiß.
Irgendwer wusste es dann, wir flogen ab, beide einen Hut auf, bester Dinge, wir freuten uns, Los Angeles, zehn Tage zu zweit rumstreunen, Blödsinn machen, bisschen an den Texten für seine nächste Platte arbeiten – und ansonsten flexible Sorte, mal gucken, ne?; so reist man mit Udo. Mir fiel ein alter Udo-Text ein, so wie mir eigentlich immer, in jeder Situation, ein alter Udo-Text einfällt, und das hier passende Grenzkontrollcomputer-Zitat geht so:
Ich sag, bitte taken Sie’s easy
Man weiß doch, was da steht
Dass die Republik an solchen Vögeln wie mir
Sowieso demnächst zugrunde geht[1]
Doch was ist nun mit Udo und dem Uniformierten? Ach, Udo erzählt ihm gerade, er und ich, wir seien Straßenkatzen, deshalb könne man noch gar nicht so genau sagen, was wir hier machen würden und wo, das werde man ja dann sehen, ne? Zwar seien GERMAN LYRICS seine Spezialität, doch sei er immer offen für Neues, und so ’n Welthit, och, den würde er schon nehmen, warum nicht, ginge zur Not auch auf Englisch, und vielleicht finde er ja hier mit seinem Hitnäschen irgendwo in der Wüste oder in einer schummrigen Bar oder so ein Lied, das er mit seiner Stimme veredeln könne, ob vielleicht er, der Uniformierte, zufällig einen hätte, einen Hit, you never know, er sähe sehr musikalisch aus, ob er nicht manchmal zu Hause musiziere für seine gewiss sehr hübsche Frau?
Und jetzt passiert das Unglaubliche: Diese volle Ladung Udo-Charme und improvisierender Laber-Jazz sind dem Uniformierten zu viel, jetzt fällt er wirklich aus seiner Rolle, der des abweisenden Angstverbreiters – und er lacht, er hört gar nicht auf zu lachen.
Er winkt Udo weiter, lacht immer noch, schüttelt den Kopf, ruft Udo hinterher, dass er ein lustiger Typ sei. And good luck!
Dann bin ich dran. Ob ich zu dem gehöre, fragt der Uniformierte, zeigt auf Udo, immer noch kopfschüttelnd und lachend.
Ja, sage ich – und darf direkt hinter Udo hergehen, ganz kurzer Blick in den Pass, jaja, alles klar.
Ich gehöre zu Udo, so viel ist sicher.
Es musste dringend was passieren – und da knallte die Musik von Udo Lindenberg in meine Kindheit. Es war, als habe jemand einen Lichtschalter in meinem Kopf betätigt.
Wir wohnten in Rotenburg/Wümme, einer Kleinstadt mit dreiziffrigem Autokennzeichen, zwischen Hamburg und Bremen, im niedersächsischen Flachland. Mein Vater war Pastor, ich war das jüngste von vier Kindern, Benjamin, letztes Kind, aber hebräisch auch: Sohn der Freude. Zu solcher gab ich familiär in dieser Zeit keinen Anlass, es ist ungefähr 1987. In der Schule war ich sehr schlecht. Mein ältester Bruder hatte soeben Abitur gemacht, knappe Sache, die beiden mittleren Geschwister waren die Streber, der Älteste und ich waren die Sorgenkinder, dauernd unerwidert verliebt, und statt wie die anderen beiden wohlklingend Klavier und Geige zu üben, hörten wir immer nur laut Popmusik, was vor allem während der heiligen Mittagsschlafzeit zwischen 14 und 15 Uhr für Kontroversen sorgte; auch waren es immer nur Freunde von ihm oder mir, die ausgerechnet in dieser Stunde anriefen – und dann aber nie wieder, weil sie so laut angeschrien wurden.
Jetzt wohnte mein ältester Bruder in der großen Stadt – in Hamburg. Er machte dort seinen Zivildienst, die meisten seiner Mitschüler wurden Soldaten, was für uns als Pastorenkinder natürlich nicht infrage kam. Ohnehin waren wir Outlaws, auf dem Schulhof musste ich ständig blöde Witze aushalten von all jenen, die bei meinem Vater Konfirmandenunterricht hatten. Konfirmieren ließ man sich, um eine Stereoanlage geschenkt zu bekommen und Geld, mein Vater aber wollte natürlich wirklich was lehren, ein unlösbarer Konflikt, und als Sohn dieses bärtigen und (weil nicht in der CDU) als kommunistisch geltenden Pastors war ich nun schuld daran, dass sie das Vaterunser auswendig lernen mussten. Strafverschärfend betrieb meine Mutter den Kinderchor.
Damit es nicht so auffiel, dass wir Pastorenkinder die einzigen waren, die alle Lieder konnten (wir hatten ja keine Wahl), und damit nicht wir immer alle hochanspruchsvollen Charakterrollen übernahmen bei den KRIPPENSPIELEN und anderen saisonalen Highlights, wurde ein besonders demütigendes Amt erfunden, meine Mutter nannte uns: Eselverstärker. Wir saßen also geduckt, verdeckt, hinter dem den Esel Verkörpernden, und unterstützten ihn gesanglich.
Meine Eltern gehörten vermutlich zu den ersten Ökos Deutschlands. Müsli war damals noch ein Schimpfwort, man bezeichnete meine Eltern und ihresgleichen so, sie wurden MÜSLIS genannt. Bio und Öko waren lange noch kein anerkannter Bessergestelltenlifestyle, Bio und Öko standen für teurer, schlechter, riecht nicht gut, schmeckt nicht gut, funktioniert nicht – ist aber FAIR. Mit Gesinnungsfreunden betrieben meine Eltern einen genossenschaftlichen Bioladen, in dem man unfassbar teuren Kaffee und Honig kaufen konnte, außerdem graues Papier, das aus Altpapier hergestellt war und auf dem die Tinte an den Buchstabenrändern immer faserig versickerte; die unlackierten Naturholzbleistifte brachen dauernd ab. Man wollte mit diesem Ökoschrott die DRITTE WELT unterstützen, weil aber dieser Begriff natürlich diskriminierend war und das Problem, das zu bekämpfen man sich vorgenommen hatte, beschrieb, nannten sie das Geschäft »Eine Welt Laden«.
An den Ladenwänden hingen Plakate von afrikanischen Kleinkindern, die an Brunnen oder Reisausgabestellen Schlange standen, ganz dicke Bäuche hatten (was, paradox, vom Hunger kam, wie uns erklärt wurde) und große traurige Augen, daneben war eine Spendenkontonummer gedruckt. Es stank entsetzlich in diesem Laden. Er lag gegenüber der Molkerei, da gab es KAKAOTRUNK in selbstverständlich hochgiftigen Verbundkunststoffkanistern, höchst umweltbedenklich und also für uns verboten, wir mussten faire Biomilch aus lichtschutzbraunen Glasflaschen trinken, außerdem, so meine Mutter gern, wenn sie sich lustig machte über ständig Limonade trinken wollende Chorkinder: »Es muss nicht getrunken werden.«
Meine Eltern und ihre Genossen trugen Buttons mit Friedenstauben an ihren kratzigen Strickpullovern. Unser Familienauto war ein dröhnender Diesel-Peugeot 504, riesig groß, mit vier Kindern galt man sowieso als asozial. Die pazifistischen und atomkraftskeptischen Aufkleber machten es nicht besser.
Ich beneidete Mitschüler, die und deren Familien von meinen Eltern als – Achtung, Kampfbegriff – SPIESSIG bezeichnet wurden. In die Kirche gingen diese Spießereltern allenfalls Heiligabend, und falls es in ihren Gänsebratenablauf passte, was meine Eltern nicht gutheißen konnten, aber ja mussten: besser als nie. Die verlässlich überhohen Weihnachtskollekten im dann ausnahmsweise geldscheinknisternden KLINGELBEUTEL waren ein etatbedeutender Posten für so allerlei SOZIALE PROJEKTE (und eine Schwundform des Ablasshandels). Kopfschüttelnde Seitenblicke meiner Mutter von der Orgel, wenn sie diese Heiligabendchristen ertappte bei der Unkundigkeit in liturgischen Abläufen, aufstehen, hinsetzen, mitsingen und so weiter. Spießerkinder bekamen viel zu viele Weihnachtsgeschenke, was meine Mutter als MATERIALSCHLACHT ächtete – das können wir nicht und das wollen wir auch gar nicht, sprach sie etwas zu Unrecht im Plural für uns Kinder mit. Doch auch die Spießerkinder mit ihren Barbiepuppen bekamen ihre Chance und durften, bei Wohlverhalten oder besonderer Förderungsbedürftigkeit, für das alljährliche Krippenspiel das Christkind zur Verfügung stellen, und so stand in der Adventszeit verlässlich irgendeine Chorkindvanessa vor unserer Haustür und übergab eine leicht zerrupfte Puppe mit dem bei uns zu Hause seither geflügelten Satz: Ich hab Jesus dabei.
Die Spießereltern fuhren teure, schicke Autos mit Aufklebern von Fußballvereinen, man durfte bei den Spießern fernsehen, es gab die ersten Computer, zum ZOCKEN, in der Küche standen Süßigkeiten, es gab Cola und Nutella, Tennisunterricht und Markenkleidung. Wir trugen Vererbtes, Geflicktes, Selbstgestricktes, und wenn die anderen im Sommer in die Wärme fuhren, ans Meer, mussten wir entweder an der Nordsee frieren oder in den Bergen zehn Stunden pro Tag wandern (das dann allerdings bei extremer Hitze). Anders als meine ununterbrochen diverse Chöre und Orchester leitende Mutter verbrachten die Spießermütter viel Zeit beim Friseur, bedienten ansonsten ihre Kinder, holten sie vom Fußballtraining ab, und wenn sie dran waren mit Trikotwaschen, legten sie in den Trikotkoffer anschließend Schokolade für alle; sie rauchten und rochen nach Parfüm. Die Väter waren nie da, und wenn sie da waren, tranken sie Bier, guckten Sportschau oder hörten Musik, und Klassik war das nicht. Bei uns zu Hause lief immer nur Klassik, niemals Popmusik, ständig diese fordernde, runterziehende Klassik, dazu ernste Gespräche.
Die meisten Spießer besaßen Häuser mit kleinen, GEPFLEGTEN Gärten und ernst gemeinten Zäunen. Wir wohnten in einer Dienstwohnung direkt neben der Kirche, ein riesiges Haus, die Großfamilie also vorgesehen – und dauernd standen jammernde Christen im Treppenhaus. Offenes Haus. Im Erdgeschoss befand sich das Kirchenkreisamt, auf dem Hinterhof die kleine Druckerei, in der Gemeindebriefe und Liederzettel hergestellt wurden. Zum Wandschießen super geeignet. Der sich dahinter erstreckende, in Wald und Sumpflandschaft übergehende Garten war nicht pflegbar, aber groß.
Das Urgeräusch meiner Kindheit: permanente Kirchturmglockenschläge, einmal um Viertel nach, zweimal um halb, dreimal um Viertel vor, viermal – plus tiefer, Uhrzeitzahl – zur vollen Stunde, sowie das ausufernde Gebimmel um zwölf Uhr mittags und sechs Uhr abends, sonntags zehn vor zehn, um zum Gottesdienstbesuch zu ermahnen, und dann noch mal gegen fünf vor elf zum Vaterunser; außerdem bei Taufen, Hochzeiten und Todesfällen – es bimmelt also das ganze Leben durch.
So lernte ich früh, was mir später bei der Dosierung von Schlafmitteln, Alkohol und anderen Drogen wiederbegegnen sollte: Dauergabe führt zum Gewöhnungseffekt, und um dann noch eine Wirkung zu erzielen, muss man die Dosis erhöhen. Noch heute ist es so, dass ich es schlicht nicht höre, wenn eine Kirchturmuhr schlägt, mein Gehör scheint das zu organisieren wie diese geräuschnivellierenden Kopfhörer, die eine Gegenfrequenz erzeugen und somit Stille. Damit ich eine Kirchturmglocke schlagen höre, muss man mich schon im Glockenturm einsperren. Auch habe ich das GEFÜHL, praktisch täglich in die Kirche zu gehen, obwohl mein letzter Gottesdienstbesuch Jahre zurückliegt; das ist wie bei Obelix, der als Kind in den Zaubertrankkessel gefallen ist und deshalb keinen mehr trinken muss, wenn es gilt, mal rasch ein paar Tausend Römer zu verdreschen.
Manchmal kam mein ältester Bruder aus Hamburg zu Besuch und erzählte uns von den Abenteuern in der großen Stadt. Von seinem ersten Zivildienstlohn kaufte er sich ein paar Gläser Nutella, weißen Toast – und Popmusik. Platten und Konzertkarten. Was er aus der Tasche zog, wenn er uns besuchte, war für mich in etwa das, was in der DDR die WESTPAKETE waren, verbotene Luxusgüter aus der freien Welt.
Die erste Lindenberg-Platte, die mein Bruder mitbrachte, war zwar fast so alt wie ich selbst, doch hörte ich sie und damit Udo jetzt zum ersten Mal: »Livehaftig« hieß die Platte, ein Konzertmitschnitt aus den Siebzigerjahren.
Himmel, was war dieser Udo Lindenberg für ein Typ! Noch heute kann man mich nachts wecken und direkt fragen, Entschuldigung, mit welchen Worten eröffnete Udo noch gleich das Konzert auf der Platte »Livehaftig«? Schön, dass Sie fragen, würde ich entgegnen, Udo sprach Folgendes:
»Willkommen an Bord, alle ready? Wir heben ab, das Panikorchester und Peter Herbolzheimers Pustefixbläser – Andrea Doria!«
Ich war direkt entflammt. Dieser Udo Lindenberg, das merkte ich sofort, der ist unser Freund. Der kämpft für uns, der ist Vorbild, Leitstern, der hat recht. Er ist verrückt und lustig, biegt die Sprache, spielt mit ihr, der erlebt für uns die großen Abenteuer und erzählt uns davon, der kennt sich aus, dem kann man vertrauen. Udos Lieder handelten von Kindersorgen, von gemeinen Eltern und blöder Schule, außerdem von Themen, die ich aus Abenteuerbüchern und Märchen kannte – und von Sachen, über die ich Vages gehört hatte und dringend mehr erfahren wollte: Mädchen, Nacht, Mafia, Bars, Amerika, Besoffensein. LIEBE, wie schön sie sein kann, wie weh sie jedoch genau deshalb auch tut, wie sie anfängt, wie sie aufhört; und der RAUSCH, wie extrem lustig, aber wohl auch ganz schön gefährlich der zu sein scheint. All das lernte ich aus Udos Liedern.
Auch für ihn waren, wie für meine Eltern, SPIESSER ein Feindbild, weitere Gemeinsamkeiten gab es aber nicht, Udos Welt, die ich nun betrat, war eine vollkommen andere. Und die war besser, viel besser.
Udos Platten waren fortan für mich der perfekte Übergang von Kinderhörspielen zur Popmusik, da gab es Außerirdische, Vampire, Detektive, das Personal hatte ausgeflippte Namen wie Rudi Ratlos, Jonny Controlletti, Bodo Ballermann, Käpt’n Zäsar Zechmann, Dr. Lockerlose, Deichgraf Hauke Wattenschlick. Auf den Plattenhüllen war Udo verkleidet als Eskimo, Neandertaler, Astronaut, Kapitän oder Dirigent, und hörspielartig gab es Hintergrundgeräusche: Autos, Flugzeuge, Schiffe. Die Großstadt, der Hafen – und dass Hamburg beides bot, außerdem Udo dort wohnte, angeblich in einem HOTEL, wie ich von meinem Bruder erfuhr, machte Hamburg endgültig zum Sehnsuchtsort für mich.
Mein Bruder hatte mit diesem Westpaket mein Leben verändert. Er überspielte mir die Platte auf eine Kassette und fuhr zurück ins gelobte Land, in meiner Vorstellung ging er dort jeden Abend zu einem Udo-Konzert. Vielleicht weil meine erste Udo-Platte ein Livemitschnitt war und ich diesen täglich hörte, dachte ich, diese tobende Menge kommt wirklich jeden Tag dort in Hamburg zusammen und Udo singt für die. Dass mein Bruder stattdessen täglich alten Menschen – wie man den Zivildienst damals prosaisch umschrieb – den Hintern abwischte, außerdem von den Desinfektionsmitteln bald schlimme Neurodermitis bekam, konnte mein Hamburg-Bild nicht trüben.
Ich hörte diese Udo-Kassette so oft, bis sie irgendwann riss, doch da kannte ich die Lieder alle schon auswendig. Materialermüdung! Mich aber hatte dieses Material geweckt, erweckt, ein Kometeneinschlag, nun war es hell, jetzt konnte es losgehen, das Leben. Ich tauchte völlig ab in diese Udo-Welt. Wenn mir alles zu viel wurde – und wenn man zwölf Jahre alt ist, wird einem natürlich mehrmals pro Tag alles zu viel –, setzte ich Kopfhörer auf und suchte Rat und Trost bei Udo. Rasch war Udo für mich in den Rang eines Aufklärers gerückt, ein Weltenentdecker, mein Humboldt.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war in doppelter Hinsicht eine Ansage, gebadet in Applaus:
»Willkommen an Bord, alle ready? Wir heben ab …«
Ich war ready. Das war mein Dampfer, mein Raumschiff, was auch immer, jedenfalls war ich an Bord, Udo war der Kapitän.
Und dann hoben wir ab.
Musik hören war ja gut. Aber leider musste ich auch selbst welche machen, denn sonst würde man später ja ziemlich sicher einen Schnurrbart bekommen, Mofa fahren, eine Lehre machen, bei der man ein Namensschild am Kittel tragen muss, und eine Frau mit Dauerwelle heiraten.
Das Gegenprogramm begann mit der MUSIKALISCHEN FRÜHERZIEHUNG in der Musikschule, da hauten alle Kinder sinnlos eine Stunde lang auf allen greifbaren Instrumenten herum. Recht bald wurde ich wegen ungebührlichen Verhaltens von der Gruppe separiert, ich hatte ein Xylophon aus dem Fenster geworfen und war auch sonst nicht gerade eine Stütze des Kurses. Zum Erstaunen meiner musikpädagogisch eher unnachgiebigen Mutter hieß es seitens der Lehrerin (die bloß den für sie lukrativeren Einzelunterricht anordnen wollte), ich sei – und wer hört solches über sein Kind schon ungern – hochbegabt. Ein folgenschweres Missverständnis.
Schlagzeug hätte ich gern gespielt, doch war meine Meinung bei der Wahl des Instruments nicht gefragt. Ich baute mir aus leeren Waschmittelpapptonnen ein provisorisches Drumset, hörte Radio Bremen und kloppte mit einem Xylophonschlegel auf die Waschmitteltrommeln. So richtig Spaß machte das nicht. An eine Stehlampe hängte ich mit einem Wollfaden eine Triangel, die ließ ich am Ende jedes Trommelsolos erklingen, wenigstens das machte Spaß. Noch toller war, die beiden Strahler von der Stehlampe abzuschrauben, dann sah sie aus wie ein Mikrophonständer, und ich konnte damit Rockkonzert spielen. Wenn es draußen dunkel war, erzeugte das Deckenlicht ein Spiegelbild im Fenster zum Garten, und ich übte mit dem Stehlampenständer die klassischen Mikrophonständer-Rocksängergesten, ich sang in den Lampenständer, kniete mich hin und zog den Lampenständer zu mir nach unten – und genau wie ein Mikrophonständer wippte er, wenn ich ihn losließ, zurück in die Stehposition, der metallene Tellerfuß ermöglichte das. Ich hielt den Lampenständer auch gern mal Richtung Kirchturm, da war das gedachte Publikum und sang für mich. Ich klappte dann, wie Sänger das auf Konzertpostern auch immer taten, kokett ein Ohr um, damit die Leute noch lauter sängen.
Noch heute hängen überm Klavier im Haus meiner Eltern gerahmte Fotos, die uns als Kinder mit unserem jeweiligen Instrument zeigen, und man sieht gleich, meine beiden mittleren Geschwister sind hoch konzentriert, die Haltung ist vorbildlich, klingt bestimmt gut – der Älteste aber pustet kreuzunglücklich in eine Posaune, und der Jüngste, also ich, hält seine Geige eher senkrecht als waagerecht, als stehe er an der Straße und halte den Daumen raus, damit ein Auto anhält und ihn mitnimmt, egal wohin, Hauptsache, ganz weit weg. Udo sang mir den mit dieser Geste verbundenen Sehnsuchtsfloh ins Ohr:
Nun steh ich wieder an der Autobahn
Und halt den Daumen in den Wind
Es wurde Zeit, mal wieder loszufahren
Ich weiß noch nicht, wohin es geht[2]
In der Musikschule roch es nach Linoleum und kaltem Schweiß, in unserer Familie wurde dieser spezifische Geruch, der überall waberte, wo man Kindern und Jugendlichen etwas beibrachte, beschrieben mit dem geflügelten Wort UNTERM ARM. Wenn meine Mutter mich, was immer mal vorkam, nach dem Geigenunterricht abzuholen vergaß, wartete ich vor einer Pinnwand im Musikschultreppenhaus. In meiner Erinnerung geraten die Proportionen da etwas durcheinander, in meiner Erinnerung nämlich stand ich netto etwa ein Jahr lang unter dieser großen Pinnwand, wo Konzerte beworben und Musikinstrumente zum Verkauf angeboten wurden. Sehr lang hing dort auch ein Plakat, das auf die Gefahren des Rauchens hinweisen sollte: eine senkrecht stehende, qualmende Zigarette, in der ein junger Mensch gefangen war, der Jeans mit Schlag trug und traurig dreinblickte. Wenn diese Zigarette fertig geraucht ist, so die nicht sehr verklausulierte Plakatbotschaft, dann ist der junge Mensch auch weggeraucht.
Ich rauchte damals noch nicht, was nicht ungewöhnlich war für einen Zwölfjährigen. Aber das Plakat konnte mich auch nicht in dem Maße indoktrinieren, es niemals zu tun, wie im Gegenzug Fotos vom rauchenden Udo auf Plattencovern mir nahelegten, dass Zigaretten unbedingt dazugehören, wenn man lässig irgendwo rumzuhängen beabsichtigt (und hat man IRGENDWELCHE anderen Pläne als kleiner Junge?). Udo im Trenchcoat, mit Hut, an einer Straßenecke, lässig an der Zigarette ziehend: jahrelang, ach, bis heute eigentlich mein Idealbild einer gelungenen männlichen Existenz. Wie der da steht! Mit diesem Typen ist zu rechnen. Der hat was vor.
Nach einem FREITAGSVORSPIEL, bei dem alle Musikschüler ihre momentan größten Hits vor elterlichem Publikum darbieten mussten, nahm irgendeine lokale Geigenkoryphäe meine Mutter zur Seite und erklärte ihr das Offensichtliche: Dieser Junge und die Geige, die werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Ich durfte aufhören mit dem Geigenunterricht, allerdings nur im Tausch gegen Klavierunterricht. Wieder kein Schlagzeug. Das Klavier hatte zwar den Vorteil, dass man nicht erst ein halbes Jahr die Haltung lernen musste, man setzte sich einfach dran, streckte die Finger aus, Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger – fertig, ein Akkord, Wohlklang. Knifflig wurde es, wenn die Finger übereinander und untereinander durchkrabbeln mussten (was sie dauernd mussten). Als deutlich wurde, dass es auch mit diesem Instrument und mir nichts werden würde, durfte ich wiederum nur aufhören mit der Auflage, ein weiteres Instrument auszuprobieren, nun das wohl demütigendste: C-Flöte.
Den peinsamen Flötenunterricht übernahm praktischerweise die Schwester meines Mathenachhilfelehrers. Das große silberne Fünfmarkstück, das ich ihr als Entlohnung dieser für sie wie mich grausamen Stunden mitbringen musste, steckte sie bei Stundenbeginn in eine leere Handcremedose – und dann die Flöte unter ihren Arm, in die Achselhöhle, das Instrumentenholz müsse aufgewärmt werden. Sie trug Norwegerpullover, auch im Sommer, und schien kein Fan davon zu sein, Deos zu benutzen oder übertrieben oft zu duschen, ziemlich unterm Arm also alles. Das lag in der Familie, denn bei ihrem Bruder, der damit betraut war, mir seine Begeisterung für Normalparabeln, den Satz des Thales und die binomischen Formeln zu vermitteln, roch es natürlich so, wie es in Zimmern von Naturwissenschaftscracks während der Pubertät eben riecht. In diesem Haus der Schande atmete ich grundsätzlich nur durch den Mund. Woche um Woche gab ich da die Fünfmarkstücke ab, und weder in Mathematik noch beim Flöten zeitigte dieser olfaktorisch herausfordernde Spezialunterricht große Erfolge.
Niemand verstand mich, außer Udo, der sang:
Und dann in der Schule hatte
Keiner Bock auf Mathe[3]
Udos Gegenangebot, das allerdings nur ausgetestet wurde von sehr verwegenen, allgemein als verwahrlost wahrgenommenen Schülern, Udos alternativer Lehrplan also:
Lieber ging man stolz mit ’ner Zigarette
Zum Schwindeligwerden auf die Toilette
Und war nicht der Typ mit den Schlagjeans, gefangen in der Plakatzigarette, der einzig coole Typ, den ich jemals im Musikschulgebäude gesehen hatte?
Instrumente und Notenhefte wurden gekauft im Musikhaus Vajen, es lag direkt am Marktplatz, und zunächst mochte ich den Laden nicht, stammten doch von dort die Tortur-Partituren meines fortgesetzten Instrumentversagens. Allerdings – und je älter ich wurde, desto bedeutender wurde das – gab es dort auch Tonträger. Popmusik.
Oft ging ich nun, während meine Mutter auf dem Wochenmarkt einkaufte, freiwillig ins Musikhaus Vajen, meine Mutter fand das gut. Ob sie dachte, ich schaute mir dort Klaviernoten an? Natürlich schlich ich nur sehnsüchtig um die Schlagzeuge herum und verlor mich dann in den Plattenauslagen. Unter L hatte »Lindenberg, Udo« ein eigenes Fach, und – Wahnsinn, gab es viele Platten von dem! Aufgeregt durchfingerte ich die zig Udo-Hüllen. Am Kassentresen konnte man Platten Probe hören, und da stand ich nun, mit Kopfhörern, hörte diese zumeist alten, für mich aber ja durchweg neuen Udo-Platten, las die beigelegten Textblätter – und streunte mit Udo gedanklich durch die ganze Welt, sein Werk wurde meine Zuflucht. Wenn meine Mutter mich im Musikhaus Vajen mal vergaß, fiel mir das, anders als unter der Musikschulpinnwand, gar nicht auf, ich hoffte sogar darauf.
Zu Hause ging ich dem Rest der Familie zunehmend auf die Nerven. Irgendwas schien mit mir nicht zu stimmen, ich empfand Regeln und Anordnungen als eher unverbindliche Vorschläge, dauernd wurde ich irgendwelcher Lügen überführt. Außerdem zählte ich immerzu Treppenstufen, Gehwegplatten, Buchstaben, ALLES – und wenn sich die Summe durch 8 teilen ließ, war ich glücklich, durch 4 teilbar war auch noch gut, durch 2 hinnehmbar, ungerade Zahlen aber ganz schlecht, und Primzahlen zwangen mich, eine Treppenstufe zu überspringen oder die letzten Stufen mehrfach hoch- und runterzutrippeln, bis sich die gegangene Gesamtstufenzahl durch 8 teilen ließ. Bin gleich da, muss nur noch schnell ein paar Straßenlaternen mit der rechten Hand berühren oder Buchstabenanzahlquersummen checken von Straßenschildern und Zeitungsüberschriften. Haferflocken zählen und durch 8 teilen!
Zudem beklagte ich seltsame Körperbeschwerden, ein irres nächtliches Beinkitzeln, permanente Kopfschmerzen und vor allem eine als Gewusel oder Gezappel bezeichnete, jedenfalls als störend empfundene Hyperaktivität, eine wahnsinnige Unruhe – meine Mutter brachte mich schließlich zu einem Neurologen. Der setzte mir eine Art Badekappe mit allerlei Kabeln dran auf den Kopf, und dann wurden meine Hirnströme gemessen. Die gute Nachricht, denn diesbezüglich schien es in meiner Familie durchaus verschiedene Meinungen zu geben: Es gab welche, es war Hirnaktivität messbar.
Der Neurologe sagte meiner Mutter: Sie müssen den Jungen einfach mal in Ruhe lassen. Lieber hätte sie wahrscheinlich gehört, ich solle mal Ruhe geben. Die Rückfahrt verlief schweigend. Das war ein Anfang.
In den Sommerferien erbte ich von meinem Bruder eine weiße Jeans und ein grün-schwarzes Nike-T-Shirt. Mit diesen beiden Kleidungsstücken, so mein Plan, würde es aufwärtsgehen. Ich war 13 Jahre alt, wir waren zum Wandern in Kastelruth, drei endlose Wochen; gut war, dass meine Arme braun wurden, vielleicht konnten sie von meiner roten Nase ablenken? Auf den täglichen von meinem Vater auf Grundlage mehrerer Wanderkarten vorbereiteten Gewaltmärschen malte ich meiner Mutter aus, wie gut ich dastehen würde am ersten Schultag nach den großen Ferien: in weißen Jeans, Nike-Shirt mit weithin sichtbarem Logo, MARKENKLEIDUNG!, obendrein diese braunen Arme, also das würde sehr gut werden. Weiteres von mir skizziertes, unverzichtbares Schulhofrequisit: eine Zimtwecke. Mein Bruder hatte mir von einer Bäckerei in der Nähe des Gymnasiums erzählt, dort gäbe es Zimtwecken. Mich elektrisierte dieses Wort, »Zimtwecke«. Vielleicht, weil es der ultimative Gegenentwurf war zum Schwarzbrot mit Goudakäse, das wir als PAUSENBROT mitbekamen, eingewickelt in Wachspapier mit Fettfleckenfensterchen von Butter und Käse. Unsere Ranzen rochen nach einer Mischung aus Leder, Käsebrotwachspapier und Bleistiftspitzerspänen. Noch heute reichen zwei dieser Geruchsbestandteile, um eine mittlere Panikattacke bei mir auszulösen, plötzlich sehe ich alles von Millimeterpapier warnorange kariert, Hilfe, ich muss noch Physikhausaufgaben abschreiben.
Die beneideten Mitschüler aus besserem Hause zogen Milchschnitten aus ihren Ranzen, mit unseren Biobroten standen wir verschämt kauend daneben. Aber nun, bald, der erste Schultag, achte Klasse, alles neu, alles besser, ein neuer Mensch, ein ganz anderer Auftritt. Somit würde doch alles von selbst laufen.
Die Reaktion meiner Mutter, mitten in den Bergen, als ich ihr so unverstellt und naiv mein Herz öffnete und dieses Remodeling meiner Person darlegte: Du denkst ja wirklich nur an Äußerlichkeiten, alles ist immer nur Oberfläche, das haben wir dir doch so nicht beigebracht.
Ja eben, wäre wahrscheinlich die richtige Antwort gewesen. Aber so weit waren wir damals beide noch nicht. Ich war beleidigt, sie auch, und so schritten wir missmutig nebeneinanderher. Es war üblich auf diesen Wanderungen, sich reihum in allen denkbaren Kombinationen mehrfach zu zerstreiten und dann wieder zu versöhnen, lang genug für solche sozialen Interaktionen waren die Wanderungen ja.
Meine Pubertät schritt voran. Zur Einhegung kleinerer Zwistigkeiten prägte meine Mutter den Ausspruch: Jetzt pubertier nicht rum.
In jenem Sommer in den Bergen entdeckte ich, welch interessante Erfolge sich mit der Duschbrause erzielen ließen, wenn ich, in der Badewanne liegend, lang genug im richtigen Winkel (und ganz wichtig: mit der richtigen Wassertemperatur, nicht zu heiß, aber auch bloß nicht zu kalt) den Wasserstrahl auf die Unterseite meines Schwanzes richtete. Augen zu, wegträumen, unerreichbare Mädchen imaginieren. Ich landete immer wieder bei denselben Bildern, hatte ja einfach noch nicht so viele im Kopf. Gewiss, es gab den kurzen Moment im Vorspann von Colt Seavers, wenn Jody da im hellblauen Bikini die Saloontür aufstieß, aber das ging immer so schnell. Zwei ganz annehmbare Motive gab es im Biologiebuch, einem großen, schweren, atlasdicken Lehrbuch mit dem Titel »Biologische Lebensformen«. Wie das meiste andere auch hatte ich es von meinen Geschwistern übernommen, und ich habe mit meinen Brüdern nie darüber gesprochen, das war aber auch nicht nötig, denn das Buch selbst erzählte es mir: Schlug ich es auf, landete ich automatisch auf der offenbar am häufigsten angesteuerten Seite, es war die Seite 117, bis heute für mich ein Code für nackte Frauen, »Seite 117«. Da sah man ein nacktes Mädchen, eine nackte Jugendliche und eine nackte Frau nebeneinander, damit man also studieren konnte, wie sich der Körper so verändert. Ich schwankte zwischen der Jugendlichen und der erwachsenen Frau, beide hatten ihre Vorzüge. Auf Seite 120 gab es ein weiteres brauchbares Foto, es hatte die für mich bald legendäre, selbsterklärende Bildunterzeile: »Frau beim Duschen«. Ein anderes früh prägendes Nacktbild entstammte der Rückseite einer Udo-LP: Auf »Votan Wahnwitz« war eine nackte Frau abgebildet, hingegossen, inmitten des Panikorchesters, und sie trug nichts bis auf ein eng umschlungenes – natürlich – Cello.
In jedem Saal in unserer Gegend
Ich saß immer in der ersten Reihe
Und ich fand dich so erregend[4]
Der erste Schultag nach den Sommerferien war kein so durchschlagender Erfolg wie erträumt. Kurz darauf ging es AUF KLASSENFAHRT ins Sauerland, in die Jugendherberge Burg Bielstein, und alles war genau so grausam, wie es eben auf solchen Fahrten in diesem Alter ist, stinkende Schlafsäle mit Etagenbetten, auf deren Matratzen die Exzessgeschichte der Räume mittels Flecken recht anschaulich kartiert ist, labbrig-bitterer Hagebuttentee aus Metallkannen, Himbeermarmelade aus Eimern, Graubrot mit Gummikäse, entsetzlich marmorierte Wurstscheiben. Ich hatte 10 Mark Taschengeld mitbekommen für die fünf Tage, und für mich war es Ehrensache, die gleich am ersten Tag auf den Kopf zu hauen. Wir machten eine Exkursion nach Köln, natürlich zur Domplatte, denn was will man in Köln schon, man will den Dom sehen und das war’s dann auch, das sah unsere Klassenlehrerin so – und exakt zwei Tage später auch Hans-Jürgen Rösner, der gemeinsam mit Dieter Degowski den Flucht-BMW des später als »Gladbecker Geiseldrama« berühmt gewordenen Banküberfalls samt Geiselnahme dorthin lenkte, um sich in aller Ruhe mitten in der Fußgängerzone von Journalisten interviewen zu lassen und sich fotogen eine Pistole in den Mund zu stecken. Rösner und Degowski waren die comic-klassischen Panzerknacker-Dummkopfgangster, die alles falsch machten.
Zwei Tage vorher aber war noch alles normal in der Kölner Fußgängerzone, und während meine Mitschüler den Dom besichtigen und den sicherlich hochinteressanten Ausführungen der armen Sau lauschen mussten, die ein REFERAT vor Ort zu halten eingeteilt war, stahl ich mich davon, denn Kirchen von innen hatte ich nun weiß Gott (der besonders) schon genug gesehen, ging mit meinen 10 Mark in einen domnah liegenden Plattenladen und schaute, was es da so unter »Lindenberg, Udo« gab. Ein neues Album kostete bei Erscheinen 19,99 Mark, es gab sie in den Darreichungsformen Vinyl und Kassette. Natürlich musste ich Kassetten kaufen, ich war ja noch nicht konfirmiert. Die sehr begrenzten finanziellen Mittel eines Dreizehnjährigen und die schier endlos erscheinende Menge Udo-Platten standen in einem unguten Verhältnis zueinander, aber ich hatte einen Komplizen: den neonfarbenen Aufkleber »Nice Price!«. Reduzierte Alben, zu alt oder zu erfolglos, um noch für 19,99 Mark verkauft werden zu können. »Nice Price!«-Alben kosteten in der Regel 9,95 Mark, manchmal sogar nur 4,95. Hier in der Großstadt gab es natürlich sogar noch viel mehr mir vollkommen neue, in Wahrheit aber schon sehr alte Udo-Alben, viele von ihnen »Nice Price!«. Ich entschied mich für »Sündenknall«, neun fünfundneunzig, Taschengeld verjubelt, Sohn der Freude.
Für den Rest der Klassenfahrt hatte ich somit 5 Pfennig Taschengeld übrig, also nie Snickers, nie Cola, immer bloß blassrot-bitterer Hagebuttentee und Graubrot mit Löchern, in denen sich die Margarine eklig sammelte, Gummikäse drauf und fertig. Ich fädelte mich wieder in die Gruppe ein und konnte es kaum erwarten, mir, zurück in der Jugendherberge, den Walkman des im Stockbett über mir schlafenden Zahnarztsohns auszuleihen.
Ich starrte an die mit Schwänzen, Hakenkreuzen, Mittelfingern und anderen Meinungsbekundungen bemalte und beritzte Unterseite des Lattenrosts über mir und hörte, was Udo mir zu sagen hatte. Er machte sich auf dieser Platte große Sorgen um die Zukunft: Computer, Umweltzerstörung, künstliche Befruchtung, der gläserne Bürger, Schurkenkapitalismus. Das kannte ich zwar alles von zu Hause, da HÖRTE ich praktisch die lila Halstücher, Merchandising-Hit vom Kirchentag in Hannover, doch wenn Udo all diese Großprobleme besang, war das was anderes, wenn Udo empört war, war ich es auch. Udo nämlich hatte einen Trotzdem-Trumpf, bei aller Weltmalaise überstrahlte eines doch alles, und das war die Liebe. Udos romantische Conclusio war für einen Dreizehnjährigen schlachtruftauglich:
Komm, wir rasen durch’s Heute
Mit oder ohne Happy-End[5]
Ich hörte diese neue alte Udo-Kassette so lang, bis die Musik aaallllllllmmmmäääääähhhhhhlllliiiich gaaaaaanz laaaangsaaaaaaaaaam wurde und schließlich erstarb, weil die Batterien leer waren. Dies verärgerte den Zahnarztsohn, denn er wollte immerzu »Bad« von Michael Jackson hören. Aber er hatte natürlich genug Taschengeld für Ersatzbatterien, ein Milchschnittentyp, da konnte ich keine Rücksicht nehmen.
Bis heute bietet mein Bildergedächtnis zu jedem Lied von Sündenknall« automatisch diese Schwarz-Weiß-Foto-Verknüpfung an: der rauchende Geiselnehmer Degowski, der den später todbringenden Revolver an den Hals der wächsern angststarren Geisel hält, auf dem Rücksitz des 7er-BMW-Fluchtwagens.
In Rotenburg war es in jeder Hinsicht eng geworden. Meine großen Momente fanden ausschließlich in den Schulpausen statt und in Freistunden, Hausaufgaben machte ich nie, bei Klassenarbeiten schrieb ich, so gut es ging, vom Nachbarn ab, und besonders gut schien das nicht zu gehen, zurück bekam ich sie als meinen Eltern zu verheimlichende Rotstiftmassaker mit zunehmend sarkastischen Lehrerkommentaren darunter.
Mein Glück war, dass es auch meinem Vater zu eng wurde. Sein Bart, der Ökoladen, die pazifistischen Aufkleber hinten auf unserem Peugeot – all das hatte ihn immer schon verdächtig gemacht, und nun hatten sie ihn am Wickel, die verkappt und die ganz ungeniert reaktionären Kräfte der Kleinstadt. In den umliegenden Dörfern rekrutierten sich rechtsradikale Kameradschaften, hin und wieder gab es Aufmärsche von Skinheads mit Fackeln, und als schließlich mein Vater auf einer Gegendemonstration eine Rede halten sollte, an der – und damit war sein Schicksal besiegelt – auch KOMMUNISTEN teilnehmen sollten, kippten die Ressentiments in offenen Hass und reale Drohungen. Die Scheune, in der sich die Neonazis zum bunten Abend treffen wollten, brannte ab, Brandstiftung, ein paar Pferde starben. Im normal provinziell-reaktionären lokalen Drecksblatt gab es einen Kommentator, der den Kalten Krieg so verinnerlicht hatte, dass ihm die Relationen etwas durcheinandergerieten, mein Vater war ihm die fünfte Kolonne Moskaus oder so. Er attackierte ihn bei jeder Gelegenheit, und nach diesem Scheunenbrand, der den armen Neonazis ihren Kameradschaftsabend vermasselt hatte, gab es kein Halten mehr, der Typ gab meinem Vater zumindest eine Mitschuld. Auch bekamen wir anonyme Anrufe, Morddrohungen, und im Briefkasten lagen Pferdepostkarten mit Grußbotschaften wie Eure roten Horden haben uns ermordet« und »So wie diese armen Tiere werdet auch ihr brennen«.
Konnten die Neonazis uns nicht wenigstens siezen? Es war Zeit, umzuziehen.
Mein Vater bekam eine Stelle in Göttingen, und aus dem Kaff kommend, war das: Metropole. Die Rettung. Das Pfarrhaus war wiederum ein riesiger verrotteter Kasten, endloser Garten und mitten in der Stadt, und das war jetzt wirklich mal eine STADT, zumindest für einen Dreizehnjährigen, der aus dem niedersächsischen Nichts kam, wo Innenstadt bedeutet hatte: Marktplatz, Fußgängerzone, Springbrunnen, Kaufhausparkplatz, Ende.
Das die Stadtgröße indizierende Ortskürzel auf den Nummernschildern war nicht mehr drei-, sondern zweiziffrig, es ging aufwärts. Die ersten Erkundungstouren mit dem Fahrrad waren verheißungsvoll, so viele Plattenläden, so viele Kinos, so viel alles. Nur vor der Schule hatte ich natürlich Angst, ein ALTSPRACHLICHES Gymnasium, auch das noch. Max-Planck-Gymnasium«, das KLINGT ja schon nach Niederlage. Die Schule lag nah an unserem Haus, überhaupt alles Interessante in dieser neuen, mir riesig erscheinenden Stadt lag nah an unserem Haus, wir waren im Zentrum, von hier aus könnte es losknallen, das elektrische Leben, von dem ich in den mich begleitenden Liedern so viel gehört hatte.
Die Schule aber sah gefährlich aus, ein einschüchternd großer, angedunkelter Bau, fast Universitäts-Aura, Säulen am Eingang, ein Schafott. Da würde nun alles rauskommen, wie geschönt die sowieso schon schlechten Noten in meinem Übergangszeugnis gewesen waren und dass ich die letzten drei Jahre des Lernstoffs nahezu komplett verpennt hatte.
Am ersten Tag nach den Ferien überfiel mich bei Betreten der neuen Schule ein Panikanfall, im Foyer kühler Marmor, Bodenmosaik mit lateinischen Sinnsprüchen, Non scholae, sed vitae discimus« – und ich hatte zwar formal schon eineinhalb Jahre Lateinunterricht, aber übersetzen konnte ich das nicht. Und das war erst der Anfang.
Ich wurde in eine Klasse geschoben, in der irgendwas nicht stimmte. Eigentlich alles. Mir war schwindelig. Ich wurde zu meinem Platz geleitet, leider nicht am Rand, sondern absolut in der Mitte des Klassenzimmers. Langsam nahm ich den Raum wahr, einzelne Gesichter, bis mir auffiel, was hier nicht stimmte: das Verhältnis Mädchen zu Jungs. Es waren 6 Jungs und 20 Mädchen. Und wir Jungs saßen alle in der mittleren Reihe. Das war doch erst mal sehr angenehm. Zumal diese 6 Jungs, auf den ersten Blick erkennbar, exakt die 6 Verlierer-Archetypen verkörperten: der Dicke, der Picklige, der Brillendepp mit den fettigen Haaren, der sitzen gebliebene und strunzdumme Schönling, der Schüchterne, der Punk. Geile Gang, ich war begeistert. Sie erkannten mich – eine akkuratanteilige Mischform dieser sechs Arten von Pubertätsmisere – rasch als einen der Ihrigen an. Zusammen waren wir der Abschaum, das Allerletzte, die Mädchen verachteten uns – aber das Tolle war, wir hatten keine Konkurrenz, zumindest während des Unterrichts. In den Pausen zog es natürlich die hübschen Mädchen zu den besser aussehenden oder einfach nur älteren Jungs aus anderen Klassen, während des Unterrichts aber repräsentierten wir unser Geschlecht, wir waren laut, lustig, Realität.
Die Sitzordnung im Klassenzimmer war streng hierarchisch: In der Reihe vor uns saßen die hübschen Mädchen, die ihren Ekel vor uns kaum verbargen; sie wurden von der völlig zu Recht hinter ihnen sitzenden Restklasse starr bewundert, ihre Anerkennung wurde gesucht, ihr Spott gefürchtet. Rechts an der Wand aufgereiht saßen die nicht komplett hässlichen Streber-Mädchen, links die unsortierten Mädchen, die in umliegenden Dörfern wohnten und mit dem Bus nach Hause fahren mussten. Und hinter uns Jungs eine Reihe mit absolut deformierten Katastrophengirls, bei denen alles zu spät und egal war, in der Hierarchie, also in der einzig ausschlaggebenden Achtung beziehungsweise Ächtung der Traumfrauen in Reihe eins, lag diese letzte Reihe sogar noch unter uns Verliererjungs. Ich mochte diese Klasse sofort. Hier würde ich eine Chance haben. Ich müsste nur irgendwie leider dann doch mal wieder was lernen. Ich hatte solche Angst, sitzen zu bleiben, dass ich erstmals seit der Grundschule wieder wirklich lernte, mit Hausaufgabenmachen und allem.
Meine Fixierung auf deutschsprachige Popmusik – auch und vor allem natürlich Udo, Udo, immer wieder Udo – wurde noch exzessiver. Ich saß jeden Tag stundenlang in meinem Zimmer, studierte die Textblätter, lernte die Texte auswendig. Göttingen hatte etwas, das ich aus der Kleinstadt nicht kannte: Plakatwände. Dort wurden Konzerte und Platten meiner Helden beworben, neben Udo waren das Westernhagen, Grönemeyer und Kunze, ich schlich abends dort lang, wenn gerade wieder neu plakatiert worden war und der Kleister noch feucht, sodass ich die Plakate mühelos abziehen konnte. Bald schon ging ich sehr professionell vor, mit Leiter und Spatel. Das Udo-Plakat »Feuerland-Revue« war besonders schwer abzureißen, und weil ich nicht ruhig genug zog oder der Kleber schon zu trocken war, wurde das Plakat dünn und riss, ich musste schließlich vier abreißen, um daraus ein vollständiges zusammenpuzzeln zu können. Die ganz sichere Methode war, mit einem Teppichmesser tief in die Plakatwand zu schneiden, rundherum ums Zielplakat, so konnte man es schließlich herausnehmen wie ein Bild aus einem Rahmen, es war dann ziemlich dick, in Schichten klebten einige Generationen von Vorgängerplakaten darunter.
Ich tapezierte mit diesen Heiligenbildern nach und nach mein Zimmer, erst die Wände, später auch die Zimmerdecke. Udo und die anderen in der Eissporthalle Kassel, in der Eilenriedehalle Hannover, in der Stadthalle Osterode – also ganz in der Nähe! LP/CD/MC out now! Incl. Hitsingle! Ich war sehr aufgeregt, ich schien mit diesem Umzug nach Göttingen der Musik und meinen Helden nähergekommen zu sein und verwandelte mein Zimmer in eine Popahnengalerie, eine Deutschrockhöhle.
Mein Vater hatte mir eine weitere Udo-Kassette geschenkt, für ihn nicht ganz untypisch die unzugänglichste und kulturell wertvollste, Udo sang darauf 20er-Jahre-Lieder, ein Konzeptalbum. War nicht direkt das, was mich ekstatisch machte, aber es war von Udo, und wenn ich mit Neuem von ihm fremdelte, suchte ich den Fehler grundsätzlich bei mir selbst und hörte es mir eben schön, pure Wiederholung half da. Ein Lied aber mochte ich gleich, Udo sang es tieftraurig und ganz zart, und plötzlich begegnete es mir in der Schule. Unsere Deutschlehrerin war eine sehr freundliche, nachsichtige Frau. Sanft schlummernd saßen wir ihr gegenüber, Reclamheftchen vor uns, immer der Blick auf die Uhr, wann der erlösende Pausengong endlich ertönte, man feuerte den Sekundenzeiger an, dass er sich mal beeilt. Diese Deutschlehrerin war denkbar uncharismatisch, sie lehrte eben so ein bisschen herum. Keineswegs sprang sie mit uns auf die Pulte und rief: O Captain, my Captain. Den Film guckten wir zwar bei ihr im Unterricht, aber sie selbst hat da wohl nicht aufgepasst. Ihr klassischer resignativer Satz gen Ende eines Schultages, wenn sich niemand mehr konzentrieren konnte oder wollte: Es ist auch für mich die sechste Stunde.
Sie wirkte immer ein bisschen traurig. Es hieß, sie habe sich gerade von ihrem Mann getrennt. Eines Tages verteilte sie Fotokopien mit einem Gedicht, es kam mir bekannt vor. Ich las die ersten Zeilen, merkte, ich kann es auswendig. Es hieß »Sachliche Romanze« und war – nicht von Udo Lindenberg, aber von dem kannte ich es. Die mikrokleinen Autorenangaben auf dem gefalteten Textbooklet der Kaufkassette hatte ich nicht genau genug studiert, mir war also entgangen, dass dieses Gedicht von Erich Kästner stammte, aber das machte ja nichts, ich kannte es, und nun war ich sehr aufgeregt. Endlich kannte ich mal was!
Die ersten Wochen in der neuen Klasse hatten mir in jedem Fach schmerzlichst vorgeführt, was ich alles nicht wusste und kannte; wenn ich aufgerufen wurde, schwitzte ich immer und wurde rot. Aber diesmal nicht, diesmal war ich mir sicher, also meldete ich mich, und weil das sonst nie geschah, kam ich sofort dran und konnte auftrumpfen: Ich kenne dieses Gedicht von einer Lindenberg-Vertonung, sagte ich.
Ach wirklich, fragte die Lehrerin, das sei ja schön, ob ich es mal mitbringen möchte? Ich mochte. Und alle anderen freuten sich auch, denn das bedeutete, dass der MEDIENWAGEN in den Klassenraum geschoben würde, darauf Fernseher, Videorekorder und Stereoanlage, also ein reingeschobenes Passivitätsangebot, zudem wurde der Unterricht angenehm unterbrochen, weil immer irgendwas nicht stimmte mit dem Medienwagen, jedes Mal musste der Hausmeister kommen und irgendwelche Kabel überprüfen, dran rumruckeln, dann alles noch mal aus- und wieder anstellen – und dann sagen: Geht doch.
In der nächsten Deutschstunde brachte ich die Udo-Kassette nach vorn, zurechtgespult auf den Anfang des Lieds »Sachliche Romanze«, der Hausmeister kam und ruckelte an den Kabeln, und dann sang Udo für uns:
Als sie einander acht Jahre kannten
Und man darf sagen, sie kannten sich gut
Kam ihre Liebe plötzlich abhanden
Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut[6]
Die Wucht dieses Gedichts traf uns alle je unterschiedlich. Besonders die Lehrerin guckte sehr traurig und ergriffen, diese Beschreibung einer an der Zeit gescheiterten Liebe sagte natürlich ihr mehr als uns, die wir ja gerade erst anfingen, uns zu verlieben. Wie schmerzvoll das ist, wenn die Liebe sich verflüchtigt, das begriffen wir anhand dieses Udo-Kästner-Lieds, noch bevor wir das Davor überhaupt selbst erfahren hatten.
Jetzt kam meine Lieblingsstelle, da war Udos Musik wieder so nah am Hörspiel:
Er sagt, es wär schon Viertel nach vier
Und Zeit, irgendwo ’n Kaffee zu trinken
Nebenan übte ein Mensch Klavier[7]
Und dann setzt der Gesang aus, das durch einen Toneffekt wie entfernt, eben wie aus der Nachbarwohnung erklingende Klavier klimpert eine Art Tonleiter. Daraufhin setzen die Streicher wieder ein, Udo singt weiter, im Hintergrund hört man jetzt (wiederum Hörspiel) Löffel in Kaffeetassen klimpern. Das bereitet das Finale vor. Die totale Erschütterung, denn die beiden ehedem Liebenden sprachen ja nun kein Wort und rührten in ihren Tassen – und konnten es einfach nicht fassen.
Das Lied war zu Ende, die Lehrerin starrte kurz ratlos auf den Medienwagen, muss ich da jetzt irgendwas ausstellen? Egal. Sie wandte sich wieder uns zu, jetzt großer Auftritt des von allen, Jungen wie Mädchen, bewunderten wie gefürchteten hübschesten Mädchens der Klasse. Sie INTERPRETIERTE dieses ja nun nicht besonders schwer zu begreifende Gedicht. Aber wir hörten ihr gebannt zu, denn erstens war man immer gut beraten, sie anzuhimmeln, das erwartete sie einfach (aus zu etwa gleichen Teilen Arroganz und Erfahrung), und wir waren, zweitens, natürlich weniger fasziniert von ihren rührenden vierzehnjährigen Gedanken zu diesem Gedicht als vielmehr – und da interpretierten nun wir, in Mutmaßungen und Träumen – von den daraus möglichen Ableitungen: Was sie, die unbestrittene Jahrgangskönigin, da so erzählte, das ließ ja nur den Schluss zu, dass diese Galionsfigur jugendlicher, wenn nicht menschlicher Evolution solche Erfahrungen schon gesammelt hatte! Sah man sie nicht nach Schulschluss oft draußen einem viel älteren Jungen in die Arme laufen, mit ihm Hand in Hand nach Hause gehen? Sie war uns in allem so weit voraus, also gewiss auch im Amourösen, wir waren sehr beeindruckt: »Die hat schon einen Freund.« Ob die auch schon – wir ließen das Ungeheuerliche, Undenkbare, wenn jemandem, dann ihr Zuzurechnende ungedacht, es war zu viel für uns.
Sie saß direkt vor mir und war doch unerreichbar. Manchmal taxierte sie einen kurz, warf dann den Kopf zur Seite, einen gezischten Laut der Verachtung von sich gebend – wir waren alle verliebt in sie, was sie natürlich wusste, und auch die Mädchen taten alles, um ihre Gunst zu erlangen, vergeblich.
Ich sah immer nur ihren Po in weißen Levi’s Jeans, wobei das nicht das Schlechteste war, und ihre blonden Haare, die sie auf besonders abfällige Weise nach hinten warf, wo sie auf ihrem Benetton-Pullover seidig weiterschaukelten, diese Haare sagten im Nachhintengeworfenwerden: Vorhang zu, Depp. Ihr Vater war Architekt, sogar ihr Fahrrad war das schönste von allen, auch hörte sie immer die allerneueste Musik. Als ich treudoof die Lindenberg-Kassette anschleppte, hörte sie längst HipHop, und zwar auf CD. Sie war in allem die Erste, in der elften Klasse würde sie sogar für ein Jahr nach Amerika gehen und hernach natürlich erst recht nicht mehr in der Lage sein, sich auf unser provinzielles Niveau herabzulassen.
Irgendwann nach dem Sportunterricht entdeckten wir im Waschraum der Umkleidekabinen, dass man, indem man etwas Wasser unter die Tür zum direkt angrenzenden Mädchenwaschraum schaufelte, eine hilfreiche Bodenspiegelung hinbekam, und so rasten wir nach dem Sportunterricht immer wie die Irren los, um einen der maximal zwei Plätze mit dieser herrlichen Aussicht abzubekommen, auf dem Boden kniend, am Türspalt, mit wie sonst nur beim Abschreiben während einer Physikklausur verdrehten Augen auf diesen Wasser-Bodenspiegel (der als solcher ja eine Art angewandter Physik und insofern einen Lerneffekt bedeutete), um die Mädchen, und vor allem die Architektentochter, beim Duschen zu beobachten. Sie wusste das, sprach uns mal darauf an: Ihr Spanner! Fortan trug sie Jeans im Waschraum und wusch nach dem Sport bloß noch ihren Oberkörper, aber das reichte uns ja völlig.
Was »Non scholae, sed vitae discimus« übersetzt heißt, lernte ich dann bald im Lateinunterricht; was es lebenspraktisch bedeutet, lehrten mich Rückansicht der Architektentochter und Udos Platten. Mein Deutschlehrer hieß Udo. Nach Kästner entdeckte ich bei ihm Tucholsky, »Augen in der Großstadt«, und ich konnte es kaum erwarten, auch mit dieser Kassette wieder den Medienwagen herbeizuzwingen und der altklugen Exegese der Architektentochter zu lauschen: Großstadt-Anonymität, Getriebenheit, Unwiederbringlichkeit, da war doch alles drin. Auch unser damaliges formales Arsenal konnte im Ganzen abgefackelt werden: Kreuzreim, Paarreim, Metaphern, Anaphern, Hyperbeln! Man fand auf Udos Platten wirklich alles, was man brauchte.