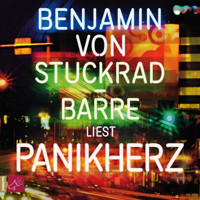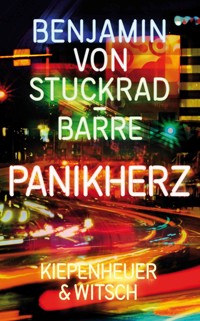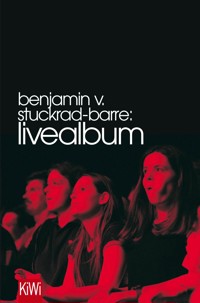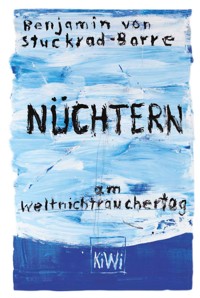Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen E-Book
Benjamin von Stuckrad-Barre
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
» … gehört zum Schönsten und Besten, was Stuckrad-Barre je geschrieben hat.« Süddeutsche Zeitung. »Panikherz« war eine Reise ins Innere – in »Remix 3« geht es in die umgekehrte Richtung: nach draußen, zu den anderen. Mit Boris Becker schaut Stuckrad-Barre in Wimbledon das berühmte Finale von Wimbledon. Mit Helmut Dietl scheitert er in Berlin wegen Berlin an Berlin. Dem Freund Christian Ulmen schaut er zu bei der Verwandlung in »Christian Ulmen«. Und Pharell Williams singt den Sommerhit zum Herbstanfang, verspätet sich aber – der Autor fährt unterdessen ein letztes Mal an den See. Nach der Reise ans Ende der Nacht wird die Welt nun bei Tageslicht betrachtet. Benjamin von Stuckrad-Barre öffnet weit die Augen und schaut, wie die anderen das hinkriegen: das Leben. Die hier versammelten Texte liefern ein akkurates Selbstporträt über Bande, es ist eine Suche nach dem Wir. Das Ergebnis: eine Familienaufstellung. Eine Heldenparade. Eine Götzendämmerung. Der Befund des von der Wirklichkeit irritierten Autors fällt melancholisch aus: Es geht uns nicht gut – wir müssen uns alle mal irgendwo hinlegen. Nur wohin? »Remix 3« endet folgerichtig dort, wo »Panikherz« entstand: am Sunset Boulevard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benjamin von Stuckrad-Barre
Ich glaub, mir geht's nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen
Remix 3
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Benjamin von Stuckrad-Barre
Benjamin von Stuckrad-Barre, 1975 in Bremen geboren, ist Autor von »Soloalbum«, 1998, »Livealbum«, 1999, »Remix«, 1999, »Blackbox«, 2000, »Transkript«, 2001, »Deutsches Theater«, 2001, »Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft – Remix 2«, 2004, »Was.Wir.Wissen«, 2005, »Auch Deutsche unter den Opfern«, 2010, »Panikherz«, 2016, »Nüchtern am Weltnichtrauchertag«, 2016, »Udo Fröhliche«, 2016, »Ich glaub, mir geht’s nicht so gut, ich muss mich mal hinlegen – Remix 3«, 2018 und »Alle sind so ernst geworden« (mit Martin Suter), 2020. Der neue Roman erscheint im April 2023.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Panikherz« war eine Reise ins Innere – in »Remix 3« geht es in die umgekehrte Richtung: nach draußen, zu den anderen.
Mit Boris Becker schaut Stuckrad-Barre in Wimbledon das berühmte Finale von Wimbledon. Mit Helmut Dietl scheitert er in Berlin wegen Berlin an Berlin. Dem Freund Christian Ulmen schaut er zu bei der Verwandlung in »Christian Ulmen«. Und Pharell Williams singt den Sommerhit zum Herbstanfang, verspätet sich aber – der Autor fährt unterdessen ein letztes Mal an den See. Nach der Reise ans Ende der Nacht wird die Welt nun bei Tageslicht betrachtet.
Benjamin von Stuckrad-Barre öffnet weit die Augen und schaut, wie die anderen das hinkriegen: das Leben. Die hier versammelten Texte liefern ein akkurates Selbstporträt über Bande, es ist eine Suche nach dem Wir. Das Ergebnis: eine Familienaufstellung. Eine Heldenparade. Eine Götzendämmerung. Der Befund des von der Wirklichkeit irritierten Autors fällt melancholisch aus: Es geht uns nicht gut – wir müssen uns alle mal irgendwo hinlegen. Nur wohin? »Remix 3« endet folgerichtig dort, wo »Panikherz« entstand: am Sunset Boulevard.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2018, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Walter Schönauer
Autorenfoto: © Daniel Hofer/laif
ISBN978-3-462-31852-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Advantage Becker
Prolog
1. Satz
2. Satz
3. Satz
4. Satz
Epilog
24 Stunden mit Jürgen Fliege
Zu Besuch in Ferdinand von Schirachs Schreibklausur
Madonna live in L.A.
Being Christian Ulmen
Der letzte Sommer mit Papier
In 80 Fragen um die Welt
Drehbuchschreiben mit Helmut Dietl
Eine Redaktionskonferenz zu Thomas Bernhards Geburtstag
Popshopping
Frühling
Eisheilige
Sommer
Spätsommer
Herbst
Rainald Goetz
WM 2010
Deutschland : Australien
Deutschland : Serbien
Deutschland : Ghana
Deutschland : England
Deutschland : Argentinien
Deutschland : Spanien
Spiel um Platz 3 & Finale
Tattoos
Schweinegrippe
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen
Der Tatortreiniger Thomas Demand
Jörg Fauser
Der Verleger
Axel Springer geht durch Berlin
Das Hollywood-Missverständnis
Berlinale
2013 – ein Jahresrückblick mit Harald Schmidt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Vorruf auf Walter Kempowski
Happy
Sunset Blvd.
Ein Sommerabend
Ein Herbstnachmittag
»A bissl Geld, a bissl Sex, a bissl Tragik und a bissl Traum, Märchen … Monarchie … Hochfinanz und Industrie … und a bissl Perversion – das wäre die ideale Mischung.«
Aus Helmut Dietls »Kir Royal«
»Wenn das so ist, dachte ich, kannst du auch aufstehen.«
Aus Jörg Fausers »Rohstoff«
Advantage Becker
Prolog
Der erste Deutsche, der ihm an jenem 7. Juli 1985 persönlich zum Sieg in Wimbledon gratulierte, war Bundespräsident Richard von Weizsäcker, die Eltern drangen erst viel später vor zu ihm, und eigentlich war das eine ganz gute Vorbereitung auf alles Weitere. Jahre später erzählte ihm Günter Grass in einer Bar die Geschichte von Sisyphos und gab ihm alsdann Tipps, wie man all seinen Kindern, auch wenn sie von verschiedenen Müttern stammen, ein guter Vater sein kann; mit Gary Kasparow spielte er Schach, Martin Walser schrieb über ihn einen leidenschaftlichen Fan-Essay, sein Nachbar heißt Michael Ballack, der wohnt schräg gegenüber, und das riesige Helmut-Newton-Buch auf dem mitgelieferten Metallklappgestell im Flur ist ein Geschenk von Günter Netzer.
Kurzum, die Rede ist von Boris Becker.
Wenn wir heute über Boris Becker nachdenken, fällt uns vieles ein, das nichts mit Tennis zu tun hat – was bedauerlich ist, komischerweise aber nicht anders zu erklären als mit, eben: Tennis. Mit der Art, wie er gespielt hat, ob er gewann oder verlor, immer war es spektakulär und eine Angelegenheit von höchstem nationalen Interesse; vor 25 Jahren wurde aus dem allzu sprichwörtlichen 17-jährigen Leimener ein Weltstar, ein deutscher Held der Gegenwart, und wäre es nicht allseits kathartisch, einfach mit ihm zusammen dieses Spiel nochmal anzugucken, das einst schlagartig den Becker-Wahn in Deutschland auslöste?
Von seinem Wohnzimmer aus kann man, hinter Zaun und Bäumen, sein Wohnzimmer sehen. Hä, wie? Ja, im Falle Boris Beckers geht es um Spiegelungen der Spiegelung, und da passt das ganz gut: Als sein Wohnzimmer hat Boris Becker seither Wimbledon – das Turnier, das Stadion, den Stadtteil – bezeichnet, und wie so vieles haben ihm die Deutschen das nachgesprochen, Wimbledon ist Boris Beckers Wohnzimmer. Stätte seiner größten Triumphe, auch bitterer Niederlagen, auf jeden Fall mit dem Turniersieg 1985 der Mythos-Geburtsort: Hier ist er ins Weltruhmeslicht getreten, und hier hat er kreisschließend seine sogenannte aktive Laufbahn beendet. Er hat zwar auch ein richtiges Wohnzimmer, natürlich hat er über die Welt verstreut mehrere, heute aber treffen wir ihn in seinem Haus in Wimbledon, das er vor gut einem Jahr bezog, Treffpunkt ist somit das Wohnzimmer im Wohnzimmer.
Hinein also in die zum deutschen Allgemeingut gehörende, seit 25 Jahren medienübergreifend zu verfolgende, ja kaum verpassbare Seifenoper »Boris Becker«, und so seltsam es einem vorkommt, nicht nur mit Bildern von ihm, sondern mit dem echten Menschen Boris Becker konfrontiert zu sein und tatsächlich in einem Raum, so schämt man sich doch für das augenblicklich sich einstellende Gefühl der Vertrautheit, man kennt ja die komplette Familie seit Jahren aus Zeitungen und Fernsehen: seine Frau Lilly, hallo Lilly, den zehnjährigen Sohn Elias aus erster Ehe, der einen, kaum angekommen, sogleich zum Fußballspielen im Garten drängt, und man macht gleich mit, fühlt sich kaum fremd, oder anders, man fühlt sich, als habe man gerade das Innere eines Fernsehapparats betreten. Alle da. Ein international angeheiterter Sprachmix schwirrt durch die Luft, Deutsch, Englisch, Holländisch – exakt, dies ist eine moderne Patchworkfamilie und, wenn man so will: der Gegenentwurf zum hypothekenbelasteten Einfamilienhaus in Leimen.
Lilly wacht über die Fernbedienung, Play, los geht’s, schauen wir uns auf dem großen Bildschirm überm Kamin das Spiel der Spiele an, das Herren-Wimbledon-Finale des Jahres 1985.
Ganz wichtig jetzt: ihn siezen! Herr Becker! Nicht du, Boris, du. Das tut gut. Das steht ihm auch gut. Wenn man über ihn in der »Bild«-Zeitung liest, ihn bei »Wetten, dass …?« durch ein brennendes Herz hechten sieht, ist es unmöglich, ihn zu siezen. Aber wie er jetzt so auf dem Sofa neben einem sitzt und man zugleich auf dem Bildschirm sieht, was er geleistet hat, was für ein KING er war, steigt der Respekt ins Unermessliche. Schön, mal wieder über Boris Becker und Tennis zu sprechen, zumal mit ihm selbst, diesem Boris Becker. Also: Herr Becker! Sir!
Es ist so: Wenn sogar dieser Mann uncool und zuweilen lächerlich RÜBERKOMMT in den Medien, dann sagt das weniger über ihn als über die Medien selbst, diese Ikonenzerbröselungsmaschinerie, die noch jeden zermalmt hat, die SOGAR Boris Becker lächerlich aussehen lässt. Also, schön siezen, bei der Sache bleiben, bei diesem epochalen Spiel 1985, seiner »persönlichen Mondlandung«, wie er selbst diesen Sieg in einer, leider wahr, Bier-Reklame genannt hat, ja wir sollten uns angewöhnen, sogar das Wort »Bier-Reklame« im Zusammenhang mit Boris Becker hämefrei auszusprechen, denn tatsächlich betrat er 1985 eine nationale Popularitätssphäre, die niemand vor und nach ihm je betreten hat. Das muss beim Sprechen über Boris Becker, das ja zumeist ein Urteilen ist, bitte immer mitbedacht werden.
1. Satz
Kommentator: Sonntag, der 7. Juli 1985, wenige Minuten vor dem Endspiel, welches ein historisches werden könnte.
Aus dem Spielereingang zum »Heiliger Rasen« genannten Centre Court treten die Finalisten Kevin Curren und Boris Becker – und ja, da ist sie: die hellblaue Trainingsjacke! Mittlerweile ein weltweit gefragtes Museumsexponat. Zwischen Beckers Lippen eine goldene Halskette, ein Geschenk der Mutter, er kaut darauf rum.
Elias: Papa!
Boris Becker: Ja, guck mal, die gleichen Haare wie du, siehste das? Und immer mit Pullunder, ich liebe Pullunder, da lachen immer alle, aber ich bin ein absoluter Pullunder-Fan, damals wie heute, ich habe vorhin sogar überlegt, mir heute auch einen anzuziehen, habe es aber dann bleiben lassen.
Er trägt heute ein schwarzes Lou-Reed-T-Shirt. Warum? Nun, ganz einfach, Lou Reeds Hit »Walk on the Wild Side« sei eines seiner absoluten Lieblingslieder.
Kommentator: Nie bisher seit 1877 siegte hier so ein krasser Außenseiter, nie ein Deutscher, nie ein so junger Spieler. In diesen zwei Wimbledon-Wochen hat sich die Welt für Boris Becker verändert. Er ist in dieser Zeit wohl mehr als 14 Tage älter geworden. Zwischen ihm und dem Sieg steht noch Kevin Curren.
BB: Man sieht hier, ich überhole Curren beim Gang auf den Platz, das war mir wichtig, da schon Entschlossenheit zu zeigen, vor meinem Gegner den Platz zu betreten, und ich wollte mir den Stuhl aussuchen können. Und immer, hier sieht man’s, mit dem rechten Fuß zuerst auf den Rasen treten, das war auch so ein Ritual von mir. So, und dann wird per Münzwurf ausgelost, wer zuerst aufschlägt, Wappen oder Zahl, Kevin Curren hat die Wahl gewonnen, und ich habe mir noch gedacht, warum wählt denn der damals weltbeste Aufschlagspieler Rückschlag – was für’n Schwächling! Aha, Curren schüttelt sich die Beine aus, man sieht, der ist nervös.
Ach was, WEISSE Tennisbälle? Ja, 1985 war das letzte Jahr, in dem bei solchen Weltturnieren noch mit weißen, nicht neongelben Tennisbällen gespielt wurde. Ha, die Erinnerung trügt also doch (natürlich tut sie das), im Gedächtnis sind gelbe Bälle abgespeichert – und beckersches Bananenessen unterm Handtuch, aber auch das kam erst bei späteren Turnieren.
Kommentator: So kommt Becker schnell zum ersten Satzball. Ausgerechnet der zehn Jahre ältere Curren zeigte Nerven. Schon dieser erste Satzgewinn kommt ins Wimbledon-Buch der Rekorde, denn nie gewann ein Ungesetzter einen Satz im Endspiel.
BB: 25 Jahre … Wenn ich diese alten Bilder sehe, ist mir vieles noch erstaunlich präsent, aber wie ich mich dann vom Kind zum jungen Mann zum Familienvater entwickelt habe – das kommt mir vor wie 100 Jahre, was in diesen 25 Jahren menschlich mit mir und um mich herum passiert ist. Dünn war ich, hm, Lilly?
Lilly: Ach, du bist immer noch dünn, Schatzi, du bist immer noch dünn!
Advantage Becker!
2. Satz
Kommentator: Auch im zweiten Satz sorgt Becker für Probleme seines Gegners. Es steht drei beide, wieder so ein Patzer von Curren, drei Breakbälle für Becker.
BB: Der Kommentator sagt Breakbälle, ich sage Matchbälle. Wenn ich ihm diesen Aufschlag abgenommen hätte und dann meinen Aufschlag durchgebracht, hätte ich den zweiten Satz auch sicher gewonnen und damit im Grunde schon das ganze Spiel. Aber er kam wieder zurück.
Drama jetzt, Becker springt quer durch die Luft, erreicht den Ball gerade so, Netzroller, Curren bekommt ihn nochmal übers Netz, Becker dann nicht mehr.
Kommentator: Sogar Curren applaudiert dem jungen Mann, aber Curren hat die drei Breakbälle abgewehrt.
Lilly: War der Amerikaner, der Curren?
BB: Südafrikaner.
Lilly: Ah so.
BB: Und jetzt kommt er, jetzt habe ich einen Schuss in die Hüfte bekommen und Selbstbewusstsein verloren, Curren hat was gewonnen und fängt an, besser zu spielen als ich.
Elias: Papa, hast du das Spiel gewonnen?
BB: Schau doch hin!!
Lustig, dass dieses Spiel für den familienfremden Besucher, einen alles in allem normalen Deutschen, ein so epochales Ereignis darstellt, unauslöschlich im kollektiven 80er-Jahre-Bildergedächtnis: Challenger-Explosion, Live Aid, Tschernobyl, Wimbledon, Maueröffnung – für Beckers Familie hingegen gar nicht so. Gattin Lilly scheint tatsächlich nicht sonderlich viel über die Tenniskarriere ihres Mannes zu wissen. Unglaublich, dennoch wahr: Elias und sie sehen dieses Spiel aller Spiele jetzt zum ersten Mal, höflich interessiert, mehr nicht.
Kommentator: Curren scheint sein Selbstbewusstsein wiedergefunden zu haben, er spielt jetzt viel besser, 6:6, Tie-Break.
Lilly: Und dieses Spiel hat damals wirklich halb Deutschland angeguckt, ja?
BB: Wie meinst du das, »halb Deutschland«? (lachend) GANZ Deutschland hat das geguckt! Und etwa 500 Millionen Menschen insgesamt, weltweit. Ich gebe jetzt ein bisschen an (lacht wieder).
Lilly: Ich war neun Jahre alt, ich habe mit Barbie und Ken gespielt.
Kommentator: Becker führt 4:2. Seitenwechsel.
BB: Und Achtung, wie ich an Curren vorbeilaufe …
Becker hat schneller das Netz passiert, weicht Curren nicht aus und hätte ihn also mit der Schulter angerempelt – wenn Curren nicht im letzten Moment ausgewichen wäre.
BB: Ich berühre fast seine Schulter, aber er dreht sich weg. Dem Gegner nicht ausweichen, das ist wichtig.
Becker geht weiter, zupft unschuldig dreinblickend die Saiten seines Schlägers. Psychologische Kriegsführung! Weiter geht’s. Becker springt artistisch in der seither als »Becker-Hecht« geläufigen Manier, erreicht den Ball noch, schlägt ihn aber knapp ins Aus.
Kommentator: Diese Hecht-Sprünge gehören zu meinem Spiel, hat der Junge gesagt. Der Patron Ion Tiriac und Trainer Günther Bosch scheinen weniger davon angetan.
Zwischenschnitt auf die Tribüne: Günther Bosch, wie so oft solidarisch gleich gekleidet wie sein, ja, man muss wohl sagen: »Schützling«; auch im Pullunder also.
BB: Günther Bosch! Mit skeptischem Blick.
Lilly: Wer ist der Typ?
Unglaublich! Sie weiß tatsächlich nicht, wer Günther Bosch war! Ist das angenehm – das freut einen wirklich für Boris Becker, dass er ganz offensichtlich kein Tennis-Groupie geheiratet hat. Nicht desinteressiert, durchaus liebevoll mitguckend jetzt, zwischendurch packt sie ein paar mit der Post gekommene, verspätete Geschenke zur Geburt des gemeinsamen Kindes Amadeus aus, und es wirkt so, als wisse sie wenig bis nichts Genaues über das gloriose Tennis-Vorleben ihres Mannes, über dieses ganze hysterische Boris-Becker-Ding.
BB: Der war mein Trainer.
Neben Günther Bosch zündet sich Ion Tiriac, Beckers damaliger Manager, eine Zigarette an. Tiriac sieht wie üblich furchteinflößend aus, mit Mafia-Sonnenbrille und Riesenschnauzbart.
BB: Tiriac damals, guck! Heiß, oder? Da sieht man die Freundin von Kevin Curren, die Blonde da auf der Tribüne.
Lilly: Und hattest du auch eine Freundin zu der Zeit?
BB (schmunzelnd): Nee, ich war noch nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht schwul bin.
Lilly: Doch, du hattest eine!
BB: Ja, aber die war nicht da, die war in Monaco. Benedict.
Na klar! Benedict, Polizistentochter! All diese Namen: Wegmarken im deutschen Publikumsgedächtnis. Man kann ja sämtliche Lebensgefährtinnen, Trainer und Geschäftspartner Beckers ab 1985 aus dem Gedächtnis chronologisch aufsagen, das Personal der Boris-Becker-Seifenoper, seine Triumphe und Abstürze, sportlich wie privat und geschäftlich, Boris suuuper, Drama um Boris, Boris hier, Boris da, neues Glück, Steuer-Prozess, uneheliches Kind, Scheidungsdrama, groteske Geschäftsideen, neue Frau …
Lilly: Die Freundin von Curren ist doch auch süß.
BB: Texanerin. Aber ich steh ja nicht so auf Blond.
Allgemeines Lachen auf allen Sofas, stimmt, das weiß man, Beckers Frauen und Freundinnen waren fast ausnahmslos solchen Typs, der in Deutschland gemeinhin und alltagsrassistisch als exotisch« bezeichnet wird.
Kommentator: Nur 4:3 für Becker – und der 4:4-Ausgleich durch diesen Volley.
Currens Freundin schaut wieder optimistischer drein, klatscht jetzt demonstrativ. Aus dem Publikum Rufe: Come on, Becker!!
Elias (belustigt): Come on, Becker!
BB: Aaaah, das war jetzt ein Dämpfer. Einen Satz habe ich gewonnen, einen er, jetzt weiß ich, okay, das wird ein langes Spiel.
Och, na ja, für Becker-Verhältnisse war das ja wohl ein sehr stringenter, schneller Sieg: Vier Sätze in 3 Stunden und 18 Minuten, das war doch ein vergleichsweise glatter Durchmarsch – wie wir in den Folgejahren mit ihm gezittert haben bei klassischen Becker-Spielen, Stunde um Stunde, über zumeist ganze fünf Sätze! Man konnte sich da herrlich reinsteigern, Becker schlug stellvertretend für uns die großen Schlachten, »Becker-Passionen« nannte Martin Walser das und schrieb, das muss man Becker jetzt einfach vorlesen hier im Wohnzimmer: »Wenn Boris Becker gewinnt, sieht er aus wie ein Kind von Kirk Douglas und Burt Lancaster. Wenn er verliert, sieht er aus wie er selbst.«
BB: Da diene ich als Projektionsfläche, ob das jetzt Martin Walser ist oder irgendein Manfred Schmidt oder so, ist dann auch egal, in dem Fall ist er Fan und sieht diesen 17-jährigen Leimener, oder noch besser war ja immer die Formulierung »der 17-jährigste Leimener«. Und da denkt der Fan, wow, wir haben auch einen, der einen Traum lebt und es mit den ganz Großen aufnehmen kann, und wenn ich dann verlor, schaute der Fan wieder auf sein eigenes Leben und merkte, ach, schade, der Becker ist ja auch nur ein Mensch.
3. Satz
Kommentator: Nun ist aus dem Match ein sehr gutes Finale geworden. Die Frage ist nur, wer zuerst dem Druck des anderen nachgibt. Im dritten Satz scheint es Becker zu sein. Drei beide, 0:40.
BB: Ich sehe da schon ein bisschen mitgenommen aus, drei Breakbälle, jetzt wird’s eng.
Lilly: Was dachtest du da, Babe?
BB: Shit, dachte ich.
Schnitt auf die Tribüne: Currens Freundin und Schwiegermutter, siegessicher.
BB: Tja, Ladies, zu früh gefreut. Ah, mein Trainer wird langsam hektisch.
Günther Bosch reibt sich – auffällig um Unauffälligkeit bemüht – am Kopf, mit ausgestrecktem Zeigefinger.
Kommentator: Was mag Günther Bosch seinem Schützling signalisieren wollen?
BB: Ball höher werfen beim Aufschlag vielleicht.
Jetzt fliegt sogar Curren einem Rückschlag entgegen, wie es sonst nur Becker tut.
BB (sanft ironisch): Der kann das also auch, sieh an.
Kommentator: Imitiert der Ältere jetzt gar den Stil des Teenagers?
Currens Freundin knabbert an ihren Fingernägeln, Curren nimmt Becker den Aufschlag ab, geht im dritten Satz 4:3 in Führung. Der heutige Becker schüttelt ungläubig den Kopf, das hat er so nicht in Erinnerung, er rutscht auf dem Sofa nach vorn.
BB: Ouh, Break?! Was? Hä? Ich glaub es nicht, der hat mir meinen Aufschlag abgenommen!
Aber es ist ja dann gut ausgegangen, wissen wir zum Glück. Raunen jetzt im beckerschen Wohnzimmer, dem echten, 2010, es wird in die Sofakissen geboxt, Daumen werden gedrückt: Papa! Oh, Babe! Come on! Come on, Becker!
Kommentator: Nun muss der 17-Jährige zeigen, was in ihm steckt. Und er zeigt es. 4:3 für Curren – aber 0:30 nach diesem verschlagenen Schmetterball.
BB (klatscht zufrieden in die Hände): Verhaut der den Ball, hm? Jetzt merke ich, ah, Curren wird wieder hektisch.
Lilly hat Kekse und Pralinen auf den Wohnzimmertisch gestellt, Becker nimmt sich einen großen Keks, lehnt sich dann wieder zurück, kaut den Keks – er weiß ja, wie das Spiel ausgeht.
Lilly: Wie alt war der Curren nochmal?
BB: Er war 27.
Lilly: Ach, zehn Jahre älter? Deshalb ist der so langsam.
BB: Was? Ist doch kein Alter, 27 – also bitte!
Currens Freundin auf der Tribüne vergräbt ihren Kopf in den Händen.
Kommentator: Diesmal sitzt Beckers Return dort, wo er hinsoll. 4:4. Ein Konter bei solch kritischem Spielstand sagt alles über das Selbstbewusstsein dieses Jungen.
BB: Das war natürlich spielentscheidend.
Kommentator: Was wird Curren tun? 4:5 und 30:15.
BB: Oh, oh, Doppelfehler, er zeigt Nerven!
Lilly (kichernd): Guck, wie du dich bewegst.
Sie steht auf, imitiert den Jungen vom Bildschirm, die Jubel-Fäuste, das Trippeln. Man will sich da jetzt nicht einmischen, müsste ihr aber vielleicht erklären, dass all diese Posen, Becker-Faust, Becker-Trippeln und Becker-Hecht, seither zum deutschen Kulturerbe gehören.
BB: Machst dich über meine Schritte lustig? Das gibt’s doch gar nicht!
Kommentator: 30:40, Satzball für eine 2:1-Satzführung Beckers.
BB: Guck, jetzt unterbreche ich, das ist natürlich ein klassischer Becker.
Ein toller Moment: Curren will gerade aufschlagen, nimmt schon Schwung auf, da dreht Becker sich um, hört man ihn da »Moment!« in die Stille sagen? Nochmal schön die Stirn mit dem Schweißband abwischen, bisschen an den Schlägersaiten herumspielen, den Gegner aus dem Rhythmus bringen – okay, kann losgehen.
BB (stolz und verschämt): Was ich da für Sachen gemacht habe, hm?
Currens Freundin kaut wieder intensiv an ihren Fingernägeln herum. Aber: Einstand. Becker flucht, erringt dann erneut einen Satzball, fliegt einmal mehr angstlos durch die Luft, radiert den Rasen mit dem ganzen Körper, T-Shirt und Hose jetzt stark verschmutzt.
Lilly (fast erschrocken): Oh, Baby!
Kommentator: Er sieht aus, als käme er von einem Fußballfeld.
BB: Ich blute am rechten Knie, okay, aber was ist da los, Satzbälle, Satzbälle – und ich mach’s nicht!
Kommentator: Und – Spiel Curren, 6:6, auch dieser dritte Satz wird also erst im Tie-Break entschieden.
BB: Ich konnte jetzt in der Schlussphase seine stärkste Waffe, den Aufschlag, lesen – und nun wird er sauer.
Currens Freundin wird immer nervöser, drückt die Daumen, guckt hin, guckt weg, guckt wieder hin. Becker, im heldenhaft verdreckten Shirt, schlägt ein Ass, 4:0.
Kommentator: Wieder einer von diesen weißen Blitzen Marke Becker.
Und noch einer: 5:0. Doppelfehler Curren, 6:0, Seitenwechsel, wieder das Spiel mit der Schulterberührung.
Lilly (empört, besorgt): Hat er dich gerammt?
BB (stolz): Ich hab IHN gerammt! Die ganze Zeit sind wir da bei den Seitenwechseln mit unseren Schultern zugange – das bemerkt der Kommentator gar nicht.
Direkt nach diesem Schulterberührspiel macht Becker immer irgendwas Ablenkendes, diesmal begutachtet er nachdenklich seinen aufgeschürften Ellenbogen, weiter geht’s.
Kommentator: Dieser Doppelfehler Currens beschert Becker weitere sechs Satzbälle.
BB: Jetzt hat er auf meinen Körper gezielt – gibt ja so ungeschriebene Regeln, das zum Beispiel macht man eigentlich nicht, und dass er es dennoch getan hat, war für mich ein weiterer Hinweis darauf, dass er langsam, aber sicher die Nerven verliert.
Kommentator: Dieser fantastische Vorhand-Return bringt dem Deutschen die 2:1-Satzführung.
Die beiden nehmen auf den Stühlen links und rechts des Schiedsrichter-Hochsitzes Platz, Becker wechselt das T-Shirt, man sieht seinen weißen Oberkörper, darauf diverse Abschürfungen und Hämatome.
Kommentator: Dies ist der Rücken eines Tennis-Akrobaten, nicht der eines Rugby-Spielers.
BB: Der Rücken eines Kindes, würde ich eher sagen, wie das aussieht.
Kommentator: Wer mag jetzt noch sagen, dass dieser junge Mann nicht auch dieses Finale gewinnen kann?
4. Satz
Kommentator: Erstes Spiel, vierter Satz, Curren führt 30:15, die krachende Vorhand des Boris Becker – und 30 beide.
Lilly: Warst du nicht erschöpft?
BB: Nee, ich hab gemerkt, dass ich jetzt nah dran bin, zu breaken und endgültig die Nase vorn zu haben, dann nur noch meine Aufschläge durchbringen muss, um das Match nach Hause zu bringen.
Kommentator: Und noch ein Return vom gleichen Kaliber, diesmal mit der Rückhand.
Auf der Tribüne klatscht nun sogar Ion Tiriac. Die Curren-Freundin ist verzweifelt.
Kommentator: Currens Anhang leidet mit ihm, Becker führt im vierten Satz 5:3, vielleicht ist in wenigen Minuten alles vorbei. Matchball Becker.
BB: Das hätt’s schon sein können, aber so kurz vor dem möglichen Sieg wurde ich nun doch nervös, Arme werden schwer, Beine werden schwer – fast Angst vorm Sieg.
Kommentator: Der Amerikaner aus Südafrika hat nicht immer gut gespielt, aber es gelang ihm wenigstens, diesen Matchball abzuwehren.
Currens Freundin auf der Tribüne greift sich in die Haare, untersucht ihre Fingernägel, ob es da noch was zu kauen gibt.
Kommentator: Und jetzt schlägt der blonde Junge auf.
BB: So, und jetzt war ich hektisch, das weiß ich noch heute genau.
Beckers erster Aufschlag berührt die Netzkante, Tiriac krault sich den Schnurrbart, Currens Freundin wirkt, als müsse sie mal dringend aufs Klo.
BB: So, jetzt beim zweiten Aufschlag, da hatte ich auf einmal überhaupt kein Gefühl mehr – bupp, Doppelfehler! Da schrei ich mich selbst an, um mich so’n bisschen aus der Nervosität zu befreien.
Kommentator: Wird Becker Geschichte schreiben?
BB: Die Bedeutung und die Historie begreift man in dem Moment nicht. Ion Tiriac hat mich sehr beschützt, damit ich meinen Rhythmus nicht verliere. Dass da zum Finale meine Eltern eingeflogen sind, zwischenzeitlich mein Großvater gestorben war, und was in Deutschland für ein »Unser Boris«-Ausnahmezustand herrschte – das habe ich alles gar nicht mitgekriegt.
Man muss wohl all die unter dem Vergrößerungsglas der Massenmedien fortan ihm widerfahrenen Fehler und Kapriolen als Protest gegen diese massive nationale Vereinnahmung werten. Übrig bleibt dann: ein Held. Nächster Aufschlag, tipptipp, gucken, Schwung holen, gucken, Zunge über die Lippen, Ball in die Luft, Körper hochschrauben – und rummms! Wie hat man bei diesen Aufschlägen, diesem Zunge-über-die-Lippen-Theater jahrelang mitgefiebert!
Kommentator: Currens Rückhandball ist im Aus, 30:15.
Es folgt ein Ass, 40:15, Matchball! Becker lässt beide Fäuste nach vorn schnellen, pustet dann in die rechte, trabt zurück zur Grundlinie. »Quiet please, ladies and gentlemen, thank you, quiet please!« – die Ladies and Gentlemen auf den Tribünen können sich kaum beruhigen. Und auch hier, in Beckers echtem Wohnzimmer, sind jetzt alle nervös – er wird gewinnen, wird er doch, oder?
BB: Ich nehm’s schon mal vorweg, ich mach jetzt nochmal einen Doppelfehler.
Der erste Aufschlag landet im Aus, der zweite im Netz, Becker schimpft mit sich, Raunen im Publikum, wird er jetzt unsicher?
Kommentator: Ausgerechnet jetzt ein Doppelfehler. Zeigt der bisher so coole Junge doch Nerven?
Lilly: Warst du sauer, Darling?
BB: Ja, sauer auf mein Nervenflattern.
Wir sehen: Bosch kratzt sich am Kopf, Tiriac hat tatsächlich seine Sonnenbrille abgesetzt, selbst er, der Pate, wirkt nun nervös. Becker holt Schwung, Zungentheater, Ball in die Luft und –
BB: So, überlege ich mir, wohin habe ich vorher zweimal gut serviert, also nochmal: in die rechte Ecke. Geschafft! Und jetzt kommt hier der Shuffle …
Becker ist noch in der Vorwärtsbewegung, die aus der Wucht dieses letzten, spielbeschließenden Aufschlags resultiert, ballt dann die Fäuste, kommt trippelnd zum Stehen, schreit vernehmlich »Yeeeaah!«, reißt die Arme in die Luft, wirft den Kopf in den Nacken. Klick – dieses Bild hängt bald darauf als Poster in Hunderttausenden deutschen Kinder- und Jugendzimmern.
Kommentator: Ein 17-jähriger Junge, der das Spiel auf den roten Ascheplätzen seiner Heimat lernte und alles so flüssig auf den kurzgeschorenen Rasen Wimbledons übertrug.
BB (lacht stolz): Hehehe – na, Lilly?
Der Becker auf dem Bildschirm dreht sich zu Bosch und Tiriac, geht dann zum Netz, pustet nochmal in die rechte Hand, Händeschütteln über der Netzkante mit dem unterlegenen Curren, geht zu seinem Stuhl, dreht sich nochmal zur Tribüne um, winkt, lächelt.
Lilly: Wem winkst du da?
BB: Ich hatte meine Eltern entdeckt, die saßen auf der Tribüne hinter Tiriac und Bosch.
Er setzt sich auf den Stuhl, fährt sich durch die Haare, zieht die legendäre hellblaue Trainingsjacke an, ein Zeremonienmeister flüstert ihm, was protokollarisch nun von ihm erwartet wird, dann – ja, doch – schreitet er zur Trophäenüberreichung durch die Herzogin von Kent.
Kommentator: Der Pokal, auf dem als 99. Name nun der des Boris Becker eingraviert wird.
Lilly: Musstest dich beherrschen, da nicht zu weinen, hm?
BB: Nein, nein, ich lächle einfach, weinen musste ich nicht.
Bosch und Tiriac, wie alle der über 13000 Zuschauer im Stadion, applaudieren stehend, Tiriac hat die Sonnenbrille wieder aufgesetzt, klatscht nur in der halben Geschwindigkeit Boschs und all der anderen, er ist jetzt wieder Mr. Cool, denn nun ist es an ihm, diesen Erfolg zu Geld zu machen, er hat da auch schon ein paar Ideen, das sieht man ihm direkt an, zwei Stunden Interview= 150000 Mark, so die Richtung, an jede Werbevertragssumme mindestens eine Null dranhängen; Currens Freundin weiß, dass sie gefilmt wird, und tut also, was in diesem Fall zu tun ist: Sie kämpft mit den Tränen.«
BB: Ich weine nicht – DIE weint!
Deutschland derweil verfiel in einen bis heute anhaltenden Becker-Taumel: »Diese Vorhand schockt die Welt!«, »Jubelschrei durch Deutschland: Boris, du bist der Wahnsinn«, und so dröhnend weiter. Der nüchternste, hellsichtigste Kommentar stand etwas später in der »Washington Post«, lesen wir ihm doch den mal vor: »Vielleicht war er zu jung, um zu wissen, dass er zu jung war, um Wimbledon zu gewinnen.«
BB: Tja, wäre mein Leben anders verlaufen, hätte ich es leichter gehabt, wenn ich mein erstes Wimbledon nicht mit 17, sondern vielleicht mit 22 gewonnen hätte? Ich glaube: ja. Ich habe diesen frühen Sieg manchmal wirklich als Fluch empfunden, plötzlich war ich Legende und Denkmal, obwohl meine Entwicklung als Spieler noch gar nicht abgeschlossen war. Jeder wollte plötzlich was von mir, Menschen haben ihre Kinder nach mir benannt, das hat mir Angst gemacht.
Lilly will jetzt Fußball gucken und die Sofas umpositionieren, sie hat da so eine Idee zur Wohnzimmerverschönerung, also weitersprechen im – sowas hat er wirklich – Pokerzimmer.
BB: Da blieb irgendwann nur noch die Flucht ins Ausland. Mein Hauptwohnsitz ist in der Schweiz, aber ich bin oft und gern hier in Wimbledon, hier sind die Menschen diskret und freundlich. Es war mir immer klar, dass ich hier mal herziehen würde. Hm, vielleicht gehen wir einfach mal kurz rüber zum Centre Court, dann erklärt es sich, glaub ich, von selbst.
In einem Bilderrahmen neben Beckers Haustür, ungefähr auf seiner Augenhöhe, hängt das Gedicht »If –« von Rudyard Kipling, aus dem zwei Zeilen am Torbogen des Spielereingangs zum Centre Court zu lesen sind:
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same
BB: Mit 17 kann man gar nicht verstehen, was das wirklich bedeutet, aber ein paar Jahre später, nach Erfahrungen aller Art, Höhen und Tiefen – aha, da habe ich es verstanden.
Epilog
Am Eingang zum »All England Lawn Tennis and Croquet Club« kommt ein Wachmann mit Wachmannmütze aus seinem Wachmannkabuff und schaut streng, er darf hier niemand Unbefugten reinlassen.
Guten Tag, sein Name, sagt Boris Becker (und man steht mit offenem Mund daneben), sei Boris Becker, er habe hier vor 25 Jahren erstmalig das Turnier gewonnen, und er wolle seinem Gast mal kurz das Gelände zeigen, ob das ginge, freundlicherweise?
Nein, sagt der Wachmann ungerührt, er dürfe hier …
Da kommt sein Chef, eilend, dienernd, die Mütze lüftend: Mr. Becker!
Ob er, setzt Becker an – aber der Wachmannchef unterbricht ihn gleich, selbstverständlich, alles dürfe er, wenn er ihm im Gegenzug bitte ein Autogramm schreibe.
Aber klar, sogar zwei!
Becker zeigt den Spielertrakt, am Torbogen des Centre-Court-Zugangs die Kipling-Zeilen, zeigt, wo Tiriac, Bosch und die Freundin von Kevin Curren damals saßen, auf welcher Seite er den Matchball verwandelte, wo Richard von Weizsäcker ihm gratulierte – und steht dann kurz schweigend am Rasenrand, dreht sich einmal, lässt das beruhigende Dunkelgrün der Tribünensitze auf sich wirken. Hier gehört er hin, und wenn man ihn hier einmal gesehen hat, wird man es für eine Lüge halten, dass er in einer Unterhaltungssendung durch ein brennendes Herz gehechtet sein soll.
Er holt tief Luft: Schön. Schön hier, oder?
24 Stunden mit Jürgen Fliege
Nachts habe ich in Jürgen Flieges Keller den Fernseher umgeschmissen, nachdem ein Hochzeitspaar im fliegeschen Garten über Tote sprechen musste, aber es fing alles ganz harmlos an: mit einem offenen Gartentor, einem etwas zu langen Händedruck und einem Blick, dem ich nicht standhalten konnte, weil es sich anfühlte wie das Unterschreiben einer Einzugsermächtigung.
Ein paar Tage zuvor war es in der Fernsehsendung von Markus Lanz hoch hergegangen, es war der Tag, an dem Loriot gestorben war, und nachdem man seiner eine Viertelstunde lang gedacht hatte, nahm die Runde Pastor Fliege in die Zange, wenn nicht ins, ja, Gebet, weil nämlich unter dessen Namen irgendein Kräutergebräu für 39 Euro 90 verkauft wird, das er zuvor GESEGNET habe, die »Fliege-Essenz«, und wenn man sich dieses Gebräu dreimal täglich in den Mund sprühe und vor jedem Sprühstoß die Wörter »Glaube«, »Liebe« und »Zuversicht« deklamiere, dann täte einem das total gut, sagt ebenjener Jürgen Fliege. In der Talkshow hatte es einen dadaistischen Dissensdialog darüber gegeben, ob Jürgen Fliege nun 5 Euro an jedem von ihm gesegneten Fläschchen verdiene oder 18 Euro 50. Stundenlang ging das hin und her: 5 Euro! Nein, 18,50! 5!! 18,50!!! 5!!!!
Jürgen Fliege hat in dieser Angelegenheit inzwischen an den Programmdirektor des ZDF geschrieben, denn er fühlt sich hintergangen. Er? Sich? Aber ja, man habe ihm eine »stille Sendung« versprochen, er sei vorher gebeten worden, KINDERFOTOS mitzubringen, die dann aber gar nicht gezeigt worden seien, und vor der Aufzeichnung habe man ihn ganz gezielt von den übrigen Gästen isoliert und diese gegen ihn aufgebracht. Hellmuth Karasek hat das alles auch, aber vollkommen anders erlebt, er war, gemeinsam mit Jutta Ditfurth, der Rädelsführer in der lanzschen Runde und erzählte anschließend, niemand habe ihn aufgewiegelt, er brauche auch keinerlei Aufforderung, um sich zu echauffieren, wenn einer derartigen Stuss rede und versuche, Menschen mit solchem Hokuspokus übers Ohr zu hauen.
Das ungefähr ist die Lage, und jetzt sitzen wir auf Jürgen Flieges Veranda am Starnberger See, Tässchen Kaffee, müde letzte Wespen, und Pfarrer Fliege serviert frisch gebackene Waffeln. 30 Autogrammkarten habe er heute übrigens schon unterschrieben, der Bedarf sei nach der Lanz-Sendung spürbar gestiegen, wohltuender Zuspruch sei das und keineswegs verwunderlich, so, wie man da im Fernsehen mit ihm umgesprungen sei. »Kreuzigt ihn«, dieser Aufruf habe noch gefehlt, alles andere sei doch da gewesen, aufgebrachte Menge, unfairer Prozess und gekaufte Gegner, das hätte er eigentlich sagen müssen, fällt ihm jetzt ein. Hellmuth Karasek im fernen Hamburg hingegen bedauerte, Jürgen Fliege nicht gefragt zu haben, ob der demnächst über den Starnberger See zu laufen gedächte. Jaja, sehr lustig, der Herr Professor, sagt Fliege. Doch in der Tat scheint er sich regelmäßig mit Jesus zu verwechseln, vielleicht ist das aber auch Theologie, wenn er immer wieder unvermittelt einwirft: »Was würde Jesus tun?« Tja, wenn man das nur immer so genau wüsste, wie Jesus sich zum Beispiel bei Markus Lanz verhalten hätte. Fliege bleibt ganz ernst, er weiß die Antwort: Jesus also, sagt Fliege, Jesus hätte die polemischen Anwürfe ertragen und wäre auch sitzen geblieben in der Talkshow, insofern also habe er, Fliege, gut daran getan, nicht einfach aufzustehen und die Runde zu verlassen, allerdings müsse er selbstkritisch eingestehen, dass Jesus anschließend wohl keinen hitzigen Brief an den Programmdirektor verfasst hätte, na ja, er greift zum Waffelteller, knetet die 5 Waffelherzen zu einem dicken Klumpen und steckt ihn sich in den Mund. Die Redewendung »einen an der Waffel haben« kommt einem in den Sinn, während Pfarrer Fliege irgendein Bibelzitat bemüht, das macht er häufig, und es ist ja auch ein dickes Buch. Bibelzitat, und dann ohne Punkt und Komma weiter mit einer Interpretation, in der Wörter wie »Kotzen«, »Mist« oder »Scheiße« vorkommen, das ist die Rhetorik des Pastors Fliege, so erdet er die Heilige Schrift.
Auf dem Verandatisch ausgebreitet liegen viele Briefe, Broschüren und Leitzordner, Jürgen Fliege ist gut vorbereitet und kann alles beweisen. Er, ein Scharlatan? Ein Sektierer? Jemand, der gutgläubigen Omas die Rente abluchst? Weil er jederzeit sehr hilfsbereit ist, antwortet Fliege auf die Frage, wie viel denn Seelsorge kosten und wie viel ein Pfarrer verdienen dürfe: »Nichts – da haben Sie Ihre Schlagzeile!« Aus der Korrespondenz mit dem Hersteller der »Fliege-Essenz« fingert er jetzt ein Gesprächsprotokoll, ob man bitte mal schauen wolle, was stehe da, 5 Euro oder 18 Euro 50 pro Fläschchen? 5 Euro steht da, und ein Vermerk seiner Mitarbeiterin, da sei eventuell noch mehr rauszuholen. Würde er 100 Euro pro Fläschchen kriegen, würde er selbstverständlich 100 Euro nehmen, er kriege aber in diesem Fall nur 5, er könne es doch beweisen, hier, er haut aufs Beweispapier – und was bleibe nach so einem Talkgemetzel hängen? Fliege lügt! Tue er aber gar nicht. Er müsse sich am Markt orientieren, in der Spiritualität regiere, wie überall, der Markt, und Kirche sei ein Anbieter. Das klingt modern und weltzugewandt, ist andererseits, 500 Jahre nach Martin Luthers Thesengenagel, eine diskussionswürdige Formulierung, aber wenn man Fliege widerspricht, holt er bloß immer neue Bücher hervor, geradezu parodistisch-naturwissenschaftliche Ausführungen über »spirituelle Schwingungen« in Wasser. Und Geld koste schließlich alles, auch herkömmliches Weihwasser! Oder die Millionen Käßmann-Bücher! Den Namen spricht er fast angewidert aus, verständlich, hat sie ihn doch als oberste Trivialtheologin der Evangelischen Kirche praktisch beerbt, Jürgen Fliege war ja sozusagen der Margot Käßmann der 90er Jahre. Sympathisch aber ist, dass er nicht ausschließt, sein Furor bei Nennung dieses Namens (»Weihnachtsmannglaube! Spießiges Scheißzeug!«) könne auch durch Neid befeuert sein.
Ob Jesus ein Handy gehabt hätte? Das von Fliege jedenfalls klingelt recht häufig, jetzt gerade wieder, er macht es kurz und sagt entschuldigend, bei der Anruferin habe es sich um eine krebskranke Muslimin gehandelt, er habe heute aber schon dreimal mit ihr gesprochen. Kostenlos, selbstverständlich. Was man eben so macht, als Pfarrer in Rente und aber weiterhin sehr beschäftigter, ja man kann durchaus sagen, geschäftstüchtiger Seelsorger: Mittlerweile im regionalen Nirgendwo ausgestrahlte Fernsehsendungen, eine nach ihm benannte Zeitschrift, Seminare, Pilgerreisen, eine gebührenpflichtige, per Telefonrechnung zu zahlende Predigt vom Band, Kongresse mit Kräuterexperten, Schamanen, Wunderheilern und anderen Predigern – kommt da nicht ordentlich was zusammen? Immerhin beschäftige er ja mehrere Personen, sagt Fliege, doch die meisten dieser Aktivitäten könne er gerade so mit einer SCHWARZEN NULL bilanzieren, wenn er Glück habe. Die Fernsehsendezeit zum Beispiel müsse er ja kaufen, und im ersten Halbjahr 2011 sei er damit unterm Strich 18000 Euro in den Miesen. Seit drei Jahren habe er kaum Steuern zahlen müssen und sich von Finanzbeamten fragen lassen, wo denn bei Gratis-Hochzeiten seine Gewinnerzielungsabsicht liege. Meistens, sagt er, zahle er doch drauf, bei der Beerdigung von Klausjürgen Wussow beispielsweise, dreimal habe er nach Berlin fliegen müssen, Vorgespräche, Zeremonie und so weiter, und man solle mal bloß nicht glauben, er habe ein Honorar dafür bekommen. Von der Kirche selbst kriege er ja nichts mehr – aber Geld für einen Mann Gottes? Wenn überhaupt, dann verschämt, die Deutschen seien da sehr verklemmt.
Begonnen hat das Missverständnis zwischen Jürgen Fliege und der Evangelischen Kirche vor vielen Jahren mit einer Kirschtorte: Er erzählt, dass er schon im Alter von vier Jahren beschlossen habe, Pfarrer zu werden, und zwar am Geburtstag seines Großvaters. Eine Kirschtorte war gebacken worden, doch Jürgen Fliege bekam kein Stück davon, die Torte blieb unangetastet, bis es nachmittags an der Tür klingelte, der Pfarrer kam zu Besuch und kriegte das erste, größte Stück von der Torte, »mit Sahne!«, und da habe er, Jürgen Fliege, gedacht: »Pfarrer müsste man sein, da kriegt man das größte Tortenstück, da hat man Macht – sogar über den Großvater.«