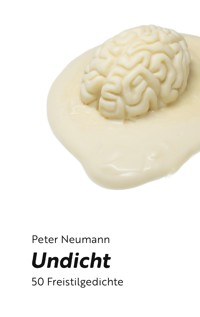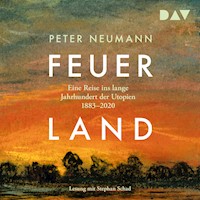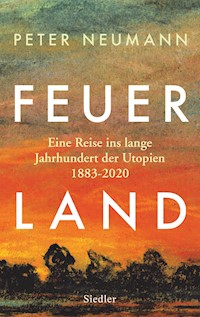
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine fesselnde Zeitreise in die Ära der großen Utopien - von Nietzsches »Übermensch« bis zu Susan Sontags Traum vom großen Frieden in Europa
Alles beginnt mit einem gewaltigen Knall: Der Ausbruch des Vulkans Krakatau 1883 ist wie ein Sinnbild für die ungeheure Kraft der utopischen Energien, die sich im langen 20. Jahrhundert entladen werden. Nietzsches »Übermensch« und Wittgensteins Revolution der Sprache, die Utopie vom grenzenlosen Fortschritt und die revolutionäre Kunst der Käthe Kollwitz, Freuds Eroberung des Unbewussten und der zerplatzte Traum vom Ende der Geschichte – all dies erweckt Peter Neumann in Szenen, Geschichten und Porträts meisterhaft zum Leben. Er lädt uns ein auf eine fesselnde Zeitreise ins Feuerland der Utopien, die uns trotz ihrer oft destruktiven Energie bis heute faszinieren und nicht loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alles beginnt mit einem gewaltigen Knall: Der Ausbruch des Vulkans Krakatau 1883 ist wie ein Sinnbild für die ungeheure Kraft der utopischen Energien, die sich im langen zwanzigsten Jahrhundert entladen werden. Nietzsches »Übermensch« und Wittgensteins Revolution der Sprache, die Utopie vom grenzenlosen Fortschritt und die revolutionäre Kunst der Käthe Kollwitz, Freuds Eroberung des Unbewussten und der zerplatzte Traum vom Ende der Geschichte – all dies erweckt Peter Neumann in Szenen, Geschichten und Porträts meisterhaft zum Leben. Er lädt uns ein auf eine fesselnde Zeitreise ins Feuerland der Utopien, die uns trotz ihrer oft zerstörerischen Energien bis heute faszinieren.
Peter Neumann, geboren 1987, ist promovierter Philosoph. Er lehrte an den Universitäten Jena und Oldenburg und ist seit November 2021 Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung DIEZEIT. 2018 erschien bei Siedler »Jena 1800. Die Republik der freien Geister«, das von Publikum und Kritik gefeiert und in viele Sprachen übersetzt wurde. Peter Neumann lebt in Berlin.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
PETER NEUMANN
Eine Reise ins lange
Jahrhundert der Utopien
1883–2020
Der Autor bedankt sich für die Förderung des Projekts bei der Deutschen Akademie Rom Casa Baldi.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © Peter Neumann 2022
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Copyright © 2022 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Ludger Ikas
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung: © SSPL/UIG/Bridgeman Images
Vor- und Nachsatz: mauritius images/Classic Image/Alamy Stock Photos
Satz: KCFG–Medienagentur, Neuss
Reproduktion: Lorenz+Zeller GmbH, Inning a. Ammersee
ISBN 978-3-641-28157-1V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Krakatau 1883:
Ein Vulkan hält die Menschheit in Atem
Erster Teil
Fieber
Rapallo 1883: Die Vision vom Übermenschen
Friedrich Nietzsche und Richard Wagner reißen die Welt aus dem Schlummer
Berlin 1898: Der Traum von Gerechtigkeit
Käthe Kollwitz und Gerhart Hauptmann stoßen die Denkmäler von den Sockeln
Intermezzo 1900:
Eine Illustrierte reist in die Zukunft
München 1903: Der Hunger nach Leben
Franziska zu Reventlow und Thomas Mann tauchen ein in die Boheme
Prag 1913: Das Verlangen der Liebe
Else Lasker-Schüler und Franz Kafka greifen nach den Sternen
Krakau 1914: Die Revolution der Worte
Ludwig Wittgenstein und Georg Trakl verschlägt es die Sprache
Zweiter Teil
Knall
Locarno 1917: Der Drang nach Freiheit
Ernst Bloch und Max Weber rufen die Republik aus
Paris 1922: Das Abenteuer der Avantgarde
James Joyce und Marcel Proust besteigen das Taxi in die Zukunft
Dresden 1937: Die Lust am Absurden
Samuel Beckett und Caspar David Friedrich glotzen den Mond an
London 1938: Die Eroberung des Unbewussten
Salvador Dalí und Sigmund Freud durchleiden schlaflose Nächte
Basel 1949: Der Mut zur Öffentlichkeit
Hannah Arendt und Karl Jaspers stellen die Frage nach der Schuld
West-Berlin 1955: Die Macht der Medien
Gottfried Benn und Theodor W. Adorno gehen auf Sendung
Dritter Teil
Walze
Olympia 1962: Die Sehnsucht nach der Antike
Martin Heidegger und Friedrich Hölderlin retten den Planeten
Weimar 1970: Wettlauf zum Mars
Johann Wolfgang von Goethe muss repariert werden
Intermezzo 1986:
Eine Wolke zieht nach Westen
Ost-Berlin 1991: Der Traum vom Jahre null
Christa Wolf und Jürgen Habermas ringen mit dem Ende der Geschichte
Frankfurt am Main 2003: Das Versprechen von Europa
Susan Sontag kämpft für den Frieden
Graz 2011: Der Stachel des Glücks
Stéphane Hessel und Walter Benjamin nutzen die Gunst der Stunde
Wuhan 2020:
Ein Sturm bricht los über der Erde
Anmerkungen:
Fragmente, Quellen, Fingerzeige
ullstein bild/Granger, NYC
Das erste globale Medienereignis: Am 26. August 1883 bricht auf einem winzigen Eiland in Indonesien der Krakatau aus. Auf der ganzen Welt berichten die Zeitungen.
Krakatau 1883:
Ein Vulkan hält die Menschheit in Atem
Overbeck ist sich nicht sicher, ob auch die anderen in den Kirchenbänken sehen, was er sieht. Als er über sich in das hohe Deckengewölbe blickt, kann er deutlich erkennen, dass der schwere Kronleuchter ins Schwanken geraten ist. Unmerklich erst. Dann immer stärker. Erst zur einen, dann – sein Kopf fängt an, sich in den leeren Rhythmus der Pendelbewegung einzuwiegen – zur anderen Seite. Kein Zittern und kein Beben. Es ist, als ob dieses Schwanken aus dem Nichts gekommen wäre. Jedes Mal scheinen die Kerzenarme nach etwas greifen zu wollen, das sie aber nicht erreichen können.
Erst als Pastor Köster seine Predigt um halb elf unterbricht und seine Augen ebenfalls auf den schwankenden Lüster richtet, der an einer langen Kette herabhängt und nun bereits einen halben Meter über dem Mittelgang ausschwenkt, gerät auch der Rest der Gemeinde, die in der Hauptkirche St. Trinitatis zu Altona versammelt ist, in Unruhe. Jeder blickt nach oben, wendet sich dann zu seinem Nachbarn, blickt wieder hinauf. Ungläubiges Staunen. Es ist unheimlich.
Ein Raunen geht durch die Reihen, und man ist sofort der Meinung, dass irgendwo ein schweres Erdbeben dieses Schwanken hervorgerufen haben muss. Man kennt schließlich die Geschichten aus Lissabon. Von jenem Tag, als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versunken war und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begraben hatte. Auch dort, so erzählt man sich, sollen nach dem ersten fernen Grollen die Kronleuchter in den Kathedralen hin- und hergeschwankt sein und die Kirchenglocken wie von Geisterhand geläutet haben. Und man weiß, dass sich das Erdbeben von Lissabon auch noch hier, im äußersten Norden Deutschlands, durch schwache Stöße bemerkbar gemacht hatte. Über einhundert Jahre ist das inzwischen her.
So schnell wie die seismischen Wellen hatten sich damals auch die Deutungsversuche verbreitet: Die Gottesfürchtigen ließen es nicht an Betrachtungen fehlen, die Philosophen nicht an Trostgründen und die Geistlichkeit nicht an Strafpredigten. Gott, der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erden, hatte sich keineswegs, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben stand, als weise, gnädig und väterlich erwiesen. Im Gegenteil. Dass er allmächtig sei, hatte Gott zur Genüge bewiesen, als er die Erde entzweibrechen ließ. Warum ließ er aber das Leiden zu, wenn er die Macht und doch eigentlich auch den guten Willen besaß, dieses Leiden zu verhindern?
Und auch jetzt, an diesem 26. August 1883, reden wieder alle durcheinander. Draußen im Land und hier in der Kirche. Jeder weiß ein bisschen besser Bescheid. Der eine fühlt sich an das Jahr ohne Sommer 1816 erinnert. Der andere an die tödliche Aschewolke aus Island im Jahr 1783, als von überallher aus Europa alarmierende Meldungen von einem »Hahl-Rauch« einliefen, wie er in solchem Ausmaß noch nie beobachtet worden war, ein Mehltau, der sich von oben herab auf die Fluren senkte.
Selbst als die Nachricht vom Ausbruch des Krakatau, eines der aktivsten Vulkane Indonesiens, wenig später über die Ticker der Nachrichtenagenturen läuft, bleibt die Sache ein Rätsel. Zwar weiß er, Carl Friedrich Theodor Overbeck, nun endlich, was das Schwanken des zehnarmigen Kronleuchters im Kirchenschiff bewirkt haben mag, aber es ändert nichts daran, dass er sich noch immer kein Bild vom Ausmaß der Katastrophe machen kann. Immer heftiger und greller soll die Eruption geworden sein. Die gekabelten Depeschen, die in den folgenden Tagen ihren Weg aus der Londoner Nachrichtenwelt in die Hamburger Blätter finden, machen das Ereignis in der Ferne nur noch unbegreiflicher.
Er, Overbeck, ist weiß Gott kein Philosoph, nur ein Verwaltungsbeamter, der bei den Hamburger Wasserwerken arbeitet und dem es hin und wieder gefällt, einen Aufsatz über die Flora der Niederelbe zu verfertigen und in einem der hiesigen Journale zu publizieren. Aber so viel begreift sein Verstand doch von der Welt im Großen wie im Kleinen, als er die Meldungen liest: dass es Dinge gibt, die über alle Vorstellungen hinausgehen. Wenn schon das Erdbeben von Lissabon solche schweren Verwüstungen verursacht hat, wie stark muss dann erst ein Vulkanausbruch am anderen Ende der Welt, auf einem winzigen Eiland zwischen Java und Sumatra, gewesen sein, damit er noch im Tausende Kilometer entfernten Altona als Pendelschlag eines Kronleuchters zu spüren ist. Und welche gewaltigen Schäden, welches ungeheure Unglück muss der Vulkan erst in Indonesien, Malaysia und auf dem asiatischen Kontinent angerichtet haben.
Allein die glühende Asche, die in den ersten Minuten des Ausbruchs in die Luft geschleudert worden ist, muss die Erde in weitem Umkreis verbrannt haben, als sie zusammen mit den faustgroßen Bimssteinklötzen vom Himmel wieder herabgeregnet kam. Im Sekundentakt wurden die Salven abgeschossen, als sich der Pfropfen im Krater gelöst hatte, schneller als ein schwerkalibriges Schiffsgeschütz seine Kanonen abfeuern kann. So schnell schießt niemand. Und dann erst die gewaltige Flut, die mit rasender Geschwindigkeit vom Meer heranrollte und Boote und Schiffe gleich welcher Größe auf ihren Wellenkämmen kilometerweit ins Landesinnere mitriss. Jahrhundertelang hat der Vulkan geschlafen, die Menschen glaubten schon, der Berg sei erloschen. Urwald breitete sich auf der Insel aus. Fischer und Kokosnusssammler besuchten die verträumten Buchten. Und nun steigt dort eine mächtige schwarze Rauchsäule auf, die der Wind weiträumig über den Indischen Ozean verteilt. Die Magnetnadeln sämtlicher Kontinente tanzen. Und wo einst die Vulkaninsel Krakatau lag, wird bald nur noch friedliches Meeresplätschern zu hören sein.
Hier versinken alle menschlichen Begriffe in Ohnmacht, und selbst die größte Vollkommenheit schwebt ohne Haltung vor jener Kraft, die imstande ist, sie mit einem Fingerschnippen zu vernichten. Und deshalb will ihm, Overbeck, schon in jenem Moment in der Kirche, als das Orgelspiel wieder einsetzt und der Pastor mit seiner Predigt fortfährt – eine Viertelstunde muss der Kronleuchter so hin- und hergeschwankt sein –, der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass nicht nur etwas Verheerendes passiert sei, sondern dass ihnen das Schlimmste erst noch bevorstehe.
Erster Teil
Fieber
Rapallo 1883: Die Vision vom Übermenschen
Friedrich Nietzsche und Richard Wagner reißen die Welt aus dem Schlummer
Zur Not hätte er diesen Stapel von Papieren höchstpersönlich über die Alpen getragen. Bis ans Ende der Welt. Da es vorläufig aber noch keinen Grund gibt, an der Zuverlässigkeit der Post so zu zweifeln wie an der moralischen Tugendhaftigkeit des Menschen, hat sich Friedrich Nietzsche an diesem 14. Februar 1883 vom italienischen Rapallo aus auf den Weg ins benachbarte Genua gemacht, um sein Manuskript direkt auf die Reise nach Deutschland zu schicken. Per Express! Die Publikation duldet keinen weiteren Aufschub.
Das Buch, eine Abrechnung mit seinem Zeitalter, hat sich Nietzsche in nicht einmal zehn Tagen von der Seele geschrieben. Zehn absolut heitere, frische Januartage, in denen so vieles möglich schien, woran er selbst nicht mehr geglaubt hatte. Es soll ein Buch »für Alle und Keinen« werden, der Untertitel ist mit Bedacht gewählt: »Für Alle«, weil das, wovon das Buch spricht, ausnahmslos alle angeht; »für Keinen«, weil es dafür eine Sprache gefunden hat, die sich der Sprache, in der heutzutage alle Welt plappert, widersetzt.
Es ist die Sprache der Moral, die Nietzsche so verachtet, die Redeweise jener Spießer, die sich nur an der Afterweisheit der Sonntagsprediger, der Priester und Bildungsphilister weiden, anstatt sich selbst auf den Weg des Denkens zu begeben. Wohin man blickt in diesem neunzehnten Jahrhundert: Noch nie ist eine Epoche so klug gewesen und weiß so wenig. Überall Kopien, Imitationen, Masken, mit denen sich die Menschen behelfen. Ein regelrechtes Karnevalsfieber hat dieses Jahrhundert ergriffen und ihm alles Leben, alle Luft zum Atmen geraubt. Zum Wohle der Moral versteht sich, zum Wohle der Mächtigen.
Damit muss Schluss sein! Wie heiter und frei fühlt es sich an, wenn erst einmal der Glaube an Moral und Sittlichkeit, an alle Werte ins Wanken geraten ist! Kann nicht alles auch ganz anders sein, als es sich die Menschen auf ihrem kleinen Stern vorstellen? Kann das Gute nicht auch schlecht sein, das Schlechte nicht auch gut? Nietzsche ist der Überzeugung: Es kann!
Man muss die Welt aus den Angeln heben, sie wird ihren Platz dann schon von ganz alleine wiederfinden. Aber dazu braucht es einen Propheten, der den Menschen von der Wahrheit kündet. Ihnen sagt, dass ihre Begriffe von »wahr« und »falsch«, »gut« und »schlecht«, »geschmackvoll« und »grässlich« abgegriffen sind wie alte Münzen. Nietzsche nennt diesen Wahrsager den »Übermenschen« und hat ihm den Namen Zarathustra gegeben.
Friedrich Hartmann [Public domain], via Wikimedia Commons
Prophet der Moderne: Friedrich Nietzsche will die Moral überwinden. Aber bevor der »Übermensch« sein Werk tun kann, müssen die alten Werte ins Wanken geraten.
Zarathustra ist ein Einsiedler, der nach Jahren der Einsamkeit und Selbstbesinnung seine Bergwelt verlässt, um den Menschen seine Weisheit mitzuteilen. Die heutigen Menschen, die »letzten Menschen«, wie Zarathustra sie nennt, sind freilich zu satt, um auf seine weisen Worte zu hören. Nichts verstehen sie. Aber auch gar nichts. »Was ist Liebe?«, »Was ist Schöpfung?«, »Was ist Sehnsucht?«, fragen sie – und blinzeln. Wir haben das Glück gefunden, sagen sie – und blinzeln. Ehemals war alle Welt irre, sagen selbst die Gescheitesten unter ihnen – und blinzeln. Es ist lächerlich!
Schenkt man den Alten Glauben, soll Zarathustra, der große Weise aus dem Morgenland, bereits bei seiner Geburt in ein schallendes Gelächter ausgebrochen sein, das seither nicht mehr verklungen sei. Als Anwalt gegen traditionelle Autoritäten kündet er von einer Welt des Kampfes zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Zarathustra selbst ist es gleichviel: Die Hoffnung auf Erlösung, auf eine andere, bessere Welt hat er längst aufgegeben. Wie können die Menschen bloß glauben, sie könnten etwas ändern?
Die Hoffnung an sich ist im Grunde das größte Übel von allen: Sie zwingt den Menschen, das Leben nicht wegzuwerfen, sondern weiterzumachen undsich immer wieder von Neuem quälen zu lassen. Sinnlos! Die Hoffnung auf Aufklärung, auf Fortschritt, auf Ruhm, Glanz und Herrlichkeit hat das Jahrhundert in einen Dämmerschlaf versetzt. Wenn man es jetzt wecken will, muss man so radikal wie möglich sein und sagen: Nichts davon ist wahr; es gibt aber auch nichts, das größer und besser und an dessen Stelle zu setzen wäre. Denn gerade in diesem Größer und Besser liegt doch bereits das Problem.
Es gibt ein Wort, das Zarathustras Haltung der Gleichgültigkeit auf den Begriff bringt: Zarathustra ist Nihilist. Ein Nihilist ist eine Person, die sich keiner Autorität beugt, die kein einziges Prinzip bedingungslos akzeptiert, egal, wie sehr es geschätzt wird, egal, von wem und woher es kommt. Solange sich der Mensch aber noch mit moralischen Lehrsätzen zufriedengibt, mit Schmerzzäpfchen, hilft alles nicht: Also hinfort mit ihm, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Die Devise des Übermenschen lautet: Nicht vom Übel muss die Welt befreit werden, sondern von ihren falschen Erlösern.
Früher, als sie noch befreundet waren, hätte der Komponist Richard Wagner ein solcher Übermensch sein können. Nur hat sich Wagner, dieser »Oberkirchenrat«, inzwischen selbst schon eine Art von Religion zurechtgezimmert. Seine neueste Oper Parsifalstrotzt nur so vor christlichen Erlösungsfantasien. Für einen wie ihn, Nietzsche, der Gott schon lange für »tot« erklärt hat, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Mit einem Wort: Abscheulich!
An Wagner und das, was zwischen ihnen vorgefallen ist, denkt Nietzsche an diesem Vormittag auf seinem Weg nach Genua aber nicht wirklich. Später am Tag wird er dann jedoch an Heinrich Köselitz, einen seiner treuesten Begleiter und Weggefährten, vermelden, was in der Abendausgabe des Caffaro steht. Etwas, womit er nie gerechnet hat, ist geschehen: Richard Wagner, sein von ihm so sehr gehasster Feind und sein einziger Freund, ist, wie es dort in einer Annonce steht, tags zuvor im Alter von 69 Jahren in Venedig gestorben.
Schon als sie am 16. September 1882 aus Bayreuth hier ankamen, ließ der Regen die Kanäle über die Ufer treten. Eine wahre Sintflut hatte sich über die Stadt ergossen. Und es will auch jetzt noch immer nicht aufhören zu schütten. Venedig, Königin des adriatischen Meeres, Besiegerin Konstantinopels, Bollwerk der Christenheit: seit Wochen eine einzige Riesenpfütze. Und er, Richard Wagner, muss darin herumwaten.
Quartier haben die Wagners im Palazzo Vendramin-Calergi am nordöstlichen Ende des Canal Grande bezogen. Das Mezzanin, das Cosima und er, die Kinder Isolde, Eva und sein jüngster Sohn Siegfried bewohnen, besteht aus fünfzehn Zimmern, der Salotto zum Kanal hinaus ist rot tapeziert, mit Doppelfenstern und Mobiliar im Stil Louis XVI. Gegenüber erhebt sich der Fondaco dei Turchi im altertümlichen Rundbogenstil. Geisterhaft huschen die Gondeln auf dem Canal Grande vorbei. Nach hinten raus befindet sich ein – für das sonst vegetationslose Venedig – weitläufiges Hofareal, das auch jetzt im Herbst noch in frischem Sommergrün prangt, anmutig wie die Blumen in Klingsors Zaubergarten. Im Vergleich zu den Bequemlichkeiten in der Villa Wahnfried in Bayreuth alles in allem aber ein bescheidenes Heim.
Heute, an diesem 22. Oktober, hat Wagner begonnen, einen Aufsatz für die Bayreuther Blätter zu verfertigen. Es soll eine Schrift über das »Bühnenweihfestspiel« werden. So hat er seinen Parsifal getauft, der im Sommer bei den Festspielen Premiere gefeiert hat.
Getty Images/Hulton Archive
Alles oder nichts: Für Richard Wagner ist die Kunst eine Religion. Allein sie vermag den Menschen noch aus seiner inneren Leere zu befreien.
Die Bild der Weihe fügt sich in Wagners Vorstellung, dass die Oper in den Rang einer Religion zu erheben sei. Sie ist eine zeremonielle Handlung, die der Welt ihre Profanität austreiben soll. Der Gläubige ist, sobald er die Weihe empfangen hat, Teil eines größeren Ganzen, einer heiligen Gemeinschaft. Von ihr erhält er den Segen, und in ihren Dienst hat er sich fortan zu stellen. Ob vor oder hinter, über oder unter der Bühne: Wagner glaubt an die weltverändernde Kraft einer Kunstreligion. Allein sie ist für ihn noch in der Lage, die Gesellschaft vom Luxus und von der Herrschaft der Lieblosigkeit zu befreien.
Gerade die Gestalt des Parsifal, des »reinen Tors«, der durch sein Mitleid zum Erlöser aufsteigt, hat das in seinem jüngsten Stück bewiesen. Der Sohn der Herzeleide und des vor seiner, Parsifals, Geburt im Kampf gefallenen Ritters Gamuret kennt selbst weder seinen Namen, noch weiß er, woher er kommt und wer seine Eltern sind. Ohne jede Ahnung irrt er durch die Welt, holt erst mit Pfeil und Bogen einen unschuldigen Schwan vom Himmel und bringt schließlich mit seinem Erbarmen Klingsors Zaubergarten zum Einsturz. Allein durch sein Mitleid, seine christliche Moral, gelingt es ihm, jenen Speer zurück in die Gralsburg zu bringen, mit dem Klingsor einst dem König Amfortas die Wunde geschlagen hat, die sich seither nicht mehr schließt. Es ist die heilige Lanze, mit der Christus damals am Kreuz von einem Soldaten traktiert wurde. Parsifal rettet so die Gralsritterschaft vor dem Zerfall, wird selbst König, und am Ende der Oper schwebt eine Taube als Zeichen göttlicher Gnade auf ihn herab. So viel Auferstehungsglaube muss sein!
In den wenigen Stunden, in denen es nicht regnet, zieht es Wagner auf die Piazza San Marco. Am liebsten lässt er sich in seinem Stammlokal, dem Caffè Lavena, einer Konditorei im Wiener Kaffeehausstil, nieder. Hier verbringt er die Nachmittage über seinen Papieren. Vor ihm die Basilika mit ihren goldenen Mosaiken, die jedes Mal zu glühen anfangen, sobald die Sonne ihr Abendlicht darauf wirft. Die einzige Zumutung sind die rauchenden Herren, die ihm mit dem Qualm ihrer Zigarren förmlich die Luft abschnüren.
Dabei ist Wagner gesundheitlich angeschlagen. Schläft schlecht. Hier und da zuckt es in der Brust. Von seinem Arzt hat er eine Diät verordnet bekommen, an die er sich nicht so recht zu halten vermag. Bei einem frisch gezapften Bier, einem Gläschen Champagner oder einer Kugel Eis wird er noch immer regelmäßig schwach, auch wenn ihn Cosima jedes Mal dafür rügt.
In den Nächten, in denen sich Wagner im Bett hin und her wälzt, hält er jetzt immer öfter Ausschau nach einem Kometen, der gerade zu sehen und von einer außergewöhnlichen Helligkeit sein soll. Noch nie soll ein solcher Komet mit einem solchen Schweif am Himmel zu beobachten gewesen sein. Noch nie soll aber auch ein Komet – zumindest nicht von dieser Größe – erschienen sein, der nicht ein Übel angekündigt habe, ein Unglück oder schreckliches Ereignis. In der Stadt rätselt man schon, inwiefern beide Erscheinungen miteinander zusammenhängen: der Komet und die anhaltenden Regenfälle, die viele Provinzen Venedigs bereits komplett überschwemmt haben.
Schon einmal hat Wagner eine solche Himmelserscheinung beobachtet: Im Jahr 1858, vor beinahe einem Vierteljahrhundert, war das, und wie es der Zufall wollte, weilte er auch damals in Venedig, nachdem er sich gerade von Minna, seiner ersten Frau, getrennt hatte und Ruhe, nichts als Ruhe suchte, um am zweiten Akt von Tristan und Isolde zu arbeiten.
Der Legende zufolge handelte es sich bei jenem Kometen damals um den Himmelskörper, der auch schon im Jahr 1556 erschienen war, dem Jahr, in dem Ihro Majestät, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Karl V., von dieser Feuerkugel wie vom Ruf des Schicksals getroffen, die Krone lieber früher als später an seinen Bruder Ferdinand übergab. Denn das Gestirn, das er am Himmel entdeckte, so erzählte es die Geschichte, sollte just derselbe Komet sein, der auch Schuld an der Sintflut trug und selbst beim Tode Cäsars zu beobachten war. Alle dreihundert Jahre kehre der Himmelskörper wieder. Und tatsächlich, fast auf das Jahr genau drei Jahrhunderte später war er wieder da gewesen. Karl V., der nach seiner Abdankung in ein Kloster nach Spanien ging, mochte seine Uhr, wie er selbst wohl meinte, für abgelaufen halten. Wagners Uhr hingegen sollte damals, 1858, gerade erst anfangen zu schlagen.
Viel ist es nicht, was Wagner heute zu Papier gebracht hat. Zu einem großen Wurf würde er gerne ansetzen, frisch, kräftig, ausdrucksstark. Aber der Text, wie er da als unvollendetes Stückwerk vor ihm liegt, ist noch reichlich unausgegoren und obendrein steif. Gleichwohl besteht kein Grund zur Sorge. Was immer er, Wagner, geschaffen hat, hat er mit ureigener Kraft aus sich selbst hervorgebracht. Und auch dieser Aufsatz wird sich schon noch seinem Willen fügen.
Zugegeben, ein Stilist ist er nie gewesen. Im Gegensatz zu seinem alten Freund Nietzsche. Der war der Aufführung des Parsifal im Sommer ferngeblieben. Kein Wort, nirgends. Schon Jahre geht das jetzt so. Eine tüchtige Frau, noch besser eine günstige Heirat hätte diesen Kauz vor seinen schlimmsten Irrtümern bewahren können, aber dafür ist es inzwischen wohl zu spät.
Wagner hat von Nietzsches letztem Buch gehört – Die fröhliche Wissenschaft ist erst in diesem Jahr erschienen. Alles, was er bisher darüber gelesen hat, ekelt ihn freilich an. Schon der Titel macht ihn rasend: Eine Wissenschaft, wie sollte die heiter sein können? Er könnte manchmal irre werden an der Menschheit. Und an diesem Nietzsche sowieso.
Es ist eine Kunst, ihn zu lesen. Wer ihn, Nietzsche, wörtlich nimmt, ist sowieso verloren. Seine Philosophie ist kein System. Es ist aber auch nicht einfach nur eine Ansammlung geistreicher Aperçus oder genialischer Ideen. Seine Philosophie ist ein System in Aphorismen. Wenn das Wort noch erlaubt wäre, würde man es als eine »Dichtung« bezeichnen – man muss schon ziemlich lange darauf herumkauen, bevor man etwas versteht.
Mögen die ausufernden Traktate bedeutender Gelehrter anderen ein Gefühl von Dauer und Ewigkeit verschaffen. Narren! Für Nietzsche sind der Aphorismus und die Sentenz die Formen, in denen sich die Ewigkeit zu erkennen gibt. Es bedarf nur eines einzigen Augenblicks, nicht mehr. Länger darf eine Ewigkeit auch nicht dauern. Wenn sich das erlösende Wort einstellt, ja, wenn unsere Seele auch nur für einen einzigen Moment vor Glück erzittert, dann ist es, als würde der graue Himmel der Abstraktion von Blitzen durchzuckt, dann scheint es, als wäre die Nacht, in der alles beschlossen liegt, für immer erhellt.
Und nun sollen ausgerechnet ihm, dem Sprachartisten, auf einmal die Worte fehlen? Dabei wäre es gerade seine, Nietzsches, Pflicht, in diesen Stunden ein Wort an Cosima zu richten, ihr sein Beileid zu bekunden. Aber nichts, kein einziges Wort des Trostes will ihm einfallen.
Die Wahrheit ist: Übel geht es ihm jetzt, nach Wagners Tod. So schlecht wie lange nicht mehr. Vor seinem Haus in Rapallo erstrecken sich die Bergrücken des Montallegro, die er noch im Herbst, als er in Italien ankam, auf seinen täglichen Spaziergängen erkundet hat. Montallegro – fröhlicher Berg: Das Schicksal muss einen grausamen Scherz mit ihm treiben.
Sieben Jahren ist es inzwischen her, dass Wagner und er sich das letzte Mal gesehen haben. Und mit jedem Monat, jedem Tag, jeder Stunde ist die Entfernung seitdem größer, der Riss zwischen ihnen tiefer geworden. So tief, dass man nur noch von einem Abgrund sprechen kann.
In Sorrent, einem Küstenstädtchen am Golf von Neapel, sind sie sich seinerzeit begegnet. Die Eröffnung des neu errichteten Bayreuther Festspielhauses, die sie gemeinsam gefeiert hatten, lag erst wenige Monate zurück. Nur fünf Minuten waren ihre Hotels damals voneinander entfernt. Eine Nähe, wie sie seither undenkbar gewesen ist.
Noch immer steht die »tödliche Beleidigung« zwischen ihnen, die Wagner ihm in jener Zeit zugefügt hat. Geredet hat Nietzsche bislang mit niemandem darüber. Und er wird es auch nicht mehr tun. Nur so viel: Es hätte tödlich zwischen Wagner und ihm ausgehen können, wäre die Feindschaft vollends zum Ausbruch gekommen, in die sich ihre einstige Freundschaft verwandelt hatte. Wagner ist wie eine Krankheit gewesen, die er durchlebt hat, die man durchleben muss: eine verheerende, unentbehrliche Epoche seines Lebens, die nun endgültig vorbei ist.
Nietzsche kann Bayreuth jedenfalls gestohlen bleiben. Hätte Wagner ihn zum Parsifal persönlich eingeladen, er wäre vielleicht auf den Hügel gefahren. So aber hatte er entschieden, durch Abwesenheit zu glänzen. Im Übrigen hätte wohl nur ein Tauber von der Aufführung dieses christlichen Erlöserdramas begeistert sein können, nach allem, was er von dem Stück gehört hat. Seine Schwester Elisabeth, das »Lama«, schien inzwischen jedenfalls taub zu sein, denn sie konnte nicht aufhören, von dem Stück zu schwärmen, vom Schluchzen der alten Männer auf den Holzbänken.
Ihm, Nietzsche, können sie gleichwohl nichts vormachen: Wagner, das ist ein Hochstapler und Dilettant. Wie arm, künstlich und schauspielerisch seine Musik klingt! Alle, die glauben, mit dem preußischen Sieg über Frankreich habe auch die deutsche Kultur einen Sieg davongetragen, werden bei Wagner eines Besseren belehrt. Ein vollkommenes Fiasko! Die ganze Passion, die er für diesen Menschen gepflegt hat, ist ein für alle Mal verflogen.
»Schirokko« hat er Wagners Orchesterklang einmal getauft – nach dem heißen Wüstenwind, der jetzt im Frühjahr von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht und eine große Menge Sandstaub mit sich führt, der das Atmen mitunter beinahe unmöglich macht. Er hätte Wagner schon viel früher aus seinem Leben verbannen sollen. Und doch ist es ihm nie gelungen.
Abschied nehmen muss man können – so wie auch Zarathustra lehrt, dass zu allem Handeln, zu jeder echten Tat ein Vergessen gehört. Nur wer die Vergangenheit hinter sich lässt, vermag ganz aus sich selbst heraus zu wachsen.
Nietzsche macht es sich schwer mit dem Brief an Cosima, so schwer, wie nur irgendein Mensch es sich schwer machen kann. Stunden wartet er nun schon auf das erlösende Wort.
Die Krämpfe in der Brust sind stärker geworden. Wenn doch nur das Wetter sich endlich bessern würde. Wagner kommt es vor, als ob es ein ewiger Winter in Venedig wäre, die kurzen Tage sind eine einzige Pein.
Das neue Jahr 1883 verspricht nicht viel besser zu werden als das alte. Auch heute, an diesem 5. Februar 1883, Rosenmontag, hat er sich, völlig erschöpft und von den wiederkehrenden Anfällen ermattet, auf einer Steinbank zwischen den Säulen der Markuskirche niedergelassen und hinaus aufs Wasser geschaut. Eine ganze Weile hat er so dagesessen und nur beobachtet, wie festliche Gondeln im Karnevalsaufzug an ihm vorbeischaukelten.
Immer öfter bleibt Wagner abends jetzt für sich allein am Klavier und improvisiert Melodien, die ihm gerade haufenweise in den Sinn kommen. Wenn Cosima zu ihm tritt, schickt er sie fort; wenn sie fort ist, vermisst er sie wieder. Es ist zu viel für sein Herz. Wagner will niemanden sehen. Nicht Cosima, nicht die Kinder, und schon gar keine Gäste.
An Aufregung hat es in letzter Zeit wahrlich nicht gemangelt. Franz Liszt, der im Dezember auf Besuch kam, ist Mitte Januar Gott sei Dank wieder abgereist. La lugubre gondola, die »finstere Gondel«, hieß das ebenso düstere wie dürftige Klavierstück in einem Satz, mit dem der Schwiegervater ihn offenbar foltern wollte. Auf die Zunge musste er sich beißen, um nicht ausfällig zu werden, als Liszt ihm das Stück zu Gehör brachte. Große Nachsicht hat Wagner mit Menschen noch nie gehabt. Aber sein Geduldsfaden ist inzwischen so dünn geworden, dass er oft genug das Verlangen verspürt, sich großräumig Luft zu verschaffen.
Liszt und er haben an den Abenden im Salotto über die Frage gestritten, ob sich sinfonische Werke auch in einem Satz komponieren ließen. Wenn überhaupt, so will Wagner ab jetzt nur noch Sinfonien dichten – einsätzig. Der tradierte Formenkanon – die Abfolge der vier Sätze –, den Beethoven bis zur absoluten Perfektion beherrscht und damit für alle Zeiten erschöpft hat, muss endlich aufgesprengt werden. Wagner ist jedenfalls nicht Künstler geworden, um ein leeres, lebloses Schema zu bedienen. Er will, Form hin oder her, einen musikalischen Gedanken da erfassen, wo er im Entstehen ist, einen melodischen Faden so lange spinnen, bis er ausgesponnen ist.
Manchmal, wenn Wagner von seinem Balkon aus in das träumende Dunkel der Stadt hinauslauscht, hört er, wie sich aus dem lautlosen Schweigen der Klageruf eines soeben auf seiner Barke erwachten Gondoliere erhebt. In wiederholenden Anläufen setzt dieser an, bis aus der Ferne ein gleicher Ruf antwortet: Es sind die Verse Tassos, eine uralte, schwermütige, melodische Phrase, die sich nachts über die Lagune legt, während sich der Nebel in die nächtlichen Gassen zwängt und ihren Klang verstärkt. Der Gesang ist so alt wie Venedig und seine Bewohner, so alt wie die öden Marschen, aus denen irgendwann kleine, von Prielen, Rinnsalen und schmalen Kanälen durchzogene Inseln wurden, auf denen später eine der reichsten und prächtigsten Städte Europas entstand.
Irgendetwas von dieser mythischen Kraft, die anschwillt, sich verdichtet und eine ganze Welt aus sich hervorgehen lässt, ist immer noch hörbar in diesem Gesang, der, wenn Wagner sich richtig erinnert, ursprünglich aus einem einfachen Grund angestimmt worden sein soll: Wenn die Fischer vom Lido, einer vorgelagerten Insel Venedigs, abends aufs Meer hinausfuhren, setzten sich ihre Frauen ans Ufer und stimmten aus voller Kehle Lieder an, auf die die Männer ihrerseits von fern antworteten. Es sind die Gesänge von Einsamen, in die Dunkelheit entsandt, damit ein Gleichgestimmter sie höre und antworte.
Berlin 1898: Der Traum von Gerechtigkeit
Käthe Kollwitz und Gerhart Hauptmann stoßen die Denkmäler von den Sockeln
Damit hat niemand gerechnet. Sie selbst am allerwenigsten. Käthe Kollwitz soll für ihren Zyklus Ein Weberaufstand die Kleine Goldmedaille der Großen Berliner Kunstausstellung erhalten, die noch bis zum 16. Oktober 1898 in den Ausstellungshallen am Lehrter Bahnhof zu sehen sein wird. Die akademische Jahresschau ist das Kunstereignis des Jahres. Wer in der Berliner Kunstszene etwas gelten will, muss hier vertreten sein. Sammler und Museen informieren sich über aktuelle Strömungen und Tendenzen, Käufer und Künstler kommen ins Geschäft, Journalisten und Kritiker wiegen bedächtig ihr Haupt.
Kollwitz’ Weberaufstand ist ein Drama in sechs Akten. In stummer Verzweiflung schlägt eine Frau die Hände über dem Kopf zusammen. Vor ihr liegt ein Kind im Bett. Leichenblass ist sein Gesicht, tiefe eingefallene Augen. Die Mutter beugt sich zu ihm hinab und kann doch nichts tun, als seinem langsamen Tod, seinem Dahinsiechen zuzusehen.
So beginnt der Zyklus. Kollwitz zeigt den Moment, in dem der Schmerz am größten ist, das Leben noch nicht ganz verloschen. Dann nimmt das Drama vom bewaffneten Aufstand der Weber seinen Lauf. Von der anfänglichen Ohnmacht über den Plan zur Revolte bis hin zum jähen Ende durch die blutige Niederschlagung verdichten Kollwitz’ Grafiken das Geschehen. Nichts ist geschönt, Kollwitz sucht die Reibung. Sie will die Realität so darstellen, wie sie sich für die Weber präsentiert – traurig und unerbittlich, aber auch reif für den gewaltsamen Umsturz.
Die Inspiration zu dem aufsehenerregenden Zyklus kommt von dem noch jungen, aber bereits jetzt schon in den Rang eines Klassikers aufgestiegenen Dichter Gerhart Hauptmann. So wie Goethe einst für den Werther gefeiert wurde, wird Hauptmann als Dichter der Weber verehrt. Es gibt kein Stück, das in den letzten Jahren höhere Wellen geschlagen hat.
Kollwitz kennt Hauptmann persönlich, hat ihn, als er noch nicht so berühmt war, in dem kleinen Vorort Erkner, einer Industriegemeinde im Südosten von Berlin, besucht. Ihre Schwester Lisbeth wohnte zu der Zeit dort im Nachbarhaus, und so wurde aus einer flüchtigen Bekanntschaft bald ein näherer Umgang, zu dem sich bei Berliner Weiße und sommerlichen Festen im Garten andere Künstler und Schriftsteller hinzugesellten, etwa der Maler Hugo Ernst Schmidt oder der Dichter Arno Holz. Hingerissen von Hauptmann war sie schon damals, aber das große Erlebnis kam erst mit der Uraufführung seines Dramas DieWeber.
Vor fünf Jahren hatte Kollwitz die Premiere des Stücks im Theater am Schiffbauerdamm gesehen. Und danach nicht mehr vergessen. Daheim im Wohnzimmeratelier packte sie daraufhin die Szenen zu Émile Zolas Bergarbeiterroman Germinal, an denen sie gerade saß, zusammen und machte sich an die Arbeit. Sie hatte ein neues Thema gefunden: Von den Webern ging eine Wucht aus, gegen die alles andere verblasste.
ullstein bild/Emil Otto Hoppe
Kämpferische Künstlerin: Käthe Kollwitz zeigt in ihren Grafiken das Leben der Armen und Schwachen. Kunst, die wirken will, muss aufrütteln, wahrhaftig und sozial sein.
Kollwitz meidet in ihrem Zyklus jede historische Distanz. Es geht ihr nicht um eine akkurate Bebilderung des Stoffs, schon gar nicht des Dramas. Wenn sie Hauptmanns Gestalten bildlich vor sich sieht, dann sitzen sie nicht nur in den Stuben der schlesischen Weberdörfer. Sie hocken auch in den Hinterhöfen der preußischen Hauptstadt, die seit der Reichsgründung 1871 aus allen Nähten platzt, oder sie versuchen, als Arbeitslose auf den Ämtern die Zeit totzuschlagen. Es sind förmlich mit der Haut verwachsene Lumpen, die auf den mit kräftigen Kontrasten gezeichneten Blättern zum Vorschein kommen. Körper, deren Konturen vom Schatten verschluckt werden, aus dem sie gerade erst heraustreten. Vollkommen gegenwärtig sollen die Weber auf ihren Zeichnungen sein – und doch zugleich zeitlose Sinnbilder eines Kampfes, der sich von jeher zwischen den Menschen zuträgt.
Ursprünglich wollte Kollwitz gar nicht Zeichnerin, sondern Malerin werden. Aber die Grafik ist ihr in den beengten Wohnverhältnissen, in denen sie mit ihrem Mann Karl, einem Arzt, am Wörtherplatz auf dem Prenzlauer Berg lebt, inzwischen zu der ihr vertrauteren Kunstform geworden. Nicht zuletzt kann sie damit gesellschaftlich eine ganze andere Wirkung entfalten. Eine kleine theoretische Schrift von dem Maler, Bildhauer und Grafiker Max Klinger – Malerei und Zeichnung, so der Titel – hatte ihr damals geholfen, sich nach ihrer Zeit an der Kunstakademie in München für die Grafik als künstlerisches Medium zu entscheiden: Die Malerei, so schrieb Klinger, habe die Harmonie und die Freude an der Welt zum Gegenstand; Kritikwürdiges und Veränderungsbedürftiges wies er hingegen der Grafik als Arbeitsauftrag zu. Genau das ist ihr, Kollwitz’, Metier.
Kollwitz ist damit einverstanden, dass ihre Kunst Zwecke verfolgt. Sie möchte wirken in einer Zeit, in der die Menschen ratlos und ohnmächtig sind. Nichts als die Wahrheit will sie mit ihren Werken, ihren Radierungen und Lithografien, zum Vorschein bringen, ungeschönt, derb, ohne den monumentalen Kitsch, wie ihn etwa die Berliner Bildhauerschule um Reinhold Begas mit ihrem Faible für den Neobarock verbreitet.
Bei den Offiziellen von der Königlichen Akademie der Künste kommt das naturgemäß nicht so gut an. Und offenbar gibt es auch schon Unstimmigkeiten bei der Medaillenvergabe. Der Vorschlag, Kollwitz die Auszeichnung zu verleihen, stammte von dem Maler Max Liebermann, der auch im kaiserlichen Lager hochgeschätzt wird. Aber sogar Liebermann hat seine Kritiker und ist in der Berliner Kunstszene nicht unumstritten.
Die Einmischung des Kaisers in Fragen, von denen er nichts versteht, ist keineswegs neu in Berlin. Auch die Uraufführung von Hauptmanns Webern war vom Kaiser seinerzeit untersagt worden, weshalb das Stück am 26. Februar 1893 von der Freien Bühne zunächst nur privat zur Aufführung gebracht wurde. Als es im Jahr darauf doch noch seine öffentliche Premiere am Deutschen Theater feiern konnte, weil ein Gericht inzwischen das Verbot gekippt hatte, wollte der Kaiser vor Wut schon seine dortige Loge kündigen und das kaiserliche Wappen daraus entfernen lassen. So weit kam es dann aber doch nicht. Wilhelm II. konnte und wollte die Integrität seiner eigenen Gerichte nicht aufs Spiel setzen und beließ es darum bei dem Schwur, das Theater nie wieder zu betreten.
Nun hat der Kaiser zu ihr, Kollwitz, sogar ein offizielles Gutachten vom preußischen Kulturminister anfertigen lassen. Der gibt zu bedenken, dass der Vorschlag Liebermanns vom künstlerischen Standpunkt aus zwar durchaus gerechtfertigt erscheine, die Darstellung des Elends aber, die bei Kollwitz jedes versöhnende Element vermissen lasse, einer staatlichen Anerkennung nicht würdig sei. Na bitte!
Wilhelm II., der Kaiser höchstpersönlich, hat nun die Auszeichnung an die Künstlerin verweigert. Eines triftigen Grunds dazu bedarf es nicht. Es genügt, dass er, Seine Majestät, es so will. Und außerdem: Orden und Ehrenzeichen gehörten an die Brust verdienter Männer. Eine Medaille für eine Frau, das ginge nun wirklich zu weit.
Lange war nicht klar, ob dieser Moment überhaupt jemals stattfinden würde. Als er dann endlich da ist, sackt Gerhart Hauptmann förmlich in sich zusammen, so erleichtert ist er. Beifall erschallt durch das Deutsche Theater, das an diesem 25. September 1894 bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Auf die Bühne kommen soll er, der Dichter. Erst traut sich Hauptmann nicht, denn auch Pfuirufe mischen sich in den Chor. Dann aber erhebt er sich, wartet noch eine Sekunde, streift den Rock glatt und nimmt den geteilten Applaus entgegen.
Der große Skandal, auf den nicht wenige Kritiker gehofft haben, nachdem die Aufführung des Stückes Die Weber erst verboten, verschoben und dann auch noch boykottiert wurde, ist ausgeblieben. Unmittelbar vor der Aufführung machte das Gerücht die Runde, die Sozialdemokraten wären in Scharen herbeigeeilt, um dem sozialistischen Parteidichter Gerhart Hauptmann ihre Aufwartung zu machen und ihn vor den Angriffen des Publikums zu schützen. Die Lage war jedenfalls angespannt – auf beiden Seiten. Und sie bleibt es.
Seit seinem Dramendebüt Vor Sonnenaufgang vor fünf Jahren gilt Hauptmann in Berlin und im ganzen Reich als Anführer einer neuen Kunstrichtung, der man jede Unflätigkeit zutraut. Nachdem der Reichskanzler Otto von Bismarck entlassen und die Sozialistengesetze vom Parlament wieder einkassiert worden sind, so sehen es viele, könne niemand mehr vor den revolutionären Umtrieben der deutschen Sozialdemokratie sicher sein. Als »Salonrevolutionäre« werden die unliebsamen kritischen Geister von der Presse beschimpft. Dabei sind Revolution und Revolte gerade das, was Gerhart Hauptmann mit seinem Engagement als Dichter am allerwenigsten im Sinn hat.
»Naturalisten« nennen sich die jungen Rebellen, die sich nicht länger vom Heiligenschein einer ach so schönen Vergangenheit blenden lassen wollen. Vielmehr wollen sie ihrer Gegenwart, dem Schmutz und Elend direkt ins Gesicht blicken. Und folglich ging es in Hauptmanns erstem Stück um eine unglückliche Bauernfamilie, die durch Kohlefunde zwar reich, wenig später aber auch schwer alkoholkrank geworden war. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Theaters bekamen die Zuschauer die Menschen zu sehen, die sonst, obwohl sie so zahlreich sind, immer nur im Dunkeln bleiben.
akg-images
Sozialer Aufrührer: Gerhart Hauptmann wird für seine Weber gefeiert. Aber auch die Obrigkeit hat einen Blick auf den aufmüpfigen Dichter geworfen.
Hauptmanns neuestes Stück, DieWeber, steht seinem Erstling an Drastik in nichts nach. Hauptmann ruft in seinem Drama den schlesischen Weberaufstand von 1844 ins Gedächtnis, der ohne ihn, den Dichter, vermutlich ein lokales Ereignis von belangloser Bedeutung geblieben wäre. Er kennt die Gegend, in der die Handlung spielt, genau, schließlich ist er in Schlesien geboren und aufgewachsen; sein Großvater hat selbst einmal als Weber gearbeitet. Hauptmann ist vertraut mit den Gepflogenheiten der Menschen vor Ort, kennt ihre Ängste und Sorgen. Er weiß, wie sehr Alter, Arbeit und Krankheit sie plagen, hat ihre vom Weben krumm gewordenen Körper vor Augen. Unter allen Geräuschen der Welt würde er das Wuchten des Webstuhls immer wieder heraushören können.
Was die Weber von allen anderen bis dahin auf deutschen Bühnen gezeigten Dramen unterscheidet, ist die Authentizität, mit der das Stück auftritt. Hauptmann hat genaue Studien in Büchern und vor Ort betrieben und lässt das Persönliche, das ihm so vertraut ist, im Fiktionalen aufgehen. Wenn doch auch alles erfunden ist, so ist doch alles wahr.