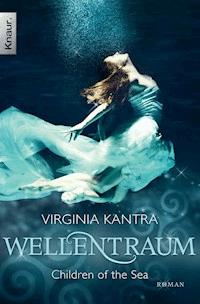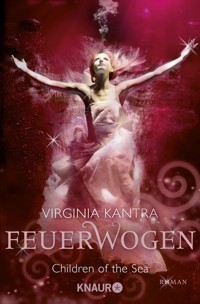
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Selkie-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Als Regina dem verführerischen Dylan begegnet, glaubt sie, endlich ihren Traummann gefunden zu haben. Doch nach einer leidenschaftlichen Nacht verschwindet er spurlos. Denn Dylan ist ein Selkie und hat sich ganz dem Leben im Meer verschrieben. Er weiß, er muss Regina vergessen, doch dann gerät sie in höchste Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Virginia Kantra
Feuerwogen
Children of the Sea
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Regina dem verführerischen Dylan begegnet, glaubt sie, endlich ihren Traummann gefunden zu haben. Doch nach einer leidenschaftlichen Nacht verschwindet er spurlos. Denn Dylan ist ein Selkie und hat sich ganz dem Leben im Meer verschrieben. Er weiß, er muss Regina vergessen, doch dann gerät sie in höchste Gefahr …
Inhaltsübersicht
Widmung
Dank
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Für Phyllis S. Kantra und Robert A. Kantra
Ich danke euch, Mom und Dad.
Dank
Mein tief empfundener Dank gilt meiner Lektorin Cindy Hwang und dem ganzen Team bei Berkley, das so unglaubliche Arbeit leistet.
Meiner Agentin Damaris Rowland, die dieses Buch erst ermöglicht hat.
Melissa McClone und Kristen Dill, dafür, dass sie mir zugehört, mir Feedback gegeben und mich unterstützt haben.
Lieutenant a. D. A. J. Carter, Dr. Martin Urda und allen weiteren Sachverständigen, die geduldig die aberwitzigsten Szenarios kommentiert haben.
Meiner Nichte Marie, die zugelassen hat, dass ich mir ihr Tattoo »auslieh«.
Jean und Will, Andrew und Mark, die, als der Termin der Manuskriptabgabe näher rückte, sicher glaubten, ihre Mutter sei von Dämonen entführt worden – oder besessen.
Und an Michael. Ohne dich wäre ich verloren.
Doch seine Seele war bei seinem Muttervolk,
das von der regenverhangenen Insel kam,
wo Patrick und Brandan schlussendlich
westwärts blickten auf eine See ohne Land
und auf das letzte Lächeln der Sonne.
G. K. Chesterton, »Die Ballade vom weißen Pferd«
Man sagt, die See sei kalt, doch birgt sie
das heißeste Blut in ihren Tiefen
das wildeste, das drängendste.
D. H. Lawrence, »Wale weinen nicht«
1
Am Abend nach der Hochzeit des attraktivsten Mannes der Insel betrank sich Regina Barone.
Sich flachlegen zu lassen wäre allerdings noch besser gewesen.
Regina sah von dem Mechaniker Bobby Kincaid, dessen Blick den feuchten Glanz seiner Bierflasche angenommen hatte, zu dem dreiundfünfzigjährigen Henry Tibbetts, der nach Hering roch, und dachte: Fette Beute. Aber auf einer Insel mit einer Ganzjahresbevölkerung von elfhundert Einwohnern hätte ein Schäferstündchen im Vollrausch auf einer Hochzeitsfeier ohnehin gravierende Konsequenzen haben können.
Und mit Konsequenzen kannte sich Regina aus. Schließlich hatte sie Nick, oder?
Die Zugbänder des Hochzeitszeltes flatterten im Wind. Da es zur Seite hin offen war, konnte Regina zum Strand hinabsehen, wo sich das glückliche Paar das Jawort gegeben hatte – ein schmaler Geröllstreifen, ein Gewirr aus Felsen, ein sichelförmiges Stück Sand am Rand des ruhelosen Ozeans.
Nicht gerade der klassische Ort zum Heiraten. Maine, selbst im August, war eben nicht Barbados.
Regina hievte ein Tablett mit schmutzigen Gläsern hoch; dabei entdeckte sie ihren Sohn, der neben ihrer Mutter an der Tanzfläche stand und von einem Fuß auf den anderen hüpfte.
Sie spürte, wie ihr Mund und ihre Schultern sich entspannten. Die Gläser konnten warten.
Sie stellte das Tablett wieder ab und ging quer durch das große weiße Zelt. »Hey, schöner Mann.«
Als sich der achtjährige Nick umdrehte, sah sie sich selbst in Miniaturausgabe: dunkle italienische Augen, ein schmales, ausdrucksvolles Gesicht und einen großen Mund.
Regina streckte beide Hände aus. »Willst du mir zeigen, was du drauf hast?«
Nicks anfängliche Skepsis wurde von einem Grinsen abgelöst.
Antonia Barone nahm seine Hand. Reginas Mutter war in vollem Bürgermeisterinnenornat – sie trug grellroten Lippenstift und ein zweiteiliges marineblaues Kleid. »Wir wollten gerade gehen«, sagte sie.
Mutter und Tochter starrten sich an.
»Ma. Nur ein Tanz.«
»Ich dachte, du hast zu tun«, erwiderte Antonia spitz.
Seitdem Regina angeboten hatte, das Catering für diese Hochzeit zu übernehmen, hörte ihre Mutter nicht auf zu sticheln. »Ich habe alles im Griff.«
»Soll ich immer noch heute Nacht auf ihn aufpassen?«
Regina unterdrückte ein Seufzen. »Ja. Danke. Aber ich möchte trotzdem vorher noch einen Augenblick mit meinem Sohn haben.«
»Bitte, Nonna«, bettelte Nick.
»Darüber habe nicht ich zu entscheiden«, sagte Antonia mit einer Stimme, die das Gegenteil nahelegte. »Mach, was du willst. Das tust du sowieso immer.«
»Schon lange nicht mehr«, murmelte Regina, während sie rasch mit Nick Richtung Tanzfläche ging.
Doch in den nächsten zehn Minuten freute sie sich einfach nur, wie Nick über die Tanzfläche hüpfte und schlitterte, sich klatschend drehte und wendete, lachte und sich wie jeder andere Achtjährige verhielt.
Dann wurde die Musik langsamer, und Pärchen eroberten die Tanzfläche.
Regina, der die Riemchen ihrer Sandalen in die Zehen schnitten, brachte Nick zu ihrer Mutter zurück.
»Zapfenstreich, Süßer. Du fährst jetzt mit Nonna in der Kürbiskutsche nach Hause.«
Er hob den Kopf und sah sie an. »Und was ist mit dir?«
Regina strich ihm das dunkle Haar aus dem Gesicht, wobei sie ihre Hand einen Moment auf seiner weichen Wange ruhen ließ. »Ich muss noch arbeiten.«
Er nickte. »Hab dich lieb.«
Sie spürte Mutterliebe unter ihrem Brustbein explodieren. »Ich hab dich lieb.«
Sie sah ihnen nach, wie sie das weiße Mietzelt verließen und den Hügel Richtung Parkplatz hinaufgingen; ihre füllige Mutter und ihr magerer Sohn warfen lange Schatten auf den Rasen. Die untergehende Sonne beschien den Hügelkamm und ließ die Sträucher dort fuchsien- und goldfarben aufleuchten wie verzauberte Rosen aus einem Märchen.
Es war einer jener Sommerabende, einer jener Tage, die Regina fast glauben machten, dass es so etwas wie ein Happyend tatsächlich geben konnte.
Aber nicht für sie. Niemals für sie.
Sie seufzte und drehte sich um. Ihre Füße schmerzten.
Bobby Kincaid hatte den Bardienst übernommen – für Freibier und um Cal einen Gefallen zu tun. Bobby verdiente gutes Geld in der Werkstatt seines Vaters. Heutzutage musste jeder Sechzehnjährige auf der Insel, dem das Geld aus den Hummerjobs ein Loch in die Tasche brannte, ein Auto haben. Oder einen Pick-up.
Regina wich aus, als Bobby versuchte, ihr an den Hintern zu fassen. Zu schade, dass er so ein Idiot war.
»Hi, Bobby.« Sie schnappte sich eine Sektflasche aus der eisgefüllten Kühlbox und drehte die Agraffe um den Korken auf. »Lass uns rasch noch eine Runde Sekt nachschenken, und dann räumen wir die Kuchenteller von den Tischen.«
»Hey«, polterte eine tiefe Männerstimme hinter ihr. »Du hast jetzt frei.«
Reginas Herz schlug schneller. Sie drehte sich um. Starke, gebräunte Hände, ruhiger Blick aus grünen Augen und ein verletztes Bein, das er aus dem Irak mitgebracht hatte. Polizeichef Caleb Hunter.
Der Bräutigam.
Er nahm ihr die Proseccoflasche aus der Hand, schenkte eine Sektflöte voll und reichte sie ihr. »Du bist hier Gast. Wir möchten, dass du dich heute Abend amüsierst.«
»Ich amüsiere mich ja. Jede Gelegenheit, mal etwas anderes als rote Sauce und Hummerrollen zu servieren …«
»Das Menü ist köstlich. Alles ist hervorragend. Diese Krabbenpastetchen …«
»Mini-Landkrabben-Plätzchen mit Jalapeño-Aioli und Sauce von geröstetem rotem Pfeffer«, rasselte Regina herunter.
»… sind wirklich der Hit. Du hast das toll gemacht.« Sein Blick war warm.
Regina errötete bei seinem Kompliment. Sie hatte es toll gemacht. Bei weniger als einem Monat Planungs- und Vorbereitungszeit und mit der völlig ahnungslosen Braut und der ungeschickten Schwester des Bräutigams als einziger Unterstützung hatte Regina die Hochzeit auf die Beine gestellt, die sie nie gehabt hatte. Warmes Laternenlicht erhellte das gemietete Zelt, das mit Rittersporn, Gänseblümchen und Sonnenblumen geschmückt war. Frisch gestärkte weiße Tischwäsche bedeckte die Picknicktische, und die Klappstühle aus dem Gemeindehaus hatte sie mit wallenden Bändern verziert.
Ein großer Erfolg war das Essen – ihr Essen: Muscheln in Knoblauch und Weißwein gedämpft, Basilikum-Tomaten-Bruschetta, geräucherter Wildlachs an einer Dill-Crème-fraîche.
»Danke«, erwiderte sie. »Ich habe schon daran gedacht, Ma dazu zu überreden, ein paar von den Vorspeisen in unsere Speisekarte zu übernehmen. Die Muscheln vielleicht oder …«
»Toll«, wiederholte Cal, aber er hörte schon nicht mehr zu. Sein Blick war über sie hinweg zu seiner Braut Maggie geglitten, die gerade mit seinem Vater tanzte.
Margreds dunkles Haar hatte sich aus der Steckfrisur gelöst und floss nun ihren Nacken herab. Sie hatte die Schuhe abgestreift, so dass der Saum ihres weißen Kleides auf dem Boden schleifte. Sie sah zu Calebs Vater auf und lachte, als er auf der Tanzfläche eine unbeholfene Drehung vollführte.
Die unverhohlene Intensität, mit der Cal seine Frau beobachtete, schnürte Regina die Kehle zu.
In ihrem ganzen Leben hatte noch kein Mann sie so angesehen, als wäre sie die Sonne und der Mond und sein gesamtes Universum in einem. Wenn das jemals einer täte, würde sie ihn nie wieder loslassen.
Wenn Cal es je getan hätte …
Aber das hatte er nicht. Würde er nicht. Niemals.
»Geh tanzen«, sagte Regina. »Es ist deine Hochzeit.«
»Stimmt«, entgegnete Cal und wollte schon weggehen.
Doch er drehte sich noch einmal kurz um und befahl lächelnd: »Und jetzt Schluss mit der Arbeit. Wir haben die Jugendgruppe angeheuert, damit du dich ausruhen kannst.«
»Du weißt doch, dass man diese Kirchenkids mit Argusaugen beaufsichtigen muss«, rief ihm Regina nach.
Aber das war nur eine Ausrede.
Die Wahrheit lautete, dass sie lieber Gläser schleppen und Platten abkratzen würde, als dieselben Gespräche zu führen, die sie schon früher geführt hatte, mit denselben Menschen, die sie schon ihr ganzes Leben lang kannte. Wie ist das Wetter? Wie geht es deiner Mutter? Und wann heiratest du endlich?
O Gott.
Sie sah zu, wie Cal mit seiner neuen Frau die Tanzfläche umrundete – langsam wegen seines Beins –, und Leere machte sich in ihr breit, heftig wie ein Krampf.
Sie griff sich ihr Glas und die offene Proseccoflasche und ging weg von alldem, von der Musik, den Lichtern und den Tänzern. Weg von Bobby hinter der Bar und Caleb, der Maggie im Arm hielt.
Reginas Absätze stachen Löcher in den zertretenen Rasen. Angezogen vom Brausen des Wassers bei den Felsen, stakste sie unsicher über den Schiefer. Schaumige Gischt leckte an ihren Füßen. Sie setzte sich auf einen Granitbrocken, um die Sandalen auszuziehen. Ihre nackten Zehen krümmten sich im kühlen, groben Sand.
Ah. Das war besser.
Sie schenkte sich noch ein Glas ein.
Der Pegel in der Flasche sank, während der Mond flach und hell aufging. Der Himmel nahm ein intensives Grau und Lila an, das sie an das Innere einer Muschel erinnerte. Regina legte den Kopf in den Nacken und sah zu den Sternen empor. Sie hatte das Gefühl, als würde sich die Erde um sie drehen.
»Vorsicht.« Die tiefe Männerstimme klang belustigt.
Regina fuhr zusammen. Der Prosecco in ihrem Glas schwappte über. »Cal?«
»Nein. Enttäuscht?«
Der Alkohol war auf ihr Kleid getropft. Mist.
Reginas Blick flog zum Zelt zurück und wanderte dann auf der Suche nach dem Besitzer dieser Stimme über den Strand.
Da stand er, barfuß am Rand der Brandung, als wäre er geradewegs dem Meer entstiegen und nicht einfach nur von der Hochzeitsgesellschaft herübergeschlendert.
Ihr Herz hämmerte. Ihr schwirrte der Kopf von all dem Prosecco.
Nicht Caleb. Sie blinzelte. Er war zu groß, zu schlank, zu jung, zu …
Seine Krawatte war gelockert, die Hose hochgekrempelt. Das graue Licht huschte über sein Gesicht und erhellte die lange, schmale Nase, den geschwungenen Mund und diese Augen, die so dunkel und verschwiegen waren wie die Sünde.
Regina spürte ein Klopfen, ein Flattern weiblicher Verzauberung, und starrte ihn finster an. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Er lachte leise und kam näher. »Sie sehen schön zusammen aus – Caleb und Margred.«
Da erkannte sie ihn. Von der Trauung. »Sie sind sein Bruder. Dylan. Der, der …«
Weggegangen ist.
Sie hatte Geschichten darüber gehört. Sie war betrunken, aber sie erinnerte sich trotzdem an das meiste. Daran, dass seine Mutter vor fünfundzwanzig Jahren die Insel sowie ihren Mann und Caleb und ihre kleine Tochter Lucy verlassen und den anderen Sohn mitgenommen hatte. Diesen hier.
»Ich dachte, Sie wären älter«, sagte sie.
Er verharrte bewegungslos im Mondlicht. »Sie erinnern sich?«
Regina schnaubte. »Kaum. Schließlich war ich damals erst vier Jahre alt.« Sie zupfte sich die feuchte Seide von der Brust. Sie würde aufs Festland fahren müssen. Auf der Insel gab es keine chemische Reinigung.
»Hier.« Ein Blitz wie eine weiße Flagge in der Dunkelheit. Sein Taschentuch. Ein echter Gentleman.
Und dann lag seine Hand auf ihrer Brust, und seine Finger umfassten das kleine Goldkreuz, das unter ihrem Schlüsselbein auf ihrer Haut ruhte. Dabei presste sein Handballen das Taschentuch zwischen ihrer Brüste. Warm. Vertraulich. Unanständig.
Regina holte hörbar Luft. Ganz und gar kein Gentleman. Arschloch.
Sie stieß seine Hand weg. »Ich hab’s schon.«
Unter dem feuchten Stoff stellten sich ihre Brustwarzen auf. Ob er es im Dunkeln sah? Sie rieb mit dem Taschentuch über das Kleid. »Was machen Sie hier?«
»Ich bin Ihnen gefolgt.«
Wenn er sie nicht gerade begrabscht hätte, wäre sie geschmeichelt gewesen. »Ich meinte: auf der Insel.«
»Ich wollte sehen, ob sie es wirklich tun.«
»Die Hochzeit?«
»Ja.« Er schenkte ihr Sekt nach, bis die Flasche leer war, und reichte ihr das Glas.
Die Geste erinnerte sie schmerzhaft an seinen Bruder. Trotz der Meeresbrise fühlte sich ihr Gesicht heiß an. Ihr war warm. Hastig trank sie einen Schluck. »Sie sind also einfach so wieder aufgetaucht? Nach fünfundzwanzig Jahren?«
»Es war nicht ganz so lange.«
Er ließ sich auf dem Felsbrocken neben ihr nieder. Seine Hüfte stieß an ihren Oberschenkel. Seine harte, runde Schulter streifte die ihre. Die Wärme breitete sich nun auch tief unten in ihrer Magengrube aus.
Sie räusperte sich. »Was ist mit Ihrer Mutter?«
»Tot.«
Ups. Autsch. »Tut mir leid.«
Lass es gut sein, sagte sie sich. Es führte doch zu nichts, Geschichten über zerrüttete Familien auszutauschen. Nicht, dass sie gewollt hätte, dass das hier zu etwas führte, aber …
»Es ist seltsam, dass Sie nicht schon vorher zurückgekommen sind«, sagte sie.
»Das denken Sie nur, weil Sie nie weggegangen sind.«
Sie war getroffen. »Das bin ich aber. Gleich nach der Highschool. Ich bekam einen Job als Spülerin bei Perfetto’s in Boston, bis Puccini mich zur Vorspeisenköchin befördert hat.«
»Perfetto’s.«
»Alain Puccinis Restaurant. Sie wissen schon. Der aus dem Fernsehen.«
»Ich nehme an, ich sollte jetzt beeindruckt sein.«
»Ja, sollten Sie.« Stolz und Ärger kochten in ihr hoch. Sie trank ihr Glas aus. »Er wollte mich zum Souschef machen.«
»Aber Sie sind zurückgekommen. Warum?«
Weil Alain – dieser Hurensohn – sie geschwängert hatte. Sie konnte weder Küchendienst mit einem Säugling schieben, noch vom Gehalt einer Abteilungsköchin einen Babysitter bezahlen. Selbst nachdem sie Alain genötigt hatte, einen Vaterschaftstest machen zu lassen, deckten seine vom Gericht angeordneten Unterhaltszahlungen kaum die Kosten für die Tagesmutter. Sein Vermögen war – natürlich verdeckt – im Restaurant angelegt.
Doch das sagte sie nicht. Ihr Sohn und ihr Leben gingen Dylan nichts an.
Sein Oberschenkel drückte warm gegen ihr Bein.
Männer sahen eine Frau jedenfalls anders an, wenn sie ein Kind hatte. Es war lange her, dass sie im Mondschein neben einem Mann gesessen hatte.
Noch länger, dass sie Sex mit einem Mann gehabt hatte.
Sie blickte zu Dylan, der so schlank und dunkel und gefährlich und nah war, und spürte, wie Verlockung ihre Adern entlangkroch wie ein Funke an der Sprengkapsel.
Sie schüttelte den Kopf, um ihn wieder frei zu bekommen.
»Warum sind Sie denn zurückgekommen?«, gab sie die Frage zurück.
Seine Schulter berührte die ihre, als er mit den Achseln zuckte. »Ich bin nur zur Hochzeit gekommen. Ich bleibe nicht.«
Regina unterdrückte eine unsinnige Enttäuschung.
Deshalb spielte es auch eigentlich keine Rolle, wie er sie ansah. Sie beugte sich vor, um ihr Glas im Sand abzustellen. Es spielte keine Rolle, was er dachte. Nach heute Abend würde sie ihn nie wiedersehen. Sie konnte alles sagen, was sie wollte. Sie konnte alles tun …
Sie hielt den Atem an. Was sie wollte.
Sie richtete sich wieder auf, rot im Gesicht und ein wenig schwindelig. Okay, der Sekt sprach wohl aus ihr. Einsamkeit und der Alkohol. Sie würde niemals wirklich … sie konnte doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen …
Sie kam schwankend auf die Füße.
»Langsam.« Er packte sie an der Hand, um sie zu stützen.
»Normalerweise schon«, murmelte sie.
Sein Griff wurde noch fester, als auch er aufstand. »Was?«
Sie schüttelte erneut den Kopf, während Hitze ihr ins Gesicht kroch. »Nichts. Lassen Sie mich los. Ich muss mir ein bisschen die Beine vertreten.«
»Ich komme mit.«
Sie befeuchtete die Lippen. »Keine gute Idee.«
Er hob anmutig eine Augenbraue. Sie fragte sich, ob er das vor dem Spiegel geübt hatte. »Besser, als wenn Sie sich auf diesen Felsen den Knöchel verdrehen.«
»Mir wird schon nichts passieren.«
Auf jemanden, der vom Zelt herübersah, mussten sie wie ein verliebtes Pärchen wirken, wie sie da Hand in Hand am Rand der Brandung standen. Ihr Herz pochte. Sie versuchte, sich ihm zu entziehen.
Sein Blick fiel auf ihre Hände. Seine Finger schlossen sich fester um die ihren. »Sie haben da einen Schutzzauber.«
Sie funkelte ihn ebenso erregt wie verwirrt an. »Wovon reden Sie?«
Er fuhr mit dem Daumen die Innenseite ihres Handgelenks entlang, über ihr Tattoo. Ob er spürte, wie wild ihr Puls klopfte? »Davon.«
Regina schluckte, während sie zusah, wie sein Daumen über die dunklen Linien, die blasse Haut strich. »Mein Tattoo? Das ist das keltische Symbol der dreifaltigen Göttin. Hat mit weiblicher Macht oder so zu tun.«
»Das ist eine Triskele.« Seine Finger zogen die drei fließenden, ineinander übergehenden Spiralen nach. »Erde, Luft und Wasser, durch einen Kreis miteinander verbunden.« Er sah ihr ernst in die Augen.
Zu ernst. Sie spürte ein Ziehen in ihrem Magen, das Nervosität oder Verlangen sein konnte.
»Mir kann also nichts passieren«, sagte sie atemlos.
Sein schöner Mund rundete sich im Mondlicht. »Nichts, was Sie nicht wollen.«
Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus. Sie fröstelte, als stünde sie nackt und entblößt an einem Fenster.
»Ich habe es ganz gern sicher«, gab sie zurück. Zumindest war das bis jetzt der Fall gewesen. »Ich habe Verpflichtungen.«
»Nicht mehr. Caleb hat gesagt, dass Sie für heute Schluss machen sollen.«
Regina blinzelte. Das hatte er gehört? Er hatte sie mit seinem Bruder beobachtet?
Plötzlich war sie auf der Hut. Sie hatte nicht gemerkt, dass sie Zuschauer gehabt hatten. Sie hatte ihn nicht anders wahrgenommen als als Calebs Bruder, eine große, dunkle Gestalt, die sich auf der Hochzeit im Hintergrund hielt, am Rand des Festes.
Ihre Zehen krallten sich in den Sand.
Nun nahm sie ihn wahr. Er berührte sie nur leicht am Handgelenk, und doch fühlte sie seine Wärme in ihrem ganzen Körper. Seine Augen glitzerten schwarz im Mondschein, verschluckten das Licht, verschluckten die Luft, wurden größer, dunkler, riesig, als er noch näher kam, verlockend mit seinem wunderbar geschnittenen Mund, aufreizend durch die Verheißung seines Kusses. Sein Atem strich über ihre Lippen. Sie schmeckte Wein und noch etwas anderes – Dunkles, Salziges, schwer Definierbares –, und sie hörte das Blut in ihren Ohren rauschen wie die See. Sie öffnete die Lippen, um Luft zu holen, und er beugte sich über sie und deckte ihren Mund fest und warm mit dem seinen zu.
2
Er schmeckte so gut – heiß und gut – nach Salz und Sex und Brandy. Vielleicht war das aber auch nur der Sekt, den sie getrunken hatte.
Regina stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn noch besser zu schmecken, während seine Zähne über ihre Unterlippe schabten und seine Zunge in ihren Mund eindrang. Spannung und Verlangen tanzten in ihrem Bauch. Doch sie war immer noch auf der Hut.
Wäre sie vernünftig – und nüchtern –, würde sie das hier sofort beenden.
Dylans Hände strichen über ihren Rücken und blieben auf den Hüften liegen, um sie enger an sich zu ziehen. Seine Erektion drängte zwischen ihre Oberschenkel, und sie vergaß fast zu atmen, weil er sich so gut, hart und real anfühlte, die leeren Stellen füllte und die einsamen Gedanken vertrieb.
Sie wollte das hier. Brauchte es.
Sie schlang die Arme um seinen Hals, begrüßte seine Zunge mit ihrer und schob ihr Becken dem seinen entgegen. Seine Hände sanken tiefer, während er sich an ihr rieb. Er war so heiß, sie verbrannte innerlich, alles in ihr schmolz und floss ihm entgegen. Er knetete ihre Pobacken, drängte nach unten, dazwischen, und als sie ihre Beine öffnete, gruben sich seine Finger in ihre Schenkel, und er hob sie hoch und brachte sie in die richtige Position.
Eine Welle von Empfindungen durchflutete sie. Sie schloss die Augen angesichts dieses unwiderstehlichen Drucks, angesichts dieser unerträglichen Versuchung.
Dumm, so dumm.
Sie entzog ihm ihren Mund. Das Herz hämmerte in ihrer Brust. Jeder konnte sie vom Zelt aus sehen. Ihre Mutter, einfach jeder.
Okay, nicht ihre Mutter, sie war mit Nick weggefahren. Aber …
»Nein«, keuchte Regina.
Dylans Arme spannten sich an. Der Griff seiner Hände lockerte sich. »Nein?«
Sie drehte den Kopf weg. Ihr Blut pulsierte in ihren Adern. Sie war feucht und offen und pochte wie eine Wunde, und wenn sie sich keine Erleichterung verschaffte, würde sie noch schreien.
»Nicht hier«, ergänzte sie.
Sein leises Lachen hallte in ihrem Bauch wider. Wenn sie ihn besser gekannt hätte, hätte sie ihm einen Schlag versetzt. Regina zog die Brauen zusammen und funkelte ihn an. Natürlich, wenn sie ihn besser gekannt hätte, hätte sie gar nicht erst diese Fummelei unter den Augen einer ganzen Hochzeitsgesellschaft angefangen.
Bevor sie noch mehr darüber nachdenken konnte, schob Dylan ihre Beine höher über seine Taille und trug sie über die Steine weiter zum Strand hinunter.
Barfuß?
Er ging plätschernd durchs Wasser. Granitbrocken lagen wie umgefallene Bauklötze dort, wo das Land steil ins Meer abfiel.
Regina umklammerte seine Schultern. »Was machst …«
Dylan umrundete einen großen Felsvorsprung. »Alles in Ordnung. Ich habe dich.«
»Noch nicht.«
Sein Lächeln leuchtete im Halbdunkel. Er setzte sie auf einem trockenen Felsen ab, der glatt und noch warm von der letzten Sonne war, und nahm in einem weiteren tiefen, erstickenden Kuss erneut Besitz von ihrem Mund.
Sein Kuss spülte all ihre Gedanken fort. Schwindelig vom Alkohol und von ihrer Lust schwankte sie, als würde die Flut an ihren Knien zerren. Ihr Herz trommelte – hart, schnell, leichtsinnig. Sie stand in Flammen, fühlte sich lebendig, und ihr Mund war ebenso hungrig, ebenso gierig wie seiner.
Seine Haut war heiß, sein Körper gespannt wie eine Sehne. Sie wühlte sich unter sein Jackett, riss an seinem Hemd, verzweifelt entschlossen, so viele Empfindungen wie möglich zu sammeln, um sie in ihre langen, keuschen Nächte mitzunehmen. »Fass mich an«, verlangte sie.
Egal wo. Überall.
Und das tat er.
Seine Hände waren stark und schlank wie sein ganzer Körper; sie rieben sie durch das Kleid hindurch, umschlossen und liebkosten sie, bis der Stoff über ihre blanken Nerven scheuerte und ihre Knie zitterten. Er fuhr die Wölbung ihrer Brust nach und wog sie in seiner Hand, bevor er den Ausschnitt beiseitezog und sie der kühlen, feuchten Luft preisgab.
Sie hielt den Atem an, als sie sah, wie ihre bleiche Brust in seiner dunklen Hand lag, wie seine Finger den strammen Nippel liebkosten.
Sein Arm lag warm in ihrem Rücken. Er bog sie hintenüber und saugte heftig an ihr. Und sie explodierte – einfach so – in einer Reihe rasanter, luftiger Eruptionen. Der Orgasmus stieg in ihr nach oben wie die Luftbläschen in einem Sektglas.
»Oh.« O Gott.
Ihr Blut brodelte. Ihr Gesicht wurde heiß. Sie starrte hinab auf seinen dunklen Kopf, die Finger noch in sein Haar gekrallt, im Kopf ein einziges Durcheinander. Sie hatte doch noch nie … Sie konnte doch nicht einfach …
Sie schluckte angestrengt. Offenbar konnte sie doch. Und sie hatte.
»Okay.« Ihre Stimme klang irrwitzig heiter. »Das war ja …« Peinlich. »Schnell.«
Er ging vor ihr auf die Knie; seine Hände lagen hart auf ihren Hüften. »Ich bin noch nicht fertig mit dir.«
Oh. Regina presste die Oberschenkel zusammen. Oder versuchte es zumindest. Aber er war ihr im Weg. Sie musste ihm mitteilen – höflich –, dass sie sehr wohl fertig war.
Nicht, dass sie ihm nicht dankbar gewesen wäre. Er hatte ihr soeben den ersten Orgasmus seit Jahren beschert, für den ein Mann verantwortlich war. Sie war ihm etwas schuldig.
Er schob ihr Kleid nach oben. Sie erschauerte.
Wirklich, sie sollte jetzt etwas sagen.
Sein Haar streifte ihren Bauch, als er ihr den Slip herunterzog. Sein Atem war heiß, und sie wurde rot.
»Äh, hör zu, du brauchst nicht …«
Er begann, sie zwischen ihren Schenkeln zu lecken, und ihr Kopf wurde schlagartig leer. Sie sagte gar nichts mehr. Sie musste nichts mehr tun. Sie steckte zwischen seinen warmen, hartnäckigen Händen und seinem drängenden, geschickten Mund in der Falle. Er ließ nicht ab von ihr, während die Sterne über ihren Köpfen kreisten und das Meer flüsterte und die Felsen unter Reginas Füßen wankten. Sie reckte sich ihm entgegen, als sich der Druck in ihr aufbaute, als die Anspannung wuchs, bis sie es nicht mehr aushielt, bis sie sich drehte und wand, um ihm zu entfliehen, bis sie kam, immer und immer wieder, zwischen seinen Händen, an seinem Mund.
Sie war angenehm kraftlos und schlaff, als er von unten wieder auftauchte. Er atmete heftig, und seine Brust war warm und feucht. Sie spreizte ihre Finger auf seinem Hemd, an seinem trommelnden Herzen. Undeutlich nahm sie das Ratschen des Reißverschlusses wahr, und dann steckte er ihn dorthin, wo eben noch sein Mund gewesen war.
Sie dachte: O ja.
Und dann: O nein.
Und schließlich, als er dick und heiß in sie eindrang: O Scheiße.
Sie japste: »Stopp!«
Er zog sich zurück und stieß dann wieder in sie. »Nein.«
Sie biss sich auf die Lippen, um nicht zu schreien. Er fühlte sich so gut an, hart und gut, er füllte sie aus, weitete sie. Dort.
Sie schlug ihm im Takt seiner Stöße auf die Schulter. »Ich will nicht … du bist nicht … ich könnte schwanger werden!« Die letzten Worte waren nur noch ein Wimmern.
Er bog den Kopf zurück. Seine schwarzen Augen glänzten. »Na und?«
Sie schlug ihn wieder. »Raus aus mir!«
In einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung spürte sie, wie er sich aus ihr zurückzog.
Doch dann drehte er sie herum, so dass ihr Gesicht nun den Klippen zugewandt war, und packte sie bei den Hüften.
Sie stützte sich mit den Handflächen auf dem kalten, rauhen Fels ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Was tust du da?«
Dumme Frage. Sie fühlte, wie er, seine Erektion, sich an ihr rieb, sie von hinten bedrängte, feucht von ihr, und an der Spalte zwischen ihren Pobacken auf und ab glitt.
Sie erstarrte, ihr Mund wurde vor Panik und Aufregung trocken. »Äh … nein. Ich will nicht …«
Sein Arm lag hart um ihre Taille und seine Brust fest an ihrem Rücken. »Sei ruhig.«
Sie biss die Zähne zusammen. Okay, sie war ihm etwas schuldig. Aber doch nicht …
Seine Hand fuhr zwischen ihrer beider Körper und pumpte einmal, zweimal, bevor er ihre Hüften mit beiden Händen umspannte. Er rieb sich erneut an ihr, während seine Finger sich in ihr Fleisch krallten. Sie spürte sein Zucken, den heißen Stoß seines Atems an ihrem Ohr, und dann die warme Klebrigkeit an ihrem Steißbein.
Oh. Gott sei Dank hatte er ihn herausgezogen.
Er erschauerte. Sein Körper klebte warm und schwer an ihrem.
Eine sonderbare Zärtlichkeit rührte sich in ihrem Herzen. Sie nahm eine Hand vom Felsen und streckte den Arm nach hinten, um ihm über die Hüfte zu streicheln. Über den Oberschenkel. Sein Bein war muskulös und rauh von seiner Behaarung. Er wandte den Kopf und schnupperte an ihrem Haar, und diese unerwartete, süße Geste ließ etwas in ihrer Brust sich überschlagen.
Sie schloss die Augen und schob alle Gedanken beiseite.
Allmählich kühlte sich ihr Körper wieder ab. Sein Atem ging gleichmäßiger. Sie wurde sich winziger Empfindungen bewusst: der Kieselsteine unter ihren Füßen, des aufsteigenden Dampfes zwischen ihren Beinen, des satten, salzigen Geruchs von Meer und Sex …
Und dann ließ er sie los.
Sie hörte, wie er hinter ihr seine Kleidung richtete, und fröstelte. Plötzlich war ihr kalt.
»Du hast etwas verloren.« Seine Stimme war tief, höflich. Calebs Stimme.
Regina öffnete die Augen und lehnte die Stirn an den Felsen vor ihr. »Meine Selbstachtung?«
Er lachte nicht.
Okay, das war nicht witzig. Sie schluckte gegen die Enge in ihrer Kehle an, während die Ernüchterung über sie hinwegrollte wie die hereinkommende Flut. Das war überhaupt nicht witzig.
»Deinen Slip«, sagte er.
»Richtig.« Errötend drehte sie sich um. Da baumelte er von seinen Fingern herab. Sie riss ihm das Nichts aus Nylon aus der Hand, ohne ihn anzusehen. »Danke.«
Er neigte den Kopf. »Bitte.«
Wenn er jetzt grinste, würde sie ihn umbringen.
Aber er fuhr fort, sie mit einer nervtötenden Ausdruckslosigkeit zu betrachten, so als wäre er nie in ihr gewesen, so als hätten sie nie …
O Gott. Ihre Eingeweide krampften sich zusammen. Ihre Knie wurden weich. Nie im Leben würde sie ihren Slip unter diesem leeren schwarzen Blick anziehen.
Regina zerknüllte den feuchten Fetzen in ihrer Faust. Und jetzt?
»Gehst du auf die Party zurück?«, fragte sie.
»Ich habe keinen Grund dazu.«
Richtig.
Regina biss sich erleichtert und enttäuscht zugleich auf die Lippen. »Du könntest dich verabschieden.«
Nicht von ihr. Es war ihr egal, wenn sie ihn niemals wiedersah.
Er zuckte unter seinem gut geschnittenen Jackett mit den Schultern. »Margred wird es gar nicht registrieren, wenn ich gehe.«
»Dein Bruder schon.«
Dylans schwarze Augen glitzerten. »Ich bin nicht wegen meines Bruders hergekommen.«
Ein peinliches Schweigen senkte sich zwischen sie, durchbrochen nur vom Flüstern des Wassers auf den Felsen und dem Klirren und Klicken der Steine wie bei einem Windspiel. Musikklänge wehten vom Zelt herüber, zu leise, als dass Regina Worte oder eine Melodie hätte heraushören können. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, irgendetwas. Das hat Spaß gemacht. Lass es uns nie wieder tun.
»Du hast Maggie gekannt?«, fragte sie stattdessen. »Vor ihrer Hochzeit?«
»Ja.«
Regina hielt den Atem an. Nicht ihr Problem, ermahnte sie sich. Das ging sie nichts an.
Aber Margred war ihre Angestellte. Regina hatte ihr Arbeit gegeben, nachdem Caleb sie am Strand aufgegabelt hatte, nackt und blutend von einem Schlag auf den Kopf. Margred behauptete, sich an nichts aus ihrem Leben vor ihrer Ankunft auf der Insel zu erinnern. Regina hatte immer geargwöhnt, dass die Frau einer Missbrauchsbeziehung entfliehen wollte.
Aber wenn Dylan sie kannte …
Regina sah ihn finster an. »Woher?«
Er hob die Augenbrauen. »Ich schlage vor, dass du das sie fragst.«
»Das werde ich.«
Sobald sie aus den Flitterwochen mit deinem Bruder zurück ist.
Vielleicht aber auch nicht.
»Du könntest es mir aber auch gleich erzählen«, schlug sie vor.
»Nein.«
Sie verschränkte die Arme, den zusammengeknüllten Slip noch immer in der Hand. »Bist du immer so gesprächig nach dem Sex? Oder liegt es an mir?«
»Vielleicht mag ich ja keinen Klatsch.«
»Oder vielleicht willst du auch jemanden schützen.«
Er antwortete nicht.
»Sie?«, riet Regina. »Oder dich selbst?«
Menschenfrauen.
Immer wollten sie etwas.
Dylan betrachtete diese hier mit frustrierter Resignation. Ihm hatte ihr Aussehen gefallen, das glatte, kurz geschnittene Haar, die hagere Figur, der Kontrast ihrer weichen, sensiblen Lippen zu diesem scharfkantigen Gesicht. Ihre Andersartigkeit zog ihn an, all diese Spannung und Energie eingesperrt in einem straffen, kleinen Frauenkörper. Er hatte es genossen, sie auszuziehen und dabei zuzusehen, wie sie zu den Sternen flog.
Aber ihre großen dunklen Augen waren nun zu scharfen Dolchen geworden, und sie reckte streitlustig das Kinn. Jetzt, da er sie gehabt hatte, dachte sie wohl, dass er ihr etwas schuldig war – Aufmerksamkeit, Antworten, irgendetwas in dieser Art.
Offenbar doch nicht so anders als die anderen. Er nahm an, dass ihre Haltung nur allzu menschlich war.
Nur schade für sie, dass er es nicht war.
»Ich bringe dich zurück«, wich er aus. »Du hast sicher noch Arbeit.«
Sie reckte das Kinn noch ein wenig höher. »Du brauchst mich nirgendwohin zu bringen. Ich kann allein hingehen, wo ich eben hingehe.«
Fast amüsiert trat er zurück, um sie vorbeizulassen. Sie lief zum Ufer hinunter und blieb stehen.
Natürlich. Sie konnte im Dunkeln nichts sehen. Dylan erinnerte sich noch daran, wie es gewesen war, bevor er sich zum ersten Mal verwandelt hatte. Diese Felsen würden ihre schmalen Menschenfüße aufschlitzen.
Sie ging langsam weiter.
Er runzelte die Stirn. Er würde weder den Atem noch die Mühe vergeuden, mit ihr zu diskutieren. Aber er konnte auch nicht danebenstehen, während sie sich beim Herumstolpern in der Brandung die Füße zerschnitt.
Während er sich noch für seine Fürsorge verspottete, ging er zu ihr und hob sie hoch.
Regina schrie erschrocken auf und zuckte zusammen. Ihr Kopf stieß an sein Kinn, so dass seine Zähne laut aufeinanderschlugen. Schmerz schoss durch seine untere Gesichtshälfte.
Er öffnete den Mund und knurrte: »Halt still.«
Sie funkelte ihn an, ihre Nase nur Zentimeter von seiner entfernt. Ihr Haar lag weich an seiner Wange und roch nach Früchten, Erdbeeren oder …
»Du hast mich erschreckt«, beschwerte sie sich.
»Ich erschrecke selbst vor mir«, murmelte er.
»Was ist los? Hast du noch nie ein Mädchen auf Händen getragen?«
»Meistens muss ich das nicht.« Aprikosen, entschied er. Sie roch nach Aprikosen, Torte und Reife. Sie war schwerer, als er in Erinnerung hatte; Muskeln umhüllten einen elastischen Rahmen aus Stahl. Die Haut in ihren Kniekehlen war weich und glatt. Um Distanz herzustellen, um sie zu ärgern, sagte er: »Meistens legen sie sich gleich hin.«
Ihr Lächeln leuchtete messerscharf im Halbdunkel. »Das erklärt, warum du noch an deiner Technik feilen solltest.«
Er lachte leise. »Und du?«
Wasser schwappte um seine Knöchel.
Ihr Griff um seinen Nacken wurde fester. »Was ist mit mir?«
»Lässt du dich oft – äh – auf Händen tragen?«
»Willst du wissen, ob ich leicht zu haben bin?«
Er wusste nicht, was er wissen wollte. Oder warum. »Deine sexuellen Gewohnheiten interessieren mich nicht.«
Sie schnaubte. »Offenbar. Sonst hättest du ein Kondom benutzt.«
In Wahrheit war es ebenso wenig wahrscheinlich, dass sie ihn mit einer Krankheit ansteckte, wie dass er sie schwängerte. Aber Dylan hatte keine Lust, ihr das zu erklären. Sie hätte ihm nicht geglaubt.
Er verließ das Wasser und setzte sie am Strand ab. Solange sie noch um Gleichgewicht rang, ließ er seine Hände auf ihren Unterarmen ruhen.
Sie seufzte. »Hör zu. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist der Erste seit … langer Zeit.«
Er spürte einen Stich, den ihm Befriedigung und schlechtes Gewissen versetzten, und sein Blick verfinsterte sich. Er hätte gar nichts fühlen sollen. Seinesgleichen tat das nicht. Sie begehrten die Empfindungen und die körperliche Erleichterung, die Sex ihnen verschaffte. Aber sie banden sich nicht durch Gefühle, und sie banden auch ihre Partner nicht an Erwartungen.
»Deine Schuhe.« Er wies mit dem Kopf darauf.
Sie lagen auf der Seite, dort, wo das Wasser sie gerade nicht mehr erreichen konnte. Die koketten Absätze und dünnen Riemchen wirkten auf diesem felsigen und sandigen Untergrund vollkommen deplaziert.
»Richtig.« Sie hob sie auf. »Danke.«
»Bitte.« Sein Blick begegnete dem ihren, der ebenso warm wie wachsam war, und er spürte, wie sich Hitze in seinem Bauch sammelte. Er wollte sie schon wieder. Aber dieser Anflug von Gefühl hatte ihn alarmiert.
Er hätte eigentlich mittlerweile wissen sollen, dass man besser nicht mit Menschen vögelte.
Er war ja fast einer von ihnen.
Diese Menschenfrau hier war nicht einmal so gut gewesen, redete er sich ein, während er die Heftigkeit ihrer Reaktion auf ihn und seine eigene Befriedigung, es ihr besorgt zu haben, geflissentlich ignorierte. Oh, nach menschlichen Maßstäben war sie durchaus akzeptabel. Doch er war an Partnerinnen gewöhnt, die wussten, wie er ihnen zu Diensten sein konnte und wie sie ihn beglücken konnten. Er war vierzehn gewesen und hatte um seine Mutter getrauert, als er seine erste Geliebte hatte – eine üppige Selkie, die tausend Jahre geübt und an ihren Fertigkeiten und an ihrer Wolllust gefeilt hatte. Nerienne war ganz anders gewesen als diese zickige, streitsüchtige Menschenfrau.
Ihre Worte pochten in seinen Schläfen: »Du bist der Erste seit … langer Zeit.«
In seiner Brust wurde es eng.
Die Luft war so warm. Warm und schwül. Sie zerrte an ihm wie ein Fischernetz, presste seine Lungen zusammen, drückte ihm die Luft ab. Er konnte kaum noch atmen. Er wollte einfach nur weg, weg und in die Freiheit der See zurückkehren.
Er stand unbewegt bei den Klippen, während die Frau – Regina – an ihren Sandalen nestelte.
»Okay.« Sie richtete sich wieder auf und durchbohrte ihn mit einem breiten Lächeln. »Dann noch eine schöne Zeit auf der Insel.«
»Ich gehe noch heute Nacht.«
Ihr Lächeln wurde unsicher, erstarrte. »Oh. Dann werden wir uns wohl nicht wiedersehen.«
Ihr beiläufiger Klaps auf seinen Oberschenkel, diese unbekümmerte Berührung, versengte ihn wie ein Brandzeichen. Die Mer berührten sich nicht. Nur im Kampf oder bei der Paarung.
Seine Hände ballten sich zu Fäusten.
»Nein«, erwiderte er.
Sie drehte sich ohne ein weiteres Wort um.
Er stand regungslos da, während sie den Strand entlangstöckelte, auf die Lichter und die Musik zu, und ihn allein ließ.
3
Der Turm von Caer Subai, geschaffen aus Nebel und Magie, war sehr alt. Doch der Prinz war noch älter und müde von der Last der Jahre und der Verantwortung. Solange er sich in diesem Turm auf der Selkie-Insel Sanctuary aufhielt, alterte er allerdings nicht. Er würde nicht sterben.
Conn ap Llyr, Prinz der Mer, Herr über die See, blickte gen Westen aus seinen Fenstern und lauschte dem Lied des Meeres, das von den Felsen unter ihm aufstieg, und dem Nordwind, der sich, schneidend wie ein Messer, durch die Mauerritzen stahl. Er konnte die Anwesenheit des Dämons spüren, auch wenn er eine halbe Welt entfernt war, wabernd wie ein Ölteppich, der dunkel und zerstörerisch an die Gestade der Insel schwappte, die die Menschen World’s End nannten.
Conn scherte sich einen Dreck darum, ob die Menschen von Dämonen überrannt wurden und ihre Insel im Meer versank. Seit Jahrtausenden hielten die Kinder der See einen unsicheren Frieden mit den Dämonen, einen Frieden, der nichts mit Stolz und eigenen Interessen zu tun hatte, der ein Konstrukt aus Kompromissen und gebrochenen Versprechen war und trotz jahrhundertelanger Verstöße und Übergriffe verteidigt wurde. Einen Frieden, von dem er glaubte, dass er von Bestand sein würde.
Bis vor sechs Wochen, als ein Dämon eine aus Conns Volk auf World’s End ermordet hatte.
Er klammerte sich an die Kante seines Schreibtischs, eines massiven Möbelstücks aus Eisen und geschnitztem Walnussholz. Es war aus einer spanischen Galeone geborgen worden, die vor der Küste von Cornwall Schiffbruch erlitten hatte. Alles, was über und in der See war, alles, was darin unterging, konnte er für sich beanspruchen oder beseitigen. Neun Zehntel der Erde waren sein Reich. Und doch war ihm der Dämon entkommen.
Seine Gedanken wandten sich nach draußen; strudelnd, kreisend in der Dunkelheit, gingen sie auf die Suche nach deren Quelle, nach deren Gefahren. Ebenso gut hätte er versuchen können, einen einzelnen Tropfen in einem Fluss aufzuspüren. Der Dämon entzog sich seinem Zugriff und versteckte sich in der bewegten Flut der Menschen.
Conn senkte den Kopf, den bitteren Geschmack des eigenen Versagens im Mund. Der Hund, der zu seinen Füßen schlief, zuckte zusammen und winselte. Jenseits der Turmfenster lag die leuchtende See, wild, weit und tief, außerhalb seiner Reichweite, seiner Herrschaft spottend.
Es hatte eine Zeit gegeben – die Wale sangen noch heute davon –, in der die Macht der Meeresherren kaum Grenzen kannte, in der die Mer mit jedem Geschöpf auf und in der See im Einklang lebten, in der sie Gletscher herbeirufen oder in einen Regenschauer gehüllt an andere Orte reisen konnten. Sogar Conns eigener Vater, Llyr, hatte, bevor er die menschliche Gestalt und jede Verantwortung ablegte …
Aber Conn war nicht fähig, ohne Wut an den abtrünnigen König zu denken, und Wut war noch etwas, das sich zu versagen er gelernt hatte. Bedächtig öffnete er die geballten Fäuste und legte sie auf die Landkarte auf seinem Schreibtisch.
In den letzten Jahrhunderten waren die Kräfte des Meereskönigs in gleichem Maße geschwunden wie die Zahl seiner Untertanen. Dem Erben des Meereskönigs blieb nur noch zu tun, das zu schützen, was noch übrig war, mit allem, dessen er habhaft werden konnte.
Schritte wurden auf der Turmtreppe laut.
Conn blickte auf, als Dylan von unten auftauchte. Sein Kopf stieß fast an das Gewölbe aus roh behauenen Steinen.
Hier war ein Werkzeug. Oder eher eine Waffe. Dylan war ehrgeizig und listenreich, ein Sohn der Meereshexe Atargatis und ihres menschlichen Ehemannes. Nach ihrem Tod hatte Conn den Jungen unter seine Fittiche genommen. Dylan musste trotzdem erst noch beweisen, was außer den Kräften, die jeder Selkie besaß – sexuelle Verführungskunst und ein wenig Wetterzauber –, in ihm steckte. Aber er hatte bereits seinen Mut und seine Loyalität demonstriert; und in der augenblicklichen Lage musste sich Conn ohnehin dessen bedienen, was zur Hand war.
»Ihr habt nach mir schicken lassen, Lord?«, fragte Dylan.
»Ja«, antwortete er knapp. Er milderte seinen Tonfall. »Ich muss dir etwas zeigen.«
Dylans Blick flog über die Karte, die den gesamten Schreibtisch bedeckte. »Seit wann sind wir auf die Landkarten der Menschen angewiesen?«
»Sie dient meinen Zwecken«, erwiderte Conn.
»Die da wären?«
Statt einer Antwort spreizte Conn die Hände auf dem Schreibtisch. Er bündelte seine Gabe und fügte das, was er mit ihrer Hilfe aufspürte, den Informationen hinzu, die bereits in der Karte enthalten waren. Allmählich füllte sie sich mit Leben; Farben wurden sichtbar wie Sterne am Nachthimmel und bildeten Streifen und Trauben aus Licht.
Dylans Augenbrauen zuckten nach oben. »Beeindruckend. Was ist das?«
Conn ballte die Fäuste, ohne auf die schwachen Kopfschmerzen zu achten, die sich bei der Ausübung von Magie stets bei ihm einstellten. Die Landkarte pulsierte vor Farben. »Grau« – ganze Schwaden von Grau – »markiert menschliche Siedlungen. Blau steht für unser Volk.«
Ein paar tausend verstreute blaue Lichtpunkte – zu wenige – gingen fast in der Weite der Meere verloren.