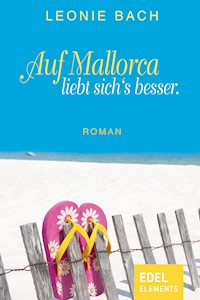Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Gestatten? Ich bin ein Miststück! Das Einzige, woran ich glaube, ist ein Kontostand mit mindestens vier Nullen am Ende und einem Plus am Anfang. Dafür würde ich sogar heiraten. Wenn man die Ehe wie ein Geschäft betrachtet, hat sie Erfolgsaussichten." Die luxusverliebte Beatrice reist zwecks erfolgversprechender Eheschließung nach Fuerteventura. Dort will sie sich – trotz alller Bedenken ihrer Freundin Verena – einen heiratswilligen Millionär angeln. Bald schon laufen die Hochzeitsvorbereitungenauf Hochtouren, und alles scheint nach Plan zu laufen. Zunächst... Die ideale Pool- und Strandlektüre – nicht nur für den Fuerteventura-Urlaub!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonie Bach
Fiesta Fatal
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1996 by Leonie Bach
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-157-6
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1. Kapitel
Nur noch zwei Tage, dann bin ich erlöst. Verena trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und schaute aus dem Küchenfenster des Pförtnerhäuschens in den weitläufigen alten Park. Draußen spendeten ausladende Buchen freundliche Schatten an diesem ersten heißen Julitag.
Ein künstlicher See glitzerte in der Sonne, ein Schwanenpärchen zog darauf gemächlich seine Bahnen und verschwand im Schilf. Weiter hinten schimmerte durch das Blattgewölbe eines Wäldchens weiß die Villa der Gablers und erinnerte mit ihren Türmchen, Dachzinnen und Erkern an ein verwunschenes Schloss.
Der Erbauer, ein Sektfabrikant, hatte um neunzehnhundert ganz à la mode im neogotischen Fantasiestil geschwelgt und wahrscheinlich zu viele Dornröschenillustrationen studiert.
Mitte der sechziger Jahre hatte der sehr erfolgreiche Immobilienhändler Randolf Gabler die damals verwaiste, heruntergekommene Villa zu einem günstigen Preis erworben und in ein Prachtanwesen zurückverwandelt, das seinen Bedürfnissen nach Repräsentation und den etwas albernen Prinzessinnenträumen seiner entschieden jüngeren Ehefrau Katharina genügte.
Heute war der Besitz Millionen wert, da er nur knapp vierzig Autominuten von zwei Großstädten entfernt lag. Randolf Gabler war immer ein Mann mit Weitsicht und Geschäftsinstinkt gewesen. Bis zu seinem Tod vor zwei Jahren hatte der ehemalige Botenjunge einer Bank ein Millionenvermögen angehäuft.
Nur noch zwei Tage, sagte sich Verena, dann kann ich endlich wieder zu mir nach Hause. Seufzend ließ sie das Spülwasser ablaufen, öffnete das Fenster und atmete den kühlen Duft der Teerosen ein, die ihre Mutter vor dem Fenster gepflanzt hatte. Jeder Außenstehende hätte sich verwundert gefragt, warum sie sich so dringlich aus diesem Paradies fortwünschte.
Das Haus, in dem sie sich aufhielt, hatte seinen eigenen, ein wenig englischen Scharm. Es war im Cottage-Stil gebaut und vergleichsweise geräumig mit seiner ersten Etage, dem ausgebauten Spitzdach, seinen fünf Zimmern und der Wohnküche mit Parkblick.
Verenas Mutter – Gisela Malchow – hatte es liebevoll mit alten Möbeln eingerichtet, angeschlagenen Biedermeierstühlen oder zerkratzten Jugendstilschränken etwa, die »im Haupthaus« – so nannte sie die Villa – nicht mehr gebraucht wurden oder die Katharina Gabler zu schäbig fand.
Verena wrang ein Schwammtuch so kräftig aus, als wolle sie es erwürgen, und wienerte verbissen die Stahlspüle und den leicht wackligen Küchentisch. Auch der war angeschlagen und zu schäbig für die Gablers gewesen. Aber selbstverständlich noch lange gut genug, nein, fast zu gut gewesen für Gisela Malchow und ihre kleine Tochter Verena, die den Tisch als Teenager übrigens mit viel Geschick und Sorgfalt wieder hergerichtet hatte. Sie hatte es satt gehabt, dass alles im Haus nach secondhand aussah.
Diese frühe, handwerkliche Begeisterung war ein erster Hinweis auf Verenas spätere Leidenschaft gewesen, die Kunst und vor allem die Bildhauerei, die neben ihrem Job als Köchin einer Szenekneipe inzwischen ihr Lebensinhalt war, auch wenn sie davon nicht leben konnte.
Nur noch zwei Tage, dann wäre sie zurück in ihrer winzigen Dachatelierwohnung, weit weg von den zweifelhaften Wohltaten der Gablers und dem Gefühl hilfloser Minderwertigkeit.
So war es immer und mit allem gewesen. Sie und ihre Mutter hatten sozusagen im Schatten eines Schlosses ein ganzes Leben aus zweiter Hand geführt, in der zweiten Reihe und – so empfand es Verena – als eindeutig zweitklassige Wesen.
Es war nicht so, dass sie die Umgebung, die Möbel oder die abgelegten Modellkleidchen der ein Jahr älteren Gablertochter Beatrice verabscheut hätte. Was sie gehasst hatte und immer noch hasste, waren die Demut und unerschütterliche Dankbarkeit, die ihre Mutter für jede noch so kleine Gefälligkeit seitens der Gablers zeigte, und die Selbstverständlichkeit mit der die Gablerfrauen die ungewöhnliche Dienstbarkeit der Mutter genossen.
So als sei Gisela Malchow ein Wesen ohne eigene Geschichte, Wünsche und Lebensziele, außer dem, die Gablers so umfassend wie möglich zu verwöhnen, zu bedienen und zu bewundern.
Vierunddreißig Jahre lang, seit Verenas Geburt, war Gisela Malchow die Haushälterin der Familie Gabler, rund um die Uhr, die ganze Woche – bis auf einen freien Donnerstag, den sie stets außer Hause verbracht hatte. Wo, das wusste bis heute nicht einmal Verena. Vielleicht hatte die Mutter sich einen Liebhaber gegönnt oder gelegentliche Flirts, es war zu hoffen. Die Donnerstage waren das einzige Geheimnis, die einzige Freiheit, die Gisela Malchow ein Leben lang genossen hatte.
Ansonsten war sie wie ein Wesen aus einer anderen Epoche oder einem Roman von Courths-Mahler: immer bescheiden, freundlich, selbstlos, stets abrufbar. Und genau diese Verhaltensweisen hatte sie gegenüber den Gablers auch im Verhalten ihrer Tochter Verena gefördert und geschätzt.
Was zählte, waren die Bedürfnisse der Gablers – nicht die eigenen. Und zu allem Überfluss hatte die Mutter die kleine Verena stets als Inbegriff der Vernunft dargestellt, ein Mädchen, das freiwillig und aus Einsicht seine Rolle annahm, eine Rolle, die Verena gehasst hatte, genau wie das Gefühl ständiger Zurücksetzung. Aber wie sich dagegen wehren, wenn man seine Mutter liebte?
Sie ist eine geborene Dienstmagd, dachte Verena bitter, warf den Lappen in die Spüle und biss sich auf die Lippen. Sie schämte sich, so von ihrer Mutter zu denken, denn tatsächlich war die vor allem der hilfsbereiteste Mensch, den sie kannte. Aber – verflucht nochmal – auch der unterwürfigste.
Und das nur, weil Katharina Gabler ihr einmal, ein einziges Mal im Leben wirklich geholfen hatte. Wahrscheinlich aus einer sozialen Laune heraus, ihrem Helferknall, wie Verena es nannte, der die kokette Millionärsgattin von Zeit zu Zeit überfiel wie ein heftiges Fieber und ebenso schnell wieder nachließ.
Aus einer Laune heraus konnte Katharina Gabler zum Weihnachtsessen vier Obdachlose in die Villa mitbringen. – »Ich habe sie vor dem Feinkostgeschäft entdeckt, es ist doch Weihnachten! Unerträglich und sehen sie nicht malerisch aus?«
Sie würde ihre Findlinge drei Tage mit Lachs und Kaviar verköstigen, mit scheußlichen selbst gemalten Seidenkrawatten beschenken, um sie dann allmählich in Richtung ihrer Haushälterin Gisela Malchow zu entsorgen: »Die hat bestimmt was Sinnvolles für Sie zu tun, meine Herren. Faulenzen allein bringt schließlich niemanden im Leben weiter, oder glauben Sie, dass wir unsere Villa mit Nichtstun erworben haben?«
Nur ausgesprochen selten zeigten die so behandelten Herren jene Dankbarkeit, die Katharina Gabler von ihrer »lieben, einzigen Gisi« – so nannte sie Gisela Malchow – gewohnt war, und bestärkten die Villenbesitzerin in ihrem wohligen Gefühl, »zu weichherzig für diese Welt« zu sein, in der eben nur nach oben kam, »wer sich wirklich anstrengt und hart gegen sich selbst ist«. So wie ihr Mann.
Dass ihre – Katharina Gablers – einzige Lebensanstrengung in der Heirat Randolf Gablers bestanden hatte, vergass die Dame des Hauses geflissentlich. Es gab auch niemanden, der sie daran erinnerte.
»Die Gablers sind zu reich für unangenehme Wahrheiten«, teilte Verena dem Küchentisch mit, »und darum umso aufgeblasener und widerwärtiger.«
»Du bist ungerecht«, meldete sich in Verenas Kopf die sanfte Stimme ihrer Mutter, »mir hat Katharina Gabler damals wirklich geholfen. Wo sollte ich denn hin? Zurück ins Dorf? Unmöglich. Mit einem unehelichen Kind hätte ich dort in den frühen Sechzigern immer noch als Hure gegolten. Ich wäre erledigt gewesen. Der Mann ...«, sie sagte immer nur »der Mann«, wenn sie von Verenas Erzeuger sprach, »der Mann wollte von uns nichts wissen. Ich war sechsundzwanzig Jahre, hatte keinen Pfennig, nichts gelernt und hätte dich ins Waisenhaus geben müssen, wenn die Gablers mir nicht dieses wundervolle Häuschen und diese schöne Stelle als Wirtschafterin angeboten hätten.«
Ja, und die Stelle als Kindermädchen, als Köchin, als Putzhilfe, als Aufsicht für die Bauarbeiter in der Villa, als seelischer Müllabladeplatz, als ...
Eine fröhliche, warme Stimme riss Verena aus ihren düsteren Gedanken. »Liebling?«
Verena drehte sich um. In der Küchentür stand ihre Mutter und entsprach nur sehr entfernt dem Bild der überarbeiteten, ausgemergelten, verachteten Sklavin, das Verena soeben gezeichnet hatte.
Irgendwie machte das die Sache noch ärgerlicher. Gertenschlank, elastisch in ihren Bewegungen und gesegnet mit einem mädchenhaften, sanften Gesicht strahlte Gisela Malchow trotz ihrer sechzig Jahre Vitalität und fast jugendliche Lebenskraft aus. Nur wer genau hinsah, konnte hinter dem Bild unverbrauchter Fröhlichkeit die Zeichen ständiger Anspannung erkennen.
Disziplin und Verschwiegenheit waren die zweite Natur Gisela Malchows und Munterkeit ihre schützende Lebensmaske. Verena erkannte dahinter sehr wohl die Zeichen von Ermüdung und sorgsam unterdrückter Enttäuschungen. Ansprechen durfte sie ihre Mutter darauf nicht. Überhaupt waren kompliziertere Gefühlsangelegenheiten nie ein Gesprächsthema zwischen ihnen gewesen.
»Liebling«, sagte Gisela Malchow, während sie eine Hand voll abgezupfter, welker Rosenblätter in den Abfalleimer warf, »wärst du so lieb und würdest du zu den Gablers hinübergehen? Eben wurde eine riesige Auswahl Hochzeitsschuhe angeliefert, und Beatrice kann sich einfach nicht entscheiden. Du weißt ja, wie sie ist. Dabei muss in drei Wochen alles für die große Reise parat sein. Meine Güte, eine Hochzeit auf Fuerteventura!«
Sie wischte sich kurz über die Stirn, als helfe diese Geste, einen Anflug von Müdigkeit zu vertreiben, dann fuhr sie fort:
»Frau Gabler hat heute Morgen einfach nicht den Nerv dafür, und ich muss dringend in die Stadt, um ihr etwas aus der Apotheke zu holen, bevor ich das Mittagessen vorbereite. Danach muss ich noch mit dem Hotel auf Fuerte verhandeln, wegen des Empfangs, der Gästeliste, den Zimmerreservierungen und ...«
Die Mutter hielt inne, um Atem zu schöpfen. Sie sollte sich regelmäßigere Pausen gönnen! Nur wann?
»Du musst dich darum kümmern? Du?«, fragte indessen Verena, bemüht, nicht allzu empört zu klingen.
»Na ja, du weißt schon, früher hat so etwas immer das Büro von Herrn Gabler gemacht, aber jetzt, wo die Firma endgültig aufgelöst ist ...«
Verena explodierte. »Meine Güte. Katharina Gabler könnte sich mit ihrem Erbe doch ein Heer von professionellen Hochzeitsberatern, Sekretären und Personal für so etwas leisten. Die ganze Heirat ist ohnehin eine Art geschäftliche Transaktion: Immobilienerbin heiratet künftigen Erben einer Baufirma. Warum musst da ausgerechnet du dich um die Hochzeit von Beatrice kümmern? Noch dazu, wenn die Hochzeit in einem Hotel stattfindet, dass der Herr Bräutigam, dieser siebengescheite Designer, dieser ...«
»Daniel Derndorfer.«
»Von mir aus Daniel Düsentrieb. Jedenfalls hat der doch soeben auf Kosten seiner Tante das Hotel entworfen und fertig stellen lassen. Der ist auf Fuerte und kann sein Personal wohl selber rumscheuchen, oder ist er dafür zu fein?«
Gisela Malchow hob bekümmert die Brauen und versuchte, ihre Tochter zu besänftigen. »Du bist sehr ungerecht, Liebling. Hast du Daniel denn überhaupt kennen gelernt? Du weißt schon, er war zum Sommerfest hier, im vorigen Jahr, da hat auch seine Romanze mit Beatrice begonnen. Eine glückliche Fügung, er ist genau der Mann, den Beatrice braucht, einfühlsam, ruhig, kein Hallodri wie ihre anderen Bekannten. Was war das für ein wundervoller Abend, die Lampions in den Bäumen, die Wärme, die Musik. Oft wollen Menschen die Romantik erzwingen, aber diesen Abend durchzog sie wie ein Duft.«
Verena schüttelte energisch den Kopf, sie wollte nicht an die Lampions und die Musik denken oder etwa an die romantische Stimmung, in die sie damals versetzt wurde. Übrigens ein weiterer Grund, sich hier wegzuwünschen. Schließlich war es mit der Romantik auch nicht weit her gewesen. Verfluchte Villa, verfluchte Gablers. Das hier war kein Paradies – nicht für sie, die Tochter der Haushälterin. Voll unterdrücktem Ärger in der Stimme antwortete sie ihrer Mutter.
»Nein, ich habe Beatrices Verlobten nicht kennen gelernt. Wenn du dich erinnerst, musste ich mich um die verpatzten Häppchen vom Partyservice kümmern und die Aushilfsköchin spielen, die aus billigen Scampi und Kühlschrankresten eine repräsentative Delikatesse zaubert.«
»Ach, die Geschichte. Es tut mir wirklich Leid, irgendwie scheinen deine Ferien hier immer auf Arbeit hinauszulaufen. Wirklich, es tut mir Leid, aber als Köchin bist du einfach göttlich.«
»Ich bin Künstlerin, Mama, Köchin ist nur mein Zweitjob.«
Gisela Malchow legte ihrer Tochter beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Du hast ja Recht. Ein weniger vernünftiges und liebes Kind als du würde diesen Ort schon lange meiden. Ich sollte dich nicht immer wieder mit meinen Problemen behelligen.«
»Du solltest dich vor allem einmal ausruhen«, sagte Verena schroff, aber herzlich.
Gisela Malchow begann den bereits sauberen Tisch zu polieren, Kummerfalten gruben sich in ihre Mundwinkel.
Die gehörten nicht dorthin, fand Verena und schämte sich. So ging es ihr immer, wenn sie einen ihrer ehrlichen Ausbrüche gehabt hatte. Sie wollte am liebsten sofort alles zurücknehmen und griff zur nächstbesten Notlüge, um die Harmonie wieder herzustellen.
Deshalb zuckte sie jetzt mit den Achseln und meinte obenhin: »Lass mal, es war halb so schlimm für mich auf dem Sommerfest. Mir ist es am liebsten, wenn ich hier etwas zu tun habe.«
In diesem Fall war die Häppchenpanne tatsächlich ziemlich hilfreich gewesen, um den umwerfend aussehenden Fabian im Rahmen der romantischen Sommernacht kennen zu lernen. Fabian Seiler, TV-Star, gefährlich sexy und einem Flirt mit der Kaltmamsell wider Willen nicht abgeneigt.
»Denn«, so hatte er verschwörerisch grinsend Wilhelm Busch zitiert, »ich hab nun mal – es ist fatal – einen Hang zum Küchenpersonal. Im Ernst, ich hasse dieses überkandidelte Jetset-Pack, diese Gucci-Trullas und Börsen-Blödianer. Frauen wie Sie sind mir lieber. Kennen Sie hier einen Ort, an dem wir ungestört etwas trinken und uns unterhalten können? Ich habe einen Mordstag hinter mir. Und Sie wohl auch? Ich meine nicht als Köchin, sie sehen irgendwie nach mehr aus, nach etwas wirklich Interessantem.«
Versonnen ließ Verena ihren Blick jetzt aus dem Küchenfenster schweifen, hinter dem See stand ein Badehäuschen, ein sehr idyllischer Ort, wenn man ein stilles Fleckchen weit weg von einem Sommerfest suchte.
Schade nur, dass Fabian wohl kein Mann für feste Bindungen war, dass er etwas zu viel getrunken hatte, und ... ihr ehrliches Ich gewann die Überhand: »Dass du einen Hang zu deplatzierter, überschwänglicher Romantik hast, wenn es um Männer geht. Ganz wie deine Mutter damals, als sie sich mit diesem Halunken von deinem Vater eingelassen hat, nicht wahr? Im Namen der Liebe bist du immer auf der Suche nach dem größten Taugenichts«, meldete sich ein teuflisches Stimmchen in Verena zu Wort.
Sie seufzte, es hatte lange geschwiegen, sie hatte ihm seit Fabian keinen Grund zur Einmischung gegeben. Aber jetzt war es wieder da – ihr persönliches Teufelchen – und putzmunter. Es passte hierher, in diese verhasste, trügerische Umgebung.
»Ist was mit dir Schatz?«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter, die inzwischen den Spülstein nachreinigte.
Verena schüttelte den Kopf. »Nein, ich war nur in Gedanken.«
»Jaaa, bei Fabian, dem Schurken, der sich von rohen Frauenherzen nährt oder in deinem Fall doch lieber von Scampi.«
Das Teufelchen musste Amors direkter Gegenspieler sein. Es ketzerte stets los, wenn es um Verenas Liebesversuche ging.
Aber, verteidigte sie sich matt, diesmal war es doch anders gewesen. Diesmal hatte der Mann sie angesprochen, sie geradezu verfolgt, nicht sie ihn. Sie hatte alle Hände voll damit zu tun gehabt, gebratene Scampi auf Spießchen zu stecken und nicht etwa Männerherzen zu durchbohren. Und schlussendlich war es nicht einmal zum Sex gekommen, darauf hatte er es also nicht angelegt gehabt, eine schnelle Nummer und ...
»Er war einfach zu betrunken«, erinnerte sie prompt das Teufelchen.
Gisela Malchow legte den Putzlappen zur Seite und rettete ihre Tochter vor weiteren diabolischen Kommentaren.
»Ganz ehrlich, Liebling, dieser Daniel Derndorfer ist wirklich ein reizender Mann.«
»Wer?«
»Na der Verlobte von Beatrice! Wo bist du nur mit deinen Gedanken. Er scheint auf Fuerte noch sehr viel zu tun zu haben. Zu viel, um sich um die Hochzeit zu kümmern. Deshalb springe ich eben ein. So ein Hotelbau ist doch nie ganz beendet, da gibt es noch tausende Kleinigkeiten, um die er sich ...«
Ärgerlich blickte Verena auf. Dämlicher Daniel, was gingen der oder die Hochzeit sie an, und warum ließ ihre Mutter sich wieder so ausbeuten? »Sollst du beim Hotelbau vielleicht auch noch zur Hand gehen? Ein bisschen Beton mischen, die Maurerkelle schwingen?«
»Ach Schatz, was für ein Unsinn. Es geht nur um die Hochzeit, und du weißt doch, wie die Gablerfrauen sind. Sie haben hohe Ansprüche ...«
»Vor allem an dich, oder?«
»Sie haben sich eben an mich gewöhnt, andere Menschen machen sie nervös, und nach allem, was die Gablers für uns getan haben, oh, bitte, guck nicht so vorwurfsvoll. Es macht mir Freude, wenn ich gebraucht werde, egal wie viel Arbeit es bedeutet. Das hält mich jung und gesund.«
Das Gesicht der Mutter bekam einen flehenden Ausdruck, der zu sagen schien: »Mach du mir bitte nicht auch noch Kummer.«
Verena schloss die Augen. Sie hasste diesen Gesichtsausdruck, sie kannte ihn seit ihrer frühesten Kindheit, er machte sie stumm. Wenn ihre Mutter sie geohrfeigt, sie ausgeschimpft hätte, aber dieser leidende Gesichtsausdruck ...
Nein, sie wollte keinen Streit, keine Leidensmiene, nicht in den wenigen Wochen im Jahr, in denen sie ihre Mutter hier besuchte.
Verflucht, es waren doch nur noch zwei Tage, die sie mit den Gablers als Nachbarn aushalten musste, und im Grunde galt ihre ganze Wut doch denen, nicht der Mutter. Auf ihre. Mutter konnte, durfte niemand ernsthaft böse sein – eine Eigenschaft, die man übrigens auch Verena nachsagte. Das war der Lohn für die ewige Opferrolle. Ein zu geringer, fand Verena.
»Außerdem hat Frau Gabler ihre Migräne«, setzte die Mutter das stockende Gespräch fort. »Eben ist irgendein Anruf wegen Fuerte gekommen, von Daniels Tante Lena, der Frau Gabler furchtbar aufgeregt hat. Sie braucht jetzt strikte Bettruhe. Seit Randolfs Tod werden die Anfälle immer heftiger. Dieser junge« – Pause – »dieser Pfleger muss ständig um sie sein.«
Nicht ein Anflug eines ironischen Lächelns umspielte die Lippen ihrer Mutter, dabei musste sie die so genannte »Migräne« und die kompletten Rückzüge ihrer Dienstherrin samt Pfleger doch längst als eine weitere Fiktion Katharina Gablers durchschaut haben.
Immerhin ließ sie sich dazu verleiten nur von »diesem« Pfleger zu sprechen, einem Masseur mit Waschbrettbauch, den Katharina Gabler in ihrem Tennisklub aufgegabelt und in der Villa als ihren Krankenpfleger installiert hatte. Unerträglich, dass dieser Nichtsnutz sich wahrscheinlich auch noch von Gisela Malchow bedienen ließ.
»Was ist mit dir Kind? Du siehst ganz missmutig aus. Es tut mir ja Leid, dass du den Tag nicht einfach im Park verbringen oder schwimmen gehen kannst, aber es wäre wirklich nett, wenn du ins Haupthaus rübergingst. Ich meine ... Beatrice und du, ihr wart doch als kleine Mädchen fast so etwas wie Freundinnen, so niedlich ihr beiden, sie so blond und quirlig und voller verrückter Einfälle, und du so dunkel und still und sanft und nachgiebig ...«
Verena unterdrückte einen Seufzer. Noch so ein unausrottbarer Irrtum. Freundinnen! Von wegen. Sie erinnerte sich noch sehr genau an das Gefühl, mit vier Jahren zum Spielen und Fröhlichsein antreten zu müssen. Im besten Kleidchen – natürlich geerbt von Beatrice – und ohne Anrecht auf eines der wunderbaren Spielzeuge, die die verwöhnte Beatrice vor allem als willkommene Zielscheiben ihrer Zerstörungswut betrachtete.
»Kind, ich würde mich ja selber darum kümmern, aber, na ja, Beatrice langweilt sich so ganz ohne gleichaltrige Gesellschaft ..., alle ihre Freunde sind jetzt im Urlaub, in St. Tropez, Monaco, auf Saint Barth, du kennst sie doch, ein Wildfang eben ... und mit ihrer Mutter hat sie überhaupt keine Geduld und ...«
Verena zwang sich zu einem versöhnlichen Lächeln. Die Erschöpfungsfalten im Gesicht der Mutter zeichneten sich jetzt überdeutlich ab.
Drüben in der Villa musste die Hölle los sein: Zwei grauenhaft verwöhnte, egozentrische Weibsbilder, die wie Hund und Katze waren, sollten eine so genannte »Societyhochzeit des Jahres« vorbereiten und hatten nicht die geringste Lust auf die kleinste Anstrengung. Stattdessen schoben sie alles auf die bewährte Gisi ab, die es wie immer versäumte, sich zu wehren.
Warum nur? Warum? Sie hatte die Haltung ihrer Mutter nie begriffen. Gab es da ein Geheimnis, das sie nicht kannte, oder eine Gefühlsebene, die ihr abging?
Warum hatte die Mutter sich nie ein Leben unabhängig von den Gablers aufgebaut, einen neuen Mann kennen gelernt, eine andere Arbeit gesucht? Sie war eine tüchtige, intelligente Frau, die in vielen Bereichen hätte Karriere machen können, und sei es als Restaurantmanagerin oder als Leiterin eines Cateringservice. Es hätte dutzende Möglichkeiten gegeben, ihre Mutter hatte keine gewählt.
Verena unterdrückte weitere Seufzer. Das Ganze war einfach wie immer zum Weglaufen, aber erst in zwei Tagen.
Die Mutter räumte das eben abgespülte Geschirr in die Schränke und tat so, als wolle sie ihrer Tochter Zeit zum Nachdenken geben und nichts erzwingen, dabei war es unmöglich, ihr eine Bitte auszuschlagen. Unmöglich!
Warum eigentlich?, fragte ketzerisch ihr inneres Teufelchen.
Weil ich ganz ihre Tochter bin, dachte Verena resigniert, nachgiebig bis zur Selbstverleugnung, zumindest wenn ich mich hier aufhalte. Im Schatten der Gablervilla falle ich jedes Mal in die Rolle des gehorsamen, anspruchslosen Mädchens zurück. Verrückt, einfach verrückt. Kompromisslos ehrlich und ich selbst bin ich nur in der Kunst, sogar wenn es zum eigenen Nachteil ist.
Sie dachte an ihren letzten verpatzten Auftrag als Bildhauerin. Für den Kassenraum einer Privatbank hatte sie eine allegorische Figurengruppe – »Wohlstand, Sparsamkeit und Gier« – entworfen. Die Begeisterung für die Skizzen – sie war eine hervorragende Zeichnerin – war groß gewesen.
Sie hielt an, bis die fertige Statue enthüllt wurde und eine der Bronzefiguren – die Gier – entfernt, aber unverkennbar die Züge des Geschäftsführers trug.
Verena hatte das nicht bewusst beabsichtigt, solche Dinge unterliefen ihr eben. Es war alles eine Frage der Inspiration. Die hinterfragte man nicht. Kunst kam eben nicht nur von können, sondern von müssen, wie der Komponist Arnold Schönberg meinte. Verena liebte diesen Satz und lächelte in Gedanken an den wutschnaubenden Bankchef, der übrigens wenig später wegen einer Veruntreuungsaffäre entlassen worden war.
Das Honorar für die Statue, die nie aufgestellt wurde, war die Bank ihr bislang schuldig geblieben. Wahrscheinlich würde die Sache – ihr erster lukrativer Auftrag – vor Gericht enden. Trotzdem war Verena stolz auf die Arbeit, auf ihren mehr als nur künstlerischen Instinkt und ihre Unnachgiebigkeit. Das war sie selber, das war ihre wahre Identität, ihr Leben. Sie sehnte sich zurück ins Atelier, egal wie einsam sie dort oft war und wie brotlos ihre Kunst.
Ihre Mutter hatte alles Geschirr verstaut und räusperte sich. »Es wäre wirklich nett, wenn du zu Beatrice, ich meine ...«
»Schon gut Mama, ich mach’s, ruh du dich aus und fahr später in die Stadt. Dieser«, Räuspern, »Pfleger wird Katharina Gabler sicher eine Weile besänftigen und beschäftigen.«
Verena drückte ihrer Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange, freute sich über die Erleichterung in deren Gesicht und machte sich auf den Weg durch den Park.
Beim Badehäuschen blieb sie kurz stehen. Ganz gegen ihren Willen durchfuhr sie blitzartig dieses irgendwie scharfkantige, heiße Gefühl unerfüllter Begierde.
Warum hatte Fabian Seiler damals nicht mehr gewollt? Einer Beatrice wäre so etwas sicher nie passiert. Oder hatte Fabian einfach zu viel Respekt vor einer Frau wie ihr gehabt, ein ehrliches Gefühl, mehr als die Gier nach einer schnellen Nummer ...
»Träum weiter, Unschuldsengel«, höhnte das Teufelchen, »du warst ihm nur nicht scharf genug.«
Elende Villa, verfluchte Gablers, über allem hier lag wahrscheinlich eine Art böser Fluch, der sie – Verena – auf ewig zum Leben in der zweiten Reihe verdammte. Das Vergnügen hatten immer nur andere.
Oh prima, rief sie sich selbst zur Ordnung, jetzt noch eine Arie in Selbstmitleid und die Jammeroper ist wieder mal perfekt.
Sie schloss die Augen und schüttelte energisch den Kopf: Nur noch zwei Tage, dann kann ich abhauen und wieder so leben, wie es mir passt, ohne mich um verwöhnte Katharinas, blasierte Beatrices oder mir unbekannte Designer-Daniels zu kümmern, und ohne peinliches Selbstmitleid.
»Und ohne an betrunkene, lustlose Fabians erinnert zu werden, nicht wahr?«, flüsterte das Teufesstimmchen.
»Hau ab«, sagte Verena laut.
Das Teufelchen kicherte.
2. Kapitel
Das Meer tief unter ihm war tintenblau. Ein kräftiger Passatwind kämmte Wellen hinein, die sich am Fuß der Steilküste brachen. Ihr Geräusch war hier oben nicht zu hören. Es war ein Ort vollkommener Stille, steinig und karg bis auf einige Flechtgewächse und Zistrosen. Über allem wölbte sich ein gläserner Himmel, der die weiße Kapelle und die verbrannten Hügel noch nackter leuchten ließ.
Ein skeletthaftes Land aus nichts als Knochen, hatte der Dichter Miguel de Unamuno die Insel Fuerteventura genannt und hinzugefügt: »Es ist ein Land, das eine ermüdete Seele zu stählen vermag.«
Genau das, dachte Daniel Derndorfer, während er aufs Meer starrte, muss mein Vater in dieser Ödnis gesehen haben, als er vor mehr als vierzig Jahren herkam. Damals lebten weniger als 16000 Menschen auf der Insel und mehr als doppelt so viel Ziegen; Touristen waren eine unbekannte Spezies, das Land unwirtlich und bitterarm. Daniel selbst war seit sechs Monaten auf der Insel und begann, seinen Vater zu verstehen.
Fuerte ist ein Ort, an dem man seinem inneren Ich begegnen kann, seinen verlorenen Träumen, seinen Grenzen und seinen Möglichkeiten. Mit beinahe dreiundvierzig Jahren wusste Daniel Derndorfer, wie mühselig es sein konnte, zu sich selber und seinen Hoffnungen zurückzufinden. Womöglich gegen den Rest der Welt und gegen die eigene Vergangenheit.
»Wir hätten öfter miteinander reden sollen«, sagte Daniel in die Stille und wandte sich seinem Vater zu. »Gerade in den letzten Jahren.« Seine Stimme klang spröde. Vielleicht lag es am feinsandigen Staub, der hier beinahe ständig durch die Luft wirbelte. Der Vater sagte – wie immer – nichts.
Wortkarg und in sich gekehrt war er sein Leben lang gewesen. Es blieb zu vermuten, dass ihn seine frühen Erlebnisse als Kindersoldat unter Hitler hatten verstummen lassen. 1945 war Leonhart Derndorfer siebzehn Jahre alt und bereits drei Monate an der Westfront gewesen. Die Hälfte seiner Klassenkameraden hatte er sterben sehen. Nein, krepieren.
Danach jedenfalls hatte er nicht mehr Tritt gefasst in Deutschland, war schließlich nach Fuerte übersiedelt, statt die Leitung der väterlichen Baumaschinenfirma zu übernehmen. Ein Kinderspiel, in Zeiten des Wiederaufbaus damit Geschäfte zu machen, doch Leonhart war längst jede Form des Befehlens oder der Unterordnung verhasst – ob militärisch oder zivil. Er hatte sich von der Schwester ausbezahlen lassen und gemeinsam mit Consuelo – seiner spanischen Frau – die Einsamkeit auf dieser Insel vorgezogen.
Die beiden hatten eine alte Finca gekauft und diese – misstrauisch beäugt oder belächelt von den Einheimischen – mühsam restauriert. Am schwersten war es gewesen, den Brunnen wieder freizugraben. Wasser war das kostbarste Gut der Insel.
Der Vater hatte begonnen zu malen. Düstere Bilder zunächst, die vom unbenennbaren Grauen seiner Kriegserlebnisse sprachen. Später folgten helle, immer hellere Landschaften im Wüstenlicht. Großzügige Flächen in jenen Farben, die Fuerte bei sinkender Sonne strahlen lassen: rostrote Berge, lavaschwarze Felder, durchsetzt von blassgrünen Streifen, weißer bis goldgelber Wüstensand voll wandernder Schatten.
Wer genau hinschaute, entdeckte in den Bildern eine heilsame Weite und einen Frieden, den Menschen nicht zu stören vermögen – der verlorene Traum seines Vaters.
»Man sieht, dass du glücklich warst, als du diese Bilder gemalt hast. Jedenfalls so glücklich, wie es einem wie dir möglich war.« Daniel wandte den Kopf nach links, wo sein Vater lag und eisern schwieg, was sonst. Sein Schweigen musste vollkommen geworden sein, als seine Frau starb, bei der Geburt von Daniel.
»War es das, was du mir nicht verzeihen konntest?«
Daniel hatte sich diese Frage wer weiß wie oft gestellt. Sich, aber nie seinem Vater. Jetzt kam er sich besonders albern dabei vor. Gerade jetzt. Es war doch klar, dass er nie mehr eine Antwort bekommen würde. Jedenfalls keine andere als die, die seine Tante Lena, Vaters ältere Schwester, für ihn parat gehabt hatte, seit er denken konnte.
»Was hätte dein Vater mit dir allein auf dieser gottverdammten Insel machen sollen? Du weißt, was ich von ihm und seiner Kleckserei halte, aber dich zu mir nach Deutschland zu schicken war der vernünftigste Entschluss, den er seit Jahren gefasst hatte. Hier hattest du alles, was du brauchst. Ein Zuhause, eine vernünftige Schule, Freunde ...« Und Tante Lena, das glatte Gegenteil seines Vaters.
Eine Frau, die zum Kommandieren geboren schien und die die elterliche Baumaschinenfirma zu ungeahnter Blüte brachte. Tante Lena eben, die nach dem Krieg – als die Auswahl an Männern gering war – auf eine Heirat verzichtete. Lena und die schwachen Männer.
Ein verschmitztes Grinsen stahl sich auf Daniels Lippen. Er wandte dem sprachlosen Vater den Rücken zu, griff sich einen roten Stein und schleuderte ihn über die Abrisskante der Steilküste hinab ins Meer.
Was Tante Lena wohl von seinen neuen Plänen halten würde? Der Brief musste sie inzwischen erreicht haben, aber noch wartete er auf eine Reaktion. So viel war immerhin klar, sie würde schäumen. Sie würde mit allen Mitteln, vor allem sehr unfeinen, kämpfen, um ihn von seiner Idee abzubringen. Zunächst mit sehr durchsichtigen Schmeicheleien, aber die sanfte Tour lag ihr nicht, auch wenn sie es gern anders sah.
Dann würden nölende Klagen folgen – völlig unglaubwürdig, denn jammern stand ihr nicht zu Gesicht. Schließlich würde sie zu handfesten Drohungen übergehen, die gewöhnlich in der Ankündigung »Du bist enterbt!« gipfelten. Ein Wunder, dass Tante Lena nicht schon längst ein entsprechendes Telegramm geschickt hatte.
Und dann war da noch Beatrice, die unberechenbare, wunderbare Beatrice. Immerhin hatte sie bei ihrem letzten und leider einzigen Besuch auf Fuerte sofort von der Insel geschwärmt. Sie liebe Abenteuer, hatte sie immer wieder betont, ein Robinsonleben sei ihr heimlicher Traum. Hoffentlich war das mehr als spontaner Überschwang gewesen. Man würde sehen, gleich wollte er ihr einen ausführlichen Brief schreiben. Eine Nachricht wie diese taugte nicht für ein Telefonat.
Sicher war es richtig, dass er seine Entscheidung vor und nicht nach der Heirat getroffen hatte. So hatten sie beide die Möglichkeit zum Rückzug. Nichts dass er einen Rückzug beabsichtigte. Beatrice tat ihm gut, ihre Sprunghaftigkeit, ihr munteres Wesen, ihre kalkulierten Koketterien und intelligenten Frechheiten. All das bewahrte ihn vor seinem Hang zur Schwermut.
Dennoch: Er würde ihr in jedem Fall einen Aufschub der Hochzeit vorschlagen, schließlich kannten sie sich kaum ein Jahr.
Blieb die Frage, was Tante Lena sagen würde, wenn die Heirat verschoben oder sogar abgeblasen würde. Für Lena Derndorfer war die Hochzeit im neuen Hotel samt Eröffnungsgala, Promigästen und Fernsehcrew eine Haupt- und Staatsaffäre. Ganz vernarrt war sie in den Plan. Sein neuestes Vorhaben hingegen würde sie hassen, das war klar.
Daniel schlenderte zum Rand der Steilklippen, eine Windböe fegte ihm das Haar aus dem Gesicht, zerrte an den Ärmeln seines Hemdes. Er und seine Tante hatten ein Leben lang miteinander gekämpft. Diesmal war er fest entschlossen, Lenas Drohgebärden nicht nachzugeben. Genauso wenig wie damals, als er – nach dem Abitur und ein paar Wanderjahren – endgültig in ihre Baumaschinenfirma hatte eintreten sollen.
»Es wird Zeit, dass endlich wieder ein männlicher Derndorfer die Firma leitet, nachdem dein Vater so kläglich versagt hat«, hatte die Tante resolut verkündet. Als ob sie das ernsthaft gestört hätte! Im Gegenteil. Ohnehin war es mit ihrem Respekt für das männliche Geschlecht nicht weit her: »Die Memmen hättest du mal damals bei der Flak sehen sollen«, war einer ihrer Lieblingssprüche.
Meist folgten darauf Anekdoten, die den Eindruck erweckten, sie – Lena Derndorfer – hätte als 20-jährige Flakhelferin Ende 1944 in letzter Sekunde einen Großteil der alliierten Flieger vom Himmel holen können, wenn man ihr das Kommando überlassen hätte.
Tante Lena eben – im Felde unbesiegt –, wobei sie mit »diesem Bürstenschnauzer Hitler und seinem braunen Gesocks« überhaupt nichts am Hut gehabt hatte. Lena Derndorfer war lediglich kein Freund von Niederlagen.
Doch als es um die Übernahme der Firmenleitung ging, hatte Daniel gesiegt und stattdessen ein Architektur- und Interior-Design-Studium in Amerika begonnen. Er drehte sich wieder zu seinem Vater hin: »Ein wenig war ich also doch wie du. Widerspenstig und entschlossen, meine eigenen Pläne durchzusetzen.« Keine Antwort. Dafür hörte Daniel in Gedanken noch einmal Lenas alte Einwände. Typisch, selbst an einem Ort vollkommener Stille konnte die ihre Klappe nicht halten.
»Interior Design, pah! Das klingt ja schlimmer als das, was dein nichtsnutziger Vater macht. Willst du etwa Blümchentapeten entwerfen oder Teppichmuster?«
»Ich hatte mehr an Kaffeekannenwärmer gedacht.«
»Das langt, mein Lieber. Du bist ab sofort enterbt. Von mir siehst du keinen Pfennig mehr.«
Pfennige hatte Daniel von ihr in der Tat nicht gesehen, dafür einen monatlichen Wechsel in harten Dollars. Dollars, die er dem einzigen butterweichen Fleck in Lenas männerresistentem Herzen verdankte. Lena Derndorfer liebte ihren Neffen Daniel mit der Leidenschaft einer Löwenmutter – weshalb sie weniger zu zarten Koseworten denn zu Drohgebrüll, Zähnefletschen und gelegentlichen Nackenbissen neigte.
Nun, Lenas Dollars hatten sich am Ende bezahlt gemacht. Daniel Derndorfer war ein weltweit anerkannter Hoteldesigner geworden, dessen Konzepte und Entwürfe für Luxusressorts und Ferienoasen im Fünf-Sterne-Bereich neue Maßstäbe gesetzt hatten.
Grund genug für Tante Lena, hin und wieder in Projekte zu investieren, die er entwickelte. So wie hier auf Fuerte. Das »Flores del Agua« – Daniels jüngstes Werk – hatte sie teilweise mitfinanziert. In der Hoffnung übrigens, dass Daniel sich künftig ganz dem lukrativen Massentourismus zuwenden würde, statt seine Zeit an prestigeträchtige Mini-Hotels auf einsamen Südseeinseln zu verschwenden.
»Diese Künstlerflausen. Darin bist du ganz dein Vater«, war Lenas ständige Klage. »Einen See in einen Fels sprengen, künstliche Wasserfälle anlegen, was so was kostet! Und alles für ein paar durchgedrehte Millionäre, die von allem zu viel und selbst davon die Nase voll haben. Das ist dekadent und kindisch.«
In diesem Punkt gab Daniel seiner Tante inzwischen Recht. Er war die kindischen Millionäre leid, zumal einer von ihnen ihm vor zwei Jahren die eigene Frau – Susan – ausgespannt hatte. Der Massentourismus war allerdings nicht Daniels neues Ziel. Im Gegenteil.
Er wandte sich wieder dem stummen Vater zu.
»Ich habe deine alte Finca gekauft. Oder besser gesagt, das, was davon übrig ist«, sagte Daniel. Keine Reaktion, nichts, was hatte er erwartet? Ein Wunder? Daniel sprach schneller, um diese schreckliche Stille zwischen ihnen zu übertönen.
»Ich werde das Haus wieder aufbauen und die Bilder, die du mir geschenkt hast, dort ausstellen. Ich möchte die Finca zu einer Künstlerkolonie machen, hörst du? Ein Hotel, eine Begegnungsstätte, ein Sommeratelier ganz im Einklang mit der stillen Schönheit dieser Insel. Ich werde auch Mutters Garten wieder bepflanzen. Du hättest ihn nicht so vernachlässigen dürfen. Von euren Fotos weiß ich, dass sie den Garten geliebt hat, er war ihr Kunstwerk. Nirgends sah sie glücklicher aus.«
Wartete er wirklich auf eine Antwort? Was für ein Unsinn. Daniel sprach trotzdem weiter. »Ich denke, sie hat es zunächst nicht leicht gehabt hier in dieser Einöde. So weit weg von ihrem geliebten Barcelona, den Ramblas., den Parks, den Cafés, ihren Freunden. Sie muss eine unternehmungslustige Frau gewesen sein, man sieht es an ihren Augen.«
Herausfordernde, glänzend braune, spanische Augen, die Daniel von ihr geerbt hatte, vielleicht zusammen mit der Umtriebigkeit, die sein bisheriges Leben geformt hatte.
»Sie muss dich sehr geliebt haben, um das alles aufzugeben«, sagte er jetzt in Richtung seines Vaters.
Consuelos Liebe war etwas, um das er seinen Vater beneidete. Nicht weil ihm die Liebe der Mutter vorenthalten geblieben war, sondern weil er eine solch hingebungsvolle Liebe von einer Frau nie kennen gelernt hatte. Ob Beatrice solch einer Liebe fähig war? Seltsam, er hatte sich diese Frage bislang nie gestellt.
Beatrice hatte Temperament – so wie Consuelo es gehabt hatte –, daran bestand kein Zweifel. Ihre Zuneigung zu ihm hatte von Anfang an äußerst stürmische Züge gehabt. Sie war so anders als Susan, sie war hinreißend gewesen, unwiderstehlich. Gewesen? Warum dachte er in der vollkommenen Vergangenheitsform an sie? Beatrice ist hinreißend, murmelte Daniel korrigierend. Aber hingebungsvoll? Nein, Hingabe und Beatrice, das passte so gut zusammen wie Champagner und Kamillentee.
»Meine Scheidung ist endgültig durch«, sagte er laut, um das Thema zu wechseln. »Susan hat mich ganz schön ausgezogen, ein cleveres Luder war sie schon immer. Aber«, er zuckte mit den Achseln, »ich habe von Anfang an gewusst, dass sie mehr am Geld und meinem Status als an meiner Person interessiert war. Wobei sie mein wahres Ich kaum gekannt haben dürfte. Ich habe es schließlich jahrelang gut versteckt.«
Sein Gesicht verfinsterte sich. »Weißt du, Susan habe ich mir passend zu meinem Status ausgesucht: schön, kühl, vorzeigbar. Ein richtiges Designerstück für gehobene Ansprüche. So wie meine Hotelentwürfe. Ich habe wenig Talent für Frauen. Mein Gott, Vater, ich wünschte, wir hätten wirklich mehr miteinander gesprochen. All die verlorenen Jahre. Ich hätte gern mehr von dir gehabt als deine Bilder.«
Daniel sprach gegen eine Wand.
Sie war aus weißem Marmor und trug eine schlichte Inschrift in Gold: »Leonhart Demdorfer 1928 – 1998«. Hinter der Platte war – nach spanischer Sitte – die Urne in einer kleinen, tiefen Grabkammer eingeschlossen.
Es war eine besondere Ehre, dass man den Vater auf diesem verlassenen Friedhof direkt an der westlichen Steilküste beigesetzt hatte. Am Ende seines Lebens war Leonhart Derndorfer auf Fuerte ein respektierter und allgemein geschätzter Mann gewesen, der in seinen Bildern die ursprüngliche Schönheit der Insel festgehalten hatte. Eine Schönheit, die sich dem wirklichen Liebhaber erschließt. Sein plötzlicher Tod bei einem Autounfall hatte das Inselparlament in Puerto del Rosario zu einer Gedenkminute veranlasst. Und seinen Sohn Daniel zu einer Rückkehr auf die Insel seiner Geburt.
Er hatte den Auftrag für das Hotel auf Fuerte angenommen, um Abschied vom Vater zu nehmen. Aus dem Abschied war ein neuer Anfang geworden.
»Ich werde deine Finca wieder aufbauen«, wiederholte Daniel mit belegter Stimme. »Ich möchte etwas schaffen, dass wirklich Bestand hat, so wie du es getan hast. Ich möchte ein gutes, wahrhaftiges Leben führen. Vielleicht kann ich sogar noch eine Familie gründen. Mit Beatrice. Sie ist sehr schön. Sie sagt, sie liebt mich.« Er zögerte kurz, dann gab er dem Grabstein einen Klaps. »Adios hombre.«
3. Kapitel
Natürlich war Beatrice amüsant. Sie hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich amüsante Bemerkungen auszudenken, amüsante Vergnügungen vorzuschlagen und amüsante Outfits auszuwählen.
Mit diesen Talenten hatte sie es – ohne allzu große Anstrengungen – verhältnismäßig weit gebracht. Bis vor einem Jahr hatte sie für das Klatschmagazin eines privaten TV-Senders gearbeitet. Wobei das Wort Arbeit übertrieben war, sie hatte lediglich von jenen Events, Partys und Promitreffs berichtet, die sie ohnehin regelmäßig besuchte. Dann war ihr das Ganze – auch das typisch Beatrice – zu langweilig geworden, und sie hatte sich wieder ganz aufs Amüsement verlegt und – seltsamerweise – aufs Heiraten, wie ihre illustren Bekannten meinten.
Beatrice war von Kindesbeinen an dazu erzogen worden, mit Scharm und Schlagfertigkeit zu gefallen, möglichst vielen Menschen zu gefallen – sofern es sich lohnte. Für ihren Bräutigam – den Hoteldesigner Daniel Derndorfer – lohnte sich das nur begrenzt, befand jedenfalls Beatrices Partybekanntschaft.
Sicher, er hatte in der internationalen Designszene einen guten Namen, aber er war ein Partymuffel, ein Small-Talk-Verächter, sein Glamourfaktor ging gegen Null, und er weigerte sich standhaft, seine Bekanntschaften mit Stars, die seine Luxusdomizile und ihn schätzten, zu pflegen und anderen zugänglich zu machen. Erstaunlich, dass ausgerechnet Beatrice Gabler sich mit so einem Spaßverderber verlobt hatte. Gigantisch reich war er nämlich ebenfalls nicht, und man munkelte, dass seine Eigenbrötelei inzwischen so weit ging, dass er sich auf die Langeweilerinsel Fuerte zurückgezogen hatte.