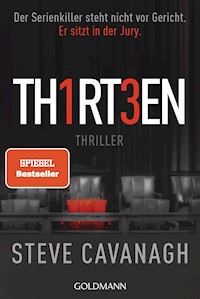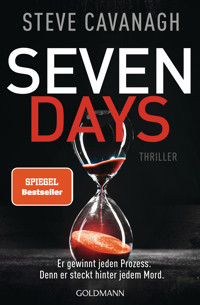10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eddie-Flynn-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Steve Cavanagh ist einfach der Beste in diesem Geschäft.« Mick Herron
Frank Avellino wurde mit äußerster Brutalität in seinem eigenen Schlafzimmer erstochen, der Täter muss in einem wahren Blutrausch gehandelt haben. Besser gesagt: die Täterin. Denn Franks Töchter Alexandra und Sofia beschuldigen sich gegenseitig der Tat. Die eine ist eine sadistische Mörderin, die andere unschuldig. Aber welche? Sowohl Eddie Flynn, der Sofia vor Gericht verteidigt, als auch Alexandras junge Anwältin Kate Brooks befürchten, dass die Wahrheit im Trubel um diesen spektakulären Fall untergeht. Denn der Ermordete war nicht nur ehemaliger Bürgermeister von New York, es gibt auch ein Millionenerbe zu verteilen. Und Eddie Flynns Chancen, die richtige Schwester vor dem Gefängnis zu bewahren, stehen fifty-fifty ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Frank Avellino wurde mit äußerster Brutalität in seinem eigenen Schlafzimmer erstochen, der Täter muss in einem wahren Blutrausch gehandelt haben. Besser gesagt: die Täterin. Denn Franks Töchter Alexandra und Sofia beschuldigen sich gegenseitig der Tat. Die eine ist eine sadistische Mörderin, die andere unschuldig. Aber welche? Sowohl Eddie Flynn, der Sofia vor Gericht verteidigt, als auch Alexandras junge Anwältin Kate Brooks befürchten, dass die Wahrheit im Trubel um diesen spektakulären Fall untergeht. Denn der Ermordete war nicht nur ehemaliger Bürgermeister von New York, es gibt auch ein Millionenerbe zu verteilen. Und Eddie Flynns Chancen, die richtige Schwester vor dem Gefängnis zu bewahren, stehen fifty-fifty …
Autor
Steve Cavanagh wuchs in Belfast auf und studierte in Dublin Jura. Er arbeitete in diversen Jobs, bevor er eine Stelle bei einer großen Anwaltskanzlei in Belfast ergatterte und als Bürgerrechtsanwalt bekannt wurde. Mittlerweile konzentriert er sich auf seine Arbeit als Autor. Seine Thrillerserie um Eddie Flynn machte ihn zu einem der international erfolgreichsten Spannungsautoren.
Mehr Informationen zum Autor und seinen Büchern unter www.stevecavanaghauthor.com.
Von Steve Cavanagh bei Goldmann lieferbar
Zu wenig Zeit zum Sterben. Thriller (Eddie Flynn 1)
Gegen alle Regeln. Thriller (Eddie Flynn 2)
Thirteen. Thriller (Eddie Flynn 4)
Fifty-Fifty. Thriller (Eddie Flynn 5)
Steve Cavanagh
______________
FIFTY-FIFTY
Der fünfte Fall für Eddie Flynn
Thriller
Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Fifty Fifty« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, LondonDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2022
Copyright © der Originalausgabe
2020 by Steve Cavanagh
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München,
nach einem Coverdesign von Head Design/Orion Books
Umschlagmotiv: © Alamy/Leonid Iastremskyi
Redaktion: Regina Carstensen
AB · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27771-0V003
www.goldmann-verlag.de
Für Luca Veste
Voller Dank und Bewunderung für meinen Podbro, weil er mich inspiriert, weil er grandiose, unterhaltsame Bücher schreibt und weil er mich so oft zum Lachen bringt.
Du bist der Größte.
JANUAR
EDDIE
Drei Wörter machen uns Strafverteidigern mehr Angst als alles andere. Diese drei Wörter starrten mich auf meinem Telefon an. Die Nachricht war eben erst gekommen.
SIESINDZURÜCK.
Die Geschworenen waren kaum achtundvierzig Minuten weg gewesen.
In achtundvierzig Minuten kann man manches erledigen. Man kann zu Mittag essen. Man kann einen Ölwechsel vornehmen. Wahrscheinlich schafft man sogar eine ganze Folge seiner Lieblingsserie.
Aber ganz sicher schafft man es nicht, in achtundvierzig Minuten ein gerechtes und ausgewogenes Urteil im komplexesten Mordprozess der Geschichte New Yorks zu fällen. Das ist unmöglich. Vermutlich haben die Geschworenen eine Frage, dachte ich mir. Die können noch kein Urteil gefällt haben.
Das kann nicht sein.
Gegenüber, an der Ecke zur Lafayette Street, liegt das Corte Café. Von außen wirkt es ganz einladend. Drinnen gibt es Kaffee und Frühstücks-Sandwiches auf Plastikstühlen an Plastiktischen. Üblicherweise sitzen drei bis vier Anwälte auf diesen Stühlen wie auf brennenden Kohlen. Man sieht es ihnen an, wenn sie gerade auf das Urteil einer Jury warten. Sie kriegen nichts runter. Sie können nicht still sitzen. Sie verbreiten eine schreckliche Unruhe im Laden, wie jemand, der mit einer Machete auf dem Schoß dasitzt. Früher bin ich auch dorthin gegangen, wenn ich auf ein Urteil wartete, aber der Anblick eines anderen Anwalts in der Warteschleife kann einem den Kaffee im Corte Café echt verderben. Und dabei ist der Kaffee richtig gut.
Statt also Fingernägel zu knabbern, holte ich mir einen Kaffee zum Mitnehmen und ging wieder raus auf den Platz. Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf dem Foley Square hin und her gelaufen bin. Mein Rekord liegt bei drei Tagen. So lange hatte eine Jury gebraucht, um einen meiner Mandanten freizusprechen. Damals hätte ich mit meinen Absätzen fast einen Trampelpfad in die Gehwegplatten gewetzt. Diesmal trat ich gerade mit meinem Kaffee in der Hand vor die Tür vom Corte Café, als die Nachricht kam.
Ich warf meinen Becher in den Müll, überquerte die Straße und machte mich auf den Weg um die Ecke zum Strafjustizgebäude von Manhattan. Zehn Meter hoch über den Eingangstüren flatterte das Sternenbanner. Es war eine alte Flagge. Zeit, Wind und Regen hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Farben waren verblasst, und der Stoff war beinah in zwei Teile zerrissen. Ein paar Sterne hatten sich abgelöst und waren mit dem Wind verflogen. Von den roten und weißen Streifen wehten lange Fäden, die fast bis auf den Boden reichten. Es fehlte das Geld, die Fahne zu ersetzen. Die Zeiten waren hart, und sie wurden immer härter. Normalerweise wurde darauf geachtet, dass die Flagge in makellosem Zustand war, selbst wenn es schon irgendwo durchregnete. Ich fand, sie sollten die alte Flagge ruhig behalten – die sonnenbleichen Farben, die Risse und Fetzen schienen mir für diese Zeiten angemessen. Möglicherweise sahen es die Obersten Richter auch so. Seit man an der Staatsgrenze Kinder in Käfige sperrte, hatte das Sternenbanner für manch einen seinen Glanz verloren. Noch nie hatte ich mein Land so gespalten erlebt.
Ganz oben auf dem Flaggenmast hockte ein Rabe. Ein großer schwarzer Vogel mit langem Schnabel und scharfen Krallen. Erst 2016 waren die ersten Raben wieder nach New York gekommen. Normalerweise fand man sie im nördlichen Umland. Keiner wusste, warum sie wieder da waren. Sie bauten ihre Nester in den obersten Winkeln von Brücken und Überführungen, manchmal sogar auf Telefon- oder Strommasten. Sie ernährten sich von Abfällen und toten Tieren, die sich zum Sterben in die Ecken und dunklen Gassen dieser Stadt verkrochen hatten.
Als ich unter dem Raben entlangging, gab er einen Laut von sich – kraaaahhh – kraaaahhhh. Ich konnte nicht sagen, ob es eine Begrüßung oder eine Warnung sein sollte.
Zumindest beunruhigte es mich.
Vor diesem Fall hatte ich nicht an das Böse geglaubt. Bis dahin war ich in meinem Beruf vielen Männern und Frauen begegnet, die Böses getan hatten, was ich meist einer menschlichen Schwäche zuschreiben konnte – Gier, Lust, Zorn oder Leidenschaft. Manche Leute waren auch krank. Im Kopf. Ich konnte mich damit beruhigen, dass sie für ihre schrecklichen Taten eigentlich nicht verantwortlich waren.
Während ich in der Lobby des Gerichtsgebäudes durch die Security gewunken wurde, konnte ich diese Gedanken nicht abschütteln. Sie bestimmten mein Denken – vergifteten meine Wahrnehmung. Jeder Gedanke war wie ein Blutstropfen im Wasserglas. Da dauert es nicht lange, bis man nur noch rot sieht.
Bei den meisten Mördern, mit denen ich zu tun hatte, konnte ich mir deren Verhalten irgendwie erklären. Irgendwas in ihrer Vergangenheit oder ihrer Psyche bot den Schlüssel für ihre Logik und ihr kriminelles Verhalten. Ich fand immer eine vernünftige Erklärung.
Diesmal gab es keine einfache Antwort. Keinen Schlüssel.
Diesmal war es vernunftmäßig nicht zu erklären. Nicht wirklich. Dieser Fall hatte etwas Finsteres an sich.
Etwas Böses.
Ich konnte es spüren. Es schwebte über diesem Fall, wie die Raben über der Stadt schwebten.
Lauerten.
Warteten.
Und sich dann herabstürzten, um zu töten, mit spitzen Krallen und scharfem Schnabel. Schwarz und finster, schnell und tödlich.
So musste man es wohl sehen. Es gab kein passenderes Wort dafür. Menschen können gut sein. Es gibt so etwas wie gute Menschen. Leute, die Gutes tun, weil es ihnen Freude bereitet. Warum also sollte es nicht auch das Gegenteil geben? Warum sollte nicht jemand Böses tun, weil es ihm Freude bereitet? So hatte ich es bisher noch nie betrachtet, doch jetzt sah ich es ein. Das Böse ist real. Es lebt an dunklen Orten und kann einen Menschen zerfressen wie der Krebs.
So viele waren gestorben. Und bis es vorbei wäre, würden möglicherweise noch mehr sterben. Ich bin in einem kleinen, kalten Haus in Brooklyn aufgewachsen, und meine Mom meinte immer, so etwas wie Monster gäbe es nicht. Die Geschichten, die ich als kleiner Junge gelesen hatte, von Ungeheuern und Hexen, die Kinder in den dunklen Wald entführten, nun, sie meinte, das seien alles nur Märchen. Monster gibt es nicht, sagte sie.
Sie hatte sich getäuscht.
Der Fahrstuhl im Strafjustizgebäude war alt und quälend langsam. Er brachte mich in das gewünschte Stockwerk, ich stieg aus und lief den Flur zum Gerichtssaal entlang, folgte der Menge hinein. Ich setzte mich auf meinen Stuhl am Tisch der Verteidigung, gleich neben meiner Mandantin. Nachdem die zahlreichen Zuschauer Platz genommen hatten, wurden die Türen geschlossen. Der Richter hatte sich bereits hinter seinem Pult eingerichtet.
Als die Geschworenen eintraten, wurde es ganz still.
Den ganzen Papierkram hatten sie schon dem Gerichtsdiener übergeben. Formulare, die sie im Geschworenenraum ausgefüllt hatten. Meine Mandantin versuchte, mir etwas zu sagen, aber ich verstand kein Wort davon. Ich konnte sie kaum hören. Das Blut rauschte in meinen Ohren.
Ich war ziemlich gut darin einzuschätzen, wie eine Jury entscheiden würde. Ich konnte es vorhersagen. Und ich behielt immer recht, jedes Mal. Bevor ich einen Fall übernahm, wusste ich, ob mein Mandant schuldig war.
Ich war viele Jahre als Trickbetrüger unterwegs gewesen, bevor ich meine Künste in den Dienst der Gerechtigkeit stellte, wofür ich kaum etwas ändern musste. Einen Drogendealer um zweihunderttausend Dollar zu bringen ist nicht viel anders, als wollte man eine Jury dazu bewegen, das gewünschte Urteil zu sprechen. Immer wieder landeten Unschuldige hinter Gittern – aber nicht, wenn ich meine Finger im Spiel hatte. Nicht mehr. Ich hatte gelernt, Menschen einzuschätzen, in Bars, in Kneipen, auf der Straße. Ich war ganz gut darin. Ich wusste schon bei der ersten Begegnung, ob ein Mandant schuldig war oder nicht. Und wenn er schuldig war, aber vor Gericht seine Unschuld beteuern wollte, wünschte ich ihm viel Glück und zeigte ihm die Tür. Darauf hatte ich mich vor Jahren mal eingelassen, und der Preis, den ich dafür zahlte, war zu hoch. Damals hatte ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört und meinem Mandanten die Freiheit verschafft. Er war schuldig, und ich hatte dafür gesorgt, dass er freikam. In gewisser Weise bezahlte ich für diesen Fehler immer noch. Niemand ist unfehlbar. Jeden kann man hinters Licht führen.
Sogar mich. Mandanten und Geschworene zu durchschauen fiel mir leicht. Aber dieser Fall war nicht normal. Er hatte ganz und gar nichts Normales an sich.
Zum allerersten Mal konnte ich das Urteil nicht vorhersehen. Ich war zu nah dran. Alles war möglich. Das Urteil hätte auch durch eine Münze entschieden werden können. Die Chancen standen fifty-fifty. Ich wusste, was ich mir wünschte. Ich wusste jetzt, wer es getan hatte. Ich wusste nur nicht, ob auch die Geschworenen es sehen würden. Ich konnte die Jury nicht mehr lesen.
Und ich war müde. Seit Wochen hatte ich nicht geschlafen. Nicht mehr seit jener blutroten Nacht.
Der Gerichtsdiener erhob sich und wandte sich an den Sprecher der Jury.
»Sind die Geschworenen im vorliegenden Fall zu einem einstimmigen Urteil gekommen?«, fragte der Gerichtsdiener.
»Das sind wir«, sagte der Sprecher der Geschworenen.
ERSTER TEIL SCHWESTERN
Drei Monate vorher
911 Notrufprotokoll
Vorfall Nummer: 19 – 269851
5. Oktober 2018
Uhrzeit: 23:35:24
Zentrale: 911 Notrufzentrale New York City. Brauchen Sie
Polizei, Feuerwehr oder Notarzt?
Anruferin: Ich brauche die Polizei und einen
Krankenwagen. Sofort!
Zentrale: Wie ist die Adresse?
Anruferin: Franklin Street 152. Bitte beeilen Sie sich!
Sie hat ihn erstochen, und jetzt kommt sie die Treppe
rauf!
Zentrale: Im Haus wurde jemand erstochen?
Anruferin: Ja, mein Vater. O mein Gott, ich kann sie auf
der Treppe hören!
Zentrale: Ich habe das NYPD und einen Notarztwagen
losgeschickt. Wo sind Sie im Haus? Wo ist Ihr Vater?
Anruferin: Im ersten Stock. Im Elternschlafzimmer. Alles
ist voller Blut. Ich bin … Ich bin im Bad. Es ist meine Schwester. Sie ist noch da. Ich glaube, sie hat ein Messer. O Gott [unverständlich].
Zentrale: Bleiben Sie ruhig. Haben Sie die Tür verriegelt?
Anruferin: Ja.
Zentrale: Sind Sie verletzt?
Anruferin: Nein, ich bin nicht verletzt. Aber sie wird mich
umbringen. Bitte kommen Sie schnell! Ich brauche Hilfe. Bitte schnell …
Zentrale: Die sind schon unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie
sind. Wenn Sie können, stemmen Sie die Füße gegen die Tür. Holen Sie tief Luft, die Polizei ist unterwegs. Bleiben Sie ruhig und verhalten Sie sich leise. Wie ist Ihr Name?
Anruferin: Alexandra Avellino.
Zentrale: Wie heißt Ihr Vater?
Anruferin: Frank Avellino. Es ist meine Schwester Sofia.
Jetzt ist sie endgültig total durchgedreht. Sie hat wie wild auf ihn eingestochen … sie [unverständlich].
Zentrale: Gibt es im Haus noch ein anderes Bad? In
welchem sind Sie?
Anruferin: Im Bad neben dem Elternschlafzimmer. Ich
glaube, ich höre sie. Sie ist nebenan. O mein Gott …
Zentrale: Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut. Das NYPD ist
gleich bei Ihnen. Legen Sie nicht auf.
Anruferin: [unverständlich]
Zentrale: Alexandra … Alexandra? Sind Sie noch da?
Anruf endete 23:37:58
911 Notrufprotokoll
Vorfall Nummer: 19 – 269851
5. Oktober 2018
Uhrzeit: 23:36:14
Zentrale: 911 Notrufzentrale New York City. Brauchen Sie
Polizei, Feuerwehr oder Notarzt?
Anruferin: Polizei und Krankenwagen. Mein Dad stirbt! Ich
bin in der Franklin Street 152. Daddy! Daddy, bitte bleib bei mir … Er wurde niedergestochen. Er braucht einen Notarzt!
Zentrale: Wie ist Ihr Name?
Anruferin: Sofia. Sofia Avellino. Scheiße, ich weiß nicht,
was ich tun soll. Alles ist voller Blut.
Zentrale: Ihr Vater wurde niedergestochen? Ist er im
Haus?
Anruferin: Er ist im Schlafzimmer. Sie hat das getan. Sie
war es … [unverständlich].
Zentrale: Ist sonst noch jemand im Haus? Sind Sie an
einem sicheren Ort?
Anruferin: Ich glaube, sie ist weg. Bitte schicken Sie
schnell jemanden! Ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Zentrale: Blutet Ihr Vater? Wenn ja, versuchen Sie, ein
Handtuch oder irgendwas auf die Wunde zu pressen. Die Polizei müsste jeden Moment da sein. Wie ich sehe, gibt es noch einen weiteren Anruf aus Ihrem Haus.
Anruferin: Bitte? Sie wurden schon angerufen?
Zentrale: Ist noch jemand im Haus?
Anruferin: O mein Gott! Das ist Alexandra. Sie ist im
Bad. Ich sehe ihren Schatten unter der Tür. Scheiße! Sie ist da drinnen! Ich muss hier raus. Sie wird mich umbringen! Bitte, helfen Sie mir, bitte … [schreit].
Anruf endete 23:38.09
KAPITEL EINS
EDDIE
Ich hasse Anwälte.
Die meisten. Eigentlich fast alle, mit nur wenigen erwähnenswerten Ausnahmen. Mein Mentor, Richter Harry Ford, und ein paar alte Recken, die durch die Strafjustizgebäude von Manhattan wandeln wie Geister bei ihrer eigenen Beerdigung. Als halbwüchsiger Betrüger hatte ich weit mehr Anwälte gekannt als heute. Die meisten ließen sich leicht übers Ohr hauen, weil sie korrupt waren.
Hätte nie gedacht, dass ich mal einer von denen sein würde. Auf der Visitenkarte in meiner hinteren Hosentasche stand: »Eddie Flynn, Rechtsanwalt«.
Wenn mein Vater, seinerzeit selbst ein ausgebuffter Schwindler, das noch erleben könnte, würde er sich schämen. Ich hätte Boxer werden sollen oder Hochstapler oder Taschendieb oder wenigstens Buchmacher. Kopfschüttelnd würde er seinen Sohn – den Anwalt – betrachten und sich fragen, was er als Vater falsch gemacht hatte.
Problematisch ist vor allem, dass Anwälte dazu neigen, eher an sich selbst als an ihre Mandanten zu denken. Anfangs sind sie voller guter Absichten: Sie haben Wer die Nachtigall stört gesehen, vielleicht sogar Harper Lees Roman gelesen, und später wollen sie mal sein wie Atticus Finch. Sie wollen für den kleinen Mann einstehen. David gegen Goliath. Dann merken sie, dass sie damit ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, dass ihre Mandanten allesamt schuldig sind, und selbst wenn sie ein Plädoyer schreiben, das eines Atticus‘ würdig wäre, wird der Richter sich kein einziges Wort von dem anhören, was sie zu sagen haben.
Diejenigen unter ihnen, die schlau genug sind, einzusehen, dass es von Anfang an nur ein schöner Traum war, gelangen zu dem Schluss, dass sie sich einer großen Kanzlei anschließen und den Arsch abarbeiten müssen, um noch vor dem ersten Herzinfarkt Teilhaber zu sein. Mit anderen Worten: Sie kommen dahinter, dass das Recht ein Geschäft ist. Und bei manchen boomt dieses Geschäft.
Draußen vor der Hausnummer 16 am Ericsson Place wurde ich wieder einmal daran erinnert, wie viel Geld Staranwälte verdienten. Es war die Adresse des ersten NYPD-Reviers. Die Parkbuchten davor – normalerweise reserviert für Streifenwagen – waren von einer Flotte kostspieliger deutscher Ingenieurskunst besetzt. Ich zählte fünf Mercedes, neun BMW und einen Lexus.
Drinnen war wohl einiges los.
Der Eingang zum Revier führte durch blau-weiß gestrichene Mahagonitüren mit Eisenbeschlägen auf jedem verzierten Paneel. Dahinter fand sich der Tresen der Verkehrspolizei und wiederum dahinter der Schreibtisch des diensthabenden Sergeants. Dort war ein Streit in vollem Gang. Ein Polizist im gelben Hemd fuchtelte mit seinem Zeigefinger vor Sergeant Bukowskis Gesicht herum, während diverse Anwälte im Wartebereich miteinander diskutierten. Der Wartebereich war nicht länger als sechs, sieben Meter und gut drei Meter breit, mit gelben Fliesen an der Wand. Die Fliesen mochten einmal weiß gewesen sein, aber in den Siebzigern und Achtzigern hatten die Cops viel geraucht.
Bukowski hatte mich vor zwanzig Minuten angerufen. Meinte, ich sollte schnell rüberkommen. Es gäbe da einen Fall. Einen großen. Was bedeutete, dass ich Bukowski Tickets für die New York Knicks schuldete. Wir hatten eine Abmachung. Sobald etwas Brauchbares über seinen Schreibtisch ging, rief er mich an. Das Problem war nur, dass Bukowski nicht der einzige Cop im Revier war, und der Menge an Anwälten nach zu urteilen, hatte es sich offenbar herumgesprochen.
»Bukowski«, sagte ich.
Er war ein Koloss aus Muskeln, Fett und Körperbehaarung in der blauen Uniform des NYPD. Das Deckenlicht ließ den Schweiß auf seinem kahlen Schädel glänzen, als er mir zuzwinkerte und dem Detective dann ungerührt erklärte, er solle den Finger aus seinem Gesicht nehmen, sonst würde er diesen bei Gelegenheit in dessen Mutter einführen. Ich ersparte mir die Details.
»Bis hierhin und nicht weiter, Bukowski. Die bekommen hier jeder genau eine Minute mit der Verdächtigen. Mehr nicht. Danach sucht sie sich einen Verteidiger aus, und wir gehen direkt zum Verhör. Kapiert?«, bellte der Detective im gelben Hemd.
»Meinetwegen. Soll mir recht sein. Das kriege ich hin. Geh ‘ne halbe Stunde Kaffee trinken. Oder ruf deine Mutter an und sag ihr, dass ich nach meiner Schicht kurz mal bei ihr reinschaue.«
Der Detective trat einen Schritt zurück, nickte mehrmals, dann machte er auf dem Absatz kehrt und verschwand durch die Stahltür im hinteren Teil des Wartebereichs.
Bukowski wandte sich der versammelten Meute von Anwälten zu, als erklärte er ihnen die Bingo-Regeln. »Also, es läuft folgendermaßen: Jede von euch Nasen zieht eine Nummer, und sobald ich die aufrufe, bekommt derjenige eine Minute Zeit mit der Verdächtigen. Wenn sie euch nicht will, seid ihr raus. Verstanden? Mehr kann ich nicht tun.«
Ein paar von den Anwälten verliehen gestenreich ihrer Empörung Ausdruck und fingen an, auf ihre Handys zu tippen, während andere fluchend zum Automaten hinüberdrängelten, um eine Nummer zu ziehen. Die Nummern waren eigentlich für Bürger gedacht, die erschienen waren, um eine Anzeige aufzugeben – nicht für Anwälte, die zu einer potenziellen Mandantin wollten.
»Was soll das werden, Bukowski?«, sagte ich. »Wozu sollte ich dir Karten für die Knicks besorgen, wenn du jedem zweiten Anwalt in Manhattan Bescheid sagst?«
»Tut mir leid, Eddie. Dieser Fall ist ein Riesending. Der dürfte dir gefallen. Das Gedrängel ist noch gar nichts gegen das, was morgen früh los sein dürfte. Dann lauern hier Horden von Paparazzi, um die beiden Mädchen auf dem Weg zum Haftrichter vor die Kamera zu bekommen.«
»Was denn für Mädchen? Worum geht es?«
»Das Sondereinsatzkommando hat gegen Mitternacht zwei junge Frauen reingebracht. Schwestern. Beide in den Zwanzigern. Ihr Vater lag zerstückelt oben im Schlafzimmer. Beide Schwestern hatten die Cops gerufen. Beide behaupten, die andere hätte ihn ermordet. Dieser Fall, der wird ganz groß.«
Ich sah mich im Wartebereich um. Die Crème de la Crème der Rechtsanwälte von Manhattan war versammelt, all die dicken Fische mit ihren Tausend-Dollar-Anzügen und ihren Assistenten im Schlepptau.
Ich sah an mir herab. Ich trug ein Paar schwarz-weiße Air Jordan Lows, dazu Jeans und ein AC/DC-T-Shirt unterm schwarzen Blazer. Die meisten meiner Mandanten hatten nach Mitternacht kein Problem mit meiner Kleiderwahl. Mir fiel auf, dass ein paar Anzugträger sich gegenseitig anstießen und in meine Richtung deuteten. Offenbar machte ich nicht den Eindruck, als wäre ich für diese Typen eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Ich verstand nur nicht, weshalb dieser Fall so ein großes Ding sein sollte.
»Die Schwestern beschuldigen sich gegenseitig. Na, und? Haben die Geld, oder was lockt die Löwen heute Nacht ans Wasserloch?«
»Scheiße, du hast noch keine Nachrichten gesehen, oder?«, fragte Bukowski.
»Nein, ich habe geschlafen.«
»Die Mädchen sind Sofia und Alexandra Avellino. Franks Töchter.«
»Frank ist tot?«
Bukowski nickte, sagte: »Ich hab mit einem vom Sondereinsatzkommando gesprochen. Frank wurde ausgeweidet wie ein Fisch. Aufgeschlitzt mit einer Klinge. Der Kollege meinte, es war richtig schlimm. Und du kennst diese Typen – die kriegen so einiges zu sehen.«
Das Sondereinsatzkommando beim NYPD operierte wie ein SWAT-Team. Es gab nicht viel, was die noch nicht gesehen hatten – von terroristischen Grausamkeiten bis zum Bankraub, von Geiselnahmen bis zu Amokläufern. Wenn jemand von denen meinte, dass es schlimm war, dann konnte man davon ausgehen, dass es ein absoluter Albtraum gewesen sein musste. Aber nicht das ungewöhnliche Ausmaß dieses Gewaltverbrechens hatte Manhattans beste Rechtsverdreher hergelockt – eher das Opfer und die möglichen Täter.
Bis zum November letzten Jahres war Frank Avellino der Bürgermeister von New York gewesen.
»Wie soll ich denn an diesen Fall rankommen, wenn ich ganz hinten in der Schlange stehe?«
»Du stehst jetzt ganz vorn. Carol konnte die Frau nicht als Mandantin gewinnen. Der Typ, der gerade drinnen ist, hat auch keine Chance. Ich bring dich gleich rein«, sagte Bukowski.
»Moment mal, ich bin als Dritter dran?«
»Carol Cipriani hat mir einen Tausender zugesteckt, um Erste zu sein, aber sie konnte die Frau nicht von sich überzeugen. Tut mir leid, Eddie. Ich muss ja auch leben.«
»Hey, was soll das werden? Wir stehen hier nicht zum Spaß«, sagte einer von den Anzugtypen.
»Ganz ruhig, keine Sorge. Er drängelt sich nicht vor. Sie kriegen Ihre Chance schon noch«, sagte Bukowski. »Alles okay, Eddie. Die meisten von den Vögeln hier wollen zu Alexandra. Du gehst zu Sofia.«
»Augenblick mal, wir sind nicht hier, um mit beiden Schwestern zu sprechen?«, fragte einer von den Typen, und überall wurden empörte Stimmen laut.
Bukowski war mein Kontakt, zusammen mit einem halben Dutzend weiterer Sergeants von anderen Dienststellen, die mir Bescheid gaben, wenn sie einen großen Fang gemacht hatten, wofür ich mich im Gegenzug erkenntlich zeigte. Diesmal witterte das NYPD einen großen Fall, und jeder Cop, der sich von einem Anwalt schmieren ließ, setzte sich ans Telefon. Das kannte ich schon. Die für den Fall zuständigen Detectives beklagten sich zwar bei den Sergeants, aber solange die Auswahl der Anwälte nicht allzu viel Arbeitszeit in Anspruch nahm, konnte man nichts dagegen tun. Die Detectives beschwerten sich nicht bei ihren Vorgesetzten, weil keiner ein Kollegenschwein sein wollte.
Kollegenschweine kriegten beim NYPD kein Bein mehr auf den Boden. Einige Anwälte würden ihre Chance bekommen, und der Rest würde sich nicht beklagen. Wer sich doch beklagte, wurde nicht mehr angerufen. Und die Mandanten beklagten sich nicht, weil sie sich so einen der besten Anwälte aussuchen konnten. Ein Prominentenmord war für die Uniformierten wie Ostern und Weihnachten zusammen. Wie so oft in dieser Stadt half ein bisschen Korruption, die Räder zu ölen.
Willkommen in New York City.
»Ich hol nur eben meine Schlüssel. Dann stell ich dir Sofia vor.«
»Warum Sofia?«, fragte ich.
Bukowski beugte sich vor, sagte: »Ich kenn dich doch. Du übernimmst keine Fälle, wenn abzusehen ist, dass ein Täter nur seiner gerechten Strafe entgehen will. Bei Alexandra habe ich da so meine Zweifel. Aber diese Kleine – Sofia –, na ja, du wirst es gleich sehen. Ich buchte jeden Tag zwanzig bis dreißig Leute ein. Ich merke es ihnen an, ob sie schuldig sind. Dieses Mädchen ist unschuldig. Aber ich muss dich warnen. Mach keine plötzlichen Bewegungen. Gib ihr nichts, lass ihr keinen Stift und auch kein Papier da.«
»Wieso?«
»Na ja, der Amtsarzt meint, sie ist irre … Aber dich wird sie schon nicht angreifen. Schließlich wirst du ihr Verteidiger.«
KAPITEL ZWEI
KATE
Kate Brooks schlief tief und fest, unter mehreren Wolldecken, im Taylor-Swift-Pyjama über ihren Sportsachen, mit zwei Paar dicken weißen Kniestrümpfen. So sehr sie auch an den alten Heizkörpern in ihrer Wohnung herumdrehte, konnte sie die Dinger doch nicht dazu bewegen, warm zu werden. Die Einzimmerwohnung war als »Zauberhafter, wohlig warmer Lebensraum« annonciert gewesen. Die beiden Heizkörper an gegenüberliegenden Wänden des Zimmers sollten wohl als »wohlig warm« gelten. Entsprechend musste sich Kate jeden Abend vor dem Schlafengehen erst anziehen. Sie wusste gar nicht, was sie machen sollte, wenn es mal richtig Winter wurde.
Ihr Handy meldete sich – ein elektronisches Glöckchen, das mit jeder Sekunde lauter wurde. Kates Arm kam unter der Decke hervor, und sie wischte über den Bildschirm, um das Telefon zum Schweigen zu bringen. Eilig zog sie den Arm wieder unter die Decke und drehte sich um, ohne wirklich aufgewacht zu sein.
Wieder klingelte das Telefon.
Diesmal zwang sie sich, die Augen aufzumachen. Das klang nicht wie ihr Wecker. Da sah sie, dass ihr Chef anrief – Theodore Levy. Und nicht nur das – sie hatte seinen ersten Anruf weggedrückt.
»Hallo, Mr Levy«, sagte sie mit krächzender Stimme.
»Ziehen Sie sich an. Sie müssen kurz rüber zum Büro, um ein Dokument abzuholen, dann treffen wir uns auf dem Revier von Tribeca«, sagte Levy.
»Oh. Na klar. Was soll ich mitbringen?«
»Scott ist jetzt im Büro und geht ein paar Hinweisen nach, aber ich brauche ihn hier. Sie müssen mir eine Mandatserteilung für Alexandra Avellino holen. Die bringen Sie mir her. Ich brauche sie innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde. Kommen Sie nicht zu spät.«
Damit legte er auf.
Kate warf die Decken zurück und stieg aus ihrem Bett. Das war das Leben einer frischgebackenen Anwältin. Sie war noch kein halbes Jahr im Job. Die Tinte auf ihrer Zulassung war kaum getrocknet. Scott, auch ein Associate der Kanzlei, war schon im Büro, aber wieso zum Teufel der nicht mitnehmen konnte, was Levy brauchte, hatte Kate nicht zu interessieren. Levy bellte Anordnungen, und die Leute sprangen. Egal, ob es vielleicht eine leichtere oder schnellere Möglichkeit geben mochte. Solange alle in heller Aufregung herumrannten, war Levy glücklich.
Sie sah auf ihre Uhr. Sie würde ein Taxi brauchen. Zwanzig Minuten von ihrer Wohnung zum Büro. Sie versuchte einzuschätzen, wie lange sie von der Kanzlei bis zum Revier vom 1. Bezirk brauchte, und kam zu dem Schluss, dass es vermutlich noch mal zwanzig Minuten dauern würde.
Keine Zeit zu duschen.
Sie stieg aus ihrem Pyjama und den Sportsachen, zog eine Bluse und ein graues Kostüm an. Der Rock war verknittert, aber das machte nichts. Als sie in ihre Strumpfhose stieg, sah sie am rechten Unterschenkel eine Laufmasche. Es war ihr letztes Paar. Fluchend begab sie sich auf die Suche nach ihren Schuhen. Sie stieß sich den Kopf am Durchgang, der das Bett von dem kleinen Bereich abtrennte, in den sie ein Sofa und ein Bücherregal gequetscht hatte – der Bereich, der sich als ihr Wohnzimmer ausgab. Die Stelle an der Stirn tat richtig weh, sodass sie scharf einatmete.
»Na, super«, sagte sie.
Ein Paar adidas-Laufschuhe lagen beim Eingang zu ihrer Wohnung. Die zog sie an, schnappte sich Mantel und Handtasche und machte sich auf den Weg.
Zwanzig Minuten später stieg sie an der Wall Street aus einem Taxi, bat den Fahrer zu warten und rannte zum Eingang des Gebäudes. Mit ihrem Ausweis öffnete sie die Tür und hastete in den gläsernen Eingangsbereich, in dem ein Wachmann hinter einem Schreibtisch saß. Der Fahrstuhl plingte. Die Türen gingen auf, und Kate trat einen Schritt vor, bereit hineinzuspringen. Scott kam aus dem Fahrstuhl, mit einer Akte unterm Arm. Er rempelte Kate an, Schulter an Schulter, riss sie dabei fast um.
»Tut mir leid, Kate, ich hab’s eilig. Levys Sekretärin ist immer noch dabei, den Anwaltsvertrag auszudrucken. Ich konnte nicht darauf warten. Levy will mich jetzt sofort auf dem Revier haben.«
»Warte. Es dauert nur zwei Minuten. Ich hab draußen ein Taxi stehen«, sagte sie.
Scott nickte, wandte sich ab und rannte zum Eingang.
Kate drückte den Knopf zur fünfundzwanzigsten Etage und zählte auf dem Weg nach oben jedes Stockwerk mit. Levys Sekretärin Maureen zog gerade die Seiten aus dem Drucker. Sie steckte sie in eine Mappe und reichte sie Kate.
»Ist das die Mandatserteilung?«
Maureen nickte. Die Blätter waren noch warm vom Drucker.
Wieso hatte Scott nicht warten können, um sie mitzunehmen?
Sie hatte es schon lange aufgegeben, sich solche Fragen beantworten zu wollen. In der Welt einer großen Kanzlei hatte niemand ein Problem damit, zwanzig Anwälte und fünfzig Gehilfen loszuschicken, wenn es ihm auch nur einen winzigen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffte. Sie war losgeschickt worden, den Vertrag zu holen, weil man sie losschicken konnte, den Vertrag zu holen. Kate stieg wieder in den Fahrstuhl, drückte aufs Erdgeschoss, dann hämmerte sie mit dem Mittelfinger auf den Türschließknopf ein. Ungeduldig flüsterte sie mach schon, mach schon, mach schon, während sich die Türen schlossen.
Als sich die Fahrstuhltüren im Erdgeschoss wieder öffneten, stürmte Kate hinaus. Der Wachmann erhob sich, als sie näher kam, und öffnete ihr die Tür.
Atemlos keuchte Kate: »Vielen Dank.« Sie hastete hinaus in die kalte Luft.
Und blieb abrupt stehen.
Ihr Taxi war weg.
Scott.
Arschloch.
In Panik suchte sie die Straße ab. Kein Taxi weit und breit. Sie öffnete die Uber-App auf ihrem Handy. Ihr Vater konnte Uber nicht leiden und hatte sie oft genug davor gewarnt. Die App zeigte ihr an, dass der nächste Fahrer zwei Blocks entfernt war.
Nur Sekunden später hielt der Wagen vor ihr an, und Kate stieg hinten ein. Es war ein metallicblauer Ford. Der Wagen war alt und stank wie ein nasser Hund. Es war zu dunkel, um sich den Fahrer genauer anzusehen, aber sie merkte sich, dass er blond war, dürr und an beiden Armen tätowiert.
Dieser Scott war echt das Allerletzte.
Scott hatte seinen Job als Associate vier Monate nach Kate erhalten. Levy, Bernard & Groff war eine Kanzlei, die den kompletten Service anbot. Sie halfen einem dabei, seine Millionen vor dem Finanzamt zu verstecken, den Partner trotz Ehevertrags übers Ohr zu hauen und jeden zu verklagen, der einem irgendwie quergekommen war. Und für den Fall, dass es mal richtig eng werden sollte, hatten sie Theodore Levy – einen gewieften Anwalt und Strafverteidiger. Kate war durch einige der Abteilungen geschleust worden und hatte sich schlussendlich für das Strafrecht entschieden. Sie besaß eine echte Gabe für diese Arbeit. Levy hatte ein Dutzend Anwälte in seinem Team, an seinen eigenen Fällen arbeitete er aber lieber mit den Jüngeren, sodass die erfahreneren Anwälte sich darauf konzentrieren konnten, ihre Beratungsstunden in Rechnung zu stellen.
Kate war aufgefallen, dass Levy besonders die Nähe der jungen, weiblichen Mitarbeiter suchte.
Scott war erst vor einem Monat zu der Abteilung gestoßen und verstand sich bestens mit dem Chef. Er war Levys kleiner Liebling. Kate merkte es genau. Sie selbst war erst einmal mit Levy zum Lunch gewesen, während ihr Chef Scott schon viermal zum Essen eingeladen hatte. Levy war klein und sah aus wie eine Kröte, Scott dagegen war groß und gertenschlank und hatte Wangenknochen, mit denen man ein Steak weich klopfen konnte. Das eckige Erscheinungsbild des Junganwalts wurde gekrönt von zwei dunkelblauen Augen, die aussahen, als leuchteten dahinter kleine Glühbirnen.
Er hatte ihr das Taxi geklaut, und Kate nahm sich vor, ihm die Meinung zu sagen, sobald sie einen Moment mit ihm allein war.
Der Fahrer blieb wortkarg, und es dauerte nicht lange, bis sie aus dem Wagen stieg und auf das Revier zusteuerte.
Drinnen war der Teufel los.
Anwälte sämtlicher Topkanzleien von Manhattan standen dicht gedrängt und warteten.
Sie entdeckte Levy und Scott auf einer Bank an der hinteren Wand des Raums. Um dorthin zu gelangen, musste sie sich im überfüllten Wartebereich an einem Dutzend anderer Anwälte vorbeizwängen. Manche kannte sie aus dem Fernsehen. Andere von deren Werbung oder Fotos in Fachzeitschriften. Das waren die Leute, die immer bei offiziellen Veranstaltungen der New Yorker Anwaltschaft fotografiert wurden. Alle waren über vierzig. Alle weiß. Alle reich. Alle männlich.
Alle ignorierten sie.
»Verzeihung«, sagte Kate, während sie versuchte, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Einige waren in angeregte Gespräche vertieft. Golf. Alle reichen weißen Anwälte liebten das Golfspiel. Andere stritten, und wieder andere waren am Telefon. Keiner sah ihr in die Augen. Sie hielt den Kopf gesenkt, schob sich höflich voran, wobei sie leise immer wieder »Verzeihung« murmelte. Mitten in der Menge, wo man Schulter an Schulter stand, spürte sie in ihrem Kreuz Hände, die sie sanft vorwärtsschoben, dann eine andere Hand an ihrem Rücken, schließlich merkte sie, wie diese erst über ihren Oberschenkel strich und danach ihren Po drückte.
Kate hustete, rempelte auf ihrem Weg durch die Menge einen weißhaarigen Anwalt härter an, als dieser erwartet hatte. Hinter sich hörte sie Gelächter. Zwei oder drei Männer amüsierten sich über irgendwas. Wahrscheinlich lachten sie darüber, dass einer ihr an den Hintern gegrapscht hatte. Weder Levy noch Scott blickten auf. Mit hochrotem Gesicht wandte Kate sich um und musterte die Menge. Der weißhaarige Anwalt stand wieder da, wo er gestanden hatte, schloss die Lücke, durch die sie gekommen war. Es ließ sich unmöglich sagen, wer sie sexuell belästigt hatte. Gesicht und Hals waren puterrot vor Scham. Wenn sie sich aufregte, würde sie nur eine Szene machen.
Hinter sich hörte sie Levys weinerliche Stimme. »Katie, wo zum Teufel bleiben Sie? Scott ist schon seit zehn Minuten hier.«
Kate schloss die Augen. Schlug sie wieder auf. Sie versuchte, ruhig zu bleiben. Es war eine schlimme Nacht gewesen. Sie wollte nicht vor Levys Augen in die Luft gehen. Er würde ihr nur sagen, dass sie sich zusammenreißen sollte, und sich darüber beklagen, dass sie ihn in Verlegenheit brachte. Sie ging darüber hinweg. Sie würde ihre ganze Kraft brauchen, um mit Levy fertigzuwerden. Nur zwei Männer nannten sie Katie. Einer war ihr Vater, der andere war Levy. Und so gern sie es hatte, wenn ihr Vater sie bei diesem Namen rief, hasste sie es im gleichen Maße, wenn Levy es tat.
Sie trat einen Schritt zurück und wandte sich ihrem Chef zu. Der nahm ihr die Dokumentenmappe ab und fuhr sie an: »Das hier ist ein großer Fall für uns. Für die Kanzlei. Wir müssen uns diese Mandantin sichern. Ich brauche Sie in Topform, okay?«
Kate nickte, sagte: »Alles gut. Worum geht’s?«
Levys Mund blieb halb offen stehen, ein paar Sekunden lang. Er sah aus, als wartete er auf ein vorüberfliegendes Insekt, das er mit seiner Froschzunge aus der Luft abschießen und in seinem rosigen Mund verschwinden lassen wollte.
»Frank Avellino, unser ehemaliger Bürgermeister, ist tot. Er wurde in seinem Schlafzimmer ermordet. Wie oft wurde auf ihn eingestochen, Scott?«
»Dreiundfünfzigmal«, sagte Scott.
»Dreiundfünfzigmal, meine Liebe. Und wir werden seine älteste Tochter vertreten. Beide seiner Töchter wurden am Tatort verhaftet, und jede beschuldigt die andere, den Mord begangen zu haben. Eine von ihnen lügt, und unser Job ist es zu beweisen, dass es nicht unsere Mandantin ist. Verstanden?«
Es sprach etwas Herablassendes aus Levys Worten, aber Kate achtete nicht darauf.
Die Formulierung »meine Liebe« war nicht freundlich gemeint. Sie hatte sich an das meiste gewöhnt, was ihr so entgegengebracht wurde, aber bei »meine Liebe« oder »mein Mädchen« knirschte sie immer noch mit den Zähnen. Sie rang den Ärger nieder, denn auf genau so einen Moment hatte sie gewartet, seit sie sich der Kanzlei angeschlossen hatte. Mit schmierigen Typen in Bars und dem alltäglichen Sexismus auf der Straße wurde sie leichter fertig. Wenn es aber um Männer ging, die ihre Karriere in der Hand hatten, war das was anderes. Sie wusste, dass es so nicht sein sollte, dass es nicht rechtens war, hielt es aber für das Beste, den Mund zu halten und den Kopf einzuziehen. Vorerst. Alle Macht lag bei denen. Wenn sie sich über ihn beklagte, wäre sie den Job vermutlich sofort los – ihre Karriere wäre zu Ende, bevor sie richtig angefangen hatte.
Monatelang hatte sie Schriftsätze verfasst, Mandanten die Hand geschüttelt und bei Kanzleipartys Häppchen serviert. Jetzt hatte sie einen Fall. Einen echten, bedeutenden Mordfall. Die Aufregung schlug ihr auf den Magen, und sie strich ihr Kostüm glatt, leckte ihre trockenen Lippen und räusperte sich. Sie wollte bereit sein. Sie fühlte sich bereit.
»Verstanden«, sagte Kate.
Levy musterte sie von oben bis unten und sagte: »Was haben Sie da an? Sind das Sportschuhe?«
Kate machte den Mund auf, um zu antworten, bekam aber keine Gelegenheit dazu.
»Levy! Sie sind dran!«, rief ein Cop von der offenen Stahltür her.
»Jetzt sind wir an der Reihe«, sagte Levy. Er stand auf und zog seine Hose hoch. Oft genug rutschte sie ihm unter seinen Wanst. Ob er einen Gürtel oder Hosenträger trug – Levy schien sich ständig die Hose hochzuziehen.
Kate sah einen kleinen Trupp von Anwälten aus der Stahltür treten. Offensichtlich hatten sie gerade mit ihrer potenziellen Mandantin gesprochen. Sie ließen die Köpfe hängen, wirkten müde und erschöpft. Levy würde den Fall bekommen. Wer der Mandant auch sein mochte. Ganz egal. Das war seine Stärke. Er konnte gut mit Mandanten. Brachte sie schnell auf seine Seite. Er war eine PR-Maschine mit Anwaltslizenz. Sie würden diesen Fall übernehmen, und Kate würde von Anfang an im Zentrum der Verteidigung stehen. Sie musste sich ein Lächeln verkneifen, das sich auf ihren Lippen auszubreiten drohte – es lag an der Aufregung, der Nervosität.
»Okay, gehen wir«, sagte Levy.
Scott nickte Kate zu. Kate nickte zurück. Gemeinsam traten die drei auf die Stahltür zu. Plötzlich hatte Kate eine Dokumentenmappe vor der Nase. Abrupt blieb sie stehen, als man sie ihr vor die Brust schlug. Kate nahm die Mappe in beide Hände.
»In Scotts Akte steht so einiges, was weder die Mandantin noch das NYPD sehen sollte«, sagte Levy. »Legen Sie die Mappe in den Dokumentensafe meines Wagens. Er steht direkt vor der Tür. Der goldene Jaguar.«
Ein Schlüsselbund baumelte vor ihrem Gesicht. Kate nahm ihn entgegen, schluckte und hatte so ein Kratzen in der Kehle. Als schluckte sie spitze Steine.
»Wir werden nicht lange brauchen. Nutzen Sie die Zeit, darüber nachzudenken, warum Sie erst so spät hier waren. Wenn wir hier fertig sind, kann ich Sie zu Hause absetzen«, sagte Levy.
Und damit marschierten Scott und Levy auf die offene Stahltür zu.
Kate erstarrte.
»Nimm’s nicht so schwer, Süße. Du hast den wichtigsten Job. Du darfst Levys Auto hüten«, sagte eine Stimme hinter ihr. Einer der herumstehenden Anwälte.
Daraufhin brach die ganze Meute in schallendes Gelächter aus.
Kate lief rot an. Sie schob sich außen an der Menge vorbei, traute sich nicht wieder durch die Mitte, hielt zielstrebig auf den Ausgang zu. Sie bekam hektische Flecken am Hals, als sie an Levys letzte Worte dachte.
Wenn er fertig war, wollte er sie nach Hause fahren. Was bedeutete, dass er womöglich wieder einen seiner unbeholfenen Annäherungsversuche unternehmen würde.
Kate drückte die Tür auf und trat auf die Straße hinaus.
KAPITEL DREI
SIE
Als man sie aufs 1. Revier brachte, musterte der diensthabende Beamte sie von oben bis unten und klärte sie über ihre Rechte auf, und dann darüber, wie es weitergehen würde.
»Ihre persönlichen Gegenstände werden als Beweismittel einbehalten. Einschließlich Ihrer Kleidung und Unterwäsche. Zwei weibliche Beamte werden Sie in einen abgeschlossenen Raum führen, wo Sie sich ausziehen können. Neue Kleidung wird Ihnen gestellt. Die in diesem Fall ermittelnden Detectives brauchen eine DNA-Probe und einen Gebissabdruck, und man wird Ihnen auch die Fingernägel schneiden. Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt. Wehren Sie sich nicht. Das geht am Ende nur schlecht für Sie aus. Die Beamtinnen werden Sie außerdem fotografieren und Ihre Fingerabdrücke nehmen. Dann wird man Sie in einen Verhörraum bringen, wo die Detectives Ihnen ein paar Fragen stellen. Gibt es da irgendwelche Unklarheiten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Haben Sie einen Anwalt?«
Sie schüttelte abermals den Kopf. Sagte nichts.
»Nun, bevor Sie gehen, werden Sie einen haben«, sagte er.
Der Cop hatte recht gehabt. Alles kam genau so wie vorhergesagt. Schweigend hatte sie sich vor den beiden Beamtinnen ausgezogen und denen ihre blutigen Kleider gegeben, die in großen, durchsichtigen Plastikbeuteln landeten. Man gab ihr Unterwäsche und einen orangefarbenen Overall. Als sie angezogen war, knipste man ihre Fingernägel in einen Beutel und strich ihr mit einem Wattestäbchen im Mund herum. Das hinterließ einen schlechten Geschmack.
Dann brachte man sie in einen Verhörraum und ließ sie allein. Die eine Wand war verspiegelt, und sie vermutete, dass dahinter jemand stand und sie beobachtete.
Sie beugte sich vor, stützte ihre Ellenbogen auf die Knie und ließ den Kopf hängen. Ihr Blick war starr auf die weißen Gummischuhe gerichtet, die man ihr gegeben hatte. Eine Weile blieb sie still. Laut- und regungslos.
Sie hatte kein Wort gesagt, seit sie in der Franklin Street verhaftet worden war. Sie hatte mitbekommen, dass einer der Cops von einem Schock gesprochen hatte, und so ließ sie die Leute in dem Glauben.
Sie stand nicht unter Schock.
Sie dachte nach.
Und hörte genau hin.
Der Stahltisch vor ihr war von Kratzern und Dellen übersät. Sie wollte mit den Fingern darüberstreichen, den Tisch riechen, ihn berühren, ihn spüren.
Es war ein Drang, der schon in jungen Jahren begonnen hatte. Ein weiteres Ärgernis für ihre Mutter, die jedes Mal nach ihr schlug, wenn sie sie dabei erwischte, wie sie ihre Umgebung betastete und beroch. Stundenlang konnte sie sich mit einem einzelnen Blatt beschäftigen, einem Stein, einem Pfirsich. Die Gerüche und Gefühle waren fast überwältigend, bis plötzlich ihre Wange brannte und die Mutter fauchte: Finger weg! Hör auf, ständig alles anzufassen, du schmutziges, kleines Mädchen!
So wurde auch ihre Freude an der Berührung etwas, das sie für sich behalten musste. Musik half, den Drang zu unterdrücken. Wenn sie sich in ein bestimmtes Lied verliebte, sah sie Farben und Formen, wodurch die Musik für sie noch realer und greifbarer wurde. Es half ihr, die Hände stillzuhalten.
Noch immer hatte sie diese Melodie im Kopf, die im Haus ihres Vaters in der Franklin Street zu hören war, als sie es an diesem Abend betreten hatte. Es war das Lieblingslied ihrer Mutter – »She« von Charles Aznavour. Ihr selbst war die Version von Elvis Costello schon immer lieber gewesen. Laut und rot waberte die Melodie durch ihren Kopf, verdrängte jeden anderen Gedanken. Als sie nun in diesem muffigen, kleinen Verhörraum saß, sprach sie lautlos ein paar Zeilen vor sich hin.
She may be the face I can’t forget …
In ihrem Kopf blitzten Bilder auf. Die Krawatte ihres Vaters. Der Knoten noch immer fest um seinen Hals. Der weiße Knochen vom Brustbein ihres Vaters. Und das hübsche Glitzern auf der Klinge, als sie diese aus seiner Brust riss, damit ausholte und sie ihm in den Bauch rammte, in den Hals, die Augen, immer und immer und immer wieder …
She …
Es war geplant gewesen. Selbstverständlich. Sie hatte es sich schon seit Jahren vorgestellt. Wie gut es sich anfühlen würde, ihn nicht nur zu töten, sondern ihn in Stücke zu hacken. Seinen Leib zu vernichten. Ihn auszulöschen. Und ihr kam der Gedanke, dass all diese anderen Morde nur Fingerübungen gewesen waren.
Zur Vorbereitung.
Anfangs war es ein erhebendes Gefühl gewesen zu sehen, wie das Licht in den Augen eines Opfers erlosch. Es war wie eine Verwandlung. Vom Leben zum Tod. Alles in ihrer Hand. Sie empfand keine Reue. Keine Schuldgefühle.
Die hatte Mutter ihr schon früh ausgetrieben, ihr und ihrer Schwester. Mutter war eine geniale Schachspielerin gewesen und wollte, dass ihre Töchter es damit noch weiterbrachten. In jungen Jahren hatte Mutter miterlebt, wie die Polgár-Schwestern das Spiel im Sturm eroberten, und wünschte sich für ihre Töchter dasselbe, weshalb sie schon früh mit der Schachausbildung begann. Bereits im Alter von vier Jahren war sie vor ein Schachbrett gesetzt worden und hatte die Figuren verschoben, unter Aufsicht ihrer Mutter, die ihr die klassischen Techniken beibrachte. Wie man die Eröffnungen und Strategien erkannte, die zu einem schnellen Schachmatt führten. Sie übten stundenlang. Jeden Tag. Beide Schwestern getrennt voneinander. Mutter ließ nie zu, dass sie gegeneinander spielten, nicht mal zum Üben. Geübt wurde ausschließlich mit Mutter. Und die verbot ihr, vor den Nachmittagsübungen etwas zu essen. Da war die Schale mit Müsli oder Früchten zum Frühstück nur noch eine ferne Erinnerung. Unzählige Stunden hockte sie in einem kleinen Zimmer, mit Mutter – eingeschüchtert, hilflos und hungrig.
Wenn sie von ihr bei einem Fehler in der Strategie erwischt wurde oder eine Figur zu lange in der Hand hielt, die Verzierungen im polierten Holz fühlte oder daran zu riechen versuchte, packte Mutter die pummelige Hand, die den Schachzug vorgenommen hatte, hielt sie hoch und biss in den kleinen Finger. Sie sah es noch genau vor sich. Wie Mutter sie beim Handgelenk gepackt hatte. Es fühlte sich an, als steckte ihr Arm in einer gnadenlosen Maschine fest, die ihre Hand langsam in eine Kreissäge ziehen würde. Nur war es keine Säge, sondern sie musste hilflos mitansehen, wie sich Mutters knallrote Lippen öffneten und zwei Reihen makelloser weißer Zähne freilegten. Ihre kleinen Finger zitterten, und dann …
Der Biss war schmerzhaft, eine Strafe, die nicht verletzen, sondern einen bleibenden Eindruck hinterlassen sollte. Um sicherzustellen, dass dieser Fehler nie wieder vorkam. Sie fragte sich, ob alle Mütter so waren. Kalte, gefühllose Frauen mit scharfen Zähnen.
Sie hatte beim Schachspiel immer Hunger gehabt. Mutter meinte, ein hungriger Geist wäre lebendiger und kreativer. Jedes Mal wenn sie diese Zähne auf ihren kleinen Finger zukommen sah, wurde ihr richtig schlecht vor Hunger, und sie fürchtete den Schmerz der Erniedrigung, der schlimmer war als der Biss selbst.
Sie hatte aus ihren Fehlern gelernt.
Sie erinnerte sich an den Gesichtsausdruck ihrer Schwester, als Mutter die Treppe hinuntergefallen war. Ihre Schwester hatte geweint und geweint, bis Vater endlich nach Hause kam. Sie war nie damit fertiggeworden. Obwohl Mutter die beiden gebissen und geschlagen und sie gezwungen hatte, jeden Tag stundenlang Schach zu spielen und Bücher darüber zu lesen, würde ihre Schwester sie trotzdem aus irgendeinem unerfindlichen Grund vermissen.
Selbst jetzt noch, Jahre später, konnte sie ihre Schreie hören, als sie Mutters Leiche fand. Sie stand am Fuß der Treppe, mit diesem dämlichen Stoffhasen in der Hand, die Knie zusammengedrückt. Ein dunkler Fleck breitete sich auf ihrer weinroten Strumpfhose aus. Sie hatte sich in die Hose gemacht. Ihr Wimmern wurde so schlimm, dass sie kaum noch Luft bekam – ein keuchendes, abgehacktes Schluchzen.
Mittlerweile waren die Bisse und Schläge und Tränen nur noch Erinnerung. Ein Teil von ihr, der dazu beigetragen hatte, sie zu dem makellosen Wesen zu machen, das sie heute war.
Der Abend war perfekt gelaufen. Es sah brutal aus, bestialisch. Daddys zerstückelte Leiche. Ein manischer Mord.
So sah es aus. Und so hatte es auch aussehen sollen. Aber sie hatte es genossen. Ihre Morde waren bisher immer kontrolliert gewesen, und es lag eine gewisse Befriedigung in deren Ausführung, doch waren sie kein Vergleich mit dem ersten Mal. Bis heute Abend. Da hatte sie wirklich losgelassen. Ihre Zwänge, die sie mit reiner Willenskraft und Medikamenten im Zaum halten konnte, hatte sie heute auf ihren Daddy losgelassen. Es fühlte sich an, als hätte sich in ihrem Kopf ein Druckventil geöffnet – die Erleichterung war überwältigend.
Nie zuvor hatte eine Strafjustizbehörde sie mit einem ihrer Verbrechen in Verbindung gebracht. Jetzt saß sie auf einem Polizeirevier und wurde eines Mordes beschuldigt, den sie begangen hatte.
Sie war genau da, wo sie sein wollte.
So, wie sie es geplant hatte.
KAPITEL VIER
EDDIE
Bukowski führte mich einen Korridor mit noch mehr nikotingelben Fliesen entlang. Hinter uns hörte ich, wie ein Cop das nächste Anwaltsteam aufrief. Ich lief etwas langsamer, um zu sehen, wer da kam.
Theodore Levy und ein blonder Bengel folgten einem großen Cop den Korridor entlang. Ich war Levy schon früher auf den Fluren der Centre Street begegnet, aber wir hatten nie am selben Fall gearbeitet. Wir waren beide Strafverteidiger, aber Levy stand ganz oben in der Hackordnung. Er vertrat Wirtschaftsverbrecher, die ihm für seine Dienste ein Vermögen zahlten. Levy wusste, dass dieser Fall Schlagzeilen machen würde, und er brauchte hin und wieder Fälle wie diesen, um sein Profil zu schärfen. Wenn man es schaffte, sein Gesicht ein halbes Jahr lang auf den Titelseiten zu halten, brachte einem das für gewöhnlich mehr Aufträge ein, und man konnte im nächsten Jahr zwanzig Prozent auf seinen Stundensatz draufschlagen.
Ich ging weiter, ließ Levy aber aufholen. Am Ende vom Korridor bog Bukowski rechts ab, und wir stiegen zwei Treppen hinauf. Bis vor ein paar Jahren gab es in diesem Stock vier Verwahrzellen. Das NYPD hatte die alten Zellen entkernt, um Platz für Büros zu schaffen. Die dreihundert Kilo schweren Eisentüren, mit denen die Zellen gesichert waren, hatte man herausgerissen. Und dann waren sie spurlos verschwunden. Die Bullen oder die Bauarbeiter. Wer weiß? Irgendjemand machte jedenfalls Geld mit Altmetall, und zwar ganz sicher nicht die Stadt New York. Nun gab es Platz für zusätzliche Büros und dazu fünf nagelneue Verhörräume.
Nur zwei davon waren belegt. Man erkannte es an den Tafeln auf den Türen, direkt unter den kleinen Guckfenstern. Ich widerstand dem Drang, einen Blick auf meine Mandantin zu werfen, und wartete auf Levy.
»Eddie Flynn, wenn ich nicht irre. Ich bin Theodore Levy«, sagte er und hielt mir seine Hand hin.
Ich schüttelte sie. Levy klemmte seinen Daumen hinter den Hosenbund und zog sich die Hose über den Bauch. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine dicke schwarze Brille, hinter der mich zwei große Augen eindringlich musterten, von oben bis unten, wie ein Bestatter, der für einen Sarg Maß nehmen wollte.
»Schön, Sie kennenzulernen«, sagte ich.
»Kommen Sie direkt vom Sofa?«, fragte er.
»Vor der Anklageerhebung ziehe ich mich noch um. Meine Mandanten engagieren mich nicht wegen meiner Garderobe.«
»Auch gut. Wie ich höre, haben Sie die Schwester?«, sagte er. »Viel Glück damit.«
»Brauche ich Glück? Sie klingen, als wüssten Sie was, das ich nicht weiß. Ich habe mich schon gefragt, wieso die Hälfte der Anwaltschaft von Manhattan sich um Ihre Dame drängelt. Wollen Sie mir nicht verraten, warum die meisten die eine Schwester der anderen vorziehen?«
»Na ja, Sofia hatte so ihre Probleme. Jeder, der Frank Avellino kannte, wird Ihnen das bestätigen. Das ist kein Geheimnis. Alexandra war seine Lieblingstochter. Sie ist ein bekanntes Gesicht in Manhattan und ganz sicher unschuldig. Sofia ist das durchgeknallte schwarze Schaf. Dieser Fall kann nur ein Ergebnis bringen. Ich denke, es wäre eine gute Idee, mit Sofia über einen Vergleich zu sprechen. Würde uns viel Zeit ersparen.«
»Ich habe noch gar nicht mit Sofia gesprochen. Mal sehen, wie es läuft.«
»Na, dann viel Glück«, sagte er und gab dem großen Cop ein Zeichen, woraufhin dieser die Tür öffnete und beiseitetrat. Levy ging vor seinem Assistenten hinein, einem gut aussehenden jungen Mann, der einen Stapel Unterlagen bei sich trug. Ich trat näher heran, um einen Blick auf Alexandra Avellino zu werfen.
Obwohl sie hinter dem Tisch vom Verhörraum saß, konnte ich doch sehen, dass sie groß war. Blondierte Haare, aber nicht so unnatürlich. Ihre Augen waren rot und ihr Lippenstift verblasst. Ansonsten machte Alexandra einen sportlichen Eindruck, mit gesundem, leicht gebräuntem Teint. Angesichts der Umstände schien es ihr ganz gut zu gehen. Ihr Gesichtsausdruck verriet ein gewisses Selbstbewusstsein. Eine Frau, die wusste, wie man sich beherrschte – und andere. Ich roch noch Reste von Parfum.
Der große Cop schloss die Tür und baute sich davor auf.
»Okay, Eddie, das hier ist Sofia«, sagte Bukowski, als er den Schlüssel ins Schloss steckte und ihm die Tür öffnete.
Ich trat ein.
Sofia Avellino wirkte kleiner als ihre Schwester, wenn auch nicht sehr. Sie hatte dunkle Haare, die sie noch blasser machten. Die Augen waren dieselben. Beide Frauen hatten die Augen ihres Vaters – eng beieinanderstehend, aber wach und klar. Sie lächelte nicht. Ihre Lippen waren schmaler als die ihrer Schwester, ihre Nase auch. Beide sahen etwa gleich alt aus, und mir war, als hätte ich gehört, dass Franks Töchter altersmäßig kaum ein Jahr auseinanderlagen. Ich konnte nicht sagen, woher ich das wusste. Wahrscheinlich hatte ich mal irgendwo was über die Schwestern oder zumindest eine von beiden gelesen.
Misstrauisch nahm sie mich ins Visier, bemerkte aber nichts. Ihr gegenüber saß ein mir unbekannter Anwalt, der genauso wohlhabend und erfolgreich ausschaute wie all die anderen. Er sammelte seine Papiere zusammen, sagte: »Sie begehen einen großen Fehler, mich nicht zu engagieren«, und stürmte hinaus.
Ich ignorierte ihn, konzentrierte mich auf die junge Frau, die vor mir saß.
»Hi, Sofia, mein Name ist Eddie Flynn. Ich bin Strafverteidiger. Officer Bukowski hat mir erzählt, dass Sie keinen Anwalt haben. Ich würde mich gern etwas mit Ihnen unterhalten, um zu sehen, ob ich Ihnen helfen kann. Wäre Ihnen das recht?«
Sie zögerte, nickte, und ihre Finger fingen an, imaginäre Linien und Kreise auf den Tisch zu zeichnen. Ich trat näher heran und registrierte, dass sie die Dellen und Kratzer mit den Fingern verfolgte, die Strukturen erkundete. Eine nervöse Reaktion, irgendwie kindlich. Sie schien sich selbst dabei zu ertappen und nahm die Hände unter den Tisch.
Ich setzte mich ihr gegenüber, zeigte mich freundlich und offen, um sie zum Reden zu ermutigen.
»Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragte ich.
Sie schluckte, nickte und sagte: »Mein Dad ist tot. Meine Schwester hat ihn ermordet. Sie schiebt die Schuld auf mich, aber ich schwöre, ich war es nicht! Ich könnte so was überhaupt nicht. Sie ist eine verlogene, mörderische Schlange!«
Sie schlug mit beiden Händen auf den Tisch, um das Wort »Schlange« zu unterstreichen.
»Okay, ich weiß, dass es viel verlangt ist, aber Sie müssen unbedingt die Ruhe bewahren. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen … wenn ich kann.«
»Sergeant Bukowski meinte, ich soll mit den Anwälten reden, mich aber erst entscheiden, nachdem ich mit Ihnen gesprochen habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll …«
Sie schüttelte den Kopf, während ihr die Tränen kamen. Ihre Augen schienen immer grüner zu werden. Sie wandte sich ab, schluckte ein Schluchzen herunter. Die Sehnen an ihrem Hals traten hervor, und sie holte tief Luft. Dann schloss sie die Augen, ließ den Tränen freien Lauf und sagte: »Tut mir leid. Ich kann einfach nicht glauben, dass er nicht mehr da sein soll. Ich kann nicht fassen, was sie ihm angetan hat.«
Ich nickte und entgegnete nichts, während sie ihre Knie an die Brust nahm und ihre Beine umarmte. Weinend wiegte sie sich langsam vor und zurück.
»Es tut mir leid um Ihren Vater. Im Ernst. Ehrlich gesagt, befinden Sie sich in einer denkbar schlechten Situation. Die Cops haben es auf Sie abgesehen und Ihre Schwester vermutlich auch. Eine von Ihnen beiden dürfte voraussichtlich des Mordes angeklagt werden. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht auch nicht. Ich muss nur eins wissen: Ich muss sicher sein, dass Sie Ihren Vater nicht ermordet haben«, sagte ich. »Oder haben Sie das getan?«
Sofia hatte trotz der Tränen zugehört. Sie wischte sich das Gesicht mit einem Papiertaschentuch, schniefte und versuchte, sich so weit zu beruhigen, dass sie sprechen konnte. Falls sie schauspielerte, war sie sehr gut. Aber ich sah vor mir am Tisch keine Schauspielerin sitzen. Ich sah eine junge Frau, die offensichtlich Qualen litt. Die waren real. Die waren echt. Aber ob es der Tod ihres Vaters war, der sie quälte, oder doch die Angst, als Mörderin entlarvt zu werden, blieb noch zu klären.
»Warum wollen Sie das wissen? Die anderen Anwälte haben mich nicht gefragt, ob ich es getan habe. Glauben Sie mir denn nicht?«
»Diese Frage stelle ich allen meinen Mandanten. Für jemanden, der mich von seiner Unschuld überzeugt hat, kämpfe ich mit aller Kraft. Normalerweise kann ich erkennen, ob jemand lügt, wenn er seine Unschuld beteuert, und dann trennen sich unsere Wege. Wenn er sich aber stellt und seine Tat gesteht, dann helfe ich ihm, dem Gericht seine Version der Geschichte zu erzählen, damit der Richter versteht, warum er es getan hat, und entscheiden kann, ob ihm dafür mildernde Umstände zugestanden werden. Ich kämpfe nicht für Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen wollen. Das ist nicht mein Ding.«
Sie musterte mich noch einmal neu, als hätte ich meine Tarnung abgelegt, und sie sähe nun den wahren Menschen.
»Ich finde es gut, dass Sie mich gefragt haben«, sagte sie. »Ich möchte, dass Sie mein Anwalt sind. Ich habe meinen Vater nicht ermordet. Alexandra war es. Sie hat es getan.«
Ich ließ mir Zeit, sah sie mir genau an, während sie sprach. Die Wahrheit lag in ihren Augen, ihrer Stimme, ihrem Gesicht. Keine Warnzeichen, nichts, was auf eine Lüge hinweisen würde. Ich glaubte ihr.
Jetzt wurde es Zeit, an die Arbeit zu gehen.
»Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte ich.
»Ich war in Dads Haus in der Franklin Street. Ich wohne ganz in der Nähe und besuche ihn oft. In letzter Zeit immer öfter, seit er so vergesslich wurde. Ich bin ins Haus gegangen und dachte erst, er wäre nicht da …«
»Halt, Moment! Erzählen Sie mir, wie Sie ins Haus gekommen sind.«
»Ich habe Schlüssel. Alexandra auch.«
»Okay, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Sie sagten gerade, Sie dachten, er wäre nicht zu Hause …«
»Ich bin reingegangen, und er war nicht im Wohnzimmer. Da ist er normalerweise, sitzt vorm Fernseher oder arbeitet. Er war nicht da. Ich habe nach oben gerufen, aber er hat nicht geantwortet. Ich dachte, vielleicht ist er ausgegangen, also habe ich mir an der Bar im Wohnzimmer einen Drink gemixt und den getrunken, dann bin ich nach oben gegangen.«
»Wieso sind Sie nach oben gegangen?«
»Ich habe ein Geräusch gehört. Er schien wohl doch da zu sein und hatte womöglich nicht gemerkt, dass ich gekommen bin. Ich bin die Treppe rauf, aber im ersten Stock war er nicht.«
»Was befindet sich im ersten Stock des Hauses?«
»Drei Schlafzimmer und ein Fitnessraum. Im Fitnessraum war er nicht, und in den Schlafzimmern habe ich nicht nachgesehen. Da ist er eigentlich nie. Und dann habe ich wieder dieses Geräusch gehört, aus dem Stockwerk darüber.«
»Was war das für ein Geräusch?«
»Ich weiß nicht. Schwer zu beschreiben. Es klang wie ein Ächzen oder Stöhnen oder so. Möglicherweise redete jemand. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich weiter nach oben gegangen bin, um nachzusehen. Er hatte hin und wieder Aussetzer. Die machten ihn orientierungslos. Das Alter oder eventuell eine beginnende Demenz oder irgendwas. Ich dachte, er wäre vielleicht gestürzt. Dann habe ich ihn im Schlafzimmer auf dem Bett liegen sehen. Das Licht war aus, und ich weiß noch, wie ich mich darüber gewundert habe. Irgendwas stimmte da nicht.«
»Was meinen Sie?«
»Ich konnte ihn im Dunkeln nicht richtig erkennen, aber ich habe einen seiner Füße auf dem Bett gesehen. Er trug seine Schuhe noch. Das war seltsam. Mein Dad hat mich immer zurechtgewiesen, wenn ich mal mit Stiefeln auf dem Sofa lag.«
»Haben Sie Licht gemacht?«, fragte ich.
»Nein, habe ich nicht. Ich bin zu ihm rübergegangen und habe gefragt, ob mit ihm alles okay sei. Ich dachte, vielleicht macht er ein Nickerchen. Er hat nicht geantwortet. Da habe ich erst gemerkt, was los war. Ich wollte seinen Kopf halten, als ich sah, was mit seinem Gesicht passiert war …« Ihre Stimme erstarb, dann sagte sie: »In Panik habe ich 911 gewählt.«
»Haben Sie beobachtet, wie Ihre Schwester oder irgendjemand anderer gestern Abend auf Ihren Vater eingestochen hat?«
»Nein, das nicht. Aber ich weiß, dass sie es war. Sie hatte sich im Bad versteckt. Ich habe das Licht unter der Tür gesehen. Ihren Schatten. Bereit, herauszuspringen und mich auch gleich zu ermorden. Ich wusste, dass sie es war. Ich bin schreiend aus dem Haus gerannt.«
»Warum sind Sie so sicher, dass es Ihre Schwester war, die Ihren Vater ermordet hat?«, fragte ich.
»Weil meine Schwester das böseste Ungeheuer ist, das ich kenne. Ich wusste sofort, dass sie es war. Sie zeigt der Welt nur eine Fassade. Wohlhabend, erfolgreich. Alles Lüge. Sie ist krank im Kopf. Unsere Mum hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Alexandra ist noch kaputter als ich. Sie versteckt es nur besser. Die Cops haben sie auch verhaftet, nachdem ich denen gesagt hatte, dass sie sich im Badezimmer versteckt hatte. Als ich hinten im Streifenwagen saß, habe ich gesehen, wie die Cops ihr Handschellen angelegt haben.«
Ein Klopfen an der Tür. In Sofias Augen blitzte nackte Angst, als sie über meine Schulter hinwegblickte. Als ich aufstand und mich umdrehte, sah ich auf der anderen Seite der Tür zwei Detectives stehen.