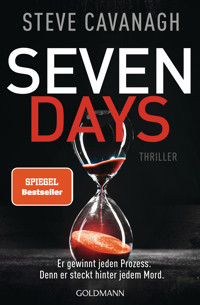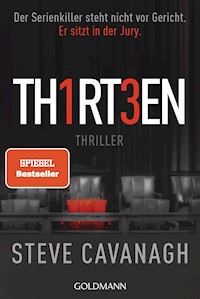
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eddie-Flynn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die sensationellste Thriller-Entdeckung des Jahres: »Dieser Autor setzt neue Maßstäbe.« Lee Child
Es ist Amerikas spektakulärster Mordfall. Doch der Killer steht nicht vor Gericht. Er sitzt in der Jury.
Der New Yorker Strafverteidiger Eddie Flynn soll Amerikas prominentesten Mordverdächtigen vor Gericht vertreten: Robert »Bobby« Solomon – jung, attraktiv und der Liebling von ganz Hollywood. Eddies Klienten zählen normalerweise nicht zu den Reichen und Schönen. Aber wenn er von der Unschuld eines Angeklagten überzeugt ist, tut Eddie alles, um ihn freizubekommen. Und er glaubt Bobby, dass dieser nichts mit dem Mord an seiner Frau und deren Liebhaber zu tun zu hat, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Der Fall scheint aussichtslos, bis Eddie erkennt: Der wahre Killer sitzt in der Jury ...
»Wenn Sie dieses Jahr noch einen Thriller derselben Qualität finden, dann nur, weil sie ›THIRTEEN‹ zweimal gelesen haben.« Mark Billingham
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Der Mord war das Leichteste an seinem Plan. Und nur der Auftakt eines teuflischen Spiels, das Joshua Kane akribisch geplant hat: Er will dabei sein, wenn eines der spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre in allen Details ausgebreitet wird – seine eigene Tat. Doch Kane will als Geschworener dafür sorgen, dass ein anderer dafür verurteilt wird. Der junge Hollywoodstar Robert Solomon soll schuldig gesprochen werden, seine Frau und deren Bodyguard brutal umgebracht zu haben. Alle Spuren sprechen gegen Solomon, das weiß auch Strafverteidiger Eddie Flynn. Bis ihn ein Verdacht beschleicht: Der wahre Täter steht nicht vor Gericht. Er sitzt in der Jury.
Autor
Steve Cavanagh wuchs in Belfast auf und studierte in Dublin Jura. Er arbeitete in diversen Jobs, bevor er eine Stelle bei einer großen Anwaltskanzlei in Belfast ergatterte und als Bürgerrechtsanwalt bekannt wurde. Mittlerweile konzentriert er sich auf seine Arbeit als Autor. Seine Thrillerserie um Eddie Flynn machte ihn zu einem der international erfolgreichsten Spannungsautoren.
Mehr Informationen zum Autor und seinen Büchern unter www.stevecavanaghauthor.com.
Steve Cavanagh
______________
THIRTEEN
Thriller
Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Thirteen« bei Orion books, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2022
Copyright © der Originalausgabe
2018 by Steve Cavanagh
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München, nach einem Entwurf von www.headdesign.co.uk
Covermotiv: Getty images
Redaktion: Regina Carstensen
AB · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27773-4V003
www.goldmann-verlag.de
Für Noah
Das folgende Zitat stammt ursprünglich von Baudelaire, aber niemand hat es je besser eingesetzt als die Filmfigur Verbal Kint. Ich danke Chris McQuarrie für die Erlaubnis, ihn hier zitieren zu dürfen.
Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.
Verbal Kint – aus Christopher McQuarries Drehbuch zu dem Film Die üblichen Verdächtigen
PROLOG
Es war zehn nach fünf an einem eisigen Dezembernachmittag. Joshua Kane lag auf seiner Pappe draußen vor dem Strafgerichtsgebäude in Manhattan und dachte daran, jemanden zu ermorden. Nicht irgendjemanden. Er hatte einen ganz bestimmten Menschen im Sinn. Es kam immer wieder mal vor, dass Kane – wenn er in der U-Bahn oder auf der Straße Leute beobachtete – daran dachte, den erstbesten New Yorker zu ermorden, der ihm über den Weg lief. Das mochte die blonde Sekretärin sein, die im K-Train einen Liebesroman las, ein Banker von der Wall Street, der seinen Regenschirm schwenkte, während er Kanes Bitten um etwas Kleingeld ignorierte, oder sogar ein Kind an der Hand seiner Mutter, während es die Straße überquerte.
Wie mochte es sich anfühlen, sie zu ermorden? Was wären ihre letzten Worte? Wie würde sich ihr Blick verändern in dem Moment, in dem sie diese Welt verließen? Kane spürte, wie ein angenehmer Schauer ihn durchfuhr, als er mit diesem Gedanken spielte.
Er sah auf seine Uhr.
Elf nach fünf.
Harte, hohe Schatten fluteten die Straße, denn der Abend dämmerte. Kane blickte zum Himmel auf und freute sich am matten Dunkel, das war, als hätte jemand einen Schleier über eine Lampe geworfen. Das trübe Licht kam ihm gelegen. Der dunkelnde Himmel lenkte seine Gedanken wieder aufs Töten.
Während der letzten sechs Wochen auf der Straße war es ihm kaum möglich gewesen, an etwas anderes zu denken. Stunde um Stunde hatte er hin und her überlegt, ob dieser Mann nun sterben sollte oder nicht. Von dieser einen Frage abgesehen, war alles andere sorgsam durchgeplant.
Kane ging kein Risiko ein. Was klug war. Wer unentdeckt bleiben wollte, musste vorsichtig sein. Das hatte er schon vor langer Zeit gelernt. Den Mann am Leben zu lassen barg ein gewisses Risiko. Was wäre, wenn sie sich irgendwann über den Weg liefen? Würde er Kane erkennen? Wäre er in der Lage, sich das alles zusammenzureimen?
Aber was war, wenn Kane ihn tötete? Auch das brachte eine Vielzahl von Risiken mit sich.
Allerdings waren das Risiken, mit denen Kane sich auskannte: Risiken, die er schon oft genug erfolgreich gemieden hatte.
Ein Postwagen hielt am Straßenrand, nicht weit von Kane. Der Fahrer, ein untersetzter Endvierziger in Briefträgeruniform, stieg aus. Verlässlich wie ein Uhrwerk. Als der Postbote an ihm vorbeikam und das Gerichtsgebäude durch den Nebeneingang betrat, würdigte er Kane, der dort auf der Straße lag, keines Blickes. Obdachlosen gab er nichts. Heute nicht. Und auch in den letzten sechs Wochen nicht. Eigentlich nie. Kane überlegte, ob er ihn töten sollte.
Ihm blieben zwölf Minuten, um sich zu entscheiden.
Der Postbote hieß Elton. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder im Teenageralter. Einmal in der Woche holte sich Elton was Leckeres aus einem teuren Delikatess-Imbiss, wenn seine Frau glaubte, er sei beim Joggen, er las Taschenbücher, die er für einen Dollar das Stück in einem kleinen Laden in Tribeca kaufte, und trug Fellpantoffeln, wenn er donnerstags den Müll rausbrachte. Wie mochte es sich anfühlen, ihm beim Sterben zuzusehen?
Joshua Kane sah anderen gern dabei zu, wenn sie emotional Achterbahn fuhren. Für ihn waren Gefühle wie Trauer und Angst so berauschend und befreiend wie die besten Drogen der Welt.
Joshua Kane war nicht wie andere Menschen. Es gab niemanden wie ihn.
Er sah auf seine Uhr. Zwanzig nach fünf.
Es wurde Zeit.
Er kratzte sich am Kinn, wo ihm mittlerweile ein dichter Bart gewachsen war. Während er noch überlegte, ob Schmutz und Schweiß wohl Einfluss auf die Färbung nahmen, kam er langsam von seiner Pappe hoch und streckte sich. Die Bewegung brachte es mit sich, dass ihm der eigene Körpergeruch in die Nase stieg. Seit sechs Wochen keine frische Unterhose, keine frischen Socken und auch keine Dusche. Er stank so sehr, dass er würgen musste.
Er musste sich dringend irgendwie ablenken. Vor ihm auf dem Boden lag eine verdreckte Baseballkappe mit ein paar Münzen darin.
Es bereitete ihm einige Befriedigung, eine Mission abzuschließen. Zu sehen, wie sich ein Vorhaben genau so entwickelte, wie man es sich ausgemalt hatte. Und doch gefiel Kane die Vorstellung, ein Element des Zufalls mit einzubinden. Elton würde nie erfahren, dass sein Schicksal in diesem Augenblick entschieden wurde, nicht von Kane, sondern von einer Münze. Kane nahm einen Vierteldollar, schnippte die Münze hoch, fing sie aus der Luft und schlug sie flach auf seinen Handrücken. Während sie im kalten Dunst seines Atems rotiert war, hatte er sich entschlossen: Bei Kopf würde Elton sterben.
Er betrachtete die blitzsaubere Münze, die da auf seiner schmutzigen Hand schimmerte, und musste grinsen.
Gleich neben dem Postwagen gab es einen Hotdog-Stand. Der Verkäufer bediente gerade einen großen Mann, der trotz der Kälte keinen Mantel trug. War vermutlich eben erst auf Kaution freigekommen und feierte das mit vernünftigem Essen. Der Verkäufer nahm die zwei Dollar von dem Mann entgegen und deutete auf das Schild unten an seinem Stand. Neben den Bildern von gegrillten Würstchen machte ein Anwalt Werbung, samt Telefonnummer.
SIEWURDENVERHAFTET?
MANBESCHULDIGTSIEEINERSTRAFTAT?
SPRECHENSIEMITEDDIEFLYNN.
Der große Mann biss in seine Wurst, nickte und ging, als Elton eben aus dem Gerichtsgebäude kam, mit drei grauen Postsäcken in seinen Händen.
Drei Säcke. Das war das Zeichen.
Heute war der Tag.
Üblicherweise kam Elton mit zwei Säcken oder manchmal auch nur mit einem Sack heraus. Alle sechs Wochen jedoch schleppte er drei Säcke heran. Auf diesen dritten Postsack hatte Kane gewartet.
Elton schloss die Hecktüren des Transporters auf und warf den ersten Sack hinein. Kane näherte sich langsam, die rechte Hand ausgestreckt.
Der zweite Sack landete neben dem ersten.
Als Elton den dritten werfen wollte, trat Kane eilig auf ihn zu.
»Hey, Mann, haben Sie ein bisschen Kleingeld für mich?«
»Nein«, sagte Elton und schleuderte den letzten Sack hinein. Er klappte die rechte Tür zu, dann griff er nach der linken und versetzte ihr einen kräftigen Stoß. Timing war alles. Schnell machte Kane einen langen Arm, hielt dem Mann noch mal die Hand hin. Und als die Tür zufiel, geriet er mit seinem Arm dazwischen.
Er hatte es genau abgepasst. Die Tür gab so ein dumpfes Knirschen von sich, als sie Kanes Arm zerquetschte. Schreiend riss er ihn zurück und sank auf die Knie. Er sah, dass Elton die Hände über dem Kopf zusammenschlug, die Augen groß, die Wangen vor Schreck aufgeblasen. Da Elton die schwere Tür mit solcher Wucht zugeworfen hatte, konnte kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Kanes Arm gebrochen war. Und zwar mehrfach. Eine schwere Verletzung.
Aber Kane war etwas Besonderes. Das hatte ihm seine Mum schon immer gesagt. Er heulte ein weiteres Mal auf. Es schien ihm von entscheidender Bedeutung, dass er eine gute Show ablieferte, dass er glaubhaft vortäuschte, verletzt zu sein.
»Ach du meine Güte! Das wollte ich nicht! Ich habe Ihren Arm gar nicht gesehen … Sie … Es tut mir leid …«, stammelte Elton.
Er kniete neben Kane und bat ihn wieder und wieder um Verzeihung.
»Ich glaube, der Arm ist gebrochen«, sagte Kane, wohl wissend, dass er es nicht war. Vor zehn Jahren war der Großteil des Knochens durch Stahlplatten, Stangen und Schrauben ersetzt worden. Das bisschen, was vom Knochen übrig war, hatte man kräftig verstärkt.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße …«, sagte Elton und sah sich auf der Straße um, wusste nicht so recht, was er tun sollte. »Ich konnte zwar nichts dafür, aber ich könnte Ihnen einen Krankenwagen rufen.«
»Nein. Die behandeln mich sowieso nicht. Die bringen mich nur in die Notaufnahme. Da liege ich die ganze Nacht auf so einer Trage, und dann schicken sie mich weg. Ich bin nicht krankenversichert. Aber es gibt da ein Gesundheitszentrum. Keine zehn Blocks von hier. Die behandeln auch Obdachlose. Bringen Sie mich dahin.«
»Ich kann Sie da nicht hinbringen.«
»Was?«, sagte Kane.
»Ich darf niemanden mitnehmen. Wenn man Sie vorn im Wagen sitzen sieht, könnte ich meinen Job verlieren.«
Erleichtert seufzte Kane, weil Elton darum bemüht war, an den Vorschriften der Post festzuhalten. Darauf hatte er gebaut.
»Setzen Sie mich hinten rein! Da sieht mich keiner.«
Elton betrachtete den Wagen und die offene Hecktür.
»Ich weiß nicht …«
»Ich werd schon nichts klauen. Mann, ich kann ja nicht mal meinen Arm bewegen!« Kane stöhnte zur Sicherheit gleich noch mal auf.
Nach kurzem Zögern sagte Elton: »Na, gut. Aber Finger weg von den Postsäcken! Okay?«
»Abgemacht.«
Kane ächzte, als Elton ihm von der Straße aufhalf, und zuckte zusammen, als dessen Hände seinem verletzten Arm zu nahe kamen. Aber kurz darauf saß Kane auf dem Stahlboden im Laderaum des Posttransporters, ließ sich von der ausgeleierten Federung durchschütteln und wimmerte angemessen, während der Wagen ostwärts fuhr. Der Laderaum war getrennt von der Fahrerkabine, sodass Elton ihn nicht sehen und vermutlich auch nicht hören konnte, aber zur Sicherheit jammerte Kane trotzdem wie unter Schmerzen. Licht kam nur von der kleinen, gläsernen Dachluke.
Kaum hatten sie das Gerichtsgebäude hinter sich gelassen, da hielt Kane bereits ein Teppichmesser in der Hand und schnitt die Kabelbinder auf, mit denen die Postsäcke vom Gericht zugebunden waren.
Im ersten Sack war nichts Interessantes. Nur ganz normale Umschläge. Im zweiten auch.
Der dritte Sack war der richtige.
Die Umschläge darin waren anders und doch alle gleich. Jeder Umschlag hatte einen roten Streifen, auf dem in weißer Schrift geschrieben stand: »UMGEHENDÖFFNEN. ENTHÄLTGERICHTLICHEVORLADUNG«.
Kane riss keinen davon auf. Stattdessen verteilte er die Umschläge auf dem Boden. Dabei sortierte er diejenigen aus, die an Frauen adressiert waren, und warf diese wieder in den Sack. Eine halbe Minute später hatte er sechzig, vielleicht siebzig Umschläge vor sich ausgebreitet. Er fotografierte immer fünf Stück gleichzeitig, mit einer Digitalkamera, die er schnell wieder in seinem Mantel verschwinden ließ. Die Fotos würde er später vergrößern, um die einzelnen Namen und Adressen erkennen zu können.
Nachdem das getan war, legte Kane die Briefe wieder zurück und band alle drei Säcke mit neuen Kabelbindern zu, die er mitgebracht hatte. Solche Kabelbinder waren nicht schwer zu bekommen. Es war dieselbe Sorte, die auch im Gericht und im Postamt Verwendung fand.
Da noch Zeit war, streckte Kane seine Beine auf dem Boden aus und sah sich die Fotos der Umschläge in seiner Kamera an. Irgendwo darin würde er den Passenden finden. Er wusste es. Er konnte es spüren. Sein Herz raste vor Aufregung. Es fühlte sich an, als würde elektrischer Strom von seinen Füßen aufsteigen, bis in seine Brust.
Nach dem steten Stop-and-go des Straßenverkehrs in Manhattan brauchte Kane einen Moment, um zu merken, dass der Wagen sein Ziel erreicht hatte. Er steckte seine Kamera weg. Die hinteren Türen gingen auf. Kane hielt seinen angeblich verletzten Arm. Elton beugte sich herein und reichte ihm die Hand. Kane griff zu und stand auf. Es wäre so einfach, so schnell gemacht. Er müsste sich nur mit den Füßen abstützen und einmal kräftig ziehen, schon hätte er den Postboten im Wagen. Mit einer einzigen, fließenden Bewegung könnte er Elton das Teppichmesser vom Nacken bis zur Kehle ziehen und ihm die Halsschlagader durchtrennen.
Elton half ihm so vorsichtig aus dem Wagen, als wäre Kane aus Glas, dann begleitete er ihn ins Gesundheitszentrum.
Die Münze hatte Zahl gezeigt: Elton würde leben.
Kane dankte seinem Retter und sah ihm hinterher, als dieser sich wieder auf den Weg machte. Ein paar Minuten später trat Kane aus dem Zentrum auf die Straße hinaus und vergewisserte sich, dass der Postbote nicht noch mal umgekehrt war, um sicherzugehen, dass Kane auch wirklich allein zurechtkam.
Er war nirgendwo zu sehen.
Viel später am selben Abend trat Elton in Jogginghose aus seinem Lieblings-Deli, in der einen Hand ein halb gegessenes Ruben-Sandwich, in der anderen eine braune Papiertüte mit Einkäufen. Auf einmal verstellte ihm ein großer, gepflegt wirkender Mann den Weg, sodass Elton im Dunkeln stehen bleiben musste, direkt unter einer kaputten Straßenlaterne.
Joshua Kane genoss den kühlen Abend und das Gefühl, das ihm ein guter Anzug und ein frisch rasierter Hals vermittelten.
»Ich hab die Münze noch einmal geworfen«, sagte er.
Kane schoss Elton ins Gesicht und verschwand eilig in einer dunklen Gasse. So eine schnelle, problemlose Exekution bereitete Kane keine Freude. Viel lieber hätte er ein paar Tage mit Elton verbracht, aber dafür war keine Zeit.
Er hatte noch einiges vorzubereiten.
Sechs Wochen später MONTAG
KAPITEL EINS
Auf den Bänken hinter mir saßen keine Reporter. Keine Zuschauer im Saal. Keine besorgten Familienmitglieder. Ich war allein mit meiner Mandantin, dem Staatsanwalt, dem Richter, einer Stenografin und einer Gerichtssekretärin. Ach ja, und in der Ecke saß ein Wachmann und sah sich heimlich ein Spiel der Yankees auf seinem Handy an.
Ich befand mich in Manhattans Strafjustizgebäude, Centre Street 100, in einem Gerichtssaal im achten Stock.
Niemand sonst war da, weil der Fall sonst niemanden interessierte. Nicht mal den Staatsanwalt schien er sonderlich zu interessieren, und dem Richter war das Interesse verloren gegangen, sobald er die Klageschrift gelesen hatte: Besitz von Betäubungsmitteln und Drogenutensilien. Der öffentliche Ankläger hieß Norman Folkes und war ein alter Hase im Büro des Bezirksstaatsanwalts. Norm fehlten noch sechs Monate bis zur Pensionierung, und man sah es ihm auch an. Der oberste Knopf an seinem Hemd stand offen, sein zerknitterter Anzug sah aus, als stammte er noch aus der Zeit von Reagans Präsidentschaft, und er wirkte insgesamt eher unrasiert.
Der ehrenwerte Cleveland Parks, seines Zeichens Vorsitzender Richter, machte ein langes Gesicht. Er stützte seinen Kopf auf eine Hand und beugte sich übers Richterpult.
»Wie lange müssen wir denn noch warten, Mr Folkes?«, fragte Richter Parks.
Norm warf einen Blick auf seine Uhr und zuckte mit den Schultern. »Tut mir leid, Euer Ehren, er müsste jeden Moment hier sein.«
Die Gerichtssekretärin raschelte mit den Dokumenten, die vor ihr auf dem Tisch lagen. Dann machte sich im Saal wieder Schweigen breit.
»Eins muss ich sagen, Mr Folkes: Sie sind doch ein altgedienter Staatsanwalt und sich gewiss der Tatsache bewusst, dass mich nichts mehr ärgert als Verspätungen«, sagte der Richter.
Norm nickte. Bat noch mal um Entschuldigung und zupfte einmal mehr an seinem Hemdkragen, während Richter Parks langsam rot anlief. Je länger Parks dort sitzen musste, desto dunkler wurde das Rot. Größere Gefühlsregungen würde man von Parks nicht zu sehen bekommen. Nie wurde er laut oder sprach mit erhobenem Zeigefinger – er saß nur da und schäumte innerlich. Dass er Unpünktlichkeit nicht leiden konnte, war allgemein bekannt.
Meine Mandantin, eine fünfundfünfzigjährige Ex-Nutte namens Jean Marie, beugte sich zu mir und flüsterte: »Was ist, wenn der Cop nicht kommt, Eddie?«
»Der wird schon kommen«, sagte ich.
Ich wusste, dass der Cop noch kam. Aber ich hatte auch gewusst, dass er sich verspäten würde.
Dafür hatte ich selbst gesorgt.
Mein Plan konnte nur funktionieren, wenn Norm als Vertreter der Anklage auftrat. Ich hatte meinen Antrag auf Einstellung des Verfahrens vor zwei Tagen eingereicht, um kurz vor fünf, als der zuständige Beamte schon nach Hause gegangen war. In den vielen Jahren meines Berufslebens hatte ich eine Ahnung davon bekommen, wie lange das Büro brauchte, um Akten zu bearbeiten und Anhörungen festzulegen. Da das Büro mit der Arbeit immer hinterherhing, war also von Anfang an klar, dass wir frühestens heute Nachmittag einen Termin erhalten würden und dass das Büro seine liebe Not hätte, einen freien Gerichtssaal zu finden. Anhörungen werden meist nachmittags abgehalten, so ab vierzehn Uhr etwa. Anklage und Verteidigung erfahren aber erst wenige Stunden vorher, in welchem Saal sie zu erscheinen haben. Das war nicht so schlimm. Norm hätte am Morgen sicher noch einiges vorzubereiten, genau wie ich. Üblicherweise hätten wir uns danach erkundigt, in welchem Saal wir erwartet wurden. Wir hätten darum gebeten, im Computer nachzusehen und uns mitzuteilen, wo mein Antrag auf Einstellung des Verfahrens später am Tag verhandelt werden würde. Nachdem der Bescheid gekommen war, hätte jeder andere Staatsanwalt sein Handy gezückt und seinen Zeugen angerufen, um ihm mitzuteilen, wo er sich einfinden sollte. Nicht so Norm. Er besaß kein Handy. Die Dinger waren ihm zuwider. Er meinte, von ihnen gingen alle möglichen ungesunden Strahlungen aus. Ich hatte Norm am Morgen extra aufgesucht, um ihm mitzuteilen, in welchem Saal unsere Anhörung am Nachmittag stattfinden sollte. Norm würde darauf bauen, dass sein Zeuge sich selbst darum kümmerte. Norms Zeuge würde der Tafel entnehmen müssen, in welchem Gerichtssaal er zu erscheinen hatte.
Diese Tafel befindet sich in Raum 1000 des Gerichtsgebäudes – dem Sekretariat. In diesem Büro steht – neben der Schlange von Leuten, die darauf warten, Bußgelder zu bezahlen – ein Whiteboard mit einer Liste der Verhandlungen und Anhörungen, die am jeweiligen Tag geplant sind. Die Tafel soll Zeugen, Cops, Staatsanwälten, Jurastudenten, Touristen und Anwälten jederzeit anzeigen, was wann wo verhandelt wird. Eine Stunde vor unserer Anhörung ging ich rauf in den Raum 1000, stellte mich mit dem Rücken zur Sekretärin, suchte meinen Antrag auf der Tafel, wischte die Saalnummer weg und trug eine andere ein. Nur ein kleiner Trick. Nicht wie die langwierigen, riskanten Dinger, die ich gedreht hatte, als ich zehn Jahre lang als Trickbetrüger unterwegs gewesen war. Hin und wieder gestattete ich mir als Anwalt auch heute noch einen Rückfall in meine alten Methoden.
Da man in diesem Gebäude immer lange auf einen Fahrstuhl wartete, dachte ich mir, mein Ablenkungsmanöver müsste dafür sorgen, dass Norms Zeuge sich um etwa zehn Minuten verspätete.
Detective Mike Granger betrat den Gerichtssaal mit einer Verspätung von zwanzig Minuten. Zuerst drehte ich mich gar nicht um, als ich hörte, wie die Türen hinter mir aufgingen. Ich nahm nur Grangers Schritte auf dem gefliesten Boden wahr. Er lief fast so schnell, wie Richter Parks’ Finger auf sein Pult eintrommelten. Doch dann hörte ich noch andere Schritte. Das ließ mich herumfahren.
Hinter Granger betrat ein Mann mittleren Alters im teuren Anzug den Saal und setzte sich ganz hinten auf eine Bank. Er war unschwer an seinem Haarschopf zu erkennen, den fernsehweißen Zähnen und dem auffällig blassen Büroteint. Rudy Carp war einer von diesen Anwälten, die ständig in den Abendnachrichten waren, die bei Court TV auftraten, auf dem Cover von Zeitschriften abgebildet wurden und auch auf das entsprechende Fachwissen zurückgreifen konnten. Ein offizieller Strafverteidiger der Stars.
Ich war dem Mann noch nie begegnet. Wir bewegten uns nicht in denselben Kreisen. Rudy war zweimal im Jahr zum Essen im Weißen Haus. Ich trank einmal im Monat billigen Scotch mit Richter Harry Ford. Früher hatte ich mich vom Alkohol unterkriegen lassen. Jetzt nicht mehr. Einmal im Monat. Nicht mehr als zwei Drinks. Ich hatte es im Griff.
Rudy winkte in meine Richtung. Ich wandte mich wieder dem Richter zu, der wortlos Detective Granger fixierte. Als ich mich noch mal zu Rudy umdrehte, winkte er schon wieder. Da erst merkte ich, dass er mich meinte. Ich winkte zurück, wandte mich ab und versuchte, mich zu konzentrieren. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was zum Teufel er in meinem Gerichtssaal zu suchen hatte.
»Nett von Ihnen, dass Sie sich zu uns gesellen«, sagte Richter Parks zu dem Detective.
Mike Granger sah vom Scheitel bis zur Sohle aus wie ein altgedienter New Yorker Cop. Er hatte so einen wiegenden Gang. Er schnallte die Waffe ab, nahm sein Kaugummi und klebte es ans Holster, bevor er alles unter dem Tisch der Anklage deponierte. Vor Gericht erschien man nicht bewaffnet. Ordnungshüter wurden angehalten, ihre Handfeuerwaffen bei der Security abzugeben. Die Ordner ließen altgediente Cops oft auch so durch, aber selbst die Veteranen waren klug genug, ihre Waffen abzulegen, bevor sie in den Zeugenstand traten.
Granger versuchte zu erklären, warum er sich verspätet hatte. Richter Parks schnitt ihm mit knappem Kopfschütteln das Wort ab. Spar dir die Luft für deine Aussage.
Ich hörte Jean Marie seufzen. Ihr schwarzer Haaransatz zeigte sich im gebleichten Blond, und ihre Finger zitterten, als sie ihre Lippen berührte.
»Keine Sorge. Ich habe es dir doch schon gesagt: Du gehst nicht wieder in den Knast«, sagte ich.
Sie hatte sich für die Anhörung einen neuen schwarzen Hosenanzug angezogen. Er stand ihr gut – stärkte ihr Selbstvertrauen.
Während ich Jean noch Mut machte, legte Norm schon los, indem er Granger in den Zeugenstand rief. Der Polizist wurde vereidigt, und Norm ging mit ihm den Ablauf von Jeans Verhaftung durch.
Er war an jenem Abend an der Ecke 37th Street und Lexington vorbeigekommen und hatte Jean dort vor einem Massagesalon stehen sehen, mit einer Tüte in der Hand. Granger wusste, dass sie einige Vorstrafen hatte, weil sie früher mal auf den Strich gegangen war. Er hielt an, ging zu ihr. Stellte sich vor und zeigte ihr seine Marke. In diesem Moment, so sagte er, sah er, dass Drogenutensilien oben aus Jeans brauner Papiertüte ragten.
»Was waren das für Drogenutensilien?«, fragte Norm.
»Ein Strohhalm. Den benutzen Abhängige, um bestimmte Drogen zu konsumieren. Er war nicht zu übersehen, wie er da aus ihrer Tüte ragte«, sagte Granger.
Richter Parks war nicht überrascht, rollte aber dennoch mit den Augen. Seit einem halben Jahr wurden junge Afroamerikaner zunehmend wegen des Besitzes von Drogenutensilien verhaftet, weil sie Strohhalme bei sich trugen. Diese ragten für gewöhnlich oben aus einem Pappbecher.
»Und was haben Sie dann gemacht?«, fragte Norm.
»Also, wenn ich bei jemandem Drogenutensilien sehe – dann besteht für mich ein hinreichender Verdacht. Miss Marie ist wegen Drogendelikten vorbestraft, also habe ich ihre Tasche durchsucht und die Drogen darin gefunden. Fünf kleine Beutel Marihuana ganz unten in der Tüte. Daraufhin habe ich sie verhaftet.«
Es sah so aus, als würde Jean ins Gefängnis wandern. Zweites Drogendelikt innerhalb von zwölf Monaten. Keine Bewährung diesmal. Wahrscheinlich müsste sie zwei oder drei Jahre einsitzen. Da fiel mir ein, dass sie schon einen Teil der Strafe verbüßt hatte. Direkt nach ihrer Verhaftung war sie drei Wochen eingesperrt gewesen, bis ich jemanden dazu bewegen konnte, eine Kaution für sie zu stellen.
Ich hatte Jean gefragt, wie die Verhaftung abgelaufen war. Sie hatte mir die Wahrheit gesagt. Jean sagte mir immer die Wahrheit. Detective Granger hatte bei ihr angehalten, weil er sich davon ein kostenloses Vergnügen auf dem Rücksitz seines Streifenwagens versprach. Jean hatte ihm erklärt, dass sie nicht mehr auf den Strich ging. Also stieg Granger aus und nahm ihr die Tüte weg, und als er das Gras darin fand, änderte sich sein Tonfall. Er meinte, von jetzt an wollte er fünfzehn Prozent ihrer Einnahmen, anderenfalls würde er sie auf der Stelle hochnehmen.
Jean hatte ihm erzählt, dass sie schon zehn Prozent an zwei Streifenbeamte im 17. Bezirk abgeben musste. Sie kannten Jean und hatten kein Problem damit wegzuschauen. Jean war eine Patriotin. Ihre Ware kam direkt von den staatlich lizensierten Marihuana-Farmen in Washington. Die meisten von Jeans Kunden waren älter und rauchten ihre Arthritis-Schmerzen weg oder verschafften sich Erleichterung vom grünen Star. Sie waren Stammkunden und machten keinen Ärger. Jean hatte Granger gesagt, dass er sich verziehen sollte, also hatte er sie kurzerhand verhaftet und sich irgendeine wilde Geschichte ausgedacht.
Natürlich konnte ich nichts davon vor Gericht beweisen. Ich wollte es auch gar nicht erst versuchen.
Als Norm sich setzte, stand ich auf, räusperte mich und richtete meine Krawatte. Breitbeinig stellte ich mich hin und nahm einen Schluck Wasser. Es sah aus, als richtete ich mich ein, als bereitete ich mich darauf vor, mir Granger für mindestens zwei Stunden vorzuknöpfen. Ich nahm eine Seite aus der Akte auf meinem Tisch und stellte Granger meine erste Frage.
»Detective, in Ihrer Aussage meinten Sie, die Beschuldigte hätte die Einkaufstüte in der rechten Hand gehalten. Wir wissen, dass es sich um eine große braune Papiertüte handelte. Schwierig, sie mit einer Hand zu halten. Ich nehme an, sie hielt die Tüte an den Henkeln, die sich oben an der Tüte befinden?«
Granger sah mich an, als würde ich ihm seine kostbare Zeit mit dummen Fragen stehlen. Er nickte, und in seinem Mundwinkel bildete sich ein Lächeln.
»Ja, sie hielt die Tüte an den Tragegriffen«, sagte er. Dann warf er einen selbstbewussten Blick rüber zum Tisch der Anklage, damit man dort sicher sein konnte, dass er wusste, was er zu sagen hatte. Es war nicht zu übersehen, dass Norm und Granger in Vorbereitung auf den heutigen Tag die zulässige Verwendung von Strohhalmen ausgiebig besprochen hatten. Granger war darauf mehr als vorbereitet. Er ging davon aus, dass ich mit ihm endlos über diesen Strohhalm und die Frage streiten würde, ob dieser nur zum Trinken benutzt worden war … bla, bla, bla.
Ohne ein weiteres Wort setzte ich mich hin. Meine erste Frage war auch meine letzte.
Ich konnte sehen, dass Granger mich argwöhnisch musterte, als wäre er nicht sicher, ob man ihm möglicherweise gerade etwas aus der Tasche gestohlen hatte. Norm bestätigte, er habe kein Interesse, den Zeugen noch einmal zu befragen. Detective Granger verließ den Zeugenstand, und ich bat Norm, mir drei der Beweisstücke zu geben.
»Euer Ehren, Beweisstück Nummer eins ist die Tüte. Diese Tüte«, sagte ich und hielt einen versiegelten, durchsichtigen Beutel hoch, in dem sich eine braune Papiertüte mit dem McDonald’s-Logo befand. Ich beugte mich vor und nahm meine eigene McDonald’s-Tüte. Hielt sie zum Vergleich hoch.
»Diese Tüten sind genau gleich groß. Sie sind fünfzig Zentimeter hoch. Die hier stammt von meinem Frühstück heute Morgen.«
Ich legte beide Tüten weg, nahm das nächste Beweisstück.
»Das ist der Inhalt der Tüte, den man meiner Mandantin am Abend ihrer Verhaftung abgenommen hat. Beweisstück Nummer zwei.«
In diesem versiegelten Beutel steckten fünf kleine Beutel mit Marihuana. Alles in allem nicht genug, um eine Müslischüssel vollzukriegen.
»Beweisstück Nummer drei ist ein gewöhnlicher Strohhalm von McDonald’s. Dieser Halm ist zwanzig Zentimeter lang«, sagte ich und hielt ihn dabei hoch. »Das hier ist ein identischer Strohhalm, den ich heute Morgen mitgenommen habe.« Ich hielt den Halm hoch, dann legte ich ihn auf den Tisch.
Ich legte das Gras in meine McDonald’s-Tüte und hielt sie für den Richter hoch. Dann nahm ich den Strohhalm, hielt ihn aufrecht und ließ ihn in die Tüte fallen, während ich diese mit der anderen Hand an den Tragegriffen festhielt.
Der Strohhalm verschwand darin.
Ich reichte dem Richter die Tüte. Er betrachtete sie, nahm den Strohhalm heraus und ließ ihn wieder hineinfallen. Das wiederholte er ein paarmal und stellte den Halm sogar auf die Marihuana-Beutel. Der Halm blieb fast fünfzehn Zentimeter unterm Rand der Tüte. Das wusste ich, weil ich es selbst probiert hatte.
»Euer Ehren, ich müsste zur Sicherheit im Protokoll nachsehen, aber meinen Notizen zu Detective Grangers Aussage hinsichtlich des Strohhalms entnehme ich, dass er sagte: Er war nicht zu übersehen, wie er da aus der Tüte ragte. Die Verteidigung räumt ein, dass der Strohhalm möglicherweise zu sehen sein könnte, wenn die Tüte oben aufgekrempelt wäre und tiefer gehalten würde. Allerdings bestätigte Detective Granger in seiner Aussage, dass meine Mandantin die Tüte an den Griffen festhielt. Euer Ehren, das ist kein Strohhalm, nach dem man greifen könnte – sozusagen.«
Richter Parks hob eine Hand. Er hatte genug von mir gehört und richtete seine Aufmerksamkeit auf Norm.
»Mr Folkes, ich habe diese Tüte begutachtet und auch den Strohhalm mit den Gegenständen in der Tüte. Ich bin nicht ausreichend überzeugt davon, dass Detective Granger hätte sehen können, wie ein Strohhalm aus dieser Tüte herausragte. Aufgrund dieser Tatsache kann es keinen hinreichenden Verdachtsgrund für seine Durchsuchung gegeben haben, und sämtliche Beweisstücke, die daraufhin konfisziert wurden, sind daher unzulässig. Einschließlich des Strohhalms. Ich muss sagen, ich bin besorgt über den gegenwärtigen Trend unter einigen Polizeibeamten, Strohhalme und andere harmlose Gegenstände als Drogenutensilien darzustellen. Wie dem auch sei. Sie verfügen über keinerlei Beweise, die eine Verhaftung rechtfertigen würden, und so wird das Verfahren eingestellt. Gewiss hatten Sie mir einiges zu sagen, Mr Folkes, aber das nützt nun nichts mehr – ich fürchte, Sie kommen zu spät.«
Jean fiel mir um den Hals, wobei sie mich fast erdrosselte. Sanft tätschelte ich ihren Arm, und sie ließ los. Sie würde mich nicht mehr umarmen wollen, wenn sie erst meine Rechnung gesehen hatte. Der Richter und seine Mitarbeiter standen auf und verließen den Saal.
Granger stürmte hinaus, erschoss mich im Vorübergehen mit dem Zeigefinger. Das machte mir nichts. Daran war ich gewöhnt.
»Und kann ich damit rechnen, dass Sie es noch mal versuchen?«, fragte ich Norm.
»Nicht in diesem Leben«, entgegnete er. »Granger nimmt keine kleinen Dealer wie Ihre Mandantin hoch. Vermutlich steht hinter dieser Verhaftung irgendwas anderes, von dem Sie und ich nie etwas erfahren werden.«
Norm packte seine Sachen und folgte meiner Mandantin aus dem Saal. Jetzt war ich mit Rudy Carp allein. Er applaudierte mir, und sein Lächeln wirkte echt.
Rudy stand auf und sagte: »Glückwunsch, das war … eindrucksvoll. Ich bräuchte mal fünf Minuten Ihrer Zeit.«
»Wofür?«
»Ich möchte wissen, ob Sie Interesse haben, mich beim größten Mordprozess zu unterstützen, den die Stadt je gesehen hat.«
KAPITEL ZWEI
Kane sah dabei zu, wie der Mann im karierten Hemd seine Wohnungstür öffnete und sprachlos staunend dastand. Als Kane merkte, dass das Staunen kein Ende nehmen wollte, fragte er sich, was der Mann im karierten Hemd wohl denken mochte. Kane war sicher gewesen, dass der Mann erst glaubte, er sähe sein Spiegelbild. Als hätte ein Witzbold bei ihm geklingelt und schnell einen großen Spiegel in den Türrahmen gestellt. Und als dem Mann dann klar wurde, dass da kein Spiegel war, rieb er sich die Stirn und wich einen Schritt zurück, versuchte sich zu erklären, was er da sah. So nahe war Kane diesem Mann noch nie gekommen. Er hatte ihn beobachtet, hatte ihn fotografiert, imitiert. Er musterte ihn von oben bis unten, zufrieden mit seinem Werk. Kane trug genau das gleiche Hemd wie der Mann in der Tür. Er hatte seine Haare genauso gefärbt und es mit etwas Trimmen, Rasieren und Schminke geschafft, den zurückweichenden Haaransatz mit genau derselben Ausformung an den Schläfen nachzuahmen. Die schwarz gerahmte Brille war die gleiche. Sogar die graue Hose hatte einen identischen hellen Fleck unten am linken Hosenbein, zwölf Zentimeter über dem Saum und fünf Zentimeter neben der Innennaht. Auch die Stiefel waren die gleichen.
Während Kane ihm ins Gesicht sah, vergingen drei Sekunden, bis dem Mann bewusst wurde, dass man ihm keinen Streich spielte und er auch kein Spiegelbild vor sich sah. Dennoch warf der Mann einen Blick in seine Hände, um nachzusehen, ob sie leer waren. Kane hielt eine Pistole mit Schalldämpfer in der rechten Hand.
Er nutzte die Verwunderung seines Opfers. Er stieß dem Mann hart vor die Brust, zwang ihn, rückwärtszugehen. Kane trat in die Wohnung, gab der Tür einen festen Tritt und hörte, wie sie hinter ihm zuknallte.
»Badezimmer. Sofort. Sie sind in Gefahr«, sagte Kane.
Der Mann hob beide Hände. Seine Lippen bewegten sich lautlos. Er rang um Worte. Irgendwelche Worte. Doch da kam nichts. Rückwärts ging er durch den Flur und dann ins Bad, bis er mit den Unterschenkeln gegen die Badewanne stieß. Seine hoch erhobenen Hände zitterten, während er Kane fassungslos von oben bis unten musterte. Panik setzte ein.
Und auch Kane konnte nicht anders, als den Mann im Badezimmer zu mustern und die kleinen Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild zu bemerken. Bei näherer Betrachtung war er schlanker als der Mann, bestimmt so um die acht bis zehn Kilo. Die Haarfarbe war fast richtig getroffen, aber doch nicht ganz. Aber die kleine Narbe auf der linken Seite, direkt über der Oberlippe des Mannes – diese Narbe hatte Kane nicht bemerkt, weder auf den Bildern, die er vor fünf Wochen gemacht hatte, noch auf dem Führerscheinfoto, das bei der Verkehrsbehörde gespeichert war. Vielleicht hatte er sich die Narbe erst später zugezogen. Auf jeden Fall war Kane sicher, dass er sie nachbilden konnte. Ganz im Stil von Hollywoods Make-up-Techniken. Mit dünner, schnell trocknender Latexlösung ließ sich fast jede Narbe modellieren. Kane nickte. Gut getroffen hatte er die Augenfarbe. Die zumindest entsprach genau den Kontaktlinsen. Unter Umständen würde er die Schatten um die Augen verstärken müssen, vielleicht seine Haut etwas aufhellen. Die Nase war ein echtes Problem.
Das er aber lösen konnte.
Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht, dachte Kane.
»Was soll das werden?«, fragte der Mann.
Kane holte einen zusammengefalteten Zettel aus seiner Tasche und warf ihn dem Mann vor die Füße.
»Aufheben und laut vorlesen«, sagte Kane.
Der Mann bückte sich mit zitternden Beinen, hob den Zettel auf, faltete ihn auseinander und las. Als der Mann aufblickte, hielt Kane einen kleinen Digitalrekorder in der Hand.
»Lauter.«
»N-n-nehmen Sie, w-w-was Sie wollen, aber tun Sie mir nichts«, sagte der Mann und verbarg sein Gesicht vor Kane.
»Hey, hören Sie zu! Sie sind in Lebensgefahr. Uns bleibt nicht viel Zeit. Man will Sie töten. Aber keine Sorge. Ich bin Polizist. Ich bin hier, um an Ihre Stelle zu treten und Sie zu beschützen. Was glauben Sie wohl, warum ich so angezogen bin wie Sie?«
Zwischen seinen Fingern hindurch sah der Mann Kane skeptisch an und schüttelte den Kopf.
»Wer sollte mich umbringen wollen?«
»Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber dieser Jemand muss glauben, ich wäre Sie. Wir bringen Sie hier raus – in Sicherheit. Aber vorher müssen Sie etwas für mich tun. Ich sehe zwar aus wie Sie, aber ich klinge nicht wie Sie. Lesen Sie laut vor, was auf dem Zettel steht, damit ich Ihre Stimme deutlich hören kann. Ich brauche Ihre Sprachmelodie, um mich so anhören zu können wie Sie.«
Der Zettel zitterte in der Hand des Mannes, während er vorlas, anfangs nur zögernd. Er stotterte und stolperte über die ersten Worte.
»Halt, stopp! Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Alles wird gut. Und jetzt versuchen Sie es noch mal von vorn.«
Der Mann holte tief Luft und setzte neu an.
»Der violette Saurier fraß den pinken, zahnlosen Fuchs, den hysterischen Krebs und den verrückten Walfisch und fing extrem qualvoll an zu jammern«, sagte er mit verwundertem Gesichtsausdruck.
»Was hat das alles zu bedeuten?«, fragte er.
Kane drückte die Stopp-Taste an seinem Aufnahmegerät, hob die Waffe an und richtete sie auf den Kopf des Mannes.
»Der Satz ist ein phonetisches Pangramm. Er zeigt Ihre phonetische Bandbreite. Tut mir leid. Ich habe gelogen. Ich bin der Jemand, der gekommen ist, um Sie zu töten. Glauben Sie mir, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander. Es hätte vieles einfacher gemacht«, sagte Kane.
Die Kugel aus der schallgedämpften Pistole schlug ein Loch in den Gaumen des Mannes. Die Waffe war vom Kaliber .22. Keine Austrittswunde. Kein Blut und Hirn aufzuwischen, keine Kugel aus der Wand zu friemeln. Sauber und ordentlich. Der tote Mann fiel in die Wanne.
Kane legte die Waffe ins Waschbecken und ging zur Wohnungstür. Er warf einen Blick in den Hausflur. Wartete. Niemand zu sehen. Keiner hatte was gehört.
Gegenüber der Wohnungstür war eine kleine Besenkammer. Kane ging hinüber, holte eine Sporttasche und einen Eimer mit Lauge heraus, die er dort abgestellt hatte, kehrte in die Wohnung zurück und ging wieder ins Bad. Hätte er die Leiche wegschaffen können, hätte er es anders gemacht. Doch die Umstände waren nun mal so. Er durfte nicht riskieren, die Leiche wegzuschaffen, nicht mal in Einzelteilen. In den fünf Wochen, die Kane den Mann beobachtet hatte, war dieser kaum öfter als ein Dutzend Mal vor die Tür getreten. Er kannte niemanden im Haus, er hatte keine Freunde, keine Familie, keinen Job, aber vor allem bekam er keinen Besuch. Da war Kane ganz sicher. Allerdings kannte man den Mann im Haus und auch im Viertel. Er grüßte die Nachbarn, plauderte mit Verkäufern. Flüchtige Bekanntschaften, aber dennoch Kontakte. Also musste Kane klingen wie er, aussehen wie er und sich so genau wie möglich an seine Gewohnheiten halten.
Mit einer offensichtlichen Ausnahme. In gewisser Hinsicht sollten sich die Gewohnheiten des Mannes auf drastische Weise ändern.
Bevor Kane sich an der Leiche zu schaffen machte, musste er an sich selbst arbeiten. Einen Moment lang betrachtete er das Gesicht des Toten noch einmal aus der Nähe.
Diese Nase.
Die Nase des Mannes war etwas nach links gebogen und breiter als Kanes. Offenbar hatte er sie sich vor Jahren mal gebrochen und entweder keine Krankenversicherung, kein Geld oder keine Lust gehabt, sie vernünftig begradigen zu lassen.
Eilig zog Kane seine Sachen aus, faltete sie ordentlich und brachte sie ins Wohnzimmer. Im Bad nahm er ein Handtuch, hielt es im Waschbecken unter heißes Wasser, dann wrang er es aus. Dasselbe machte er mit einem Waschlappen.
Das nasse Handtuch rollte er zu einer Wurst. Den Waschlappen legte er auf seine rechte Gesichtshälfte, wobei er darauf achtete, dass auch die Nase bedeckt war. Das aufgerollte Handtuch war lang genug, dass er es sich um den Kopf binden konnte.
Kane stand im Badezimmer, nahm den Türgriff mit der rechten Hand und zog die Tür an sein Gesicht, bis die Kante sein Nasenbein berührte. Der Lappen würde den Aufprall abmildern, damit seine Haut nicht aufplatzte. Kane neigte den Kopf etwas zur Seite und legte seine linke Hand auf die linke Wange. Er spannte die Halsmuskeln, presste seinen Kopf gegen die Hand. Auf diese Weise würde der Kopf beim Aufprall nicht nach links geworfen werden.
Kane zählte bis drei, holte aus und schlug sich die Türkante ans Nasenbein. Sein Kopf hielt stand. Die Nase nicht. Er hörte Knochen knirschen. Orientieren konnte er sich nur am Geräusch, denn gespürt hatte er nichts.
Das Handtuch um seinen Kopf hatte verhindert, dass ihm die Tür an die Stirn schlug, was eine Orbitabodenfraktur zur Folge gehabt hätte. Bei einer solchen Verletzung wären Blutungen im Auge unvermeidlich gewesen, und die hätten operativ behandelt werden müssen.
Kane nahm das Handtuch von seinem Kopf, schälte den Waschlappen von der Wange und warf beides in die Wanne auf die Beine des Mannes. Er betrachtete sich im Spiegel. Dann die Nase des Mannes.
Noch nicht ganz.
Kane nahm seine Nase fest in die Hand und drückte sie nach links. Wieder knirschte es, als zerdrückte jemand Cornflakes. Er sah noch mal in den Spiegel.
Schon besser. Auch die Schwellung würde helfen. Die Hämatome, die unweigerlich um Nase und Augen herum entstehen würden, konnte er überschminken.
Dann stieg er in einen Chemikalienschutzanzug, den er in der Sporttasche dabeihatte. Er zog den Mann in der Wanne nackt aus. Als Kane den Eimer mit dem konzentrierten Laugenpulver öffnete, puffte eine kleine Pulverwolke daraus hervor. Aus dem Hahn lief kochend heißes Wasser. Die Haut des toten Mannes färbte sich bereits rot. Blutige Schlieren drifteten wie roter Rauch im heißen Wasser. Kane schaufelte drei Kellen mit Laugenpulver hinein.
Als die Wanne zu drei Vierteln voll war, drehte er das Wasser ab. Aus der Sporttasche holte er eine große Gummimatte, faltete sie auseinander und breitete sie über der Wanne aus. Dann riss er eine Rolle Klebeband auf und versiegelte die Wanne rundum.
Kane kannte mehrere Möglichkeiten, sich einer Leiche zu entledigen, ohne Spuren zu hinterlassen. Diese Methode der Beseitigung hatte sich als besonders wirksam erwiesen. Der Vorgang basierte auf alkalischer Hydrolyse. Eine solche Bio-Bestattung löste Haut, Muskeln, Gewebe und sogar Zähne bis auf zellulare Ebene auf. Das Laugenpulver – mit der richtigen Wassermenge – konnte einen Menschen in unter sechzehn Stunden zerlegen. Dann wäre da nur noch eine Wanne voll grünlich brauner Flüssigkeit, derer sich Kane entledigen konnte, indem er die Wanne leerlaufen ließ.
Die Zähne und Knochen, die übrig blieben, waren bleich und brüchig und problemlos mit dem Absatz zu zertreten. Diesen Knochenstaub ließ man am besten verschwinden, indem man ihn mit Waschpulver vermischte. Kein Mensch käme je auf die Idee, darin zu suchen.
Das Einzige, was in der Wanne nicht abfließen würde, wäre die Kugel, aber die konnte Kane einfach in den Fluss werfen.
Sauber und ordentlich, so wie es ihm am liebsten war.
Bisher war Kane mit seiner Arbeit zufrieden. Er nickte vor sich hin und trat in den kleinen Flur hinaus. Neben der verschlossenen Wohnungstür stand ein Tischchen, auf dem sich geöffnete Post stapelte. Obenauf – unverkennbar mit rotem Streifen auf weißem Papier – lag der Umschlag, den Kane vor Wochen fotografiert hatte. Die Aufforderung zum Geschworenendienst.
KAPITEL DREI
Draußen auf der Centre Street, direkt vor dem Gerichtsgebäude, parkte eine schwarze Limousine, deren Fahrer auf dem Bürgersteig stand und die Hintertür offen hielt. Rudy Carp hatte mich zum Lunch eingeladen. Das kam mir gerade recht.
Der Fahrer hatte drei Meter vor einem Hotdog-Stand geparkt, an dem unten ein großes Bild mit meinem Gesicht prangte, mit Klebestreifen befestigt. Als müsste mich das Universum daran erinnern, wie groß der Unterschied zwischen Rudy und mir war. Sobald wir in der Limo saßen, nahm Rudy einen Anruf auf seinem Handy entgegen. Der Fahrer brachte uns zu einem Restaurant an der Park Avenue South. Ich konnte nicht mal den Namen aussprechen. Es sah französisch aus. Rudy beendete seinen Anruf, sobald er ausgestiegen war, und sagte: »Ich liebe diesen Laden. Beste Gierschsuppe in der ganzen Stadt.«
Ich wusste nicht mal, was ein Giersch ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um ein Tier handelte, aber ich fügte mich und folgte Rudy hinein.
Der Kellner machte einen Riesenaufstand um seinen Gast und führte uns an einen Tisch weiter hinten, abseits des Mittagsgeschäfts. Rudy setzte sich mir gegenüber. Es war so ein Laden mit Tischtüchern und Servietten. Jemand spielte Klavier, ganz leise im Hintergrund.
»Ich mag die Beleuchtung hier drinnen. Ist so … stimmungsvoll«, sagte Rudy.
Die Beleuchtung war so stimmungsvoll, dass ich den Lichtschein von meinem Handy-Display brauchte, um die Speisekarte entziffern zu können. Sie war auf Französisch. Ich beschloss, einfach das Gleiche zu bestellen wie Rudy. Ich fühlte mich in diesem Laden unwohl. Ich mochte nichts von einer Speisekarte bestellen, die nicht bereit war, Preise neben den Gerichten auszuweisen. Nicht meine Sorte von Laden. Der Kellner nahm unsere Bestellung entgegen, schenkte uns zwei Gläser Wasser ein und ging.
»Dann lassen Sie uns zur Sache kommen, Eddie. Ich mag Sie. Ich habe Sie schon eine ganze Weile im Auge. Sie hatten in den letzten Jahren ein paar große Fälle. Diese Sache mit David Child?«
Ich nickte. Ich redete nicht gern über meine alten Fälle. Die sollten zwischen mir und meinen Mandanten bleiben.
»Und Sie hatten einigen Erfolg bei Verfahren gegen das NYPD. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Sie haben es echt drauf.«
Die Art und Weise, wie er das Wort »Hausaufgaben« aussprach, sagte mir, dass er vermutlich auch wusste, was für einen Ruf ich vor meiner Zulassung als Anwalt genossen hatte. Was mein früheres Leben als Trickbetrüger anging, so waren das im Grunde nur Gerüchte. Keiner konnte mir was nachweisen, und das war mir auch am liebsten so.
»Ich nehme an, Sie wissen, an welchem Fall ich momentan arbeite«, sagte Rudy.
Wusste ich. Es war schwer zu ignorieren. Seit fast einem Jahr sah ich sein Gesicht einmal die Woche in den Nachrichten. »Sie vertreten Robert Solomon, den Filmstar. Wenn mich nicht alles täuscht, ist nächste Woche Prozessbeginn.«
»Der Prozess beginnt in drei Tagen. Morgen werden die Geschworenen ausgewählt. Wir hätten Sie gern in unserem Team. Mit etwas Vorbereitung könnten Sie sich um einige Zeugen kümmern. Ich glaube, mit Ihrer Arbeitsweise hätten Sie einiges beizutragen. Deshalb bin ich hier. Sie wären für ein paar Wochen mein Zweitanwalt. Dafür bekämen Sie mehr kostenlose Werbung, als Sie sich überhaupt vorstellen können, und wir wären bereit, Ihnen eine Pauschale von zweihunderttausend Dollar zu zahlen.«
Rudy lächelte mich mit seinen strahlend weißen Zähnen an. Er sah aus wie ein Bonbonladenbesitzer, der einem Kind von der Straße so viel Schokolade anbietet, wie es essen kann. Sein Blick war mildtätig. Je länger ich schwieg, desto schwerer fiel es Rudy, dieses Lächeln aufrechtzuerhalten.
»Wenn Sie wir sagen, von wem genau sprechen Sie da? Ich dachte, Sie wären Ihr eigener Chef.«
Er nickte. »Bin ich auch, aber bei Mordprozessen gegen Hollywoodstars spielt immer noch jemand mit. Mein Mandant ist das Studio. Die haben mich gebeten, Bobby zu vertreten, und übernehmen auch die Rechnung. Was meinen Sie? Wollen Sie ein berühmter Anwalt werden?«
»Ich halte mich gern etwas bedeckt«, sagte ich.
Er machte ein langes Gesicht.
»Kommen Sie, es ist der Mordprozess des Jahrhunderts. Was meinen Sie?«
»Nein danke.«
Damit hatte Rudy nicht gerechnet. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme und sagte: »Eddie, jeder Anwalt in dieser Stadt würde so ziemlich alles tun, um in diesem Fall einen Platz am Tisch der Verteidigung zu ergattern. Das wissen Sie. Liegt es am Geld? Wo ist das Problem?«
Der Kellner kam mit zwei Suppenschalen, doch Rudy schickte ihn weg. Er zog seinen Stuhl näher an den Tisch und beugte sich vor, stützte sich auf seine Ellenbogen, während er auf meine Antwort wartete.
»Es geht nicht gegen Sie, Rudy. Sie haben recht. Die meisten Anwälte würden einen Mord begehen, um diesen Platz zu kriegen, aber ich bin nicht wie die meisten Anwälte. Nach allem, was ich aus Zeitung und Fernsehen vernommen habe, glaube ich, dass Robert Solomon diese Leute ermordet hat. Und ich werde nicht dazu beitragen, dass ein Mörder entkommt, so reich und berühmt er auch sein mag. Tut mir leid, aber meine Antwort ist nein.«
Rudy hatte immer noch dieses Fünftausend-Dollar-Lächeln im Gesicht, aber er musterte mich mit schrägem Blick und nickte leicht.
»Verstehe, Eddie«, sagte Rudy. »Warum machen wir nicht eine runde Viertelmillion daraus?«
»Es geht nicht ums Geld. Ich setze mich nicht für Schuldige ein. So was habe ich vor langer Zeit schon mal getan. Mit Geld ist das nicht wiedergutzumachen.«
Rudy sah aus, als käme ihm eine Erkenntnis, und er gab sein Lächeln vorerst auf. »Na, dann haben wir ja kein Problem. Denn eins ist klar … Bobby Solomon ist unschuldig. Das NYPD hat ihm die Morde angehängt.«
»Ach ja? Können Sie das beweisen?«
Rudy wartete kurz. »Nein«, sagte er. »Aber ich glaube, Sie können es.«
KAPITEL VIER
Kane betrachtete den großen Schlafzimmerspiegel, vor dem er stand. Um den Rand des Spiegels herum steckten – zwischen Glas und Rahmen – Dutzende Fotos von dem Mann, der sich gerade in der eigenen Badewanne langsam in seine Bestandteile auflöste. Kane hatte die Fotos mitgebracht. Er brauchte noch etwas mehr Zeit, um den Mann korrekt nachzuahmen. Ein bestimmtes Foto – das einzige, das Kane von dem Mann in sitzender Position hatte machen können – zog mehr Aufmerksamkeit auf sich als alle anderen. Auf dem Bild saß der Mann auf einer Bank im Central Park und fütterte Vögel. Die Beine hatte er übergeschlagen.
Der Sessel, den Kane aus dem Wohnzimmer herübergeschleppt hatte, war ein gutes Stück niedriger als die Parkbank auf dem Foto, und Kane hatte Probleme, die Beinhaltung richtig hinzubekommen. Er selbst schlug die Beine nicht über. Für ihn war das weder eine bequeme noch eine natürliche Sitzhaltung, aber Kane war Perfektionist, wenn es darum ging, sich in jemand anderen zu verwandeln. Es war von entscheidender Bedeutung für den Erfolg.
Seine Gabe hatte er in der Schule entdeckt. In den Pausen äffte er die Lehrer vor der Klasse nach, und seine Mitschüler kringelten sich vor Lachen. Kane lachte nie, aber er freute sich über die Aufmerksamkeit. Er hörte das Lachen seiner Klassenkameraden gern, wenn er auch nicht verstehen konnte, warum sie lachten, und keinen Zusammenhang zwischen ihrem Lachen und seinen Imitationen sah. Trotzdem machte er es immer wieder. Es half ihm, sich einzufügen. Als kleiner Junge war er oft umgezogen: fast jedes Jahr eine neue Schule in einer neuen Stadt. Immer wieder verlor seine Mutter ihren Job, wegen Krankheit oder Alkohol. Dann fing es an, dass überall im Viertel diese Zettel auftauchten: Fotos von vermissten Haustieren.
Da wurde es meist Zeit weiterzuziehen.
Kane hatte lernen müssen, schnell neue Leute kennenzulernen. Es fiel ihm leicht, Freunde zu finden, was auch daran lag, dass er viel Übung darin hatte. Seine Parodien brachen das Eis. Für ein paar Tage hörten die Mädchen aus seiner Klasse auf, ihn komisch anzusehen, und die Jungs ließen zu, dass er sich an ihren Gesprächen über Baseball beteiligte. Schon bald ahmte er nicht nur Mitglieder des Lehrkörpers nach, sondern auch Prominente.
Kane setzte sich aufrecht und versuchte noch mal, ein Bein über das andere zu schlagen, damit er aussah wie auf dem Foto. Rechtes Bein übers linke Knie, rechter Fuß ausgestreckt. Sein rechtes Bein rutschte vom Knie, und er verfluchte sich. Er brauchte einen Moment und wiederholte das Pangramm, das er den Mann hatte aufsagen lassen, kurz bevor er ihm eine Kugel in den Kopf geschossen hatte. Er sprach die Worte nach, flüsterte sie erst, dann wurde er immer lauter. Er spielte die Aufnahme ab, wieder und wieder, lauschte aufmerksam, mit geschlossenen Augen. Die Stimme aus dem Diktiergerät klang nicht so gut. Er konnte noch die Angst heraushören. Ein Zittern in der Kehle des Mannes ließ einige Worte beben. Kane versuchte, sie zu isolieren, und wiederholte sie selbstbewusster, probierte aus, wie sie ohne Angst klangen. Die Stimme im Gerät war ziemlich tief. Er ging eine Oktave runter, trank etwas Milch, mit Schlagsahne gemischt, um seine Stimmbänder zu verkleben. Es funktionierte. Mit etwas Übung war er in der Lage, diesen Klang in seinem Kopf zu hören – Kane war zuversichtlich, dass er ihn nachahmen konnte, zumindest annähernd, selbst ohne die Milch.
Nach weiteren fünfzehn Minuten waren die Laute aus dem Rekorder und Kanes Aussprache identisch. Und als er diesmal sein Bein übers andere schwang, blieb es, wo es war.
Zufrieden stand er auf, ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Als er sich die Milch herausnahm, fielen ihm noch weitere Lebensmittel ins Auge. Schinkenspeck, Eier, etwas Sprühkäse, ein Stück Butter, ein paar matschig wirkende Tomaten und eine Zitrone. Eier mit Speck, dazu vielleicht etwas geröstetes Brot, würden seine Kalorienzufuhr steigern. Kane musste ein paar Pfunde zulegen, wenn er seinem Opfer entsprechen wollte. Vermutlich würde es niemandem auffallen, wenn er etwas weniger wog, und er hatte auch noch die Möglichkeit, seinen Bauch zu polstern, aber Kane ging solche Sachen methodisch an. Wenn er seinem Ziel ein Pfund näher rücken konnte, indem er heute Abend eine ordentliche Portion ungesunder Fette zu sich nahm, dann würde er es tun.
Er fand eine Bratpfanne unter der Spüle und machte sich ans Werk. Beim Essen blätterte er in den Anglerzeitschriften, die auf dem Küchentisch lagen. Zufrieden schob Kane den Teller von sich. Je nachdem, wie der Abend lief, würde er möglicherweise erst weit nach Mitternacht wieder etwas zu essen bekommen.
Heute Nacht, dachte er, könnte einiges passieren.
KAPITEL FÜNF
Ich fand, die Gierschsuppe war das Warten wert gewesen. Sie schmeckte nach Zwiebeln, Knoblauch und Olivenöl. Nicht übel. Gar nicht übel. Das Gespräch geriet ins Stocken, sobald Rudy dem Kellner gewunken hatte, uns die Suppe zu bringen. Wir aßen schweigend. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass er fertig war, legte auch ich meinen Löffel weg, wischte mir den Mund mit der Serviette ab und widmete Rudy meine volle Aufmerksamkeit.
»Ich glaube, dass der Fall Sie reizt. Vielleicht möchten Sie noch ein paar Details erfahren, bevor Sie sich entscheiden. Richtig?«, fragte Rudy.
»Richtig.«
»Falsch«, sagte Rudy. »Das ist der heißeste Fall, den die Ostküste je erlebt hat. In zwei Tagen soll ich mein Eröffnungsplädoyer vor den Geschworenen halten. Ich bin von Anfang an dabei und habe großen Aufwand getrieben, die Taktik der Verteidigung geheim zu halten. Das Überraschungsmoment ist vor Gericht von entscheidender Bedeutung. Das wissen Sie. Momentan sind Sie als Anwalt nicht beteiligt. Alles, was ich hier und jetzt zu Ihnen sage, unterliegt nicht der anwaltlichen Schweigepflicht.«
»Was ist, wenn ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibe?«, fragte ich.
»Ist nicht mal das Papier wert, auf dem sie gedruckt ist«, sagte Rudy. »Ich könnte mein ganzes Haus mit Vertraulichkeitsvereinbarungen tapezieren, und was meinen Sie, wie viele davon eingehalten wurden? Wahrscheinlich nicht mal genug, dass ich mir damit den Hintern abwischen könnte. So ist Hollywood.«
»Sie wollen mir also nicht mehr über diesen Fall erzählen?«, fragte ich.
»Ich darf es nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen: Ich glaube, der Junge ist unschuldig«, sagte Rudy. Ehrlichkeit kann man vortäuschen. Rudys Mandant war ein begabter, junger Schauspieler. Er wusste, wie man sich vor der Kamera verstellte. Aber Rudy – bei aller Großspurigkeit und all seinen professionellen Überredungskünsten – konnte die Wahrheit nicht vor mir verbergen. Ich kannte ihn erst seit einer halben Stunde, vielleicht etwas länger. Aber diese Aussage fühlte sich echt an. Sie fühlte sich an, als meinte er es ehrlich. Da waren keine körperlichen oder verbalen Hinweise, weder bewusst noch unbewusst. Es klang sauber. Die Worte kamen flüssig. Hätte ich wetten sollen, hätte ich darauf gewettet, dass Rudy die Wahrheit sagte – er hielt Robert Solomon für unschuldig.
Aber das war nicht überzeugend genug. Nicht für mich. Was war, wenn Rudy von einem manipulativen Mandanten vorgeführt wurde? Einem Schauspieler?
»Hören Sie, ich weiß Ihr Angebot wirklich zu schätzen, aber ich glaube, ich müsste jetzt langsam …«
»Augenblick«, fiel Rudy mir ins Wort. »Sagen Sie noch nicht nein. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Schlafen Sie drüber und geben Sie mir morgen früh Bescheid. Vielleicht überlegen Sie es sich noch.«
Rudy beglich die Rechnung, einschließlich eines promiwürdigen Trinkgelds, dann traten wir aus dem dunklen Restaurant hinaus auf die Straße. Der Chauffeur stieg aus und öffnete die Hintertür.
»Kann ich Sie irgendwo absetzen?«, fragte Rudy.
»Mein Wagen steht an der Baxter, gleich hinterm Gericht.«
»Kein Problem. Was dagegen, wenn wir unterwegs an der 42nd Street vorbeischauen? Ich würde Ihnen gern was zeigen.«
»Soll mir recht sein«, sagte ich.
Rudy sah aus dem Fenster, mit dem Ellenbogen auf die Armlehne gestützt, und strich mit den Fingerspitzen über seine Lippen. Ich dachte über das nach, was ich gehört hatte. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, warum Rudy mich unbedingt dabeihaben wollte. Ich konnte nicht sicher sein, hatte aber eine Frage, die das ein für alle Mal klären würde.
»Ich weiß ja, Sie dürfen mir keine Details verraten, aber sagen Sie mir nur eins: Kann ich davon ausgehen, dass in den letzten zwei Wochen keine entscheidenden Beweise aufgetaucht sind, die geeignet wären, Robert Solomons Unschuld zu belegen?«
Eine Sekunde lang sagte Rudy nichts. Dann lächelte er. Er wusste, was ich dachte.
»Sie haben recht. Es gibt keine neuen Beweise. Nichts Neues in den letzten drei Monaten. Sie haben es also genau richtig durchschaut. Nehmen Sie es nicht persönlich.«
Wenn ich dafür angeheuert wurde, dem NYPD das Leben schwer zu machen, wäre ich der einzige Anwalt im Team der Verteidigung, der die Polizeizeugen verhörte. Ich wäre derjenige, der den Cops die unangenehmen Fragen um die Ohren haute. Wenn es funktionierte – super. Wenn es bei den Geschworenen nicht so gut ankam, wäre ich draußen. Rudy würde die Gelegenheit nutzen, den Geschworenen zu erklären, dass man mich erst eine Woche vorher angeheuert hatte – und dass etwaige Anschuldigungen, die ich gegen Cops erhoben haben mochte, nicht von seinem Mandanten stammten. Ich hätte mich mit niemandem abgesprochen und sei weit übers Ziel hinausgeschossen. Auf diese Weise konnte Rudy die Geschworenen in jedem Fall auf seiner Seite halten. Ich war ein verzichtbares Mitglied des Teams – Held oder Sündenbock.
Clever. Sehr clever.
Ich blickte auf und sah, dass Rudy aus dem Seitenfenster der Limo deutete. Ich beugte mich vor, bis ich eine Werbetafel für einen neuen Film namens The Vortex entdeckte. Werbetafeln an der 42nd Street waren nicht billig. Und auch der Film sah nicht billig aus. Aufwendige Science-Fiction. Weiter unten auf dem Plakat stand, die Stars des Films seien Robert Solomon und Ariella Bloom. Ich hatte von dem Film gehört. Wie auch jeder andere, der im letzten Jahr einen Fernseher eingeschaltet hatte. Es war eine Dreihundert-Millionen-Dollar-Produktion mit Robert Solomon und seiner Frau Ariella Bloom in den Hauptrollen. Wenn der nächste vielversprechende Hollywood-Bad-Boy des Mordes beschuldigt wurde, garantierte das eine umfassende, ans Hysterische grenzende Medienaufmerksamkeit. In diesem Fall gab es zwei Mordopfer: Bobbys Security-Chef – Carl Tozer – und Bobbys Frau Ariella Bloom. Zum Zeitpunkt der Morde waren Bobby und Ariella zwei Monate verheiratet. Sie hatten gerade die erste Staffel ihrer Reality-TV-Show abgedreht. Die meisten Experten gingen davon aus, dass der Prozess größer als OJ und Michael Jackson zusammen werden würde.
»Diese Werbetafel hängt seit letzter Woche da. PR für Bobby, aber der Film liegt jetzt schon fast ein Jahr auf Halde. Sollte Robert verurteilt werden, wird der Film in der Versenkung verschwinden. Sollte Robert nach langem Prozess freigesprochen werden, wird der Film ebenfalls in der Versenkung verschwinden. Die einzige Möglichkeit, dass dieser Film in die Kinos kommt und das Studio sein Geld wieder reinholt, besteht darin, die ganze Welt von Roberts Unschuld zu überzeugen. Bobby hat einen lukrativen Vertrag für drei weitere Filme desselben Studios unterschrieben. Er soll ihr Goldesel werden. Wir müssen dafür sorgen, dass er diesen Vertrag auch erfüllen kann. Anderenfalls läuft das Studio Gefahr, viel Geld zu verlieren. Millionen, um genau zu sein. Da steht einiges auf dem Spiel, Eddie. Wir brauchen ein klares Ergebnis zu unseren Gunsten, und zwar schnell.«
Ich nickte und wandte mich von der Werbetafel ab. Möglich, dass Rudy sich für Robert Solomon interessierte, aber nicht so sehr wie für das Geld des Studios. Wer wollte es ihm verdenken? Schließlich war er Anwalt.
Sämtliche Zeitungsstände an der 42nd Street kündeten vom bevorstehenden Beginn des Prozesses.
Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, was für ein Albtraum er war. Es hörte sich so an, als könnte es da zu einem Konflikt zwischen dem Studio und Bobby kommen. Was war, wenn der Junge die Absicht hatte, sich schuldig zu bekennen oder einen Deal mit dem Staatsanwalt auszuhandeln, und das Studio ihn nicht ließ? Und was, wenn er unschuldig war?
Wir ließen die 42nd Street hinter uns und fuhren südwärts in Richtung Centre Street. Ich dachte an das, was ich aus den Nachrichten über den Fall wusste. Allem Anschein nach hatten zwei Polizeibeamte auf Solomons Notruf reagiert. Dieser hatte am Telefon erklärt, er habe seine Frau und seinen Security-Chef tot aufgefunden.
Solomon hatte die Cops ins Haus gelassen, und die waren direkt rauf in den ersten Stock gegangen.
Auf dem oberen Treppenabsatz lag ein umgekippter Tisch. Daneben eine zerbrochene Vase. Über dem Tisch war ein Fenster mit Blick auf den kleinen, ummauerten Garten hinterm Haus. Auf dieser Etage gab es drei Schlafzimmer. Zwei waren dunkel und leer. Auch im großen Schlafzimmer am Ende vom Flur war alles dunkel. Dort fanden sie Ariella und Carl, den Security-Chef. Oder zumindest das, was von ihnen übrig war. Beide lagen tot und nackt auf dem Bett.
Solomon hatte Blut seiner Frau an sich. Offenbar gab es noch mehr forensische Hinweise, die der Staatsanwalt als unwiderlegbaren Beweis für Solomons Schuld interpretieren würde.
Der Fall war klar.
Dachte ich zumindest.
»Wenn Robert diese Leute nicht umgebracht hat, wer dann?«, fragte ich.